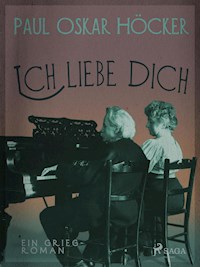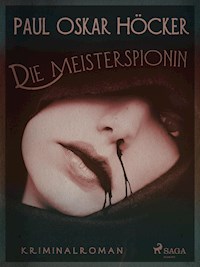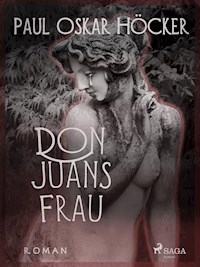Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die junge Dina 1922 in der Tanzschule Dr. Lohmanns an der Havel Aufnahme findet, ist sie schon bald der von allen beneidete Star. Doch es beginnen auch Freundschaften, die schicksalshaft über viel Jahre bestehen bleiben. Mit Sonja, die in den Kriegswirren im Baltikum schweres Leid erfahren hatte, und mit Benedikt, dem jungen Komponisten, den Dina Jahre zuvor in einem Schweizer Sanatorium kennengelernt hatte. Es vergehen Jahre, bis Dine in dem Tanzdrama "Die Frau am Quell" zur Musik Benedikts große Erfolge feiert.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Oskar Höcker
Die Frau am Quell
Der Roman einer Tänzerin
Saga
Die Baltin, die jetzt vertretungsweise die Gymnastikkurse der Dr.-Lohmann-Schule leitete, hatte den Teilnehmerinnen gerade Feierabend geboten, als drüben, jenseit der Havel, das Berliner Mietsauto, in dem Dina sass, auf die Fähre rollte. In dem noch immer hellen Frühsommer-Abendlicht unterschied man alle Einzelheiten: den grossen Schrankkoffer neben dem Chauffeur, die zahlreichen Gepäckstücke aus blauem Leder im offenen Wagen und Dinas smaragdgrünen Topfhut.
„Es wird die Neue aus Stockholm sein“, sagte Sonja zu ihrer ersten Assistentin, der hageren Turnlehrerin. „Das Auto lässt auf schwedische Kronen schliessen.“
Die Inflation beherrschte im Sommer 1922 unleidlich viele Gespräche.
„Hat sie drüben Mensendieck getrieben?“ fragte die Hagere.
Sonja zuckte die Achsel. „Welches System nicht? – Übrigens schrieb der Meister sehr anerkennend über sie. – Als Kind war sie in der Münchener Ballettschule, dann bei Dalcroze in Genf, jetzt zwei Jahre in Schweden.“
„Da werden wir ja masslos viel von ihr zu lernen haben.“ Spöttisch überlegen wandte sich die Turnlehrerin ein paar Mitschülerinnen zu, die barfüssig übers Wiesengras schlenderten, im Schwimmtrikot sich dehnend.
Die Botschaft erregte immerhin einiges Aufsehen. Die Mehrzahl der Kursusteilnehmerinnen war seinerzeit vom Bahnhof Werder auf der staubigen Chaussee zu Fuss hier in Retzin einmarschiert; Dorfjungen hatten ihnen die Pappschachteln oder das Leinwandköfferchen getragen. „Also grosses Tier!“ – „Primadonna!“ – „Filmdiva!“ – „Valutaprinzessin!“ Das absprechende Urteil über den Zuwachs stand fest, noch bevor das Auto auf der Dorfstrasse hielt.
Und dann – diese Überraschung!
Dina war klein und schmal und wirkte wie ein unentwickelter Backfisch, als sie so ratlos neben dem Wagen stand und die Gruppen der jungen Mädchen entlangsah, die in den Vorgärten der Bauernhäuser ihrem Einzug beiwohnten, ohne ihr zu Hilfe zu kommen. Hübsch war sie gar nicht. Jede Künstlergeste fehlte ihr.
Der Chauffeur rief eine alte Frau an, die mit dem Milchtopf in der zitternden Hand aus dem Kolonialwarenlädchen von Meyer herauskam. „He, Mutterchen, hier soll doch eine grosse neue Schule sein: Lohmann, Dr. Lohmann?“ Beide Ankömmlinge schienen irgendeine Baulichkeit von architektonischer Bedeutung erwartet zu haben. Aber die Alte wies nur stumm, fast verächtlich, mit dem spitzen Kinn auf eine niedere Gartenpforte. „Sie versteht wohl nicht“, sagte Dina mit ihrem tiefen Altstimmchen, das zu der Kindergestalt nicht recht passen wollte.
Nun endlich erbarmte sich Sonja der neuen Schülerin und trat durch die halboffene Holzgittertür, an der sich das kleine Porzellanschild mit Dr. Lohmanns Namen befand, auf die Dorfstrasse.
„Are you Miss Brown?“
„Yes, I am.“
„Then you are all right here.“
Nun folgten auch andere. Fast alle waren barfüssig, die meisten noch im knappen Schwimmtrikot. Es machte ihnen Spass, mit ihrer Naturwüchsigkeit dieses kleine Kulturpflänzchen zu verblüffen.
Die Auseinandersetzung ward dann auf Deutsch weitergeführt, das die Neue ebensogut beherrschte.
Nein, Dr. Lohmanns Assistent sei nicht anwesend, er bereite die Ferienkurse in Dievenow vor. Wo sie unterkommen könne? Ja, das habe jetzt seine Schwierigkeiten. Der Gasthof sei bis aufs letzte Bett besetzt. Im Massenquartier, der Scheune vom Bäckermeister Haber, sei ja noch Platz, aber mit ihrem grossen Gepäck sei sie dort wohl kaum an der rechten Stelle. Vielleicht gebe Herr Meyer nun doch noch sein Balkonzimmer her, der Kolonialwarenhändler, aber freilich: der ‚nehme es von den Lebendigen‘.
Dina hatte ein rührend verlegenes Lächeln. Ihre grauen Augen waren gross, etwas erschrocken. Die dunkeln Wimpern unterstrichen diesen Ausdruck noch. Sonst war es ein richtiges Kindergesicht: eine kurze, unten breite, etwas gestülpte Nase, die Oberlippe wie in kindlichem Schmollen leicht aufgeworfen, so dass man die Zähne sah.
Der Chauffeur wollte endlich das Gepäck abladen und umkehren. Er berechnete fünfundvierzigfache Taxe, auch für die Leerfahrt bis nach Berlin zurück. Entsetzen, Entrüstung und schadenfrohes Gelächter brachte die Mädchenschar in Bewegung. Aber Dina öffnete sofort ihr blaues Ledertäschchen und begann gehorsam die Banknoten aufzuzählen. Da sie jahrelang an schwedisches Geld gewöhnt war und mit den neuen deutschen Scheinen nicht Bescheid wusste, half ihr die Turnlehrerin, die den Kneifer aufsetzte, bei der Abrechnung.
Inzwischen war Herr Meyer in die Ladentür getreten, und Sonja hatte mit ihm verhandelt. Ein Hinweis auf das Auto und das reiche Gepäck genügte. Er hatte sein schönes Balkonzimmer mit dem Nussbaumvertikow und der roten Plüschgarnitur zwar für einen gutzahlenden Berliner Sommergast aufsparen wollen, aber die englische Miss mit dem schwedischen Geld war vielleicht doch noch vorzuziehen.
Den mächtigen Schrankkoffer die enge Stiege hinaufzubringen, war nicht ganz leicht. Herr Meyer musste den Chauffeur bei dieser Arbeit unterstützen. Ein paar Schülerinnen machten sich das Vergnügen, die übrigen Gepäckteile aus dem Auto herauszuholen und ins Haus zu tragen. Meist recht kostbare Lederstücke in bayerischem Blau. Dina wollte ihnen höflich wehren, aber sie ordneten sich übermütig zu einer Art feierlichen Triumphzugs und behandelten die Angelegenheit wie auf Verabredung durchaus parodistisch. Der kleine Dorfplatz war jetzt von ein paar Dutzend Mädchengestalten in Trikot, Dirndlkleid, Lodengewand, Büsserhemd und städtischer Sommerkleidung bevölkert. Auch Kinder und Einwohner von Retzin liefen herzu. Alles lachte über die gravitätischen Bewegungen der Gepäckträgerinnen, die wie orientalische Sklavinnen auf alten Vasenbildern, unter scheinbar schweren Lasten sich beugend, einherschritten.
Vom roten Backsteinturm der Retziner Dorfkirche schlug es acht Uhr. Eine Dampfsirene heulte von Werder oder von Baumgartenbrück her.
Endlich stand Dina allein mit Sonja in ihrem neuen Quartier. Das „Fürstenzimmer“ nannten es die Schülerinnen.
Sonja musterte mit ihrem stahlharten Blick das kleine, verschüchterte Wesen, das nun den seidenen Reisemantel abstreifte und den tiefsitzenden Topfhut abnahm. „Der Meister wird Ende der Woche kommen. Wollen Sie so lange warten oder gleich morgen in die Schule eintreten? Ich leite jetzt den Kursus für die Vorgeschrittenen. Die Anfänger arbeiten in drei Sonderklassen. Aber Sie haben ja schon Kenntnisse, nicht?“
„Ein wenig. Ja.“ Dina blickte zu der ernsten, herrischen Baltin, die sie um Haupteslänge überragte, wie um Verzeihung bittend empor. „Vielleicht darf ich zuerst einmal zusehen. Ist die Schule hier in der Nähe?“
„Wir üben auf dem Wiesengelände am Wasser. Im Freien. Gleich hier unten.“ Sie trat auf den kleinen Balkon und zeigte.
Dina musste sich auf die Fussspitzen stellen, um über die mit roten Pelargonien bepflanzten Blumenkästen das Ufer sehen zu können. Die weitere Aussicht war überraschend. Links die breite Havel, rechts der waldumsäumte Schwielowsee. Das Wasser trug in breiten, sanften Wellen alle Opalfarben. Die Sonne war im Untergehen, der Himmel, von langen Bändern mit Lämmerwölkchen durchzogen, war rosa getönt.
„Es ist wie in den Schären“, sagte Dina emporblickend und atmete tief.
Sonja presste für ein paar Sekunden die Lippen fest aufeinander. Sie entsann sich nicht gern ihrer Heimat. „Die roten Felsen fehlen.“
„Ich meine den Himmel.“ Dinas graue, schwermütige, etwas feuchte Augen folgten dem unendlichen Zug der zarten Wolkenstreifen, die sich in dem glühenden Sonnenkessel im fernsten Westen verloren. Eine Sehnsucht verklärte das schmale Kindergesicht.
„Sie heissen Dina?“ fragte die Baltin. „Das ist aber kein englischer Name.“
„Nein. Meine Mutter stammt ja aus Deutschland.“ Dann mit einem schüchternen Aufblick: „Und – wenn Sie so gut sein wollen – wie darf ich Sie nennen?“
„Ich heisse Sonja. Wir sagen hier übrigens du zueinander.“
„Oh, das ist schön. Soll ich auch du zu Ihnen sagen? Und: Sonja?“
„Bitte.“
„Ich danke Ihnen, Sonja.“ Sie gab der Baltin die Hand. „Dir.“
Die harte, ernste Sonja lächelte nun doch ein wenig über die Hilflosigkeit der Kleinen. „Also komm hernach noch in den Krautgarten, Dina. Nebenan, wo ich wohne. Du weisst: wo das Schild am Gatter ist. Nach dem Abendessen. Da singen wir meistens noch. Einige spielen Laute. Dabei lernst du dann gleich ein paar kennen. Willst du?“
„Oh, gern, Sonja.“
„Nun wirst du wohl auspacken. – Oder hast du noch eine Frage, einen Wunsch?“
Dina schluckte. „Ich möchte dir nur sagen, dass ich froh bin.“
„Froh?“
„Ja, ich habe solche Angst vor dir gehabt. Und nun finde ich: du bist sehr gut zu mir.“
Ein bisschen Spott zog über die harten, schmalen Lippen der Baltin. – „So verwöhnt bist du also gar nicht, kleine Dina?“
„Verwöhnt? Nein. Nur ... ich bin ein bisschen einsam, weisst du.“
Es war hier schon eine bunte Mischung vereint. Dr. Lohmanns Schule für Körperkultur und hygienische Gymnastik war aus Lehren hervorgegangen, die Jahrzehnte gebraucht hatten, um sich durchzusetzen, nun aber Allgemeingut waren. Doch in geschickter Weise hatte Lohmann dann auch all’ die neuen Strömungen aufzufangen gewusst, die nach Kriegsschluss in die verschiedensten Richtungen sich ergossen: der Zug zum Okkultismus wurde von ihm ebenso gewandt benutzt wie die Propaganda für naturgemässe Lebens- und Nahrungsweise, die Rutzsche Lehre, die indische Atemgymnastik nach Hatha Yoga. Eine ganze Literatur beschäftigte sich bereits mit seinem System. Für und wider. Der Zudrang zu den Frühsommerkursen in Retzin war so stark, dass die Teilnehmerinnen in der Ortschaft selbst gar nicht mehr unterzubringen waren. Ausser den ständigen Schülerinnen gab es auch noch zahlreiche Hospitanten, die zu den Gymnastikstunden täglich aus Berlin, Wannsee, Potsdam und anderen Bezirken herüberkamen.
Dr. Lohmann war von diesem Erfolg selbst überrascht worden. Er hatte den Nachdruck auf die Vorbereitung der Ferienkurse in Dievenow gelegt, wo die gymnastische Ausbildung in einem neugepachteten Riesengelände am Strand erfolgen sollte. An dieser Zentralstelle hatte er bereits Anfang Juni all’ seine Lehrkräfte vereint, um mit ihnen das ganze System noch einmal durchzuarbeiten.
Hier in Retzin bildete Sonja seine Hauptstütze. Sie hatte sich in den wenigen Monaten seit ihrem Eintritt allseitigen Respekt zu verschaffen gewusst. Eine Persönlichkeit wie sie, die gelegentlich auch rücksichtslos durchzugreifen wusste, war hier erforderlich. Auf der einen Seite war mit dem jungen Volk, das aus Wandervogelgruppen stammte, ein unverkennbar kommunistischer Zug in die Schülergemeinde gekommen; anderseits drängten sich auch aus den besitzenden und gehobenen Grossstadtkreisen immer mehr Anhängerinnen zu den Kursen: blutjunge Haustöchter, die dem elterlichen Zwang auszuweichen hofften, Dilettantinnen, die sich in ihrem gesellschaftlichen Umgang interessant machen wollten, und schliesslich Leichtsinnige, denen es auf die Gelegenheit zu wechselnden Liebesabenteuern ankam.
Wenn Sonja durch ihre Assistentin die ganze Schule zusammenrufen liess und in die Mitte des grossen Kreises auf der Uferwiese trat, dann schwieg sofort jeder Lärm. Neulinge, die etwa noch zu flüstern wagten, bekamen aus ihren fast farblosen Augen einen steinharten Blick, der sie unbedingt zum Gehorsam zwang. Sie hatte einen charakteristischen Kopf; etwas slawischer Einfluss sprach in den Gesichtszügen mit; das aschblonde Haar trug sie im Bubenschnitt.
Die Kurse hatten nach dem Frühbad schon um sieben Uhr begonnen. Dina war mit anderen Neulingen von Gruppe zu Gruppe geschickt worden. Alle Schüler und Schülerinnen trugen das schwarze Schwimmtrikot. Die meisten waren schon von Sonne, Wasser und Wind dunkel gebräunt und abgehärtet. Es gab vereinzelt klassisch schöne Gestalten unter den Kursusteilnehmerinnen, aber die Mehrzahl wirkte in dem grellen Sonnenlicht doch recht ernüchternd. Es fehlte alle Weichheit, alle Rundung. Man merkte überall die Muskel- und Sehnenarbeit zu sehr. Die Übungen, die Dina hier sah, unterschieden sich von der Mensendieckmethode durch zu starke Absichtlichkeit, durch zu sinnfälliges Betonen besonders der Entspannungen. Dieses Fallenlassen einzelner Gliedmassen, Gliederteile und Rumpfteile, des Kopfes, der Schultern, der Gelenke, wurde wie auf militärisches Kommando durchgeführt und hatte eher etwas Krampfhaftes als Entspannendes. Dina wurde immer trauriger und mutloser, je länger sie zusah.
In der kurzen Versammlung im Ring trug Sonja einige der Leitsätze Dr. Lohmanns über die Anfänge der Gymnastik vor, liess ein paar Übungen durch ihre Assistentinnen darstellen und verkündete schliesslich die neuesten Nachrichten über den am 5. Juli beginnenden Dievenower Sommerhauptkursus: nur diejenigen Schüler sollten dort zugelassen werden, die sich in den Filialanstalten als körperlich genügend vorgebildet und geistig reif erwiesen hatten.
Sonja wanderte dann, von ihrem kleinen Stab begleitet, zu dem auch Dina von ihr aufgerufen wurde, am Ufer der Havel entlang zu der Wiese, auf der die Männer-Abteilung übte.
Hier herrschte unbedingt grösserer Ernst. Die Mehrzahl der jungen Männer bildete sich zu Lehrern des Lohmann-Systems aus. Sie stammten aus den verschiedensten Schichten. Man sah es dem Ausdruck der Köpfe, sogar dem Schnitt der Gestalten, der Form der Fesseln und der Hände an. Sonja war auch hier die unbedingte Meisterin, der Gehorsam geleistet wurde. Aber Dina hatte das peinliche Gefühl, dass viele dieser Schüler sich nur duckten, weil sie sich hier eine Brotstelle zu verdienen hofften und von der Assistentin eine gute Note bei Dr. Lohmann brauchten. Wieder andere Teilnehmer am Kursus, die schwierige Gleichgewichtsübungen vorführten, lösten bei Dina geradezu Furcht und Mitleid aus. Magere Gestalten waren das, unterernährt, mit tiefeingegrabenen Gesichtszügen und fanatischen Augen.
Ein schlanker, blonder Schüler hatte sich abseits ins Gras gesetzt, die nackten Beine verschränkt; er rauchte eine Zigarette und machte allerlei lose Bemerkungen. Sonja wehrte ihm unwillig, aber er schien einer der wenigen, die sich hier etwas herausnehmen durften. „So wird nun die Spezies Mensch, wenn sie sich bloss von Spinat und Morgentau ernährt. Sonja, verordne doch dem schlesischen Hungerapostel da drüben ’mal ein Hamburger Beefsteak mit Ei. Ich wette, er hat keine hundert Pfund Lebendgewicht mehr. Das ist doch keine Gymnastik; das ist Derwischtanz.“
In Sonjas Stab wurde gelacht. Auch ein paar Schüler, die triefend aus dem Wasser herbeikamen, als sie Sonja erblickten, hatten ihren Spass an den spöttischen Glossen.
„Bist du wieder einmal aufgezogen, Julian?“ fragte Sonja lässig. Aber ihre Schärfe hatte schon etwas nachgelassen. Sie gab ihm wohl innerlich recht. Den negerbraunen Assistenten der Männer-Abteilung mit sich ziehend, einen jungen Seminaristen, sprach sie sich dann in einige Erregung. „Diese Mazdaznan-Apostel verderben einem wirklich die ganze Fassade!“ hörte Dina die Baltin sagen.
„Was für ein kleines Schulmädel habt ihr denn da aufgegabelt, Ella?“ fragte er dann, Dina betrachtend, indem er sich die Augen mit der Hand beschattete. „Oh, das ist die kleine Schwedin, die gestern angekommen ist? Wie heisst sie? Schwedinnen heissen immer Ebba. Ebba ist schöner als Ella. Das musst du doch zugeben, Ella Berndt, nicht?“
Die Hagere legte nun sogleich eine Lanze für Dina ein, wohl nur aus Opposition gegen den ewig angriffslustigen Spötter. „Dina ist kein kleines Schulmädel, Julian, sondern sie hat bei Dalcroze und bei Mensendieck die Abschlussprüfungen bestanden. Mit deinen Leistungen hier nimmt sie’s schon lange auf.“
Er machte in angenommener Feierlichkeit auf altrömische Weise Honneur gegen die Lehrerin, dann gegen Dina. „Ich will deiner Abiturientenehre nicht zunahetreten, Dina“, sagte er lachend. „Du musst nämlich wissen: ich bin hier nur als Zwischenaktclown zugelassen.“
Soeben kehrte Sonja mit dem negerbraunen Seminaristen zur Gruppe zurück. „Du könntest uns mehr sein, Julian. Mann wie du, preisgekrönter Segelflieger, bald Dr.-Ingenieur!“
In Schweden hatte Dina bei den Übungen und in den Seebädern viel schöne Männer gesehen. Hier in Deutschland mochten die Kriegs- und Nachkriegsnöte die körperliche Entwicklung der männlichen Jugend behindert haben.
„Nach der Männer-Abteilung unserer Retziner Filialanstalt darfst du den deutschen Nachwuchs aber nicht beurteilen“, sagte in der Mittagspause, bei einem Gespräch im Wirtsgarten am Landungsplatz, Hanna Hesslein zu der neuen Genossin. „Übrigens ist es vielleicht ganz vorteilhaft, dass wir hier keine Preisschönheiten zu zeigen haben, sonst wäre der Andrang der Kurfürstendamm-Damen noch grösser geworden. Und die hindern uns doch nur, diese Modepuppen.“ Hanna Hesslein bildete zu der hageren und spitzen Ella Berndt den ausgesprochenen Gegensatz; sie hatte ein breites Untergestell und war ziemlich plump in den Fesseln. Ihr Drang zur Körperkultur entsprang mehr der inneren Überzeugung als der persönlichen Eignung. Auf die elegant gekleideten Dilettantinnen der Berliner Bankierskreise war sie sehr schlecht zu sprechen. Es war ihr eine schadenfrohe Genugtuung, dass hier in Retzin keine Liebeleien aufkommen konnten. Ausser Julian Kessler, dem hübschen, blonden technischen Hochschüler, gab es ja kaum ein halbes Dutzend junger Männer, die irgendwie für einen Flirt in Betracht kommen konnten. Und Sonjas Männerhass duldete schon gar keine Übergriffe.
Über Sonja sprachen sie alle gern. Aber sie senkten dabei immer gleich wie in Scheu oder Ehrfurcht den Ton.
„Warum ist Sonja Männerfeindin?“ fragte Dina unschuldig.
„Du weisst nicht, was sie in Argentinien erlebt hat?“ Hanna Hesslein warf einen vorsichtig prüfenden Blick in die Runde. „Es ging ja damals durch alle Zeitungen. Aber hier soll niemand davon sprechen. Ella Berndt hat sie schon früher gekannt. Sie sagt, in Riga und in Helsingfors sei sie der glänzendste Stern in jedem Ballsaal gewesen, strahlend schön und liebenswürdig, und immer von Tänzern umringt ... Sie muss Furchtbares durchgemacht haben. Nicht wiederzuerkennen sei sie jetzt. Und ist doch auch erst fünf- oder sechsundzwanzig. Frage Ella Berndt nur niemals aus. Sonja hasst jeden, der ihr nachspürt. Und wen sie einmal nicht mag, dem macht sie das Leben hier unerträglich.“
Dina seufzte. „Ich dachte, sie sei gerecht. Denn sie ist doch ein starker Mensch, will mir scheinen.“
„Eine grausame Tyrannin ist sie.“ Ein paar Schülerinnen standen in der Nähe des Tischs. Hanna Hesslein sah sich argwöhnisch nach ihnen um. „Aber wenn du mich verrätst, Dina, spreche ich nie wieder ein Wort mit dir.“
Im Nachmittagsunterricht beteiligte sich Dina an den Übungen. Sie hatte bald zahlreiche Zuschauer. Auch Sonja beobachtete sie. Es war offenbar, dass Dinas Können Überraschung, ja sogar Bewunderung erregte. Nachbargruppen hörten zu üben auf und liefen herzu. Der Kreis wurde immer dichter. Die Nachzügler riefen den Vornstehenden zu, sie sollten sich setzen. Mit verschränkten Beinen, wie hier üblich, liessen sich die im innersten Ring befindlichen Zuschauer und Zuschauerinnen nieder, die nächsten knieten, die dahinten blieben stehen; schliesslich sprangen die Nachzügler den Stehenden auf die Schultern. Wie in einem lebenden Amphitheater führte Dina nun ihre Übungen aus.
Die kleine, schmale Kindergestalt hatte Leben und Reiz gewonnen. Man sah jetzt erst, wo sie sich in vollendeter Harmonie bewegte, wie anmutig geformt ihr junger Körper war.
Sie hatte mit den Anfängen des Mensendiecksystems begonnen: Lockerung der Gelenke und Nutzgymnastik. Das meiste, was hier in Retzin gelehrt wurde, liess sich im Grunde auf diese einfachsten Übungen zurückführen. Wie Dina ihre Glieder, ihren Körper, ihren Kopf, ihre Schultern beherrschte, wirkte es so selbstverständlich, dass jedes „System“ überflüssig erschien. So schritt, so drehte sich, so bückte sich, so sprang und ruhte der Mensch. Aber alle, die hier schon ernsthaft gearbeitet und die Schwierigkeiten und Widerstände an sich selbst erlebt hatten, erkannten: diese letzte, freieste Natürlichkeit aller ihrer Bewegungen beruhte auf vieljährigem Studium.
Als sie eine Pause machte, winkte Sonja sie zu sich heran. Alles lauschte.
„Wann hast du eigentlich angefangen, Dina?“
Dina lächelte etwas verlegen. Ihr tiefes Altstimmchen klang drollig schülerhaft in die allgemeine Stille hinein. „Ach, ich war schon mächtig alt, meinte der Ballettmeister damals, der mich prüfte.“
„So. Wie alt denn, Dina?“
„Sechs Jahre. Ja, die andern waren doch höchstens fünf.“
Das löste nun allgemeine Heiterkeit aus.
„Hast du in Wien auch den Spitzentanz gelernt?“ fragte Sonja.
„Ja. Aber Dalcroze duldete dann nicht, dass ich ihn weiterübte. Nun hab’ ich ihn auch längst verlernt.“
„Willst du uns noch etwas zeigen, Dina?“
Dina stand nun wieder mit hängenden Armen da, unscheinbar, ein Kind; mit einem müden Lächeln hob sie die Schultern und seufzte leicht auf.
„Gott, ist sie rührend, die Kleine!“ sagte irgendwer leise.
„Keulenschwingen!“ rief Hanna Hesslein mit ihrer groben Stimme. Und andere stimmten ein, weil ihnen nichts Besseres einfiel.
Man wartete.
„Es ist nur eine dumme Idee von mir,“ sagte Dina schüchtern nach einem Weilchen, „aber warum sollte man nicht einmal eine Nebelwolke sein oder das Schilf ...“
„Was sagt sie? Schilf? Nebelwolke?“
Dina sah über das im Wind sich wiegende Schilf in die weite Havelfläche hinaus. Von Werder her, das wie in einer milchweissen Wolke lag, krochen hauchzarte Schwaden über die leichtgekräuselte Wasserfläche. Eine Augenblickseingebung war’s. Mit einem musikalischen Freund hatte sie früher solche Aufgaben besprochen. Ihr lebte ja die ganze Natur, lebte ihr in jedem Gegenstand, der anderen tot vorkam.
Sonja ahnte wohl, was die Kleine im Sinn hatte. „Also wird es ein pantomimischer Tanz?“ fragte sie überlegen lächelnd.
„Nein, nein, kein Tanz.“ Noch immer stand Dina unschlüssig, mit hängenden Armen da, wirkte hilflos, fast kümmerlich. „Aber es ist doch alles viel schöner und leichter, so wie es da draussen ist, als in der Übstunde.“
Es ward kein Tanz, auch keine Pantomime. Dina nahm nur ganz allmählich, wie unwillkürlich dem Beispiel folgend, das sie in dem Schilfgewoge am Ufer lockte, eine Bewegung auf, die irgendwie dem Rhythmus und der Linie glich, die sie vor Augen hatte. Sie machte keine anderen Schritte als die allen bekannten aus der schwedischen Schule, bewegte sich nur ganz wenig von ihrem Platz. Aber in den weichen, gelösten, sich rundenden Bewegungen der Arme, der Schultern, des Kopfes, der Hüften und Glieder lag ein Ausdruck, der auch dem Stumpferen die Vorstellung gab: so duckte, ängstigte und wehrte sich das Schilf vor den Vorboten eines Unwetters.
Eine der Berliner Hospitantinnen begann begeistert Beifall zu klatschen. Aber sofort ertönte mahnendes Zischen. Jeder Applaus war in der Lohmann-Schule verpönt. Man fühlte sich hier in einer Kulturgemeinde, nicht in einem Theater.
Dina entlief dem Kreis, der sich langsam auflöste.
„Ich erwarte dich hernach, Dina“, rief Sonja ihr nach, wandte sich aber sofort wieder ihren Assistenten zu, mit denen sie die Übungspläne für den nächsten Tag durchsprach.
Die Vorführung beherrschte in allen Gruppen noch lange die Gespräche.
Dina war unzufrieden mit sich. Sie hätte das, was sie schon so lang bewegte, hier nicht gleich vor all’ den Vielen, den Vielzuvielen zur Schau stellen sollen. Ihre Stockholmer Lehrerin hatte ihr einmal, bei einem ähnlich improvisierten Versuch, das niederschmetternde Urteil abgegeben: das sei eine Varieténummer! Sie hatte das ganz vergessen gehabt; aber als sie jetzt allein nach Hause ging, frass es wieder an ihr.
Zwischen dem Stundenschluss und der Abendbrotzeit kam die letzte Post. Sobald der Briefträger sich auf der Dorfstrasse zeigte, war er von Dutzenden von Mädchen im Trikot umringt. Nur die wenigsten hüllten sich in den Zwischenpausen in den Kimono oder den Bademantel. Die Einheimischen hatten längst Anstoss an der freien Art der Lohmann-Schülerinnen genommen; es hiess sogar, dass die Polizeibehörde einschreiten und Verbote erlassen werde. Der Briefträger, der sich wie Parsifal in Klingsors Zaubergarten vorkommen mochte, war zudem mit der Tochter eines Gemeinderatsmitglieds verlobt.
Die Aufgeregtheit und Hast der meisten Kursusteilnehmerinnen verzögerte nur immer die ordnungsmässige Ausgabe. Doch endlich war die Post verteilt.
Dina, die ihr Kittelkleidchen übergeworfen hatte und in die Sandalen geschlüpft war, folgte dem Postboten bis zum Eingang von Sonjas Büro. Er hatte nur noch eine Handvoll Briefe mit Dr. Lohmanns Schuladresse. Für sie war nichts darunter.
„Auch kein Telegramm ist für mich gekommen? Dina Brown. Ich hatte es schon gestern erwartet.“
„Nein, Kleine. Ein Telegramm schon gar nicht.“ Er hielt die Fragerin für ein Schulkind. In ihrem kurzen Hängerchen, mit den nackten Waden, konnte man sie für vierzehn, fünfzehn halten, obwohl sie noch in diesem Jahre mündig wurde.
Dina kehrte also wieder in ihre Balkonstube zurück, machte ihr Haar – sie hatte rötlichblonde Flechten, die sie in der altmodischen Schneckenform trug –, dann holte sie aus ihrer Schreibmappe den letzten Brief heraus, den sie von Benedikt erhalten hatte.
Benedikt Denk war ihr einziger Freund. Vor zweieinhalb Jahren, als sie vom Arzt zu einer Winterliegekur nach Leysin sur Aigle geschickt worden war, weil sie ihm lungenverdächtig erschien, hatte sie mit Benedikt, der in der Liegehalle neben ihr lag, diese seltsam schwärmerische Freundschaft geschlossen. Er war als Cellist ausgebildet, hatte auch schon viel komponiert. Die Erkrankung hatte ihn mitten aus seinem ersten grossen Aufstieg herausgerissen, und er war verzweifelt, klagte Gott und die Welt an. Für Dina ward die unfreiwillige lange Rast eine selige Zeit. Sie las unendlich viel, las mit Begeisterung alle Bücher, die ihr Nachbar ihr gab. Sie hatte ja viele Schulen besucht, sprach mehrere Sprachen ziemlich korrekt, war mit ihrer Mutter lange im Inland und Ausland gereist –, aber zum erstenmal in ihrem Leben fand sie Sammlung und Selbstbesinnung und einen richtigen geistigen Führer. Hernach ergab sich’s, dass die Liegekur im Grunde überflüssig gewesen war. Sie hatte nur an einem leichten Lungenspitzenkatarrh gelitten.
Ihre Mutter hatte sich überängstlich gezeigt. Vielleicht war Dina ihr nur unbequem gewesen. Die schöne Frau Madelon wollte es wohl nicht wahrhaben, dass sie schon eine halberwachsene Tochter besass. Dina ahnte es, nein, sie wusste es, und sie begriff es schliesslich auch –, weil sie ja die Mutter so schrankenlos bewunderte, selbst wenn die schöne, vielumschwärmte Frau ihr wehtat.
Benedikt hatte ihr nach Schweden geschrieben, er werde Anfang Juni die Liegekur beenden. „Die Ärzte wollen mich nun also endlich entlassen, kleine Dina! An die Wiederaufnahme meines Berufs ist vorläufig ja noch nicht zu denken. Ich bin noch viel zu matt dazu. Da hab’ ich mir’s nun wunderschön gedacht, kleine Dina, wenn wir beide am Sommerkursus der Lohmann-Schule teilnähmen. Sieh mal, kleine Dina, da lernst Du wieder einmal etwas Neues kennen – und ich habe grosses Zutrauen zu den Atemübungen nach Hatha Yoga, die sie dort treiben. Der gute Professor warnt freilich vor jeder Überanstrengung, aber grundsätzlich ist er nicht dagegen. Hauptsache ist, das meint er selbst, dass ich jetzt wieder in andere Umgebung komme. Ja, weisst Du, langsam in der lebenden Menschheit wieder Fuss fassen, das ist für mich nun die Aufgabe des neuen Sommers. Und Du sollst mir dabei helfen. Willst Du, darfst Du, kannst Du, kleine Dina?“
Dina war von niemand abhängig, konnte leben, wo und wie sie wollte. Ihre Mutter liess ihr schon seit Jahren völlig freie Verfügung über ihr väterliches Erbteil. Das Bankhaus Brown & Peakok in London schickte ihr eine bestimmte Monatsrate. Freudig hatte sie ihm zugesagt. „Ob ich will und darf und kann?“ schrieb sie ihm zu Pfingsten aus Stockholm. „Ach, guter Benedikt, ich hab’ ja laut aufgejubelt, als Dein Brief kam! Also werde ich Dich endlich einmal ein bisschen bemuttern können. Ich denke mir das himmlisch. Die Havel ist sehr schön. Auf der Durchreise nach Bremen – das war damals, als Madelon mich nach Ägypten mitnahm –, machten wir in Berlin Station. Es waren goldene Herbsttage. Da waren wir auch in Potsdam und Sanssouci. Ich werde es nie vergessen. Villen in Gärten am Ufer und rostrote und dunkelblaue Wälder. Weisst Du, es wird sich da schon eine hübsche Pension finden, in der es einen sonnegebadeten Balkon gibt. Ich kann es kaum mehr erwarten, meine Zelte in Schweden abzubrechen und dort unten an der Havel aufzuschlagen. Wir werden schon gute Zeltkameradschaft halten, Du! Und Du wirst mir endlich Dein Tanzdrama geben, das Du mir versprochen hast ... Nur das eine verstehe ich nicht, dass es keine musikalische Komposition sein soll. Du sagst das, Du, Benedikt, in dem alles, was in der Welt ist (und drüber und drunter liegt), klingt und sich in Harmonie und Melodie und Rhythmus auflöst? Ich bin in solcher Spannung, Benedikt! Telegraphiere mir nur gleich den Tag, an dem Du bei Dr. Lohmann antreten wirst, ich richte es dann so ein, dass ich schon vor Dir in Retzin eintreffe und Umschau halte.“
Die Verhältnisse lagen hier nicht so, wie Dina sie erträumt hatte. Dass sie Benedikt ihr Balkonzimmer abtreten würde, war ihr klar. Aber Herr Meyer stand ihrem Wunsch, ihr auch noch das Eckzimmer abzumieten, in dem sie sich einzuquartieren gedachte, um Benedikt nahe zu sein, bis setzt ablehnend gegenüber. Das Eckzimmer war seine „gute Stube“. Sie nannte es das „heilige Grab“, weil es völlig unbenutzt dalag und die Polstermöbel und Plüschvorhänge feierliche Überzüge trugen. Ob sie verwandt mit dem jungen Herrn sei, fragte er. Ganz allmählich dämmerte ihr: Herr Meyer hatte moralische Bedenken. Darüber musste sie nun herzlich lachen.
Gerade wollte sie sich anschicken, Sonjas Befehl nachzukommen und sie in ihrem Büro aufzusuchen, als ein barfüssiger Dorfjunge die Meyersche Treppe vom Kolonialwarenlädchen heraufgetappt kam und an ihre Tür klopfte. Sie steckte Benedikts Brief in die Mappe und wandte sich um.
„Das schickt das Fräulein – und sie käme gleich selbst.“
Ein Depeschenformular, geöffnet, mit verstümmelter Adresse. Aus Stockholm nachgesandt. „Rückfall, acht Tage Liegezeit. Gebe Wochenende neuen Bescheid. Benedikt.“
Sie war sehr traurig über diese Botschaft. Er musste inzwischen ihren Gruss in Händen haben, den sie ihm bei der Ankunft auf deutschem Boden geschickt hatte, und mochte nicht weniger traurig sein als sie.
Langsam trat sie in die Balkontür, lehnte sich gegen den Pfosten und stand lange, in Gedanken versunken. Auf der Wiese spielten sie, im Wasser plantschten sie, in den Gärten sangen sie und schlugen die Laute. Leichter Nebel hatte den Himmel überzogen. Wie durch Watte gedämpft klang das Rollen der Eisenbahnzüge auf der Havelbrücke.
So einsam hatte sie sich seit Jahren nicht gefühlt.
Nun hörte sie den leichten, aber sicheren Schritt von Sonja auf der Treppe und ein paar Worte, die sie in ihrem kurzen, harten Befehlston zu Herrn Meyer sprach, der aus der klingelnden Ladentür in seinen Filzpantoffeln ins Treppenhaus herausgeschlurft war.
Dina hatte in dieser trostlosen Abendstimmung wieder grosse Angst vor der Baltin.
Aber Sonja war wie verändert, als sie ins Zimmer trat.
Und diese Stunde bestimmte über weite Strecken ihres ferneren gemeinsamen Schicksals.
„Was bist du für ein seltsames Wesen, Dina? Als ich dich zuerst sah, auf der Dorfstrasse am Auto, sagt’ ich mir: eine Konfirmandin, die in die erste Tanzstunde geschickt wird. Und nun zeigst du einem plötzlich ganz neue Begriffe. Die stammen aus deinem eigenen klugen, kleinen Kinderköpfchen, Dina? Ja, was haben sie drüben in Stockholm gesagt?“
„Ach, dort haben sie mich nur ausgelacht. Und Christa Soerensen nannte es verächtlich eine Varieténummer.“
„Das glaube ich, dass die böse war. In dir steckt eine ganze Revolution, Dina. Die darf man nicht aufkommen lassen.“
„Ach, Sonja, dass du mir Mut machst – Du!“
Sie sassen an der offenen Balkontür. Im Zimmer war es jetzt ganz finster. Die Lichter, die am anderen Havelufer aufgesprungen waren, zogen lange, zitternde Bahnen übers Wasser. Man war geblendet, wenn man den Blick wieder ins Zimmer zurückwandte. Und Dina erschrak, denn das Antlitz der Baltin erschien jetzt fast gespenstisch. Es war blass, die farblosen Augen unterschieden sich kaum von der Haut, nur das Weiss der Augäpfel schimmerte metallisch.
Dina erzählte, zuerst noch stockend, dann mehr und mehr wieder Mut gewinnend, von ihrem Freunde in Leysin sur Aigle, der sich für ihre Ideen ja auch lebhaft eingesetzt und ihr sogar versprochen hatte, für sie ein Tanzdrama zu schreiben. Ein Tanzdrama ohne Musik.
„Aber das alles wird man draussen nicht so bald verstehen können“, sagte Dina und seufzte. „Weisst du, sie denken immer gleich ans Theater, an die Oper, ans Ballett. Aber davon soll sich’s doch himmelweit unterscheiden. Eine Pantomime soll’s schon gar nicht sein; denn dabei ist’s einem doch nur, als ob Taubstumme sich verständigen wollten. Geht dir’s nicht auch so?“
Sonja hatte die Füsse unter sich aufs Sofa gezogen und nachdenklich den Kopf in die aufgestützte Hand gelegt. Ihre Stimme klang längst nicht mehr hart und männlich. Diese neue Ausdruckskunst, die sie heute nachmittag in so reifer Vollendung kennengelernt, erschien ihr als Lösung von Fragen, die sie selbst schon oft gestellt hatte, ohne dass ihr Antwort darauf geworden wäre. „Wie ist das abenteuerlich, Dina. Wenn ich mir ausdachte, es käme einmal ein Mensch, der die Tiefe und die Kraft hätte, all die Ansätze, die wir auf unserem Gebiet erleben, in die Tat umzusetzen, dann sah ich immer so eine Art hellenischer Schönheit vor mir, ein vollerblühtes Weib, dem sich alles beugen müsste, weil es sieghaft wäre schon durch äussere Gaben. Und da hockst du nun, du Kind, bist ein so einsames Etwas und trägst alles in dir. Ich muss mich erst daran gewöhnen.“
Nun war es Dina zumut, als habe sie Wein getrunken: diese grosse, stolze, harte Baltin, allen ein Rätsel, erschloss sich ihr!
„Ich bin auf deinen jungen Freund gespannt, Dina. Du musst mir recht viel von ihm erzählen. Natürlich liebst du ihn?“
Dina lächelte fast melancholisch. „Wenn ich Mutter wäre und ein sehr, sehr krankes Kind hätte, das ich bald zu verlieren fürchtete –, ja, das würde ich wohl so lieben.“
„Kleines Seelchen du. Das kannst du dir vorstellen?“
„Ach, weisst du, Sonja, ich bin doch immer so einsam gewesen. Wenn ich mich in Genf nicht so geschämt hätte ... Ich will dir erzählen. Da war in der Pension am Plain Palais, wo ich wohnte, eine kleine Waise, ein Kind von drei Jahren; die Pensionsmama, ihre Tante, hatte keine Zeit, sich um sie zu kümmern, aber jede Stunde, die mir freiblieb, gehörte dem Kind. Es schlief dann auch bei mir. Octavie hiess es. Die Eltern waren beim Brückeneinsturz in der Rhône umgekommen. Ich wollte es durchaus mitnehmen. Und ich wäre Octavie eine gute Mutter geworden. Aber sie lachten mich alle aus. Als ich dann allein nach Stockholm fahren musste, war ich so unglücklich, so fassungslos ... Der Mensch muss doch ein Wesen haben, an das er sein Herz hängt ... Benedikt verstand mich.“
„Er ist auch so ein Einspänner?“
„Einen Bruder hat er noch. Irgendwo in Unterfranken, am Main, glaube ich. Aber der ist geistlicher Herr, steht auf ganz anderem Boden, die Brüder haben einander nie verstanden. Er ist ja solch ein Rebell, der Benedikt. Du wirst staunen, wie der liebe, arme, oft so hilflos kranke Mensch aufsässig werden und hassen kann. Schliesslich packt’ ich ihn da, wo er ganz wehrlos war, weil im ärgsten Rebellen doch immer noch die Kindesliebe schlummert: sein Mütterchen bin ich geworden. Oh, bitte, lache mich nicht aus!“
„Du – Mütterchen!“ Sonja lachte. Aber es war ihr dabei merkwürdig eng in der Kehle. So viel Hässliches und Grausames hatte sie in ihrem Leben durchgemacht, Menschenverachtung prägte sich in jeder ihrer Handlungen aus. Da wirkte die sonnige Kindlichkeit dieses einsamen Wesens auf sie wie ein Bad der Seele. Sie hatte sich erhoben und war auf den Balkon getreten. Tiefe Nacht lag draussen. Die Wasserfläche trug dicken Nebel. Man sah kein einziges Licht mehr. Sonja atmete tief. „Es ist längst Schlafenszeit. Ich gehe. Schreib Benedikt, dass auch ich ihn erwarte. Wir wollen hier gemeinsam etwas Grosses unternehmen. Aber es muss bald sein, sehr bald. Dr. Lohmann ist jetzt an der See festgehalten. Er würde ja niemals dulden ... Also stell’ dir vor, Kind, wenn wir hier in den Wochen bis zum Ferienbeginn die talentvollsten und vorgeschrittensten Schüler zusammennähmen und versuchten, euer ganzes neues Werk auf die Füsse zu stellen. Euer Tanzdrama ...“
Im Nu war Dina an der Seite der Baltin. „Das würdest du wagen, Sonja? In Stockholm – Christa Soerensen hättest du hören müssen – da sollt’ ich im Frühjahr ja sofort ausgeschlossen werden, als ich auch nur den schüchternen Versuch machte, ein paar Schüler dafür zusammenzurufen!“
Sonja fröstelte es. „Es ist auch wohl nur in diesem Monat hier möglich. Solang wir allein sind. Und drum ist keine Zeit zu verlieren.“
„Du glaubst also daran, Sonja?“
„Ja, ich glaube daran. Und darum werde ich dir helfen. Gewiss wird es schwere Kämpfe geben. Wer weiss, wie es enden wird. Vielleicht kostet mich’s meine Stellung. Aber ich habe fast ein halbes Jahr Tag für Tag hier voll Zorn all diese Unfähigkeit und Hilflosigkeit erlebt. Nun soll es ein Aufatmen geben.“
„Ich schicke Benedikt ein langes, ausführliches Telegramm. Oh, wird er staunen und sich für mich freuen!“
In der Dunkelheit fanden sich ihre Hände. Sonja ging.
Es erregte den Neid der älteren Assistenten und Assistentinnen, dass die Neue schon nach wenigen Tagen zur Gruppenführerin ernannt wurde. Am meisten ereiferte sich Ella Berndt. Sie kam öfters in den Ring, in dem Dina mit ihren aus allen Gruppen ausgewählten Schülern und Schülerinnen übte, und masste sich Kritik an, lief dann zu Sonja und meldete ihr: was Dina lehre, das werfe ja den ganzen Lohmannschen Ausbildungsplan über den Haufen.
Sonja hörte die Hagere mit ihrem undurchsichtigen Lächeln an und sagte obenhin: „Lass das Kind sich doch ein Weilchen austoben. Es ist ja amüsant für uns. Der Meister wird über diese neue Stilwut lachen. Sein System steht felsenfest, das weiss er, wissen wir alle.“
„Aber es sind doch fast die Allerfähigsten unserer Schule, die du ihr anvertraut hast.“
„Bei den Schwächeren bestünde eine Gefahr, bei diesen nicht.“
Ella Berndt brachte dies im Gespräch mit anderen bei Gelegenheit recht schadenfroh und hämisch an. Es sprach sich bald herum. Dina erfuhr es von Hanna Hesslein.
„Sagt’ ich dir’s nicht, Dina? Diese Baltin ist eine hinterlistige Intrigantin. Sie lässt dir jetzt scheinbar Freiheit –, damit du dich vor dem Meister unmöglich machst.“
Vorübergehend geriet Dina in einige Verwirrung. Fragen stellen, sich vergewissern konnte sie nicht. Sonja vermied es in der nächsten Zeit, mit ihr allein zusammenzutreffen.
Dann kam Benedikt in Retzin an.
Dina fand sein Aussehn besser als damals in Leysin sur Aigle. Er war von der Frühlingshöhensonne verbrannt, hatte rote Backen und sprühende Augen. Der ganze Mensch war freilich ein Bündel Nerven. Immer war er im Schaffenseifer, immer von Ideen erfüllt, die er sich vom Herzen wälzen musste. Dina, die in der „guten Stube“ neben dem Balkonzimmer schlief, hörte nachts oft, dass er sich vom Bett erhob und sich an den Schreibtisch setzte. Da huschte sie denn endlich hinein, nahm ihm Noten- oder Schreibpapier und Feder weg. Schlafen sollte er, ruhen, ausruhen!