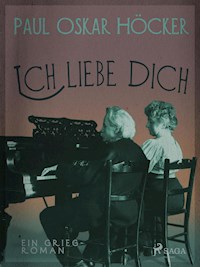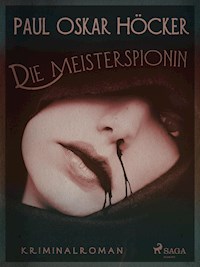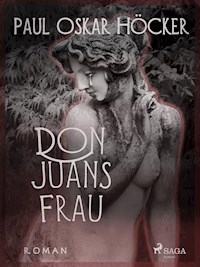Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die junge Pianistin Dina Antze in einer Pension am Berliner Kurfürstendamm tot aufgefunden wird, geht man zunächst von Selbstmord aus. Doch schon bald stellt sich heraus, dass sie umgebracht wurde. Eine wichtige Rolle spielt dabei Helma Doost, die aus dem gleichen Heimatort wie Dina am Rhein stammt. Nach und nach entwickelt sich vor den Augen des Lesers eine dramatische Mordgeschichte, deren Motive Liebe, Geltungsbewusstsein und Habgier sind. AUTORENPORTRÄT Paul Oskar Höcker, geboren 1865 in Meiningen, gestorben 1944 in Rastatt, war ein deutscher Redakteur und Schriftsteller. Höcker verfasste Lustspiele, Kriminalromane, Unterhaltungsromane, historische Romane und auch etliche Jugenderzählungen. Er galt in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als überaus erfolgreicher Vielschreiber. Einige seiner Romane wurden verfilmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Oskar Höcker
Dina und der kleine Herzog
Roman
Saga
Vier Zeitungsmeldungen
Montag, den 11. Januar (Abendausgabe). — Selbstmord der Pianistin Dina Antze. Das einzige Berliner Konzert des Sontmar-Vokalquartetts, das heute abend stattfinden sollte, mußte in letzter Stunde abgesagt werden. Die ständige Begleiterin des Quartetts, die bekannte Pianistin Dina Antze, hat in der Pension R. am Kurfürstendamm Selbstmord verübt. Unser Konzertleben verliert in der Dahingeschiedenen eine Musikerin, die durch Feinhörigkeit und Fingerspitzengefühl für das schwierige, nicht immer dankbare Amt des Akkompagnements besonders befähigt war. Wer erinnert sich nicht gern des Scharms und der silbernen Brillanz, womit sie z. B. die Brahmsschen Liebeswalzer zu begleiten wußte! Dina Antze stammte aus einer Lehrersfamilie am Rhein. Sie stand im zweiunddreißigsten Lebensjahr. Am gestrigen Sonntag hatte die Künstlerin mit dem Sontmar-Quartett noch bis zum Abend geprobt. Sie war auch diesmal wieder in der Pension R. abgestiegen, wo eine Landsmännin von ihr wohnte, Fräulein Helma D., Gesangsschülerin der Hochschule. Die junge Dame hatte der von der Probe abgespannt heimkommenden Künstlerin als Schlafmittel eine Veronaltablette verabreicht. Als heute vormittag das Sontmar-Quartett bis 10½ Uhr vergebens auf seine Begleiterin zur Saalprobe warten mußte, ergab sich bei der Nachforschung in der Pension R., daß die Pianistin tot im Bett lag. Der Rest des in einem Cocktailglas aufgelösten Schlafmittels läßt, nach Meinung des Arztes, darauf schließen, daß die Unglückliche mindestens zehn (!) Veronaltabletten zu sich genommen hat. Fräulein Helma D. betont, daß sie an Dina Antze nicht die Spur eines Lebensüberdrusses wahrgenommen habe, im Gegenteil von neuem überrascht gewesen sei von der außerordentlichen Frische und dem rheinischen Temperament ihrer Lehrerin und Freundin.
Dienstag, den 12. Januar (Morgenausgabe). — Dina Antze nicht durch Selbstmord geendet. Racheakt? Die Leiche beschlagnahmt. Ein Stubenmädchen der Pension R. am Kurfürstendamm, die neunzehnjährige Elli Rejewski, unter dem Verdacht, der Künstlerin Gift beigebracht zu haben, am gestrigen Abend verhaftet.
Dienstag, den 12. Januar (Abendausgabe). — Die Mordkommission in der Pension Reitmeyer am Kurfürstendamm. Die dem schweren Schlaftrunk erlegene Pianistin Dina Antze das Opfer eines Raubmordes. Auch der Bräutigam der Rejewski, der Monteur Otto Ruhwe, in Haft genommen.
Mittwoch, den 13. Januar (Abendausgabe). — Sensationelle Wendung in der Raubmordaffäre Dina Antze. Frau Lucy Schlentzig, die Inhaberin der Autofahrschule Knesebeck, deren beide Garagen am Sonnabendnachmittag durch den Gerichtsvollzieher versiegelt worden sind, ist unter dem Verdacht, ihre Pensionsgenossin betäubt und beraubt zu haben, verhaftet worden. Die Verhaftete, bekannte Autosportlerin, lebt von ihrem Mann getrennt; Ehe vor vier Monaten geschieden; Frau Lucy Sch. hierbei wegen ihrer Geldverschwendung als schuldiger Teil erklärt; völlig zerrüttete Vermögensverhältnisse.
*
Die Gesangstudierende der Hochschule Helma Doost hat noch bei jedem Aufenthalt, den das Sontmar-Vokalquartett für ein Konzert in Berlin nimmt, ihre Landsmännin, die Pianistin Dina Antze, als Gast zu sich gebeten, um unter ihrer Leitung an eigenen Programmen zu arbeiten. Aber nie zuvor ist ihre erwartungsvolle Spannung so stark gewesen wie diesmal; denn für Anfang März plant sie doch ihren allerersten eigenen Liederabend im Bechsteinsaal.
Helma ist Waise, wie Dina, und aus Dinas Heimat Runnswick am Rhein stammte auch ihr früh verstorbener Vater. Die Familie Doost lebte aber schon seit Jahrzehnten in Amsterdam, wo Helmas Mutter, die im vorigen Frühjahr dem Gatten in den Tod gefolgt ist, der Reederei van Kuypers & Cie. vorstand, deren einzige Besitzerin sie seit 1927 war.
Ein Besuch der rheinischen Freundin bringt Helma also nicht nur künstlerische Anregung, sondern auch stimmungsvolles Wiederaufleben von viel frohen Erinnerungen an Ferientage am Rhein und an künstlerische Feierstunden in Amsterdam. Helmas Mutter galt mit Recht für sehr kunstsinnig; solange sie am Leben war, bildeten die Wohltätigkeitskonzerte im Hause Doost-van Kuypers stets einen künstlerischen und gesellschaftlichen Mittelpunkt für die oberen Vierhundert der alten Handelsstadt. Auch das Sontmar-Quartett hat dort manchen Triumph feiern können.
Ankunft und Einholung des Sontmar-Quartetts wird von der Berliner Konzertdirektion und den Freunden und Anhängern der Künstler und Künstlerinnen gern zu einem kleinen Festakt ausgestaltet. Reklame kann ja auch solch prominenten Leutchen nicht schaden. Es gibt viel Blumen, es gibt viel Tücher- und Hüteschwenken. Meist ist auch ein Kurbelmann, mindestens ein Photograph, ganz bestimmt ein Pressevertreter zur Stelle.
Auch diesmal, fünf Tage vor dem Singakademie-Konzert, das jetzt schon beinahe ausverkauft ist, hat sich auf dem Bahnsteig des Anhalter Bahnhofs eine stattliche Gruppe von Herren und Damen eingefunden und begrüßt die Ankömmlinge mit großem Enthusiasmus. Der Tenor ist ein eleganter, nicht mehr ganz junger Künstler, dem viele Abenteuer nachgesagt werden. Der Baß vertritt den Typ des modernen Sportsmannes und Naturburschen: auch wenn er von Prag nach Berlin reist, steckt er im Golfanzug. Die Altistin mit dem Madonnenscheitel und den dunklen Augen ist der besondere Schwarm der Konservatoristinnen. Erika Sontmar, die etwas füllige Sopranistin, ist gewohnt, sämtliche Huldigungen, die dem Vokalquartett dargebracht werden, auf sich allein zu beziehen, auf dem Podium wie bei sonstigen Gelegenheiten. So nimmt sie auch Helma Doost, die bei der Zugeinfahrt ihrem Fenster erster Klasse zunächst steht, mit ihrem berühmten gnädigen Lächeln den für Dina Antze bestimmten großen Nelkenstrauß aus der Hand, haucht einen Kuß hinein und schwenkt die Blumen über den Köpfen des neben dem Wagen mitwandernden Empfangstrupps. Es wirkt wie ein Engrosgruß an Berlin.
„Dina, also du wohnst bei mir! Nein, schläfst nicht auf der Couch, wie im Herbst. Du hast dein eigenes Zimmer. Den Flügel hab’ ich gestern stimmen lassen. Du, ich freue mich mächtig! Wie lange bleibt ihr? Ist’s wahr, daß ihr schon am Mittwoch nach Paris weiter müßt? Ekelhaft, diese Hetze immer! Mädel, was ist das für eine unmögliche Mephistokappe, die du da trägst?“
„Ist das neueste Prager Modell. Kühne Behauptung, nicht? Erika hat mir das Ding ausgesucht.“
„Kannst du in Berlin unmöglich tragen! Das steht in jedem Warenhausfenster zu Dutzenden mit vier Mark fünfundneunzig ausgezeichnet. Du bist wieder märchenhaft verwahrlost, göttliche Dina!“
„Denkst du denn, du kleiner Aff’, ich will hier Triumphe feiern wie ein Tenor? Ausfaulenzen will ich ... Mein Gott, Helma, Wilhelma, Willemintje, was hast du doch für süße Augen! Die sind inzwischen noch blauer geworden. Gib dir bloß keine Müh’ um mich und mein Hütchen, du Kleine! Gegen dich Bündel Jugend und Frechheit und Blondheit und Angelhaken im Geschau komm’ ich alte Scharteke ja doch nicht auf!“
Sie umarmen sich lachend auf dem Bahnsteig. Dina ist um einen halben Kopf größer als Helma, agiert viel mit den langen, etwas knochigen Armen und hat unbedingt etwas Exaltiertes. Dabei sagt sie, es sei ihr Traum, so vornehm wie Helma oder auch nur wie die Altistin des Quartetts zu wirken. Manchmal persifliert sie sich selbst, indem sie in Gang und Haltung eine junonische Würde annimmt. Man kann Tränen über sie lachen, wenn sie mal so richtig aufgezogen ist.
In der Pension Reitmeyer wird sie in der kleinen Diele halbstocks von Frau von Scheidegg liebenswürdig begrüßt. Die gewandte Pensionsinhaberin weiß gleich dabei einzuflechten, daß ihr der Chopin-Abend vom Winter 1928 unvergeßlich sei. Helma Doost-van Kuypers hat damals verschwenderisch Freibillette verteilt.
„Ja, damals war ich noch jung und schön ... Geschenkt, geschenkt, Frau von Scheidegg!“ Dina schiebt lachend ihren Arm in den Helmas. Im Lift sagt sie: „An den Chopin-Abend denk’ ich nur noch zurück, wenn ich Alpdrücken habe. Ein Deibel ritt mich damals. Ich raste den Minutenwalzer in neunundvierzig Sekunden herunter. Das Publikum tobte Beifall — aber die Kritik hat mich hernach erbarmungslos skalpiert. Ach, man hat schon so seine Glücksstunden im Künstlerleben ... Furchtbar komisch ist sie, deine Landlady!“
„Lästre nicht, Dina! Sie opfert sich für mich auf. Und die himmlischen Tulpen, die sie dir auf Nummer dreißig hingestellt hat!“ Sie öffnet die Tür. „Da — bitte!“
„Ich bin ein Rabenaas — ich weiß.“ Dina kneift das Gesicht zusammen, so daß die scharfe Nase noch mehr heraussticht, und schielt grauenhaft. „Guck, Helma! So ein Kölner Hänneschen hab’ ich in Runnswick als gehabt. So guck doch, du! Länger kann ich die Fratz’ nicht halten.“
Dinas umfangreiches Gepäck wird aus dem Lift geschafft; die Damen sind so lange noch vor der offenen Zimmertür stehengeblieben.
„Nette Käschperle-Vorstellungen gibst du da wieder, Dina!“ sagt Helma, die belustigt im Spiegel über dem Anrichtetisch bemerkt hat, daß Herr Prinz, ihr Flurnachbar, aus Nr. 23 herausgetreten ist, von Exzellenz von Malchow bis zur Tür begleitet.
Nun gewahrt auch Dina erschrocken die Fremden. Sofort legt sie ihr Gesicht wieder artig zurecht und sieht unschuldsvoll in den Spiegel.
„Aber das ist doch Fräulein Antze!“ ruft die Generalswitwe und tritt voller Begeisterung auf die Pianistin zu, beide Hände nach ihr ausstreckend. „Die berühmte Dina Antze! Ja, ja, ich weiß: das Sontmar-Quartett!“
„Exzellenz von Malchow!“ stellt Helma vor.
„Haben Sie mich etwa auch Chopin spielen hören, Exzellenz?“ fragt Dina, mit einem Augenblinzeln zu Helma.
„Ihr himmlischer Sopran!“ sagt die fast taube alte Dame, mit einem entrückten Augenaufschlag.
„Exzellenz ist schwerhörig,“ erläutert Helma halblaut.
„Na ja: Wenn ihr mein Klaviergepauke schon als himmlischer Sopran erschienen ist —?“ bemerkt Dina, plötzlich in tiefem Baß murmelnd.
Helma kann sich kaum des Lachens erwehren. Sie wendet sich nach Herrn Prinz um. „Darf ich Sie auch gleich mit meiner Freundin bekannt machen, Herr Prinz?“
„Ich hörte schon von Ihrem triumphalen Einzug, gnädiges Fräulein.“ Er beugt sich leicht auf Dinas Hand. „Fräulein Doost-van Kuypers hat nämlich mit ihrer freudigen Aufregung die ganze Pension angesteckt.“
Prinz ist ein auffallend gutgewachsener und wohlgepflegter Herr von höchstens vierundzwanzig Jahren. Er stammt aus den Vereinigten Staaten, beherrscht die deutsche Sprache aber fast ohne Akzent. Dina ist überrascht von seinem schöngeformten Kopf, den ausdrucksvollen, klaren grauen Augen. Obwohl Prinz noch bis vor kurzem in Hollywood tätig gewesen ist, besitzt er doch nichts, was an den Filmschauspieler erinnert. Dabei hat man ihn drüben den Zweiten Valentino genannt. Seine liebenswürdige Art wirkt sehr zurückhaltend, auch durch die immer etwas gedämpfte Sprechweise.
„Hoffentlich wird Sie mein Musizieren nicht stören, Herr Prinz?“ fragt Dina. „Manchmal kommt man sich beim Üben so unausstehlich grausam gegen seine Mitmenschen vor.“
Er lächelt — Dina ist gleich ein bißchen verliebt in sein wundervolles natürliches Gebiß — und nickt Helma freundlich zu. „Durch Fräulein Doost-van Kuypers bin ich hier schon ein bißchen erzogen worden für ernste deutsche Musik. Übrigens war ich nie ein Schwärmer für Negerrhythmen. Beunruhigen Sie sich meinetwegen gar nicht, gnädiges Fräulein!“
„Der ist ja bezaubernd, Willemintje!“ sagt Dina hernach. „Bist du mit ihm befreundet? Habt ihr einen netten kleinen Flirt miteinander?“
„Gar nicht! Sie machen ihm hier ja schon alle so schrecklich den Hof. Wer? Nun, alle Weibchen. In der ganzen Pension. Bei Tisch ist es manchmal unerträglich, wie sie ihm heimlich, auch im Spiegel, zulächeln oder zutrinken. Ich wollte so tun, als könnt’ ich ihn nicht leiden, wollte der Bekanntschaft überhaupt ausweichen. Aber da kam der Zimmerwechsel. Nämlich Frau Schlentzig, die das Zimmer neben mir hatte, beschwerte sich darüber, daß ich manchmal schon früh um acht Uhr Solfeggien übe; Frau von Scheidegg vermittelte; Herr Prinz war gefällig, gab Nummer einundzwanzig frei und zog auf Nummer vierundzwanzig, und so kam’s dann doch dazu, daß er mir vorgestellt wurde.“
„Ihr seid hier fabelhaft vornehm, Willemintje. Eine Exzellenz — so ein eleganter Herr Prinz ...“ Sie bricht ab: „Nein, weißt du, daß mir da gleich eine frappante Ähnlichkeit aufgefallen ist?“
Helma lacht. „Kunststück! Du wirst Bilder von ihm gesehen haben. In tausend Journalen. Mister Balthasar Prinz als X, als Y, als Z. Immer in neuen, berauschend schönen Kostümen. Oder auch fast ohne. Als ich in Amsterdam zum erstenmal in einen Film mit durfte, sah ich ihn als kleinen Lord Fauntleroy. O Gott, hab’ ich damals für den Bengel geschwärmt! Und dann war er der süße Karl-Heinz in ‚Alt-Heidelberg‘. Und Aiglon war er auch.“
„Richtig, richtig! Aber ich hab’ noch eine ganz besondere Erinnerung ... Zum Kuckuck, Mädel, krieg’ ich denn nichts zu essen? Klingle doch mal! Zwei weiche Eier, Toast mit Butter und Tee.“
„Ach, du Spielverderber! Du alter Philister! Heut gibt’s doch ein Festmahl! Wir schlüpfen sofort in mein Auto und fahren in mein Leiblokal. Ich hab’ extra ein paar Spezialitäten bestellt. Rheinische und holländische. Du wirst staunen!“
„Und nachts stöhnen!“ Dina droht ihr und macht wieder ihre tragikomischen Schielaugen. „Ha — Verführerin!“ Jetzt steht sie am Waschtisch und erklärt: „Du, aber große Toilette wird heut nicht gemacht!“
„Bewahre! Bloß ein bißchen Puder auf die Nase! Deine Sommersprossen sind übrigens kaum mehr zu sehn, Dina. In drei Minuten also Abfahrt!“
„Und wer packt aus? Etwa ich? Etwa du? Wenn wir, des süßen Weines voll, von deiner lasterhaften Orgie um Mitternacht hier landen?“
„Elli packt aus. Macht das glänzend.“
Dina klingelt also dem Stubenmädchen Elli, um ihr die Kofferschlüssel anzuvertrauen. Aber dann schlägt sie sich an die Stirn. „Geht nicht.“
Helma wendet sich in der Tür um. „Was geht nicht?
„Abgang! Raus! Vorhang! — Elli, kommen Sie mal geschwind her! Hier in diesem Sack ist meine seidene Wäsche. Die muß unbedingt noch heute abend gewaschen und geplättet werden ... Und hier sind die Spitzen abgetrennt — da fehlen auch die Bändchen ...“
Ein Dutzend Aufträge, wenn nicht mehr, würden jetzt folgen. Helma kennt ja ihre unberechenbare Dina. Sie entzieht sie jeder Widerrede der störrisch dreinblickenden Elli und macht sich zu dem gemeinsamen Ausgang fertig. — —
Eine „lasterhafte Orgie“ ist es dann doch nicht geworden; denn sie gingen gleich von den Vorspeisen zum Mokka über. Soviel hatten sie einander zu erzählen. Aber gemütlich war die Ecke in dem alten Schlemmerrestaurant auf alle Fälle, und Helma ist sehr stolz darauf, es entdeckt zu haben; es erinnert sie an ein berühmtes kleines Frühstücksstübchen in Amsterdam. Die halbe Flasche Hautes Sauternes hat sie aber beide doch so müde gemacht, daß Helma es dem Pagen überläßt, den Wagen in die Garage zu fahren.
Früh um acht Uhr bereits kommt Dina, in Schlafanzug und Kimono, über den Gang herüber zu Helma, die die beiden Eckzimmer bewohnt, Nr. 25 und 26, und setzt sich an den großen Konzertflügel. Der Klavierauszug von „Madame Butterfly“ liegt da aufgeschlagen. Sie beginnt zu spielen. Dazwischen ruft sie ins Nebenzimmer: „Du, Willemintje, was sind denn das für Seitensprüng’? Willst du etwa umsatteln und zum Theater?“
Helma lehnt sich verschlafen an den Türpfosten, hüllt sich fester in den Kimono, schüttelt sich und gähnt mitleiderweckend. „Du bist von einer barbarischen Grausamkeit, Dina! Ich begreife nicht, wie du jetzt schon ausgeschlafen sein kannst. Das ist pervers! Und, ‚Butterfly‘, vor dem Frühstück? Das kommt mir vor wie Aal mit Himbeersoße!“
„Brrr!“ Mit einem schrill dissonierenden Akkord springt Dina auf. Aber wie schuldbewußt setzt sie sich sogleich wieder nieder und fügt eine schulgerecht auflösende Schlußkadenz à la Haydn hinzu. „Du, Willemintje, ich hab’ dir doch gestern von der Ähnlichkeit erzählt, nit?“ Sie nimmt das Päckchen wieder auf, das sie auf die Flügeldecke gelegt hat. „Grad’ wie ich den Schreibtisch einräumen will, gerät mir das Bildchen zwischen die Finger. Ich kann mich von dem alten Kram ja nicht trennen. Guck bloß einmal selbst! Das ist mein kleiner Herzog als ‚Blue boy‘. In Runnswick damals.“ Sie holt ein paar Liebhaberaufnahmen aus dem kleinen Paket und breitet sie aus.
Helma beginnt ihren Morgen sonst immer mit Solfeggien. Sie fühlt sich in ihrem Tagesprogramm gestört. Aber dem impulsiven Gast kann sie das nicht klarmachen. „Moment mal! Ich drehe bloß das Bad für dich auf.“
„Für mich? Danke! Ich bade um sechs Uhr abends. Seit tausend Jahren. Müßtest du wissen! Donnerwetter, warum schlüpfst du nicht in deine Pantoffel? Ach so, ich soll deine bildhübsch polierten Fußnägel bewundern? Gemacht! Jetzt setz’ dich her, Willemintje, und guck!“
„Ich guck schon. Aber Tee will ich noch rasch bestellen, ja?“
„Hab’ ich längst getrunken. Er war scheußlich. Verzeih schon, Willemintje! Der Einfachheit halber hab’ ich eurer Elli auch gleich anvertraut: Was ihr Berliner hier Tee nennt, das nennen sie auf Sumatra Abwaschwasser.“
„Du scheinst dich ja wieder fabelhaft beliebt zu machen, göttliche Dina.“
„Das sowieso!“ Dina nimmt eine Zigarette. „Also, die Spitzenwäsch’, die euch eure Huldinnen hier abliefern dürfen — na! Ich hab’ euerm Wuschelkopf mal gleich ein Privatissimum darüber im Damenbad erteilt. Die hat nicht schlecht die Augen aufgerissen, eure Elli.“
„Heil und Sieg, praeceptor Germaniae!“
Dina nimmt eines der Bilder auf. „Das da ist aus dem Jahr zwölf oder dreizehn. Ich war damals auf Schloß Runnswick herzogliche Kindergärtnerin.“
„Also mit elf oder zwölf Jahren? Grauenhaften Unsinn verzapfst du einem so auf nüchternen Magen, Dina!“
„Na ja, der Herzog nannte es nur ‚Gespielin‘. Aber Vater hatte doch bloß sein kleines Lehrergehalt und mußte darauf sehen, daß diese erste Sprosse auf meiner Glücksleiter in einen bestimmten Lohntarif fiel.“ Sie reicht ihr ein Bild nach dem andern. „Hier der kleine Herzog allein — hier mit seinen Eltern — hier seine Mama im Schloßhof ... Ach, die Ärmste, sie war doch nicht standesgemäß, und was hat es damals für Kämpfe mit dem Heroldsamt gegeben! — Und da der kleine Herzog mit seiner Kindermuhme Dina!“
Helma lacht hellauf. „Das bist du?“
„Leibhaftig! Ich würde das lange Gestell auch eher für einen Stockfisch im Hängerkleidchen halten. So schön wie heut war ich damals natürlich nicht. Was verlangst du auch, Willemintje? Ja — und das ist nun mein Lieblingsbild ... Guck mal: Percy als ‚Blue boy‘! Ist das nicht allerliebst? Der Bengel war ja zum Küssen. Da hatten sie ein großes Fest auf dem Schloß. Das war knapp ein Jahr vor dem Zusammenbruch von Runnswick. Das Geld der Herzogin floß damals noch in Strömen. Sie war doch unser Goldsischchen aus Amerika. Nach Runnswick paßte sie ja nicht, überhaupt nicht nach Deutschland. Aber der Herzog hatte sich doch derart verknallt in sie — es war tatsächlich eine Liebesheirat. Und der Sommernachmittag auf der Schloßterrasse — mit all den schönen Menschen in den schönen Kostümen —, die paar Stunden kommen mir immer wieder ins Gedächtnis, wenn ich an die Vorkriegszeit denk’.“
Helma kniet auf der Polsterbank am Klavier und betrachtet die Bilder. „Ja, du hast recht, Dina: Fabelhaft ist die Ähnlichkeit! Man muß sich natürlich die Pagenfrisur wegdenken. Aber genau so muß auch Balthasar Prinz als Knabe ausgesehn haben. Das kecke Näschen und der trotzige Mund ...“
„Und die Augen, Willemintje, die Augen!“
„Na ja, da haben wir’s! Nun bist du auch schon restlos eingefangen von ihm — wie alle Frauensleut’ hier!“
„Menschenskind, ich bin doch nicht, wie ihr, in euern Filmprinzen verschossen! Ich konserviere meinen Jugendschwarm!“
„Du mußt mir noch unendlich viel über Runnswick und deine früherotischen Dämmerzustände erzählen, meine teure Dina. Aber jetzt verzeih! Ich muß mir wenigstens die Zähne putzen, bevor ich Frühstück heraufkommen lasse.“
„Dandy!“
*
Es gibt ein paar herrliche Tage.
Helma schwänzt den Unterricht bei ihrem Gesangsprofessor und übt mit Dina, bei der sie in einer halben Stunde mehr zu lernen glaubt als auf der Hochschule in einem ganzen Monat, und in der übrigen Zeit machen sie Ausfahrten im Auto, das Helma virtuos zu steuern weiß, oder sie schwatzen auf Helmas „Bude“.
Wenn es nach Helma ginge, nähmen sie hier auch sämtliche Mahlzeiten ein. Aber Dina sagt, es mache ihr großen Spaß, die Pensionäre zu beobachten. Es regt sie wohl an, sie hernach zu kopieren. Dina versteht das köstlich. Helma merkt natürlich: ihre Freundin hat sich in das erwachsene Double ihres kleinen Herzogs Percy von Runnswick verliebt ... Also gönnt sie ihr’s gern, beim Gabelfrühstück oder bei der Hauptmahlzeit den eleganten Filmprominenten wenigstens aus der Ferne andächtig zu bewundern.
Sie streikt aber, als Dina den Vorschlag macht, Herrn Prinz einmal zum Tee einzuladen. „Stell dir bloß die andern Weiberchen hier vor, Dina, wie die sich den Mund zerschlügen! Selbstverständlich hieße es, das geschähe bloß meinethalben; denn wenn du nach Paris abgedampft seist, würde er die Teebesuche bei mir allein fortsetzen. Ausgeschlossen, Dina! Du ahnst nicht, wie hier eins das andere kontrolliert. Es herrscht eine fabelhaft sittliche Weltanschauung in der Pension Reitmeyer. Man muß überhaupt Beziehungen haben, um hier unterzukommen. Du hast ja gestern gehört, wie sie am Nebentisch über die Dame von Nummer einundzwanzig hergezogen sind? Eine Frau Schlentzig. Geschieden. Ich kümmere mich natürlich um die kleinen Skandälchen nicht ... Was übrigens auch dich bei weitem mehr interessieren wird, Dina: Onkel Nidders kommt auf einen Tag her!“
„Der Justizrat aus Runnswick?“
„Ja, er ist jetzt in Stettin zum Besuch. Heute früh hat er mich angerufen. Natürlich hab’ ich ihm Folter, Fegefeuer und andere Lieblosigkeiten angedroht, falls er nicht Station macht in Berlin. Nun will er also morgen gegen Abend hier eintreffen.“
„Dann bleibt er doch zum Konzert am Montag?“
„Kann er leider nicht. Dumm! Er hat Dienstag früh Termin in Bonn.“
„Schlafwagen ist ihm eine noch unbekannte Einrichtung?“
„Bissel bequem ist er wohl geworden. Hat doch schon vor zwei Jahren seinen siebzigsten Geburtstag gefeiert.“
Dina wandert durch Helmas Wohnzimmer und sinnt vor sich hin. „In meiner Kinderzeit war er wohl die größte Respektsperson, die es für das Haus Antze gab: für Vater wie für Mutter und Kind. O Gott, der Herr Domänenrat! Weißt du, der hat die Schicksale aus nächster Nähe gesehen: Wie der Herzog damals die Amerikanerin geheiratet hat; wie es dann den Berliner Hofskandal gab, weil seine Frau keine Einladung bekam; später ihre Flucht mit dem Kind; ach, und der Brand im Schloß — hernach das Ende der ganzen Herrschaft; nach Runnswicks Tod im Feld keiner da, der für die Schulden aufkommen konnte ... Und der Domänenrat nach wie vor immer feierlich, immer ernst, den Silberscheitel gesenkt, als trüge er die ganze Last der Verantwortung ... Natürlich muß ich ihn endlich mal wiedersehn, Willemintje!“
„Ist alles schon verabredet. Er freut sich mächtig. Wir gehen am Sonntagabend zusammen ins Theater und essen danach bei ihm im Hotel. Er wird Unter den Linden absteigen. Das ist er noch aus seiner feudalen Zeit her so gewohnt.“
„Gut! Aber dann muß er uns auch Kaviar in der Schüssel im Eisblock spendieren!“
Helma lacht. „Tut er! Tut er! Er ist ein reizender alter Herr. Und ernst und feierlich? Nicht die Spur ... Weißt du, was er sagte, als ich ihn an das Töchterchen vom Lehrer Antze in Runnswick erinnerte? ‚Och, das lustige klein’ Rotznäsle?‘ hat er gesagt. — Es wird famos werden, gib acht! Beim Rheinwein taut er immer auf. Übrigens: Große Toilette liebt er sehr. Du mußt eins deiner neuen Konzertkleidchen anziehn!“
„Wird gemacht! Komm mit und hilf aussuchen, Willemintje!“
Sie kreuzen den breiten Gang und wollen bei Dina eintreten. Humpelnd kommt da ein Herr vom Lift her auf die benachbarte Zimmertür zu. Er grüßt und bleibt erwartungsvoll stehen. Helma dankt, und da er zögert, macht sie bekannt: „Herr Doktor Neumann — mein Logierbesuch, Fräulein Antze.“
Dr. Neumann hält mit dem Hut in der Hand vor Nr. 31, offenbar gewillt, irgend etwas Verbindliches zu sagen. Aber er besitzt wohl die Leichtigkeit nicht, flüchtige Konversation zu machen. So verbeugt er sich nur noch einmal stumm und verschwindet dann in seinem Zimmer, hastig, fast etwas scheu.
Helma blickt ihm mit einem sinnenden Lächeln nach. Es will Dina so vorkommen, als habe ihre Freundin für diesen Pensionsgenossen, so unbehilflich er wirkt, mehr übrig als für den eleganten Filmzauberkünstler, in den die ganze übrige Pension verschossen ist.
Da Dr. Neumann das Nebenzimmer von Dina innehat, sprechen sie nur in gedämpftem Ton weiter. Natürlich will die immer neugierige Dina Näheres über diesen weltfremden Nachbarn hören. Daß Dr. Neumann erst Mitte der Zwanziger stehe und soeben erst in Oxford promoviert habe, will Dina kaum glauben. Er sieht wesentlich älter aus. Vielleicht hat sein körperliches Gebrechen ihn früher gereift? Als Vierzehnjähriger — so erzählt Helma der Freundin — war er auf dem Eis gestürzt und hatte sich die Kniescheibe verletzt. Monatelang mußte er im Bett, dann im Streckbett liegen. Als er sich wieder erheben durfte, war er stark gewachsen, aber das linke Bein war um eine Kleinigkeit kürzer geblieben. Seit der Zeit muß ein besonders konstruierter Schuh die Ungleichheit beheben. Aber man hört den dumpfen Ton beim Auftreten, hört auch den Gebrauch des Stocks mit der Gummizwinge.
„Er ist Kunstgelehrter“, sagt Helma. „Man kann sich sehr gut mit ihm unterhalten, doch ein Gesellschaftsmensch ist er gar nicht. Nun scheint er auch finanziell nicht gut zu stehen. Er ist sehr, sehr sparsam. Frau von Scheidegg beobachtet ja so mancherlei. Sie sagt: er übergehe einzelne Mahlzeiten, bloß, um eine kleinere Wochenrechnung zu haben. Anschluß hat er hier an niemand gefunden, vielleicht auch nicht gesucht; denn er ist sehr verschlossen. Ich finde ihn aber äußerst interessant. Wirklich! Nur manchmal geniere ich mich vor ihm; denn er ist ein grundgelehrtes Haus, und wenn man mal so richtig ins Gespräch mit ihm kommt ... Siehst du: Ich war doch schon zweimal in Neapel — er noch nie; aber was er einem über das Museum dort zu sagen weiß, über die Ausgrabungen, über die Geschichte, tausend Einzelheiten, das ist wirklich überraschend. Und im Kaiser-Friedrich-Museum kennt er jedes Bild, weiß dir so wundervoll vom Künstler, von seiner Schule, seiner Zeit zu erzählen, auch allerliebste Döntjes aus der Kulturgeschichte ...“
Indes: Dina kann nun einmal, seitdem sie in New York gewesen ist, Menschen, die Intelligenzbrillen tragen, nicht leiden. „Dort, auf der Eastside, trägt sie jeder dritte Clerk in den Trödelläden, denn sie wollen alle so aussehen wie Harold Lloyd.“
„Findest du etwa, daß Doktor Neumann so aussieht?“
„Ich werd’ mich hüten, was gegen ihn zu sagen! Wo du ihn doch gleich so verhimmelnd angeguckt hast!“
„Dina, du bist ein süßer Quatschkopp! Nicht?“
Dina lacht. „Ach, Willemintje, die schöne Faulenzerzeit ist so schnell vorbei! Morgen früh muß ich tüchtig üben; denn am Nachmittag haben wir Probe. Geld verdienen — Geld verdienen ... Na ja: Du, reichste Erbin von Amsterdam, du ahnst nicht, wie unsereins schuften muß, um sich für seine einsamen alten Tage etwas zusammenzusparen ...“
„Göttliche Dina, lästre nicht! Selbstverständlich macht dir auf deiner nächsten Indienfahrt irgendein juwelenbesetzter Maharadscha einen glänzenden Heiratsantrag.“
„Er wird sich hüten, der Maharadscha! Unser Tenor hat mir erklärt, ich hätte keinen Sex appeal. Und ein Tenor muß das doch beurteilen können.“
„Bist ja ganz verdreht, Dina!“
Dina schließt ihren Schreibtisch auf. „Gestern früh hatten wir auf der Konzertdirektion Schlußabrechnung. Ich hab’ mir meinen Mammon gleich mitgenommen. Du, das ist nun alles, was mir von den beiden letzten Jahren geblieben ist.“ Sie blättert in dem Bündel Banknoten. „In Paris richte ich mir ein Bankkonto ein. Der Frank ist jetzt wohl noch das sicherste. Erika hat an ihren englischen Pfunden ekelhaft verloren. Oder soll ich mein Geld zu euch nach Amsterdam bringen? Ach, du hast ja selbst keine Ahnung!“ Sie schließt die Scheine wieder weg. „Hallo! Meine neuen Konzertroben mußt du dir noch ansehn, Helma! Die mit der großen Schärpe steht mir am besten; aber Erika mag sie nicht.“
„Morgen abend ist ja Erika nicht maßgebend, sondern Onkel Nidders — dem du ganz fabelhaft den Kopf verdrehen sollst!“
„Meine glühendsten Verehrer find alle über siebzig ... Guck! E hübsch Fähnche, nit? Aber die Elli muß mir noch den ganzen Volant aufplätten; es ist wieder alles so verdrückt worden im Koffer.“
„Die wird sich riesig freuen, die Elli! Sag’s ihr, bitte, nur selber! Und beizeiten!“
Das ist der Samstagabend. Dina ist selig, sich heute noch einmal nach Herzenslust ausschlafen zu können. Morgen beginnt der schwere Dienst wieder. Eine Probe mit den immer aufgeregten, anspruchsvollen, immer miteinander im Kampf liegenden vier Solisten ist jetzt oft schon eine Tortur für sie.
Noch ein paarmal huschen die Freundinnen hin und her über den Gang. Immer wieder haben sie einander noch etwas zu sagen, etwas zu fragen. Dann bleibt es endlich beim letzten „Gute Nacht!“ und „Schlaf gut!“
... Es ist der letzte Schlaf, aus dem Dina Antze noch einmal zu einem neuen Tag erwachen sollte ...
*
Auf der Probe im Hotel hatte es Streitigkeiten gegeben. Die vier Künstler konnten sich nicht über die Stücke einigen, die „Dreingabe“ sein sollten. Erika Sontmar bevorzugte dafür ein paar leichtere, fast etwas operettenhaft anmutende Gesangsquartette; die Herren traten für Gediegeneres ein, für altdeutsche Volkslieder, denn sie fürchteten die strenge Berliner Kritik. Was man sich in Melbourne oder San Franzisko am Schluß eines ernsten Programms leisten durfte, das würde hier als stillos empfunden, meinten sie. Die Altistin kam mit ihren Einsprüchen gegen Erika Sontmar ja niemals auf.
Da mischte sich endlich Dina ein, in der es schon längst kochte, und sie nahm kein Blatt vor den Mund. Die Sopranistin warf die Noten auf den Flügel und erklärte, sie werde absagen müssen. Daraufhin wurde der Bassist grob. Nicht nur gegen Erika, sondern auch gegen Dina. Und sogar die milde Altistin, die sich mit ihren großen dunklen Augen verzweifelt umsah, bekam ein Donnerwetter von ihm. Schließlich saß jede der drei Damen weinend in einer Ecke, und die beiden Herren liefen aufgeregt durchs Zimmer.
So blieb die Probe fast eine Stunde unterbrochen. Als sie dann wieder zu üben anfangen wollten, saß kein Ton. Wiederum gab es Zank; denn nun warf eines dem andern vor, den Streit begonnen zu haben. Dabei wurden auch ältere Zwiste von der Reise wieder durchgesprochen. Dina hatte in Wien und Prag wegen eines Neuralgieanfalls ihre Soli auslassen müssen; Erika konnte ihr das so rasch nicht vergeben, denn an diesen beiden Konzertabenden hätte sie selbst Schonung gebraucht. Auch das wurde jetzt wieder aufgewärmt.
„Wenn es Ihnen lieber ist, Fräulein Sontmar“, sagte Dina schließlich, ganz außer sich, „dann können wir uns ja trennen?“
Erika Sontmar blieb Statue, während die Altistin von neuem zu weinen begann und die beiden Sänger sich verzweiflungsvoll in die Haare fuhren und dann wieder zu vermitteln suchten ...
„Ich bin jetzt einfach erledigt!“ sagt Dina, als sie endlich in die Pension zu Helma zurückkehrt. Und nun bricht sie in ein fast hysterisches Schluchzen aus. „Was bildet sich dieses Spatzengehirn denn ein? Hat nichts im Kopf, die Sontmar, statt Herz einen schlappen Gummibeutel, ist zusammengesetzt aus Arroganz und Eitelkeit und Geiz! Bloß das bißchen Instrument in der Kehle hat sie. Und keinen Text versteht sie — man muß ihr den Sinn der Worte immer erst, wie einer Kommunalschülerin, auseinandersetzen und einpauken, damit sie ihren seelenvollen Ausdruck nicht auf einer falschen Note anbringt! Ach, es ist das trostloseste Handwerk, jahraus, jahrein mit dieser schrecklichen Leidenschaftsverwalterin durch die Welt ziehn zu müssen! Hätt’ ich mich doch lieber an die Nähmaschine gesetzt statt an die Drahtkommode!“
Helma sucht zu trösten, zu beschwichtigen. „Jetzt machen wir uns beide feenhaft schön und holen Onkel Nidders ins Theater ab. Da kommst du bald auf bessere Gedanken, Dinakind! Wetten?“
„Nix, nix, nix, nix! Ich bleib’ zu Haus.“
„Dann ärgerst du dich bloß den ganzen Abend.“
„Das will ich ja grad’!“
„Vorhin hat der alte Herr angerufen. Er zieht sich den Frack an, hat er gesagt, weil im Hotel Hausball ist. Ich hab’ ihm gleich verraten, daß du sehr für English Waltz schwärmst ...“
„Was nicht noch? Tanzen — ich — heute? Du ahnst ja nicht, Willemintje, wie fuchtig ich bin! Und mein Puls — da, fühl nur mal!“
„Du wirst ein bissel Brom nehmen ... Hallo, das Telephon!“
Aus dem Hotel spricht Justizrat Nidders.
„Onkel hat drei Karten für die Staatsoper: erster Rang, erste Reihe.“
„Was wird denn gegeben?“ fragt Dina, ein wenig den Kopf hebend.
„Gounods ‚Margarethe‘“, sagt Helma, wie schuldbewußt.
„Um Gottes willen! Nein, Kinder, das könnt ihr mir heute nicht zumuten!“
Helma verhandelt also mit dem alten Herrn. Die arme Dina sei von der Probe ganz schachmatt nach Hause gekommen. Und in solchem Zustand Gounod — und gar „Margarethe“?
Der Hotelportier habe auch noch schönste Plätze für ein Revuetheater.
„Geh ohne mich, Willemintje!“ entscheidet Dina. „Ich will versuchen zu schlafen. Wenn mir um zehn Uhr besser ist, zieh’ ich mich an und fahr’ ins Hotel zu euch.“
„Nein: Dann kommst du ja doch nicht, Dina; das weiß ich jetzt schon. Mag Onkel Nidders lieber allein ins Theater gehn!“
Dina will durchaus nicht dulden, daß ihre Freundin nun auch für sich selbst absagt.
Aber Helma läßt sich das nicht mehr ausreden. „Du nimmst dir für die Revue einen Logenplatz, Onkelchen!“ ruft sie ins Telephon. „Machst deiner Nachbarin auf Tod und Leben die Cour — das kannst du ja so vorzüglich—und bist dann in bester Übung, wenn wir uns alle drei im Hotel treffen! Pünktlich um halb elf sind wir in der Halle. Bis dahin ist Dina bestimmt wieder kregel. — Wie? — Danke vielmals! — Also: zwoundzwanzigeinhalb Uhr! Jawohl!“ Sie wendet sich nach Dina um. „Und er rät auch, ich solle dir Brom geben.“ Sie zieht ihr den Pelz aus. „Willst du dich hier bei mir auf die Couch legen, Dinakind?“
„Nein. Ich bade und verfrachte mich dann ins Bett.“
Helma begleitet die Freundin auf Nr. 30. Dann ruft sie Elli, die in der Tür zur Anrichte steht, zu, rasch das Bad aufzudrehen und etwas Brom für Fräulein Antze zu besorgen.
Der Wuschelkopf sieht sie verdutzt an. „Ein Bad — jetzt? Die Damen wollten doch ausgehn?“
„Fräulein Antze soll zuerst ein paar Stündchen ruhen. Wir fahren dann nach zehn Uhr ins Hotel zum Abendessen.“
Dina klingelt schon wieder sehr ungeduldig: ein Zeichen, daß ihr ärgster Seelenschmerz im Abziehen begriffen ist.
„Ja, ja!“ gibt Elli zurück. „Ich komme ja schon!“
Hernach geht die Suche los, für Dina Brom zu bekommen. Helma klopft bei der Exzellenz an. Nach Überwindung einiger Mißverständnisse holt die alte Dame hilfsbereit ihren homöopathischen Kasten. Nein: Brom besitze sie leider nicht.
Inzwischen kommt Elli vom Hochparterre wieder heraufgesprungen. Auch sie ohne Ergebnis. Frau von Scheidegg sei zu einem Tee, und das Wirtschaftsfräulein wisse nicht Bescheid.
Dina hat sich zuerst gegen jedes Mittel gesträubt; jetzt besteht sie darauf. „Dann laufen Sie zur Apotheke, Kleine! In euerm großen Berlin wird man doch noch ein Schächtelchen Brausepulver oder so was Ähnliches bekommen, zum Schwerebrett!“
„Aber am Sonntagabend? Die Apotheken sind geschlossen.“
„Doch nicht alle!“ wirft Helma ein. „Elli: Drüben an der Uhlandstraße, an der Tür der Apotheke, da muß ein Plakat hängen, auf dem zu lesen ist, welche nächste Apotheke heute Dienst hat.“
„Jetzt nützt mir auch kein Brom mehr!“ sagt Dina trotzköpfig. „Ich werde gewiß kein Auge zutun können.“
„Zieh dich schon immer aus, Dinakind, damit du ins Bad kommst! Inzwischen sorge ich für Brom.“
„Oder hast du vielleicht ein Schlafmittel, Helma?“ fragt die Pianistin.
„Ja: zwei Tabletten Veronal. Aber das ist doch zu schwer? Wo du in drei, vier Stunden doch wieder munter sein sollst?“
„Gib mir eine! Aber löse sie in Wasser auf, Willemintje! Pillen schlucken kann ich nicht. Die Kehle ist mir überhaupt wie zugeschnürt. Und nun macht doch endlich, daß ihr ’rauskommt, alle miteinander. Ich kann mich doch nicht ausziehn bei sperrangelweit offner Tür ...“
Helma lacht. „Wenn du grob wirst, ist das schon ein gutes Zeichen!“
Sie läuft in ihr Zimmer, Elli hinterher, und nimmt eins der schönen Cocktailgläser, die sie einmal im Autoklub der Damen als Preis bei einer Zielfahrt bekommen hat. Elli soll das Glas mit der darin aufgelösten Tablette auf Nr. 30 bringen. Inzwischen hat Dina schon das Damenbad aufgesucht; gleich darauf hört man sie planschen. Elli setzt also das Cocktailglas auf das schmale Wandtischchen zwischen Nr. 30 und dem Bad und huscht in die Anrichte.
Es tut Helma ein bißchen leid um den alten Herrn aus Runnswick, der nun ohne Gesellschaft ins Theater abziehn muß. Aber sie hat in den letzten Tagen während Dinas Besuch alle Korrespondenz liegenlassen, so daß ihr die paar Stunden Ruhe jetzt dafür zupaß kommen. Sie dreht also die Schreibtischlampe an und beginnt.
Als sie drüben die Dusche gehen hört, macht sie eine Pause und lauscht. Jetzt verläßt Dina das Badezimmer; gleich darauf fällt die Tür von Nr. 30 ins Schloß. Helma läuft auf den Korridor. „Na ja, da hat sie doch richtig vergessen —!“
Auch Frau Malchow kommt soeben aus ihrem Salon heraus. „Mein liebes Kind, wissen Sie, was mir zum Einschlafen immer hilft? Sie lachen vielleicht darüber! Einfach ein Apfel.“ Sie bringt vom Nachtisch ihres Abendbrots einen herrlichen Tafelapfel auf einem Tellerchen. „Ich will ihn Fräulein Antze wenigstens anbieten.“
„Zu gütig, Exzellenz!“ So treten sie denn beide auf Nr. 30 ein. Helma hat das Cocktailglas vom Servierbrett aufgenommen. „Noch einen Hornlöffel zum Umrühren, Elli!“ ruft sie dem Stubenmädchen zu, das aus der Anrichte heraustritt, als es die Damen sprechen hört.
Aber bevor der Löffel herbeigeschafft ist, hat Dina das Glas schon geleert. Sie ist nicht mehr so aufgeregt wie vor dem Bad, hat ein verbindliches Wort für die alte Exzellenz und deren Apfel und verabschiedet Helma mit dem Versprechen, kurz vor 22½ Uhr, „berückend schön und festlich angeschirrt“ fürs Hotel, anzutreten.
Aber als Helma später drüben anklopft, antwortet Dina nicht. Sie scheint so fest und traumlos zu schlafen, daß Helma unschlüssiig das Zimmer wieder verläßt. Auf dem Korridor begegnet sie der gerade aus dem Lift heraustretenden Frau Schlentzig, mit der sie in ein kurzes Gespräch kommt.