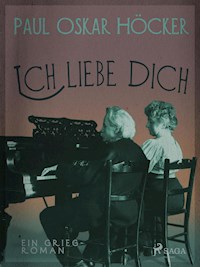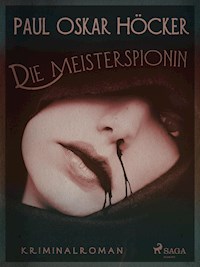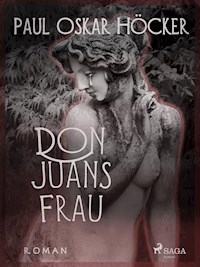Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Menschen, die sich im Grand Hotel St. Moritz treffen. Menschen wie der Arzt Axel Groll, der seine Praxis in Berlin aufgegeben hat, seinen Bruder die verschiedenen Vorkommnisse berichtet und über Bozen, Venedig und Nizza im Skiparadies St. Moritz landet. Menschen, wie die junge Holländerin Wilhelmintje, die auf ihren Onkel Abraham von Jonkbloet trifft. Weitere Frauen, ein Baron Kamerlander, ein Herr Leutnant Genzmer, ein Rechtsanwalt Mayr, Sportgäste, die sorglos dem Bobsport und Skijoering frönen, Wettbewerbe werden veranstaltet. Eine heile Welt, eine nette Gesellschaft, aber nicht alles ist Gold, was im Schnee glänzt und vor die Sonne von St. Moritz schieben sich dunkle Wolken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Oskar Höcker
Die Sonne von St. Moritz
Roman
Reese Verlag
Die Sonne von St. Moritz
1
Der Gong rief schon das zweitemal zum Lunch. Aber von den Hunderten von Gästen des Grand Hotel St. Moritz, für die an diesem Winterabend des Jahres 1910 in dem Riesenspeisesaal gedeckt war, fand sich erst ein verschwindend kleiner Teil ein. Unpünktlichkeit schien hier Gesetz. Man erlebte jeden Vormittag wieder den unbegreiflichen Sommer überm Schnee, man sonnte sich, man lief Schlittschuh oder Schneeschuh. Der Lift, der unermüdlich sämtliche Stockwerke bis zum Hoteleisplatz hinabglitt, brachte noch mit jeder Fahrt ein Dutzend erhitzter Eisläufer herauf. Und schwatzend, lachend, flirtend zogen die Pärchen, die von den Rodelbahnen kamen, durch das von vier Pagen bediente Glasportal des Windfangs.
Drinnen im Speisesaal, zwischen dem Heer der kleinen, blumengeschmückten Tische, standen harrend die Kellner. Unruhig trat der Oberkellner in die Tür. Mit korrekten Verbeugungen, leicht abgetönt zwischen Wohlwollen und Ehrfurcht, empfing er die Ankömmlinge.
»Er zählt die Häupter seiner Lieben —!« sagte im Vorübergehen Baron Kamerlander, ein Wiener, lächelnd zu Fräulein de Steeg, die noch auf der Hallentreppe Ausschau nach dem Portal hielt.
Munter nickte sie. »Die teuren Häupter der Bummelanten. — Ich möchte hier nicht Hausfrau sein.«
»Also bitt’ schön, folgen S’ meinem guten Beispiel: An die Arbeit!«
Er war schon weitergegangen. Andere Gäste begrüßten sie dann. Zuletzt der junge preußische Artillerieleutnant mit den lustigen Haselnußaugen.
»Zu nett, wie Sie hier die Parade abnehmen«, sagte er.
Sie neckte sich immer mit ihm. »Nicht Parade — ich bilde Spalier.«
»Das kann ich ja gar nicht annehmen.« Er blieb stehen. »Nein, im Ernst: Sie erwarten die Gnädigste noch zum Lunch von der Bobsleightour zurück? Jetzt kommt kein Zug aus Preda.«
»Da — eben fährt der Bahnhofsschlitten vor!« Sie tat ein paar Schritte zur Glastür.
»Vom Ostende-Expreß. Aber der hält zwischen Chur und St. Moritz überhaupt nicht.«
»Gehen Sie, gehen Sie, Herr von Genzmer, Sie bekommen sonst einen kalten Lunch.«
»Dann teile ich Ihr Schicksal. — Nun lachen Sie mich wieder bloß aus. Sie wollen durchaus nicht glauben, was für ein rasend netter Mensch ich bin.«
»Gut. Ich will meiner Freundin berichten, daß Sie sich sogar in ihrer Abwesenheit Mühe gegeben haben, nett zu sein. Sind Sie nun zufrieden?«
»Sogar in ihrer Abwesenheit. Hm. So jung, so hübsch — und so impertinent sind Sie.«
Nun lachten sie beide. Er nickte ihr kordial zu und suchte drinnen im Speisesaal sein Tischchen auf.
Die mit dem Ostende-Expreß eingetroffenen Gäste erfüllten den Gang zwischen den Fahrstühlen und den Hotelbüros. Mit ihren städtischen Gehpelzen und weißen Gesichtern stachen sie seltsam gegen die sportmäßig gekleideten, von der Sonne verbrannten Winterkurgäste ab. Der Hoteldirektor, die langflatterten Zimmerlisten in der Hand, war von seinen Sekretären und den Portiers aller Etagen umgeben.
Die junge Holländerin amüsierte sich über die aufgeregte Art einiger Berliner und die kühlgemessene Ruhe des Schweizer Direktors. Sie wollte dem Getümmel eben den Rücken wenden, als sie eine Männerstimme hörte, die ihr sofort bekannt vorkam. Es war die mächtige Baßstimme eines Landsmannes. Jetzt sah sie auch den Besitzer, einen etwas untersetzten, äußerst lebhaften Herrn. Er mochte ein halbes Jahrhundert auf den Schultern haben, trug es aber sehr elastisch. Ob sein Haar weißblond oder silberweiß war, konnte man nicht recht unterscheiden; es war ringsherum mit der Maschine abgeschoren, und der Wirbel zeigte blanken Mondschein. Den Quadratschädel mit dem apoplektischen Hals, das joviale, bartlose Gesicht mit den buschigen Augenbrauen und der etwas vorgeschobenen Austernschluckerlippe vergaß man so leicht nicht. Es war Abraham van Jonckbloet, ein Teeplantagenbesitzer. »Der Indier« war er familiär immer genannt worden, wenn er zu Besuch nach Europa kam.
»Oh, God —!« brummte er nun plötzlich, riß seine farblosen, vergnügten Schweinsäuglein auf und kam ein paar Schritte auf die schlanke junge Dame zu. Sie hatte einen langen Seidenschal, der in zarten gelblichen Tönen abschattiert war, über ihren eleganten, knappen, weißen Sportdreß geworfen. Ihr volles, dunkelblondes, etwas krauses Haar schimmerte in der Sonne. Mit ihren übermütigen Augen, die leicht ins Grünliche spielten, musterte sie den behäbigen Lebemann überlegen. »Das ist doch Willemintje de Steeg, wie?« Er blieb zögernd stehen. »Oder ... Ich hätte mich frikassieren lassen ...«
Nun lachte sie und hob ihr Näschen noch ein bißchen höher. »Unnötig, Onkel Abraham. Und es wäre ja ein Verbrechen an der Mitwelt, wenn ich’s dazu kommen ließe.«
»Kleines Rackerchen. Schau an, schau an. Na, du hast dich ja nett entwickelt. Weißt du noch, wie ich euch in Groningen besuchte? Warte mal — das ist schon sechs Jahre her, wie?«
»Sogar sieben, Onkel Abraham.«
»Unerhört, wie die Zeit vergeht. Ein magerer, kleiner Hering warst du da. Sag’ mal, Willemintje, wie ist das: haben wir uns das letztemal nicht umarmt und abgeküßt?”
»Ja. Ich denke noch mit Entsetzen daran.«
»Ich nicht.«
»Lecker siehst du aus. Mejsje, was bist du hübsch geworden. Wie geht es dir? Was treibst du eigentlich? Wie kommst du hierher?«
»Verlangst du eine komplette Biographie?«
»Natürlich. Und alle Sünden mußt du mir beichten.«
»Das wäre zu zeitraubend. Ich muß zum Lunch — habe einen Bärenhunger — drei Stunden war ich auf dem Eise.«
»Hunger hab’ ich natürlich auch. Nimm mich doch gleich mit, Willemintje, ich brauche noch nicht fünf Minuten zum Ablegen. Bist du allein hier? Sag’. Oder hast du dich angeschlossen?«
Das spöttisch überlegene Lächeln wich nicht aus ihrer Miene. »Für heute bin ich zufällig allein. — Gut, ich lasse also ein Kuvert für dich auflegen, und du kommst an meinen Tisch.« Sie zeigte nach dem Saal. »Drinnen, gleich rechts am zweiten Fenster.«
»Im Nu bin ich zurück. Heda, mein Boy, dritte Etage, Nr. 327 ... Au revoir, Kind, au revoir!«
Die junge Dame sah ihn vom Pagen begleitet in den Fahrstuhl eintreten. Als sie sich dem Speisesaal zu wandte, blitzte etwas wie Triumph aus ihren lustigen, grünlich schimmernden Augen.
»Da ist ein Bekannter, Zimmer Nr. 327, eben angekommen,« sagte sie zum Oberkellner, »bringen Sie ihn am Platz meiner Freundin unter.«
»Sehr wohl. Fräulein Englhofer kommt nicht zum Lunch?«
»Nein, jetzt wohl nicht mehr.«
Im ganzen Saal war nun auch kaum ein Sessel mehr unbesetzt. Auf dem Weg zum Fenster wurde sie da und dort von Bekannten begrüßt. Leutnant von Genzmer, dessen Tisch dicht bei dem ihren stand, neckte sie: Er habe gesehen, was für eine neue Errungenschaft sie soeben da draußen gemacht habe.
Sie schnitt eine schalkhaft geheimnisvolle Grimasse und legte den Finger an den Mund. »Uralter Onkel! Furchtbare Respektsperson meiner Jugendtage. Sie wissen es doch, Genzmer.«
»Ach — wahrhaftig, — der ist es?! Ihr ,Indier’? Und der darf an Ihren Tisch?«
»Er scheint ganz vergessen zu haben, wie wir miteinander stehen. Aber — meinen Spaß will ich haben.«
»Ich werde aufpassen wie ein Schießhund.«
»Nützt Ihnen nichts. Ich lese ihm die Leviten in unserer lieben Muttersprache.«
»Schade.«
Sie setzte sich zurecht und überflog das Menu. Als Mynheer van Jonckbloet erschien, winkte sie ihm zu.
»Das nenne ich Glück. Komme an — und taumle gleich selig in die Arme von so einer allerliebsten jungen Nichte. Aber nun sage, wie lebst du, was treibst du, wo hausest du für gewöhnlich — und wie kommst du hierher? Na, erzähle, erzähle.«
»Wo anfangen?«
»Na, wo es interessant wird.«
»Also — seitdem ich mich amüsiere?«
»Ja, bravo, seitdem du dich amüsierst. Du bist ja ein köstliches kleines Gewächs, Willemintje.«
»Seit zwei Jahren amüsiere ich mich. Die mageren Jahre vorher soll ich also überspringen, Onkel Abraham?«
Es lag etwas in Blick und Ton, das ihn leicht zu beunruhigen begann. »Wenn du dich nicht gern erinnerst, Willemintje —«
»Ich weiß nicht, ob du dich gern daran erinnern läßt, Onkel Abraham. Denn ich war damals in die Welt hinausgezogen, mutterseelenallein, um zu arbeiten, mein Brot zu verdienen, ein Kind von sechzehn .Iahren. Um nicht Frau Snyders zu werden.«
Unbehaglich sah er sich um. »Alte Geschichten. Ja, ich entsinne mich. Ein rechter Trotzkopf bist du doch gewesen damals.«
»Bin ich noch.«
»Hier, Willemintje«, — er ließ vom Kellner, der den Champagner brachte, einschenken und reichte ihr den Kelch — »erst unser Wiedersehen begießen. Damals lebte dein Bruder Jimmy noch. Schade, daß alles so kam. Du warst schließlich also ganz auseinander mit ihm?«
»Gewiß. Mit ihm — mit euch allen. Mit dir doch auch.«
»Barmherziger! Mit mir? Ich war doch so weit draußen —«
»Ich hab’ dir damals in meiner Verzweiflung einen recht dummen Bettelbrief geschrieben. Was mußt du über mich gelacht haben, über den mageren kleinen Hering.«
Er war puterrot. »Gelacht, wieso gelacht? Aber stell’ dir einmal vor; da kommt plötzlich die Post — da hinten in Indien — und bringt dir zwei Briefe aus Groningen — von einem gesetzten, ruhigen Mann und von seiner Schwester, einem halbflüggen Ding. Da gibt man natürlich dem gesetzten, ruhigen Mann recht. Oder etwa nicht?«
Sie schüttelte die trüben Gedanken ab und stieß leicht mit ihm an »Nun, du siehst, ich bin auch so nicht umgekommen.«
Er merkte, daß hinter der überlegenen Siegermiene seiner Nichte noch irgendein Wurfgeschoß seiner harrte. »Ich bin überglücklich, daß dir’s jetzt gut geht. Nach Jimmys Tod schwieg jede Verbindung. Wirklich schade ... Nimmst du nichts von der köstlichen Pastete? Siehst du, die dumme, alte Geschichte hat dir den Appetit verdorben. Mir übrigens auch. — Danke.« Er ließ den Gang vorübergehen, trank aber rasch hintereinander ein paar Glas Champagner. »Aber noch eins, Willemintje. Als ich das letztemal in Europa war — Berlin, Köln und daheim — da wollt’ ich deine Adresse haben. Aber Frau de Katers sagte« — er dämpfte seine Stimme — »du wärst Tanzlehrerin oder so etwas geworden. Irgendwo in Schweden. Das glaubt’ ich natürlich nicht. Mädel wie du — aus dieser Familie.«
»Ja, Onkel Abraham, wenn du mir in meinen bösen Tagen begegnet wärst — jetzt vor drei, vier oder fünf Jahren — dann hättest du dich sicher nicht an meinen Tisch gesetzt. Denn bevor ich Tanzlehrerin wurde, war ich Austragmädchen in einem Putzgeschäft ...«
Er sah sich fast entsetzt um. »Hör’ auf. Das ist ja zum Jammern. Das wußt’ ich doch nicht.«
»Wirklich nicht? Ich schrieb dir’s aber einmal, Onkel Abraham. Als es mir so ganz, ganz, ganz miserabel ging.«
»Ich schwöre dir ...«
Lachend wehrte sie ab und trank ihm zu. »Prosit, Onkel Abraham. Nur nicht gleich schwören ... Na ja. Also das Tanzinstitut hernach ging auch nicht. Da ward ich Eislauflehrerin im Haag. Und im Sommer fuhr ich als Stewardesse auf der Red Star-Linie.«
»Hör’ auf, hör’ auf. Mejsje, du schwindelst ... Wie kämst du sonst jetzt in die Lage ...« Er brach ganz verwirrt ab.
»Auf dem Kanal hab’ ich dann mein Glück gemacht.«
Nun riß er die Augen auf. »Willemintje — du bist am Ende verheiratet?«
»Bewahre. Aber es hat sich jemand liebevoll meiner angenommen. Eigentlich der erste und einzige Mensch seit Mutters Tod. Mein einziger, ehrlicher Freund.«
»So. So. Hm. Und wer — wer ist dieser Jemand?«
»Mein Freund?« Sie sah ihn mit lustig blitzenden Augen an. »Ein ganz entzückendes Bürschlein. Jung, verteufelt hübsch, reich, liebenswürdig, immer bei Laune, beim Sport unter den Allerersten ...«
»Ja, hör’ mal, das ist ja sehr nett, gewiß, gewiß, aber ... Er hat sich deiner angenommen, sagst du. Angenommen. Hm. Aber wie hat er sich deiner angenommen, dein Freund?«
»In Liebe.« Sie konnte kaum mehr an sich halten. »Wir reisten zusammen. In einer eigenen, wunderhübschen Jacht. Einen ganzen Sommer lang. Großes, schönes, seetüchtiges Boot mit Kuttersegelung. Erst kreuzten wir bei Schottland, dann bei Norwegen. Dort kenterten wir, das Boot ward verkauft, wir blieben bis Weihnachten in Christiania und trieben Wintersport. Darauf ging’s zum Frühjahr nach Paris, nach San Sebastian, nach Pau — und seit Mitte Dezember amüsieren wir uns hier in St. Moritz.«
»Großartig.« Er hatte immer rascher getrunken. Die Flasche war leer. Erhitzt fächelte er sich mit der Serviette zu. »Ein Rackerchen bist du, Willemintje, ein Rackerchen. Und hier im Hotel — da nimmt niemand Anstoß?«
»Wieso Anstoß, woran?« fragte sie mit unschuldigem Augenaufschlag. »Wir haben das entzückendste Appartement im ganzen Hotel. Drei Zimmer, Balkon, Loggia, Bad, Kamin. So heimnisch, sag’ ich dir. Du mußt dir’s einmal ansehn.«
»Wenn ich euch — hm — in eurem jungen Glück nicht störe. Dein Freund ist heute auswärts?«
»Auf einer Bobsleightour zwischen Preda und Bergün — Du machst aber so ein seltsam verkniffenes Gesicht, Onkel Abraham. — Freut’s dich denn nicht, daß mir’s so gut geht?«
»Natürlich freut’s mich, überhaupt, wenn du dachtest, ich wäre nicht vorurteilsfrei — vielleicht wegen der Sache mit Jimmy, damals ... Man lebt nur einmal. Ich genieße mein Leben ja auch.«
»Du bist ein großartiger Mensch, Onkel Abraham. — Da kommen Zigarren. Wir nehmen den Kaffee draußen in der Halle. Bring eine Zigarette für mich mit.«
Sie erhob sich; beim Hinausgehen grüßte sie lachend dahin und dorthin.
Mynheer van Jonckbloet folgte mit rotem Kopf. Das war ja ein Teufelsmädchen, die Kleine. Und wundervoll gewachsen war sie. Er ließ sich ihr gegenüber in einen Klubsessel fallen und sah ihr zu, wie sie, graziös im Schaukel Stuhl sich wiegend, ihre Zigarette rauchte. Unter dem kurzen, weißen Sportsrock gewahrte er ihre schlanken und doch vollen Formen.
»Worüber sinnst du, Onkel Abraham?«
»Ich? Es wäre wahrhaftig schade gewesen, sagt’ ich eben zu mir, wenn so eine herrliche Gottesgabe, wie du’s bist, in Groningen hätte verkümmern müssen.«
»Nicht wahr? Tausendmal besser, ich amüsiere mich.«
Er lachte. »Ausgezeichnet. Nein, wenn ich mir so den edlen Jimmy vorstelle, den langweiligen Philister, der dich armes Ding partout dem verdammten Snyders verkuppeln wollte —! überhaupt die ganze liebe Verwandtschaft in Groningen —!«
»Und in Indien.«
»Ei, Willemintje. Ich tat ja bloß so mit. Siehst du, ich stand mit der Gesellschaft in tausend Geschäftsverbindungen ...«
»Mich haben sie immer in Furcht vor dir gehalten. Vor deinen strengen Prinzipien.«
Er lachte. »Hab ich nie gehabt, nie! Du hättest mich sehen sollen, Kleine, wenn ich ’mal losgelassen war. Auf Reisen. Tolles Leben hab’ ich da geführt. Das glaubst du wohl gar nicht?«
»Ach erzähle, Onkel Abraham.«
Er schmunzelte in Erinnerungen, »übrigens — weißt du, nenne mich doch nicht immer ,Onkel Abraham‘ Das klingt so nach Methusalem. Ich fühle mich noch verflixt jung. Jonckbloet — das paßt viel besser zu mir.«
»Aber wo bliebe der Respekt?«
»Ich verlange gar keinen Respekt. Wir sind hier in den Ferien, was? Kein Mensch kennt mich hier. — Wann kommt dein Freund zurück, he?«
Willemintje warf den Zigarettenrest in die Aschenschale und erhob sich. »Im Verlauf des Nachmittags. Komm später aufs Eis, dann mache ich dich bekannt.«
»Du willst schon gehen?«
»Ich muß noch eine Figur üben. .Am Dienstag ist hier großer Match im Kunstlauf. Da konkurriere ich mit.«
Etwas schwerfällig erhob er sich. »Also werde ich auspacken und ein kurzes Schläfchen tun ...«
In diesem Augenblick wandten sich Dutzende von Köpfen der Treppe zu, wo eine Gruppe von Sportsleuten erschien: Vier Herren und eine Dame. Sie trugen alle schräg über dem weißen Sweater ein blauseidenes Band mit der in Gold gestickten Aufschrift: »Soleil«. Mehrere Gäste erhoben sich sofort wie elektrisiert, gingen auf die Gruppe zu, die junge Dame war im Nu umringt, in verschiedenen Sprachen redete man auf sie ein. Das junge Mädchen schien eine sportliche Berühmtheit. Er war überrascht über die originelle Erscheinung. Sie strich sich soeben den weißen, seidegefütterten Baschlik aus der Stirn, so daß er in den Nacken fiel. Dadurch ward das braune, leicht zerzauste, ins Rostrote spielende Haar sichtbar. Dunkle, fast schwarze Augen blickten aus dem frischen, lustigen Gesicht. Beim Lachen sah man die ziemlich großen, festen Zähne. Ein Bild strahlender Gesundheit. Jetzt ging ein helles Leuchten über ihre Züge. Sie entwand sich den sie umdrängenden Herren, kam eilig die Treppe herab und stürmte auf Willemintje zu.
»Mächtig viel Schnee!« rief sie mit einer warmen, vollen Altstimme. »O Willemintje, das nächste Mal mußt du mit!«
»Gottlob, daß du heil da bist, Lore!«
»Wir sind auf jeder Fahrt ein paarmal umgeschlagen. Aber gelacht haben wir, nein, was haben wir gelacht —!« Die Bobsleighfahrerin brach ab und blickte leicht fragend den fremden Herrn an, der an Willemintjes Seite getreten war.
»Mein Onkel Abraham von Jonckbloet,« stellte die Holländerin vor, aus deren grünlich schimmernden Augen jetzt tausend lustige kleine Teufel guckten. »Und das ist Lore Englhofer, lieber Onkel Abraham. — Mein einziger Freund, du weißt.«
Jonckbloet machte ein ungeheuer verdutztes Gesicht. »Wieso? Ich dachte doch ...« Er ward noch um eine Nuance röter. »Du hast mich also — zum Besten gehabt?«
»Eine kleine Revanche, Onkel Abraham. Wenigstens weiß ich jetzt, wie ich’s hätte anfangen müssen, um mir in eurem Sinne durchs Leben zu helfen.«
Er fand kaum Worte. Seine Blamage war riesengroß. »Du bist ja — ein ganz — ein ganz ungeheuerlicher Kobold!«
Willemintje hatte ihren Arm um den Nacken ihrer Freundin gelegt Ruckweise von Lachen unterbrochen, flüsternd, erklärte sie ihr in ein paar Sätzen das groteske Mißverständnis.
Nun lachte auch Fräulein Englhofer. So herzlich, so hell, so erschüttert, daß Jonckbloet überhaupt nicht mehr zu Worte kam.
Die Mannschaft des »Soleil« war Fräulein Englhofer gefolgt. Andere Gäste schlossen sich der Gruppe an. Im Nu war sie wieder umringt. Man wollte wissen, worüber sie lachte.
»Wenn Sie’s ausplaudern, reise ich noch in dieser Stunde ab!« warf Jonckbloet hastig ein.
»Nein, du sollst bleiben, Onkel Abraham,« sagte Willemintje und klopfte ihm kordial auf die Schulter. »Ich hoffe, jetzt werden wir uns famos verstehen.«
Es wurde über die Bobsleighfahrt gesprochen, in fünf, sechs Gruppen wollte man Einzelheiten über die Kurven und Schneewälle erfahren, denn Schneemangel und Tauwetter hatten die Benutzung der Strecke für Sportzwecke seit Weihnachten nicht mehr ermöglicht. Auch der Baron Kamerlander und der Leutnant Genzmer, die von Lore Englhofers Triumphwagen unzertrennlich waren, hatten sich eingefunden Das lustig-bewegte Treiben bildete den Mittelpunkt der ganzen Halle.
Jonckbloet konnte sich umbemerkt zu der breiten Treppe zurückziehen, die von der Halle zum Erdgeschoß emporführte. Auf der obersten Stufen wandte er sich noch einmal um, fast etwas scheu, und fing einen übermütigen Gruß seiner Nichte auf.
Er erwiderte ihn — aber es kochte dabei in ihm.
2
Als Jonckbloet nach kurzem, schwerem Nachmittagsschlaf ans Fenster trat, ging schon die Sonne unter. Es war knapp vier Uhr vorbei. Unten auf den künstlichen Eisplätzen hinter dem Hotel herrschte noch eifrige Tätigkeit. Er erkannte auch seine Nichte und deren Freundin unter den Läufern.
Wer mochte sie nur sein, diese Freundin? Wie war Willemintje, das Groninger Aschenputtel, ihre Gesellschafterin geworden? Wenn die Angaben stimmten, mußte das Fräulein enorm reich sein. Eine Jacht bloß für eine Sommerfahrt zu kaufen — das konnte sich der erstbeste arme Gulden-Millionär nicht leisten. Nun — gleichgültig. Er wollte allen unnötigen Begegnungen ausweichen. Zum heutigen Diner gedachte er verspätet zu erscheinen, so daß er dann im Restaurant speisen mußte. In der Bar würde er abends schon Anschluß finden und Näheres über dieses rotblonde Sportgirl erfahren.
Als er, vom Portier der Etage und von den beiden Zimmermädchen unterstützt, den Inhalt seiner Riesenkoffer in den Schränken des Vorraums und seines Zimmers untergebracht und leidlich Ordnung geschaffen hatte, war es Zeit, sich in den Frack zu werfen.
Das Bild der Speisesäle bot den denkbar stärksten Gegensatz zu dem vom Mittag. Aus den kurzröckigen Sportgirls hatten sich elegante Ladies entpuppt.
Während Jonckbloet durch den langen Gang dem Restaurant zuschritt, hörte er — unsicher fragend — seinen Namen nennen. Ein Herr im Smoking trat zögernd auf ihn zu. Es war unbedingt ein Norddeutscher; es konnte ein preußischer Leutnant sein — vielleicht war’s auch nur ein eleganter Bankbeamter. Er hatte einen schwarzen, breiten, modisch kurz geschnittenen Schnurrbart, eine scharfe Hakennase und trug ein Monokel.
»Herr von Jungblut — aus Indien — stimmt’s?« fragte der im Smoking jetzt etwas dreister.
»It’s my name. Yes, Sir. Jonckbloet. Aber mein miserables Namensgedächtnis ...«
»Auf dem Kolonialfest in Berlin. Vor zwei Jahren. In den Ausstellungshallen am Zoo. Sie hatten da einen allerliebsten kleinen Käfer ...«
Jonckbloet schmunzelte. »Hm. Es war jedenfalls eines der lustigsten Feste, die ich je mitgemacht habe.«
»Wir hatten uns da im Zelt der Gräfin Schlettwitz zusammengefunden. Die tanzte doch so großartig, wissen Sie noch? Auf einem winzigen Tisch.«
Mehr und mehr taute Jonckbloet auf. »Straf mich der und jener, es war eine himmlische Nacht. Aber nun tun Sie mir die Liebe an und sagen Sie mir Ihren Namen.«
Der Berliner lachte. »Mein Name ist gar kein Name, sondern ein Sammelbegriff. Ich habe das Pech, Mayr zu heißen.«
Jonckbloet stimmte in sein Lachen ein und gab ihm die Hand. »Sie tragen’s mit Humor. — Meine kleine Zerline ist mir übrigens bald darauf abhanden gekommen.«
Ein Page riß vor ihnen die breite Glastür auf, die zum Restaurant führte und meldete dem Berliner: »Herr Baron Kamerlander läßt bitten, auf ihn nicht zu warten. Er mußte noch ins Kulm-Hotel.«
»Danke. — Wir speisen sonst drüben am gleichen Tisch im großen Saal. Wollen Sie bei mir Platz nehmen?«
»Gern, Herr. Baron von Kamerlander — ist das der bekannte Wiener Herrenreiter?«
»Ist er. Riesig patentes Kerlchen übrigens. Wir haben uns rasch angebiedert. Er wird Ihnen auch gefallen.«
Rechtsanwalt Mayr trat im Restaurant um eine Nuance lauter und selbstbewußter auf, als es Jonckbloet liebte. Aber er war doch froh, Gesellschaft gefunden zu haben. Sie bekamen ein gemütliches Tischchen, auf dem eine frisch gefüllte Blumenschale stand — immerhin eine Leistung, 1860 Meter hoch im Monat Januar —, einigten sich auf eine Flasche »Knallkümmel«, wie Mayr sich ausdrückte, und stiegen dann wieder in die Erinnerungen jener Ballnacht zurück.
»übrigens treffen Sie hier noch einen Bekannten aus dem fidelen Kreis von damals,« sagte Mayr, sich mit Kennerblick von der Hors d’oeuvres-Platte bedienend. »Ein gewisser Dr. Groll.«
»Groll? Hm. Das war der Blonde, Ausgelassene im Tropenanzug, den die Schlangendame immer ‚Axel‘ nannte?«
Es blitzte überrascht auf in Mayrs Augen. Dann ging ein Lächeln über seine Züge. »Sehen Sie, ich hatte ganz vergessen, daß Sie die hübsche Frau Gertie ,Schlangendame‘ getauft hatten.«
»Sie war eine der wenigen, die in Salontoilette gekommen war. Eine kostbare Flitterrobe, elektrisch blau, wahnsinnig tief ausgeschnitten. Wir begleiteten sie schließlich noch bis zum Wagen, früh um sechs, die Schlangendame und ihren Freund ...«
Mayr war geradezu aufgeregt. »Da waren Sie noch dabei?«
»Der dicke, putzige, kleine Herr im Matrosenanzug führte ja noch ein ganzes Theater auf. Rief: ,Hoch lebe das junge Paar!1 Und ein Schutzmann kam.«
»Gott, was ist hernach noch darüber geredet worden. Sie lebte doch nicht gerade in glücklicher Ehe, die schöne Frau Gertie —«
»Die Schlangendame?«
»Ja. Frau Gertie Selle. Pikante Person. Totschick. Berlin W.W. überhaupt ... Na ja, und ihr Mann war damals auf Reisen.«
»Oh, sie hatte sogar einen Mann?«
»Dr. Selle. Riesiger Arbeiter, erstklassiger Geschäftsmann. Besaß ’ne große chemische Fabrik. Das Hauptgeld hatte er mit ’nem Ernährungsmittel oder so einem Zeug gemacht. Er hinterließ ein rundes Milliönchen.«
»Hinterließ?«
»Ja, vor ein paar Monaten ist er plötzlich gestorben. Ganz urplötzlich.«
»Woran?«
»Weiß nicht.« Mayr trank, während er sprach, in kleinen Zügen aus seinem Sektglas, behielt dabei aber die Miene seines Gegenübers unausgesetzt im Auge. »Groll ging als Hausfreund und als Arzt bei Selles aus und ein. Er hat Frau Gerties Mann auch in den letzten Tagen behandelt. — Ja. — Ich hab’ ihn seitdem gar nicht mehr gesprochen, den Doktor.«
Jonckbloet war zerstreut. Mehr als diese Berliner, von denen der Rechtsanwalt ihm da erzählte, interessierte ihn die Freundin seiner Nichte Willemintje. Dieser Herr Mayr schien ihm das lebende Adreßbuch; über alle Weit wußte er ja Bescheid. Vorsichtig tastend tat Jonckbloet ein paar Fragen, ohne seine Beziehungen verraten zu wollen.
Aber der Berliner verfügte über eine scharfe Kombinationsgabe.
»Fräulein de Steeg ist die Freundin von Fräulein Englhofer. Sie ist Holländerin — Sie sind Holländer. Da werde ich mich hüten, mir die Zunge zu verbrennen.«
»Vorzüglich. Also spielen wir mit offenen Karten. Willemintje de Steeg ist meine Nichte. Zufällig hab’ ich sie vorhin getroffen. Sie hat’s faustdick hinter den Ohren. Hab’ ich recht?«
»Haben Sie. Aber ihre Freundin, Fräulein Lore, — das dürfen Sie ruhig mal anbringen — ist nach meiner unmaßgeblichen Meinung das kompletteste Bijou, das in Mitteleuropa überhaupt zu finden ist. Ich bin natürlich verliebt in das reizende Geschöpf. Es ist hoffnungslos, denn es gibt ja in diesem ganzen Hotel mit seinen vierhundert der Neuzeit entsprechend eingerichteten Zimmern keinen einzigen Junggesellen, der die Schwärmerei nicht mitmachte. Aber kann man für sein Herz? Es ist eine Affenschande. Prosit.«
Nun fühlte sich Jonckbloet wieder als der überlegene. »Also sind Sie doch nicht die richtige Auskunftsstelle Sie färben mir zu rosig. Ich möchte eher wissen, wie man den verflixten Mädels eins auf die Nase geben kann.«
»Herr —?!«
»Ich bin sonst ein gutmütiger Waisenknabe. Wahrhaftig. Aber heute ist der Berserker in mir erwacht.« Er schüttete den Rest seines Kelches hastig hinunter. »Die kleine de Steeg nämlich — die ist als Mejsje von sechzehn Jahren von zu Hause durchgegangen. Ja. Aus Groningen. Es war ein Skandal. Als Tanzlehrerin oder so ’was Gutes dann durch die Welt gezogen. Ja. Denken Sie. Schließlich war sie sogar Stewardesse. Und nimmt sich nun hier einen Ton heraus, mir gegenüber, na —! So ein Mädel zählt doch einfach nicht mit, wie?«
»Zählt sehr mit, Herr van Jonckbloet. Fräulein de Steeg ist bei ihrer Freundin alles. Hofdame, Vizemama, Anstandswauwau. Baron Kamerlander sagt: der Cerberus ihres Herzens. Wer Willemintje schief ansehn wollte — der hätt’s mit Fräulein Lore verschüttet.«
Der Holländer lachte kurz auf. »Und ihr junges Volk tanzt also alle nach ihrer Pfeife?«
Mayr seufzte leicht elegisch. »Wenigstens so lange, bis Fräulein Englhofer ihre Wahl aus dem reich assortierten Lager getroffen hat. — Kommen Sie jetzt, Herr van Jonckbloet. Drüben im Tanzsaal ist gewiß längst schon die Konkurrenz an der Arbeit.« Der Berliner hatte sich erhoben, klappte ein wenig zusammen und sagte: »Mahlzeit!«
3
Aus dem großen Saal waren schon sämtliche Tische entfernt, die Stühle an den Wänden aufgereiht, auf der Empore spielte das Hotelorchester einen »two-step«, eine Mauer von befrackten Herren schnitt den Verkehr zwischen der Halle und dem Tanzsaal ab. Die beiden mischten sich darunter und sahen dem Treiben zu. Es wurde flott getanzt, die Hitze und die Enge waren schon unerträglich.
»Jetzt — ’s hat mir so leid getan, daß ich nit hab’ Wort halten können,« sagte ein überschlanker Herr, der sich eilig durch die Menge durchwand, im Vorübergehen zu dem Berliner, »der Erzherzog-Thronfolger wollt’ herüberkommen ...«
Schon war er weiter.
»Das war Baron Kamerlander«, flüsterte Mayr, »er ist häufig droben im Kulmhotel, spielt eine Rolle am Hofe in Wien.« Er begann dann mit anderen Herren in der Nachbarschaft eine Unterhaltung, zum Teil in grausamem Englisch. »Wenden Sie sich mal halbrechts«, sagte er nach einer Weile geheimnisvoll ergriffen zu Jonckbloet, »die Herrschaften hier in der Ecke rechts — die sind’s.«
»Wer?«
»Der österreichische Thronfolger und die Erzherzogin — die hübsche Blondine, die eben mit Kamerlander spricht. Großartig, wie die sich hier so nett und gemütlich unter uns bewegen. Nicht?«
Jonckbloet fand im Gegenteil, daß die Halbkreise von steif und feierlich dastehenden Neugierigen, die die Ecke einfaßten, jede Bewegung der fürstlichen Gäste unmöglich machten.
Baron Kamerlander hatte, von der Erzherzogin entlassen, eine Tour mit Fräulein Englhofer getanzt. Sie paßten vorzüglich zueinander und führten den neuen amerikanischen Tanz mit bedeutend mehr Grazie aus als all die anderen Paare. Kein Zweifel — sie fielen allgemein auf. Knapp vor dem Schlußtakt brach Kamerlander ab — es war dicht bei der Saalecke, aus der die Fürstlichkeiten dem Tanz zusahen —, und lächelnd nickte die Erzherzogin dem jungen Herrenreiter zu, der seine Tänzerin daraufhin näherführte und vorstellte.
»Fräulein Englhofer wird vorgestellt, sehen Sie nur!« flüsterte Mayr aufgeregt dem Holländer zu. Gleich darauf schoß er über das Parkett — auf die Stelle zu, wo Fräulein de Steeg stand und wohin wenige Minuten später Fräulein Englhofer von dem österreichischem Baron zurückgeführt wurde.
Die junge Deutsche bildete unbedingt die interessanteste Erscheinung von sämtlichen Tänzerinnen. Aber bei den Zuschauerinnen auf der Empore ward scharfe Kritik geübt. Man fand ihre Toilette, die einen Überwurf von echten Spitzen hatte, nicht mädchenhaft genug. Eine Pariserin behauptete, die junge Deutsche hätte enorm viel Sommersprossen. Andere fanden ihre Hände zu groß — vom Tennisspiel und von anderem Sport. Wieder andere hielten das eigentümliche Rostrot ihrer Haare für unecht.
Ein neuer Tanz setzte ein, diesmal ein Walzer. Lore Englhofer sah sich zu gleicher Zeit von mehreren Bewerbern umringt — Herr Mayr war auch darunter —, sie faltete aber lächelnd die Hände und bat für dies eine Mal um Dispens.
»Lassen Sie uns jetzt noch ein bißchen schwatzen, bitte, bitte!« sagte sie herzlich, legte ihre Hand wieder in Willemintjes Arm und blieb mit ihr eifrig redend zwischen den Säulen der Empore stehen.
Die Herren begannen eine Unterhaltung miteinander, ziemlich gezwungen und abwartend. Keiner traute hier dem andern. Sie beobachteten das schmucke Paar fortgesetzt. Irgendeine Meinungsverschiedenheit schien zwischen den Freundinnen zu bestehen. Man sah Willemintje abwehrend lachen. Es war, als ob Lore Englhofer immer wieder mit einer Bitte in sie drängte, wie ein ungestümes Kind. Ganz allmählich schien sich ihre Freundin dann erweichen zu lassen. Ein paarmal wanderten ihre Blicke über die Gruppe des »Gefolges« — und Rechtsanwalt Mayr merkte plötzlich, daß zwischen ihnen sein Name genannt wurde. Unwillkürlich zog er seine Weste straff und klemmte darauf das Monokel wieder ein, das er häufig verlor.
Den nächsten Tanz von Fräulein Lore erhaschte Genzmer, der hübsche, junge Artillerist mit den lustigen Haselnußaugen. Ein Neuling der Gruppe versuchte Willemintje zu engagieren, bekam aber einen Korb; die Holländerin ging bei offiziellen Gelegenheiten nie aus der Rolle einer Gardedame heraus.
Plötzlich stand sie neben dem Berliner.
»Sie kennen doch das ganze Hotel, Herr Mayr«, sagte sie lächelnd, »bitte, geben Sie mir einmal Auskunft.«
Der Rechtsanwalt war geschmeichelt: Willemintje hatte ihren Arm leicht in den seinen geschoben und machte mit ihm einen Rundgang.
»Aber Sie müssen nicht wieder Unsinn anstellen, Herr Mayr. Man weiß ja nie, was ist Scherz bei Ihnen, was Ernst.«
»Ernst ist meine Huldigung für Sie, Fräulein de Steeg.«
»Neulich haben Sie mir eine Liebeserklärung für meine Freundin gemacht.«
»Sie verehre ich — für Fräulein Englhofer bin ich in Liebe entbrannt.«
»Hu. Ja, Sie lodern.« Sie hatte seinen Arm losgelassen und wandte sich halb dem Saaleingang zu. »Bitte, sehn Sie einmal nach rechts. Dort ist ein Herr, hellblond, das Haar glatt mit der Maschine geschoren, — etwas links von dem Portugiesen mit dem schwarzen Bart, der gestern auf dem Eise gestürzt ist ... Kennen Sie den Herrn?«
»Aber gewiß. Das ist ein Herr aus Holland. Er heißt Abraham van Jonckbloet und ist Ihr Onkel.«
Sofort schmollte sie. »Ach, den meine ich doch nicht. Woher wissen Sie überhaupt —?«
»Juristischer Scharfblick.«
»Also: der zweite Herr rechts neben Jonckbloet. Mein Gott, so ein charakteristisches Gesicht: die große Nase, der trotzige Mund, die stahlblauen Augen — und dazu die dunklen Augenbrauen.«
»Sie haben ihn ja schon ausreichend studiert.«
»Wir sehen ihn Tag für Tag bei sämtlichen Mahlzeiten. Sein Platz ist unserem Tische schräg gegenüber. Also: wissen Sie, wer es ist?«
»Gewiß. Ein Herr Axel Groll aus Berlin, seines Zeichens Arzt. Sein alter Herr war der Geheimrat Groll, der das große Sanatorium in der Fasanenstraße gegründet hat. Bombensicheres Geschäft, da heutzutage jeder dritte Mensch sanatoriumsreif ist. Leider ist er schon in festen Händen.«
»Sind Sie mit dem Herrn persönlich bekannt?«
»Ja. Wir haben gemeinsam ein paar Dummheiten gemacht.«
»Der Mann sieht mir nicht so aus, als ob er Dummheiten machte.«
Mayr lachte. »Er verstellt sich. Sie sind ein jung, unschuldig Blut, Fräulein Willemintje.«
»Ich hab’ Ihnen schon gestern gesagt, daß ich meinen Vornamen von Ihnen nicht gern hören möchte.«
»Willemintje klingt so drollig majestätisch. Aber ich gehorche natürlich. Nun, und warum halten Sie den Doktor für besser als mich?«
»Weil Sie ihn offenbar nicht leiden können.«
»Das ist nadelspitz — aber sehr geistreich ausgedrückt.«
Sie waren wieder am alten Platz angelangt, und Willemintje entließ ihn mit einem fast ungnädigen Nicken.
4
Der Aufbruch des hohen Inkognito-Besuchs gab dem Tanzsaal sofort ein verändertes Ansehen. Der Tanzeifer ließ auffallend nach, auch die Mehrzahl der Zuschauer verlief sich.
Lore Englhofer hatte die Einladung eines amerikanischen Ehepaares angenommen, mit ihrer Freundin an dessen Tafel Platz zu nehmen, die im Vorraum der Halle, am Durchgang zum großen Saal, aufgestellt war. Mr. Biddle war ein großer Sportsmann. Seinen Sohn wollte Lore Englhofer mit der Zusammenstellung der Mannschaft für ihren Bobsleigh betrauen, der bei den großen Clubrennen mitstarten sollte. Zu rechter Aussprache darüber kam es aber nicht, immer wieder wurde sie in den Tanzsaal geholt.
Da entwand sie sich einmal am Schlüsse eines Walzers geschickt ihrem Tänzer, dem jungen Artilleristen, tauschte noch flink durch die Tür einen Blick mit Willemintje, die draußen die schwerhörige Mrs. Biddle zu unterhalten suchte, und schritt beherzt auf einen Herrn zu, der neben dem Saaleingang stand. Es war Dr. Axel Groll.
In sich versunken sah der junge Arzt über das dichte Gewühl hin. Er schien so mit seinen Gedanken beschäftigt, daß er die Fremde gar nicht gewahrte, — oder doch nicht annahm, daß ihre Annäherung ihm galt.
Erschrocken blickte er auf, als sie ihn ansprach.
»Wenigstens begrüßen muß ich Sie. Sie fragen, ob Sie sich meiner entsinnen?«
Er hatte ein junges Gesicht mit energischen Zügen, jedenfalls wirkte es jetzt jung, fast knabenhaft, als er so in einem Anflug von Trotz sie musterte Sie sagte ihm ihren Namen und erinnerte ihn daran, daß ihr Vater mehrere Monate im Sanatorium des Geheimrats zugebracht hatte.
»Sie waren damals noch Student — oder junger Assistent. Aber der Geheimrat brachte Sie öfters zur Visite mit.«
Er entsann sich sofort des Falles, als er den Namen hörte. Englhofer — das war der berühmte Ingenieur, der die gigantischen Brücken in England, Schottland und Amerika gebaut hatte. Aus seinem Ausdruck wich das Mißtrauen. Er bat sie um Entschuldigung, daß ihm die Begegnung nicht sogleich eingefallen war.
»Es liegen ja fünf Jahre dazwischen«, sagte sie. »Es war in der Zeit, wo sie den Neubau hatten.«
»Ja. Genau fünf Jahre. Im Frühjahr wurde dann das große Sanatorium eröffnet.«
»Sie waren damit beide stark in Anspruch genommen damals. Aber Ihr Herr Vater opferte uns trotzdem viel Zeit. Er hatte ein so warmes, herzliches Interesse für meinen armen Kranken, daß ich es ihm nie vergessen werde. Leider war ja nichts mehr zu retten; Vater hatte sich aufgebraucht in seiner schweren, rastlosen Arbeit, — Aber so sehr verändert haben Sie sich. Meine Freundin mußte darum vorhin erst einen Herrn nach Ihnen fragen. Ich war meiner Sache gar nicht sicher.«
Er war bisher nur mit dem jungen Mr. Biddle zusammengetroffen, beim Skilauf; den kannte er von dem Freiburger Wintersemester her. Lore Englhofer nannte ihm ihren Gewährsmann. Es war ihr dabei so, als ob ihn die Erinnerung an den Berliner Rechtsanwalt verstimmte.
Da ein neuer Tanz begann, hatten sie den Platz räumen müssen. Unwillkürlich war Lore ein paar Schritt weit auf den Tisch von Mrs. Biddle zugegangen. Die Blicke der ganzen Gruppe verfolgten sie auf Schritt und Tritt. Und zweifellos hatte Herr Mayr seinen Namen nennen hören — denn er lehnte sich weit in seinen Klubsessel zurück, um von ihrer Unterhaltung etwas aufzufangen.
»Was für eine schwere Zeit muß das damals für Sie gewesen sein, gnädiges Fräulein.« Und er fügte hinzu, da sie nur stumm nickte; »Ich habe es damals wohl noch nicht so ermessen können. Da hatt’ ich Vater noch —«
Sie hatte die Stirn gesenkt. »Ja, sehen Sie, so wie Sie damals an ihm hingen — so war es zwischen uns. Mein Stolz auf Vaters Namen, auf seine Triumphe. Und die hundert großen Aufgaben, die seiner noch harrten. Er hatte mich ja überall mit hingenommen. Mutter hatte er früh verloren. Da war ich verwachsen mit allem. Und wußte nun seit der ersten Untersuchung: hart da draußen vor der Tür steht der Tod — jeden Augenblick kann er die Klinke niederdrücken. Ich wehrte mich, ich rang innerlich in kindischem Trotz, erwartete noch immer ein Wunder, ich wollte Vater nicht hergeben, das Schicksal hatte noch kein Recht an ihn . . Sie hob das Antlitz und sah ihm ins Auge. »Nun können Sie sich denken, wie eigen das auf mich wirken mußte, Sie so voll Lebenslust und Tatendrang zu sehen. So Schulter an Schulter mit Ihrem Vater, immer so strahlend, sprühend, voller Hoffnung, Begeisterung, den Himmel voller Geigen. Ich empfand fast etwas wie Zorn gegen Sie. Das war ungerecht, gewiß. Aber in meiner damaligen Verzweiflung und Trostlosigkeit erklärlich. Ich erstickte fast im Kummer darüber, daß unsere Pläne, unsere Entwürfe dem Tod geweiht waren.«
»Hoffentlich hat die Zeit Ihren Schmerz gelindert, gnädiges Fräulein, — und damit erscheint Ihnen auch meine Schuld geringer; daß ich die Welt vor mir in Sonne sah, während Sie im Schatten saßen.«
»Heute denke ich gerechter.«
Ein kurzes Schweigen trat ein. Er wollte sich nun mit leichtem Gruß zurückziehen. Aber sie hielt ihn mit einer unwillkürlichen Bewegung ihres Kopfes zurück.
»In allen Krankenzimmern wurde viel über Sie gesprochen. Besonders die Oberin sang Ihr Loblied. Mit 22 Jahren Assistent und mit welchem Feuereifer Sie bei Ihrem Beruf wären.«
»Die erste jubelnde Begeisterung. Die verflüchtigt sich dann ja allmählich. Mit den Jahren und mit der Erfahrung. Ich sah gar zu bald die Grenzen unserer Kunst.«
»Sie haben das Sanatorium seitdem ganz allein geleitet?« fragte sie nach einer Pause.
»Nein. Als Chefarzt hab’ ich einen alten Studienfreund meines Vaters eingesetzt. Für die Leitung fühlte ich mich bisher nicht erfahren genug. Und jetzt — wollte ich mich erst im Leben umsehn.«