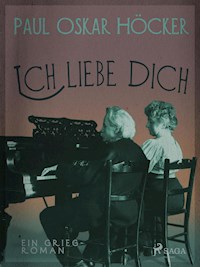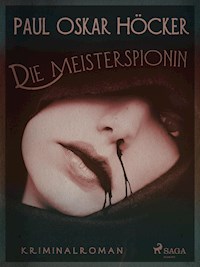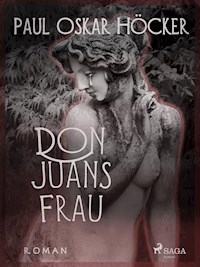Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bernt Olshagen ist ein erfolgreicher Berliner Geschäftsmann Mitte der 20iger Jahre, aber er steht nach dem Tod seiner Frau auch mit seinen beiden Kindern alleine da. Dazu hat er es noch mit den Frauen, zunächst Paula aus Stettin und insbesondere Marion. Wie würde er sein Leben und das der Kinder organisieren können, gebe es in seinem Haushalt nicht die "kleine Mie", die sich zum guten Geist des Hauses entwickelt. Die Situation verschärft sich, als Bernt durch Fritz von Dette, Marions Bruder, in große finanzielle Schwierigkeiten gerät. Jetzt erst begreift Bernt, was er an Mie hat. Zum Autor: Paul Oskar Höcker, geboren 1865 in Meiningen, gestorben 1944 in Rastatt, war ein deutscher Redakteur und Schriftsteller. Höcker verfasste Lustspiele, Kriminalromane, Unterhaltungsromane, historische Romane und auch etliche Jugenderzählungen. Er galt in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als überaus erfolgreicher Vielschreiber. Einige seiner Romane wurden verfilmt. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Oskar Höcker
Im Hintergrund der schöne Fritz
Roman
Saga
1
Wie, wann und wo er Marion kennengelernt hat, wie, wann und wo die kleine Mie (denn es sind zwei grundverschiedene Frauenzimmerchen, diese beiden Mariannen, die Bernts Schicksal bedeuten), das lässt sich wohl am besten darstellen, wenn man sich entschliesst, zuvor die Geschichte mit Paula zu erzählen. Bernt gegenüber kommt das einem kleinen Verrat gleich, weil er sich ja so’lächerlich viel Umstände gemacht hat, diese unschuldige Liebschaft zu verheimlichen. Lassen wir aber jede Rücksicht beiseite. Gerade diese fast knabenhafte Scheu ist nämlich für Bernt besonders bezeichnend, entspringt sie doch jenem peinlichen Sauberkeitsgefühl, das ihn von Kindheit an beherrscht hat.
Bernt war knapp 22 Jahre, als er Sibylle heiratete, die damals 19 zählte. In Sportkreisen hiess sie „der grosse Preis von Schlesien“. Die Kriegstrauung fand im letzten Frühjahr des Völkerschlachtens statt. Bei der Geburt des zweiten Kindes starb Sibylle. Das ist jetzt vier Jahre her. Und seit dem Tod seiner jungen Frau ist Bernt seines Lebens nicht wieder froh geworden. Die Arbeit wuchs, mit ihr die Verantwortung. Das Riesengeschäft seines Schwiegervaters, die Waggonfabrik in Heinersbach, hat sich in ungeahnter Weise entwickelt. Nun sind auch noch die Werke in der Neumark und in Stettin hinzugekommen. Bernt ist der gehetzteste Mitteleuropäer — sein Tag eine einzige Flucht. Auch die ganze Auslandsvertretung hat er sich aufpacken müssen, denn der alte Droeseke, ebenso geizig wie misstrauisch und eigenbrötlerisch, gönnt den Verdienst ja keinem Aussenseiter. So geht für Bernt seit Jahren das Hin und Her zwischen Büro und Haus, Lager- und Verladeplätzen und zwanzig, dreissig fremden Städten. Er hat keine Zeit für seine Kinder — er hat keine Zeit für sich selbst.
Und erst recht keine Zeit für Paula.
Aber Paula genügte es schon längst nicht mehr, ihn nur ab und zu einmal über Wochenend bei sich zu sehn, wenn er die Stettiner Werke besuchte. Gewiss, sie hatte sich eine nette kleine Wohnung in der Braungasse nehmen können, er beschenkte sie reichlich, schickte sie im Sommer ins Bad nach Schweden, und ihre Kolleginnen im Warenhaussalon beneideten sie alle um ihren freigebigen Kavalier. Aber hatte sie’s nötig, sich von ihm hier dauernd verstecken zu lassen? In diesem Klatschnest? Sie mit ihrem Schick, mit ihren hübschen Tanzbeinen? In Berlin konnte sie damit Karriere machen. Warum sperrte er sich dagegen, dass sie nach Berlin kam? Wollte er sich etwa wieder verheiraten und fürchtete, dass sie ihm dort im Wege sein würde? Er lachte sie aus: er denke nicht im entferntesten an eine zweite Ehe. Aber sie wusste doch, was für eine glänzende Partie er war — und dass in seinem ganzen Dunstkreis alle Schürzen in Bewegung gesetzt wurden, um ihn einzufangen. Schliesslich: lag es denn so ganz ausser jeder Möglichkeit, dass sie selbst —?
Und so fuhr sie eines Tages kurz entschlossen nach Berlin, um ein paar Wohnungen im Bayrischen Viertel zu besichtigen, deren Adressen ihr die Agentur besorgt hatte.
Bei dieser Gelegenheit kam sie in das kokette Nestchen, das Marion dort in der Münchner Strasse besass.
„v. Dette-Dubois“ stand auf dem kleinen Bronzeschild. Eine Jungfer in kurzem, schwarzem Seidenkleid und operettenmässig grosser weisser Haube öffnete. Marion war im Begriff, zu einem Tanztee zu gehn, steckte schon in ihrem kostbaren Breitschwanz, empfing das Fräulein aus Stettin aber sehr liebenswürdig und zeigte bereitwillig die ganze Wohnung, nannte auch gleich die erschreckend hohe Abstandssumme, die sie verlangen musste.
Paula spielte sich nicht als selbständige Grosskapitalistin auf, sondern erklärte der eleganten Wohnungsinhaberin sofort, dass die erforderlichen Mittel nicht von ihr, sondern von — nun, von einem Verwandten aufgebracht werden würden, nebenbei gesagt, einem Grossindustriellen aus dem schlesischen Fabrikadel. Die Drei-Zimmer-Wohnung mit Bad, Diele, Wintergarten, Fernsprecher und Fahrstuhl war entzückend, ganz das, was sie suchte und brauchte.
„Aber es muss sich rasch entscheiden“, sagte Marion, die Handschuhe überstreifend. „Ich will verreisen. Brauche Nervenruhe. Ich stehe am Schluss meines Scheidungsprozesses. Ein ganzes Jahr hindurch Termine. Das zermürbt. Natürlich liegen schon sehr viel Angebote vor. Auf die Wohnung, meine ich. Das können Sie sich ja denken.“ Sie stand schlank und gross und überlegen, ganz Weltdame, vor der kleineren und molligeren, jüngeren, aber auch unbedeutenderen Provinzialin, die voller Bewunderung war. Marion hatte grosse, hellgraue, lebhafte Augen; nach der Nasenwurzel zu standen sie etwas schräg. Die Nase war schmal und fein geschwungen, der Mund sinnlich, dabei spottlustig. Eine ganz moderne Knabenfigur hatte sie. Die pikant vom Hellen Teint abstechende Mephistokappe verdeckte das Haar. Ein Porträt von ihr, das noch ungerahmt auf der Staffelei stand, zeigte aber den charakteristischen blonden Etonkopf.
„Wenn ich gleich einmal telephonieren dürfte —?“ Paula gedachte Bernt jetzt am besten rasch zu überrumpeln.
„Bitte.“ Frau von Dette klingelte der Jungfer und liess die Bewerberin zum Apparat führen. Er befand sich nebenan im Schlafzimmer am Bett.
Paulas Augen schluckten die ganze Pracht dieses schwelgerischen Raumes gierig ein. Geradezu fürstlich, diese blauseidene Daunensteppdecke, diese Spitzenkissen. Und die Orchideen auf dem Fensterbrett. Die echten Teppiche. Das gehämmerte schwere Silber auf dem Putztisch. Tausend schöne und gediegene Dinge. „Kein Warenhaus-Tinneff!“ Paula besass Fachkenntnisse.
Während der Besuch drinnen am Fernsprecher verhandelte — ziemlich lang, ziemlich aufgeregt, zuletzt fast weinend, wenn auch immer nur in angestrengtem Flüsterton —, sass Marion an ihrem Schreibtisch und machte sich flüchtige Notizen. Eine Fernsprechnummer, ein paar Namen, nicht mehr.
Mit heissen Wangen kam Paula zurück. „Ich kann leider noch nichts Bestimmtes sagen. Ich hoffe aber heute abend ... Darf ich dann morgen früh anrufen, gnädige Frau?“
„Bitte. Lassen Sie nur Ihre Adresse hier, damit ich weiss ... Also Krusius. Paula Krusius, Stettin, Braungasse 24/II. Danke, gnädige Frau.“
„Eigentlich“ — Paula vollendete nicht. Sie verabschiedete sich ziemlich rasch.
Marion ging mit ihrem Notizenzettel zum Avparat und blätterte im Namenverzeichnis. Droeseke & Co. hatte Fräulein Paula zuerst verlangt. Und dann Herrn Olshagen. „Ach, Bernt, Bernt — ich muss dich sprechen ...“ Also Bernt Olshagen. Hier seine Privatwohnung: Herbertallee 37/39, Grunewald.
Nun war Marion im Bilde. Bernt Olshagen, der allmächtige Generaldirektor der Vereinigten Waggonfabriken Droeseke & Co. Und ein paar geschickte Fragen auf dem Teeempfang vervollständigten das Porträt.
Als Fräulein Paula am andern Morgen anrief und, etwas bedrückt, meldete, dass sie leider noch immer keine definitive Zusage geben könne, dehnte und reckte sich Marion noch ein Weilchen wie ein Kätzchen unter der blauseidenen Daunensteppdecke, dann griff sie nach dem Schallbecher und liess sich mit Droeseke & Co. verbinden. Nein, Herr Olshagen sei nicht mehr anwesend. Marion wusste die Sache sehr wichtig und dringlich zu machen und erfuhr: Herr Olshagen wolle verreisen, habe noch zu Hause zu tun, in der Mitropa am Bahnhof Zoo, vielleicht sei er auch auf der Rumänischen Gesandtschaft zu erreichen. In der Privatwohnung bekam sie Anschluss, im Augenblick, als Herr Olshagen das Haus verlassen wollte, um das Reisebüro aufzusuchen.
Ob sie wohl eine Auskunft über Fräulein Krusius aus Stettin bekommen könne? Ja, wegen des Wohnungskaufs. „Hier Frau von Dette-Dubois, Münchner Strasse 23.“
Höflich-kühle Ablehnung, etwas verwundert, aber in durchaus korrekter Form.
Marion bat um Entschuldigung. Es sollte keine Indiskretion sein. Aber sie stünde im Begriff, nach dem Süden überzusiedeln, und müsse rasch abschliessen. „Immerhin handelt sich’s um ein wertvolles Objekt ... Doch eine Vertrauenssache, nicht wahr ...?“
Ihr Ton war warm, offen, fast herzlich. Der Angerufene hörte sofort heraus, dass es sich um keine berufsmässige Wohnungsagentin handelte. Aber es widerspreche nun einmal seinen Gepflogenheiten, sagte er abwehrend, am Telephon irgendwelche geschäftlichen Verbindlichkeiten einzugehen. „Nichts für ungut, meine Gnädigste.“
„Bitte“, schloss Marion diese ihre erste Unterhaltung mit Bernt Olshagen, hängte den Hörer an und klingelte ihrem Mädchen. Sie wollte sich sofort anziehen, um zur Mitropa am Zoologischen Garten zu fahren.
Das ganze Büro dort war mit Wartenden angefüllt. Man sass und stand an Tischen und Pulten und blätterte in den Bäderprospekten und Kursbüchern. Es war Februar. Die Vergnügungsreisenden bestellten zumeist Bett- und Fahrkarten nach den Wintersportplätzen oder nach der Riviera.
Bernt hatte noch keinen bestimmten Plan. Viel vornehmen konnte er in der kurzen Zeit nicht. Zur Konferenz der Europäischen Waggonzentrale muss er spätestens zurück sein. Er braucht bloss ein paar Sonntage, ein bisschen Skisport, Freiheit von der Arbeitshetze, Ferien vom Ich.
„Olshagen, alter Junge, famos!“ rief ihn in seiner lärmenden Art Herr von Losse an, der baumlange Regierungsrat, der alle Welt kannte und dem alle Welt auswich. „Auch auf einen Urlaubstrip? Ich fahre nach St. Moritz. Kommen Sie mit?“
Bernts Reiseplan stand in derselben Sekunde fest, wenigstens insoweit, als er das Engadin ausschloss. „Nein, ich suche mir ein ganz stilles Plätzchen aus. Ich brauche Einsamkeit.“
„Aha, Zweisamkeit“, sagte der Baumlange und kniff das rechte Auge hinter dem Einglas zusammen. Er nahm an der Kasse seinen Schein in Empfang, schob die Zigarette in den Mundwinkel und winkte Bernt kordial zu. „Hals- und Beinbruch! Skiheil!“
Bernt blätterte ungeduldig in den Prospekten. Dann wandte er sich rasch dem Beamten zu, der gerade freigeworden war. „Haben Sie noch Bettkarte Erster für morgen abend nach Basel? Mit Anschluss nach Adelboden. Bitte, sehen Sie einmal nach.“
„Sofort, Herr Olshagen.“
In Reichsbahnkreisen war Bernt allgemein bekannt, hier auf dem Büro zudem ein häufiger Gast. Der Beamte schlug den Plan auf und bezeichnete die noch nicht vergebenen Plätze. Bernt wählte, liess sich die Karten ausfertigen, dankte dem Beamten, zahlte und ging. Das Auto erwartete ihn draussen.
Die schlanke junge Dame in dem kostbaren Breitschwanz hatte sich nun auch endlich schlüssig gemacht ... Adelboden! ... Und konnte sie denn noch für morgen abend einen Schlafwagenplatz bekommen? Natürlich Erster. Gut. Bitte. „Der Zug geht 20.15 vom Anhalter Bahnhof. Wagen 231, Platz 9 und 10.“ Marion nickte zufrieden und verliess das Büro in ihrem weichen Gang, eine feine Duftbahn hinter sich herziehend. Die Blicke aller Herren folgten ihr; die Nasen hoben sich und schnoberten in die Luft.
So kam Bernt zu Marions Reisegesellschaft auf seiner Winterferienfahrt nach Adelboden.
2
Ader es gibt noch unendlich viele Dinge zu erledigen, bevor ein so geplagter Geschäftsmann wie Bernt Olshagen endlich Rast in seinem Schlafwagenabteil findet.
Die Hausdame beschwert sich über die Kinderschwester: sie ist wieder erst um fünf Uhr früh nach Hause gekommen. Es bedarf einer ernsten Verwarnung und der Androhung fristloser Entlassung. Der kleine Klaus hat 37, 9. Der Arzt war da, hat eine Magenverstimmung festgestellt, es sei nichts Ernstliches. Freilich, wenn das Fieber über Nacht steigt, so will Bernt die Reise aufgeben. Sibylle soll morgen ihre kleinen Schulfreundinnen aus dem Privatzirkel zur Schokolade bei sich sehn. Im Gartensaal ist ein Karussell aufgebaut; die Kinder sollen auch tanzen. Hoffentlich werden es bei Klaus nicht Masern, denn dann müsste ja alles abgesagt werden. Sibylle hasst die Hausdame, die eine solche Katastrophe auch nur in Erwägung ziehen kann. Aus dem Geschäft wird angerufen, die Vertreter der rumänischen Ostbahnen sind da, sie haben Vollmacht und müssen heute noch abgefertigt werden. Am besten, man lädt die Herren zum Abendessen ins Hotel Adlon. Das wird natürlich Paula nicht verstehen können, die ihn bestimmt im Exzelsior erwartet ... Und ein paar dringliche Ferngespräche gibt’s mit Heinersbach, mit Stettin und Neu-Dalchow ... Dazwischen die peinliche Auseinandersetzung mit der Schwippschwägerin Adi, die wieder einmal, recht überflüssiger Weise, von Heinersbach herübergeautelt ist, um in seinem Hause „nach dem Rechten zu sehen“. Adi ist die Tochter von Droesekes Bruder, Witwe des Freiherrn v. Tross, des ehemaligen Leibkürassiers und Rennreiters. Reich, geizig, gelbblond, fader Teint, aber kess, von jener gemachten Forschheit, wie sie ehemals in Gardekreisen bei Damen, die von draussen hereinkamen, beliebt war. Enge Stimmritze, berlinernder Stalljargon. Immer aufgeregt und absprechend, ewig voller Entrüstung über Dienstboten und Geschäftsleute. Wenn sie helfen kommt, gibt’s jedesmal Krach im Hause, denn sie steckt ihre spitze Nase in alles, versucht auch ihn zu schulmeistern. Dabei hat sie lang genug die zähe Absicht verfolgt, ihn zu heiraten, obwohl sie drei Jahre älter ist als er. Die Hausdame hat ihm erklärt: sie kündigt, wenn die Frau Baronin in seiner Abwesenheit etwa wieder die Regierung hier im Hause an sich reissen will. Schauderhafte Aufgabe, das in milder Form der nichtsahnenden Adi beizubringen. Sie hat das stärkste Talent, sich überall unbeliebt zu machen. Auch Klaus, das folgsame Bübchen, ist nur unartig, solang Tante Adi im Hause weilt. Sibylle ist zu gerissen, um sich’s mit Tante Adi zu verderben: wenn man Tante Adi schmeichelt, erreicht man ja alles von ihr ... Nun, Bernt kann ihr nicht schmeicheln ...
Und nun das Allertollste, was einem Staatsbürger passieren kann: er hat für den Reisetag um elf Uhr vormittags eine Vorladung vors Amtsgericht erhalten. In einer Vormundschaftsangelegenheit. Die Sekretärin erinnert ihn daran, sonst hätte er den Termin versäumt.
Wenigstens braucht er auf dem trostlosen Korridor des Amtsgerichts nicht zu warten und wird sogleich aufgerufen. Diese Amtsgebäude mit ihrer Kurellabrustpulverfarbe hasst er. Und ebenso diese staubigen Aktenbündel, diese grauen Bürogesichter, diese eingeschlossene Luft in den überheizten Räumen. Warum man ihm das antun müsse, ausgerechnet ihm, der kaum Musse finde, sich mit seinen eigenen Kindern zu beschäftigen? Da gebe es in seiner Villenstrasse Dutzende von behäbigen Rentiers, die ein solches Ehrenamt doch mit viel grösserer Wonne und Sorgfalt ausüben könnten ... „Wie sind Sie bloss auf mich verfallen, Herr Amtsgerichtsrat?“
Der lederfarbene Herr mit der Stahlbrille schlägt das tütenblaue Heft auf. „Es handelt sich um die Hinterbliebenen eines Angestellten aus Ihrem Büro, der vor kurzem verstorben ist. Es hält so schwer, Herr Olshagen, für all die armen Menschenkinder den richtigen Vormund zu finden. Auf der Liste stehen Sie längst. Nun las ich in der Aufnahme, dass Sie dem Manne das Gnadenvierteljahrsgehalt bewilligt haben, nahm also an, Sie waren mit ihm zufrieden, wissen auch etwas Bescheid über die Verhältnisse, unter denen er seine Kinder zurückgelassen hat. Es sind Zwillinge, Mädchen, fünf Jahre alt. Der Verstorbene war sechs Jahr in Ihrem Büro als Modellzeichner tätig. Heimsöth. Peter Heimsöth.“
„Möglich. Aber gesehen hab’ ich ihn nie. Wissentlich nickt. Das Zeichenbüro hier arbeitet unter dem Diplom-Ingenieur Wessel, der wird ihn natürlich genau gekannt haben. Auf Wessels Vorschlag ist gewiss auch das Geld angewiesen worden.“ Er überfliegt die Papiere, die ihm der Amtsgerichtsrat hinschiebt. „Richtig, ich habe die Zuschrift selbst unterzeichnet. Ja, aber bedenken Sie, Herr Amtsgerichtsrat, die Firma beschäftigt im ganzen neunzehntausend Arbeiter, Angestellte und Beamte. Übrigens muss der Mann doch auch von einer Sterbekasse bedacht worden sein, nicht?“
„Das ist alles restlos verbraucht. Die lange Krankheit, Rückstände, Beerdigungskosten. Die Schwester des Toten war in der vorigen Woche bei mir. Die Not scheint dort gross zu sein. Das junge Ding hat wohl etwas übertriebene Hoffnungen, macht sich einen falschen Begriff von den Funktionen eines Vormunds, jedenfalls war sie sehr beglückt davon, dass der hohe Chef persönlich mit dem Ehrenamt betraut worden ist.“
Bernt lächelt. „Zunächst ein grundlegender Irrtum, denn der hohe Chef bin nicht ich. Und zweitens ein Beweis dafür, dass sie den Seniorchef der Firma durchaus unrichtig einschätzt. Droeseke in Heinersbach ist nichts als eine Rechenmaschine und belastet sein Gemüt niemals mit Sentimentalitäten. Können ja sehen, ob sich noch etwas von der Firma herausschlagen lässt. Immerhin, wenn der Mann sechs Jahre auf dem Werk gearbeitet hat und Wessel mit ihm zufrieden war ... Ich lasse mir noch berichten ... Ob ich mir die Kinder mal ansehen will? Aber selbstverständlich. Nur bin ich gerade im Begriff, für zehn Tage auf Reisen zu gehn. Ich habe mir die kurze Frist sauer verdient. Sie haben kaum eine Vorstellung davon, was alles auf mir herumklaviert. Und wer ist der Gegenvormund, Herr Amtsgerichtsrat?“
„Habe ich gar nicht erst ernannt. Das ist nur gesetzliche Vorschrift, wenn sich’s um die Verwaltung grösserer Vermögen handelt. Aber das Heimsöthsche ist leicht zu übersehen: Plus minus null. Nähere Verwandte sind ausser Heimsöths Schwester nicht vorhanden, bloss von seiten seiner Frau ein paar entfernte Tanten in Dänemark. Heimsöth habe sich in seiner Not einmal um Unterstützung an sie gewandt, berichtete mir seine Schwester, aber es sei niemals eine Antwort erfolgt. Ich darf Sie also verpflichten, Herr Olshagen ... Hier sind die Papiere; die Ausfertigung erhalten Sie durch die Gerichtsschreiberei.“
Händedruck. Abgemacht. Um eine Ehrenlast reicher verlässt Bernt das Gebäude mit dem Schutzanstrich gegen Lustempfindungen und gibt seinem Chauffeur die Adresse der Zwillingsfamilie. Es ist irgendwo in der Drehe von Schmargendorf.
Richtige Kleineleutgegend. Grossberliner Provinzialwesten, wo er am geschmackverlassensten ist. Ein Haus mit wüsten Orgien in Stuck. Angeklebte Säulenimitationen, aufgepappte Spitzkugeln über den Fenstersimsen. Im engen Hof werden Teppiche geklopft, ein Leiermann spielt, und es riecht aus allen Wohnungen nach Sauerkohl, denn es ist Donnerstag.
„Wohnt hier Heimsöth?“ fragt er eine teppichklopfende Walküre.
„Nee, der is dot, der Heimsöth. Als wie seine Kinder, det sind die Zwillinge da in die Ecke. Da gehn Sie man Quergebäude drei Treppen rechts bei das Fräulein, wo die Schwester von is.“
„Das ist die Tante Mie!“ ruft eine Fünfjährige aus der Hofecke, wo der krumme Schneemann steht.
Bernt sieht ein kleines Plaidbündel, das im Schnee auf und nieder hüpft. Eine rote Nase guckt oben heraus, ein Paar vergissmeinnichtblauer Augen mit strohblonden Brauen und Wimpern. Der wollene Schal ist kreuzweis um die winzige Gestalt herumgewickelt, auch um die Oberarme, was die Bewegungsfreiheit einigermassen einschränkt. Ein zweites Bündel, etwas dicker, mit noch röterer Nase, die stark läuft, und ebenso vergissmeinnichtblauen, ebenso strohblond bewimperten Augen, hüpft im Hintergrunde mit. Das Paar übernimmt nun die Führung. „Wollt ihr erst eure Pfoten abkratzen!“ ruft die Walküre ihnen nach. Die Zwillinge trampeln ein Weilchen auf dem Schabeisen herum und kichern. „Kroppzeug!“ Draussen im Hof geht das Klopfen weiter.
Unendlich lange drücken die Zwillinge an der Flurtür zwei Treppen rechts mit ihren roten Fäustchen den Klingelknopf nieder, beide gemeinsam. „Ich hab’ zuerst geklingelt“, sagt die eine. „Nein ich“, die andere.
Auf das Sturmzeichen kommen rasche, leichte Schritte näher, die Tür geht auf, und die kleine Mie erscheint. „Mein Gott!“ seufzt sie, als sie den fremden Herrn sieht. „Von der Steuer?“
„Olshagen. Der Amtsgerichtsrat Seyb schickt mich. Ich bin zum Vormund der Kinder ernannt worden, Fräulein Heimsöth.“
„Ach, von Droeseke und Koh! — Kinder, so macht doch Platz und lasst den Herrn eintreten. Bitte sehr, ach, das ist furchtbar freundlich, ich wäre natürlich ebenso gern selbst ... Dagmar, wo hast du dein Taschentuch? Ingrid, so hör doch bloss mit Klingeln auf.“
„Ich hab’ zuerst!“ triumphiert das dickere Plaidbündel. „Zuerst — und zuletzt!“
„Ja doch, ja doch ... Entschuldigen Sie, Herr Olshagen.“
Es kann sich ja nur um eine Blitzvisite handeln. Bernt will einen Blick in die Wohnung werfen. Die Zwillinge müssen ihm ihre roten kleinen Pfoten geben, nachdem sie einer mehr symbolischen Reinigung unterzogen sind. Also das ist Dagmar und das ist Ingrid. Solang sie die Plaidumschnürung tragen, kann man sie unterscheiden — die dickere ist Ingrid, weil sie das dickere Plaid bekommen hat —, aber in ihren groben schwarzen Kleidchen ähneln sie einander erschreckend. Schönheiten sind sie gerade nicht, die Zwillinge. Richtige Semmelköpfe.
Und nun die kleine Mie. Einen grösseren Gegensatz kann man sich kaum denken. Grosse, dunkelblaue Augen, schmales Köpfchen, dunkelbraunes Haar, Bubikopf, halbverschnitten. Der Teint auffallend dunkel. Fein gezeichnete, dunkle Brauen hat sie. Eine klare, schöne Stirn. Die Lippen sind schmal, der Mund ist unsinnlich. Im ganzen aber wirkt ihr Figürchen sehr hübsch. Und sie hat noch das Kinderstrahlen in den Augen.
„Also das ist nun euer Herr Vormund, Dagmar und Ingrid.“
„Na, und wie heisst der neue Onkel?“ fragt Bernt gemütlich onkelhaft, indem er sich tief zu den kleinen Semmelblonden hinunterneigt.
„Du bist Herr Droeseke und Koh!“ sagt Dagmar. Und Ingrid plappert es nach.
Es riecht nicht nach Sauerkohl und Armut hier, mehr nach Seife. Nach billiger Seife, freilich. Die kleine Mie hat ein grosses Scheuerfest abgehalten. Die Wohnung ist blitzsauber. Es hängen auch keine Öldrucke an der Wand, sondern schmalgerahmte Zeichnungen und Aquarelle. Werke des toten Modellzeichners, aus der Zeit, als er noch Künstlerträumen nachhing. Gerade keine grossen Talentoffenbarungen sind’s, sie halten sich etwa auf der Höhe eines gewissenhaften Zeichenlehrers.
Die kleine Mie erstattet Bericht, etwas ängstlich, sie verschluckt sich ein paarmal vor lauter Respekt. Ja, die drolligen Farbengegensätze in der Familie Heimsöth, danach wird sie oft gefragt. Ihr Bruder Peter ist ganz blond gewesen. Auch dessen Frau. Die Heimsöths waren immer in Holstein ansässig. Da gab es eine blonde und eine brünette Linie. Eine der vier Urgrossmütter stammte aus Spanien, aber welche, das weiss die kleine Mie selbst nicht mehr.
„Haben Sie einen Beruf, Fräulein Heimsöth?“
„Noch nicht. Ich wollte studieren, Medizin. Letzten Herbst Hab’ ich das Abiturium gemacht. Aber da starb meine Schwägerin, und gleich darauf legte sich Peter. Da ist unser letztes Geld draufgegangen. Ich möchte jetzt Röntgenschwester werden. Der Sanitätsrat Werner will mir dazu verhelfen. Aber das geht doch nur, wenn ich die Kinder unterbringen kann. Wir hoffen immer noch, dass Herrn Werners Freund, Doktor Hesslein, der das Kindersanatorium in Büsum leitet, Freiplätze für sie bekommt. Das wäre ja fein. Aber sie sind so schrecklich plebejisch gesund, sagt der Doktor und lacht dabei. So ganz zum Lachen ist es aber gar nicht. Halbe Freiplätze, das ginge wohl zu machen, meint er, auch so. Aber das kostet 62 Mark den Monat je Kopf.“
„Je Kopf, so so.“
„Au, ist das teuer!“ sagt Dagmar, um die Pause auszufüllen. Und darauf beginnt Ingrid so zu lachen, dass sie husten muss. Dagmar ist sofort eifrig dabei, ihr den Rücken zu klopfen, Ingrid klopft zurück, und unter unbändiger Heiterkeit entsteht eine kleine Keilerei.
Es ist ein Bild ungetrübten Familienglücks. Aber Bernt ist beeilt, kann nicht länger daran teilnehmen. Er lässt sich noch von Fräulein Heimsöth ein paar Adressen geben, macht sich Aufzeichnungen, verspricht, von sich hören zu lassen, und lässt ein kleines „Patengeschenk“, wie er sich ausdrückt, für die Zwillinge zurück: je fünfzig Mark.
„Mein Gott, das kann ich ja gar nicht annehmen“, sagt die kleine Mie entsetzt, aber strahlenden Auges.
„Es ist auch gar nicht für Sie bestimmt, Fräulein Heimsöth. Schaffen Sie an, was die Kinder am dringendsten brauchen. Für ein halbes Jahr, denke ich, wird die Firma Ihnen wohl noch die Sorge abnehmen; ich stelle einen Antrag an die Zentrale in Heinersbach. Inzwischen sind Sie dann ja wohl selbst so weit ... Na, auf Wiedersehen, kleine Dagmar ...“
„Das ist doch die Ingrid!" ruft Dagmar in komischer Entrüstung. „Onkel Droeseke und Koh, das musst du nu aber lernen!“
„Ich verspreche dir’s feierlich!“
Husch, ist der interessante Besuch wieder weg. Die kleine Mie hat Tränen in den Augen, aber zum erstenmal seit langer, langer Zeit sehen die Zwillinge ihre Tante wieder richtig vergnügt. Nein, was wird heute in der aufgeregten Zwillingsfamilie noch gelacht und gespielt und gesungen. Dieses Fest für die Kinder: sie bekommen Wintermäntelchen, brauchen nicht mehr in die grässlichen Plaids eingewickelt zu werden! Und neue Stiefelchen und Fausthandschuhe gibt’s!
Bernt hat im Verlauf dieses Tages kaum eine Minute, um sich der Begegnung mit Mie zu erinnern. Bloss ein paar Sätze in Sachen Heimsöth diktiert er auf dem Büro für die Zentrale. Und hofft im stillen, dass Direktor Schrötter dort die Geschäfte ohne weiteres in Ordnung bringt und den Betrag von Jahresbeginn an ins Pensionskonto einsetzt, denn wenn er erst umständlich dem Seniorchef darüber Vortrag hält ...
*
Aber all die Abhaltungen haben ihn nun um die fällige Aussprache mit Paula gebracht. Paula hat da und dort angerufen, dringlich, immer wieder. Auch mehrmals in der Wohnung. Die Hausdame berichtet ihm, die Baronin habe sie vom Telephon fortgeschickt und lange mit der Dame allein verhandelt.
„Eine Dame aus Stettin wollte dich sprechen, Bernt, sehr eilig und sehr dringlich“, sagt Adi in ihrem harten, gequetschten Gardeton. „Ein Fräulein Krusius. Wollte aber zuerst den Namen durchaus nicht nennen. Sonderbar.“
Nun bleibt Bernt — es ist im kleinen Salon — kerzengerade vor ihr stehen. „Warum sonderbar, Adi? Es wird Paula gewesen sein. Die hat doch keine Ursache, sich dir vorzustellen. Denn du würdest sie ja doch nicht kennen wollen.“
„Paula? Ach so, das ist deine kleine Freundin?“
„Sie war es. Bis heute.“
„Bis heute?“
„Ja. Ihre erste Indiskretion bringt uns natürlich auseinander.“
„Ekelhaft!“ sagt Adi und streift an ihm vorüber zur Tür. „Keine Stunde bleibe ich länger in deinem Hause.“
„Ich mache nicht den Versuch, dich zu halten, Adi.“
„Das ist also der Dank. Auch noch Weibergeschichten. Ich ahnte es aber längst.“
„Nur eine Bitte habe ich an dich. Sei so gütig, Adi, und weihe Onkel Droeseke in meine Verderbtheit ein, noch bevor ich nach Heinersbach komme. Ich kann mich dann dort in meinem Bericht knapper fassen. Und dir macht es ja auch wohl mehr Vergnügen als mir.“
Adi ist dicht an der Tür stehengeblieben. „Ich werde Onkel kein Wort sagen, wenn du mir versprichst, Bernt ... Überhaupt, wer und was ist diese Paula? ... Sich so wegzuwerfen. Ach, Bernt, ich meine es doch gut mit dir. Und mit Sibylle und Klaus erst recht ... Aber bilde dir nur nicht etwa ein, Bernt ... Ach, das wäre ja zum Lachen. Etwa Eifersucht? Phantastisch. Nein, ich mag dich gar nicht mehr sehen, verstehst du. Natürlich begleitet sie dich, deswegen hast du ja bloss diesen plötzlichen Urlaub genommen. Na, viel Vergnügen. Nicht mal richtig Deutsch sprechen kann sie. Ein Barmädchen oder so was, vielleicht eine Masseuse. Furchtbar unkompliziert seid ihr doch, ihr Herren der Schöpfung. Na, adieu, Bernt.“
„Adieu." Einen Augenblick starrt er vor sich hin, dann hebt er den Fernsprecher ab und lässt sich mit dem Hotel Exzelsior verbinden.
Endlich ist Paula am Apparat.
„Ich wollte mich nur noch von dir verabschieden, Paula. Jawohl, endgültig, Paula. Nein, wiedersehn werden wir uns kaum mehr. Ich kann dich nicht daran hindern, nach Berlin zu ziehen, nein, gewiss nicht. Aber zwischen uns muss es jetzt aus sein ... Nachweisen dir, was denn, wieso? ... Nein, nein, lediglich ein paar Indiskretionen, die mir nicht gepasst haben. Kleinlich, sagst du? Die grosse Liebe? Aber ich habe dir doch niemals vorgeheuchelt, liebe Paula, dass du die Erfüllung meines Lebens seist. Und du warst ja auch viel zu geschmackvoll, um mir eine Leidenschaftskomödie vorzuspielen. Wir waren für eine Ballstrecke gute Tanzkameraden, nicht wahr? Nun lass uns ohne hässliche Szene auseinandergehen. Ich schicke dir dasselbe auf dein Bankkonto, was du im letzten Jahr dort gehabt hast. Es brächte dich weiter, Paula, du verbrauchtest das Geld in Stettin. Aber das ist meine Privatmeinung. Nein, bitte, keinen letzten Abschied. An der Bahn schon gar nicht. Ich hasse Perrongespräche. Nun gar ... Aber behalte mich in leidlichem Andenken, Paula ... Um Gotteswillen, Paula, am Telephon weinen ...“
3
Im glattlaufenden Schlafwagen geht der Schaffner von Tür zu Tür und weckt. Es beginnt zu dämmern. In dreiviertel Stunden ist man in Basel.
Bernt balanciert schon vor dem Spiegel und rasiert sich. Er hat wie tot geschlafen. Aber ausgeruht sieht er nicht aus. Sein Bild missfällt ihm. Er wird im Mai dreissig Jahr — und sein Gesicht ist doch schon recht zerknautscht. Da er viel Sonnensport treibt, täglich mit den Kindern im Dachgarten oben auf der Villa turnt, selbst im Winter bei Schnee, ist er durchtrainiert, schlank, fast mager. Und seine Haut ist gesund bräunlich. Aber die Schläfen sind eingefallen und lassen ihn älter erscheinen. Nun ist auch sein Haaransatz zurückgetreten, die Stirn sehr hoch, man könnte schon beinahe von einer Glatze sprechen, so dünn ist die blonde Haarschicht oben. Vorbildlich gesund sind seine weissen, festen Zähne. Der Zahnarzt, von dem er sich und die Kinder kontrollieren lässt, schmeisst ihn stets mit humoristischer Entrüstung aus dem Sprechzimmer hinaus. Den Spiegel benutzt er nur beim Rasieren, das sind also auch die einzigen Minuten, wo er sich mal ins Auge sieht. Die Farbe seiner Augen ist im Pass braun angegeben, aber in Wirklichkeit ist sie braungrün schillernd. Besondere Kennzeichen? In seinem Elternhaus (er ist früh Waise geworden) hiess er der „fröhliche Bursch“; nach einer Björnson-Novelle hatte ihn seine Mutter so genannt, weil er so gern und so herzlich lachte. Aber wie all seine Altersgenossen, die im ersten Semester der Technischen Hochschule standen, als der Krieg ausbrach, hat er das Lachen zeitig verlernt. Flandern und Galizien! Rasch wurde er zum Offizier befördert. Im Flammenwerfertrupp holte er sich im Dezember 17 die dritte Verwundung. So kam er ins Heimatslazarett, im Mai 18 zur Nachkur ins Heilbad. In Wiesbaden lernte er Droeseke und Tochter kennen. Verliebt, verlobt, Kriegstrauung. Sofort ging’s wieder hinaus. Aber unmittelbar danach reklamierte ihn sein damals sehr mächtiger Schwiegervater für die kriegswichtige Fabrik. Als der Umsturz begann, leitete er das Berliner Büro. Die kleine Sibylle war noch in Schlesien geboren. Im Jahre 19 kaufte Droeseke dem jungen Paar die schöne Grunewaldvilla. Die grosse Sibylle hat das Glück darin ja nicht lang erlebt ... Und sie haben so gut zu einander gepasst. Gerade weil Sibylle das glückliche Gegenteil ihres Vaters war, des geizigen, schrulligen Mannes, der das Leben hasst und nur das Geld liebt ... Was haben sie doch oft gelacht, als junges Paar, wenn es ihnen einmal gelungen war, Papa Droeseke zu beschummeln ... Sibylle konnte ja ein solcher Kindskopf sein, so ausgelassen, und Gesichter schneiden, nein, woher hatte sie das bloss ...? Weder ihr Töchterchen noch Klaus haben auch nur eine verschwindende Ähnlichkeit mit ihr. Eigentlich ähneln sie beide ihrem Grosspapa, äusserlich und innerlich. Schade ...
Der Schlafwagenschaffner bringt die bestellte Tasse schwarzen Kaffee. Bernt nimmt zwei Schlucke und verzichtet auf den Rest. Das Handgepäck ist fertig gemacht. Er zündet sich eine Zigarette an und tritt auf den Gang. Eine schlanke junge Dame im kostbaren Breitfuchs steht am Gangfenster und blickt in den grauen Morgen hinaus. „Muss ich in Basel umsteigen nach Adelboden?“ fragt sie den Schaffner. Nein, sie könne im Zug bleiben bis Frutigen, aber hier in Basel würde der Schlafwagen abgehängt, es sei Aufenthalt genug, wegen der Zoll- und Passrevision.
Der Zufall bringt sie dann in dem neuen Schweizer Wagen zusammen; er hat nur dieses eine Abteil erster Klasse. Und es ergibt sich, dass sie beide in Frutigen den Zug verlassen werden. Das Postauto habe unmittelbar Anschluss nach Adelboden, versichert der Schweizer Schaffner. „Aber es wird Nacht werden, bis man dort ankommt?“ fragt die Reisende etwas unbehaglich. Sie kenne Adelboden nicht, erklärt sie dem Fahrtgenossen, wisse daher nicht, wo man dort am besten unterkomme. Bernt ist das Grand Hôtel empfohlen worden; er hat sich telegraphisch ein Zimmer vorausbestellt. „Gewiss ist der Hausdiener an der Bahn, Sie können dann gleich erfahren, ob noch Platz im Hause ist oder wo sonst.“
Bernt freundet sich unterwegs nicht gern an. Er bleibt auf der Weiterreise zurückhaltend. Die Mitreisende ebenso. Aber es ergibt sich, dass sie viel gereist ist. In Zürich und München weiss sie gut Bescheid. Sie ist durchaus Lady, auch offenbar die Begleitung einer Jungfer gewohnt. Sie brauche ein zweites Zimmer für ihre Bedienung, die in ein paar Tagen nachkommen soll, sagt sie in Frutigen dem Hausdiener vom Adelbodener Grand Hôtel. Oh, es gebe Platz genug oben, die Hauptsaison sei doch jetzt vorbei ...
Unheimlich schön ist die nächtliche Fahrt bergauf im Postauto auf den beschneiten Serpentinen, die sich längs des Tals emporschrauben. Der Scheinwerfer beleuchtet nur immer einen kleinen Ausschnitt aus der schneeverzauberten Welt. Mehrere hundert Meter geht es ununterbrochen steil empor. Zuweilen tut sich der Blick in jähe dunkle Schluchten auf, die links oder rechts von der Poststrasse abstürzen. Der mächtige Kasten rollt über Brücken, passiert kleine Gebirgsdörfer. Alles ist dick verschneit.
Im Hotel klingt Tanzmusik aus der Halle. Das übliche Bild: Ladys in Abendtoilette, Gents im Smoking. Meistens Engländer und Holländer, berichtet die Empfangsdame. Die Ankömmlinge haben reichlich Auswahl unter hübschen Zimmern. Es ist alles gut durchgeheizt und sehr behaglich.
Eine kleine Stunde später sitzt Bernt, frisch umgezogen, an seinem Tischchen im sonst leeren Speisesaal beim Essen. Auch die Reisegefährtin erscheint. Sie hat nur eine kleine schwarze Abendtoilette ausgepackt, aber ein kostbarer handgestickter Seidenschal gibt ihr Relief. Vom Menü wählt sie bloss eine Kleinigkeit aus. Die Empfangsdame kommt und erkundigt sich nach weiteren Wünschen. Hauptsorge der Neuangekommenen ist: kann sie gleich morgen früh einen gewandten Skilehrer bekommen? Ja, gewiss, das ist der junge Berner, der in der Halle als Eintänzer tätig ist. Auch Bernt bedarf seiner, wenigstens bei der Besorgung der Bretter, denn er hat für den kurzen Ausflug seine Ski nicht mitgenommen. Also stellt hernach in der Halle die Hotelbesitzerin den Sport- und Tanzlehrer den Ankömmlingen vor. Ein Sportgespräch beginnt. Und sie vermittelt auch die Bekanntschaft der Reisegefährten, wobei die Namen genannt werden.
„Olshagen?“ fragt Marion. „Etwa aus Berlin-Grunewald?“ Sie ist leicht verdutzt und lächelt dann. „Oh, ich entsinne mich ... Nein, ist das drollig!“ Und als die Wirtin ins Büro abgerufen wird, erzählt sie ihm eine kleine Begegnung, die sie vor ein paar Tagen mit einer reizenden jungen Dame aus Stettin gehabt hat.
Bernt hat noch immer die knabenhafte Angewohnheit, zu erröten, wenn er in Verlegenheit gerät. Marion bemerkt es und lacht herzlich. Sie hat ein wohliges, etwas rollendes Lachen. „Nein, Sie brauchen nichts von mir zu befürchten, Herr Olshagen, ich bin verschwiegen wie ein Kalifengrab. Und jedenfalls — haben Sie keinen schlechten Geschmack bewiesen.“
„Ich bin völlig entwaffnet. Aber nachdem sich’s nun einmal so getroffen hat, gnädige Frau, müssen Sie schon ein übriges tun und mir den Besuch der jungen Dame etwas eingehender schildern. Ich war nämlich doch stark überrascht von dem Anruf.“
Sie setzt sich auf einen kleinen Schaukelstuhl am Backsteinkamin, wippt ein wenig und blickt lustig zu ihm auf. „Paula ist so nett! Nein, ist sie nicht?“
Nun lacht er auch. „Paula ist eine rechte kleine Provinzialin. Bei ihrem ersten Schritt aufs Berliner Pflaster blamiert sie mich in so haarsträubender Weise.“
„Vor wem? Vor mir doch nicht? Ach, Herr Olshagen, wenn eins sich blamiert hat, dann bin ich’s. Ich war der Tolpatsch, ganz allein ich. Jetzt tut mir’s tatsächlich leid. Aber diese Wohnungsgeschichte hat mir natürlich schon viel Kopfzerbrechen gemacht. Ich hab’ es nun meiner Jungfer überlassen, mit einem der Bewerber abzuschliessen. Es ist Verlass auf ihr Urteil. Aber vielleicht wird es doch ein Reinfall. Und Paula wäre so glücklich gewesen ... Nein, aber nun kein Wort mehr davon ... Übrigens hat mir die Art, wie Sie mich am Telephon abblitzen liessen, doch sehr gefallen.“
„Ich hoffe, dass ich nicht unhöflich war.“
„Durchaus nicht. Korrekt waren Sie. Diplomat in jeder Silbe. Sind Sie’s von Beruf, Herr Olshagen?“
„Nein, ich bin Geschäftsmann. Sehr gehetzt, muss ich wohl sagen. Es hat sich gerade in den letzten Tagen viel zusammengedrängt. Da wird man nervös, vielleicht auch ungerecht.“
„Sehen Sie, nun tut’s Ihnen doch leid, dass Sie Paula so lieblos behandelt haben ... Nein, nein, nein, ich fange nicht mehr davon an.“ Sie steht auf und nickt ihm zu. „Jetzt muss ich Kräfte sammeln für morgen früh. Um zehn Uhr meine erste Skilektion. Sicher werde ich mich wie der dumme August im Zirkus anstellen. Und dann ist die Reihe zu lachen an Ihnen.“
„Ich hoffe das Schlimmste — um mich rächen zu können.“
Amüsiert von dem kleinen Geplänkel trennen sie sich.
Bernt geht noch einmal ins Empfangsbüro und liest ihren Namen. Frau v. Dette-Dubois. Er hat sie unterwegs fliessend Französisch sprechen hören. Aber Ausländerin ist sie nicht. Ihr Gepäck ist umfangreich, alles sehr gediegen, mit den Hotelzetteln erster Fremdenstationen bekleistert. Ihre Toilette ist kostbar, alles verrät Geschmack, besonders künstlerisch ist der wenige Schmuck, den sie trägt.
Sie hat der Empfangsdame erklärt, dass sie sich für länger als fünf Tage nicht binden möchte. Vielleicht führe sie gleich zum Genfer See hinunter, wenn sie dem Skisport keinen Geschmack abgewinnen könne. Zunächst wartet sie aber ihre Jungfer hier ab.
Es wäre schade, wenn er die nette Gesellschaft gleich wieder verlieren sollte.
*
Aber keine Sorge, er verliert sie nicht.
Am ersten Morgen ist Marion der Mittelpunkt des Interesses auf dem ganzen Übfeld. Sie steckt in einem praktischen Sportkostüm, in dem sie wie ein schlanker Junge von sechzehn Jahren wirkt. Die Sportmütze steckt sie bald in die Tasche. Auf ihren blonden Scheitel scheint die Sonne. In wenigen Stunden ist ihr Gesicht, ihr Hals rotgebrannt. Sie entwickelt einen fabelhaften Eifer. Niemand will glauben, dass dies ihre erste Lektion sei. Jedenfalls ist sie sehr begabt für den Sport. Bernt übt sich zuerst ein bisschen ein, unternimmt ein paar Aufstiege auf die nächsten Abhänge, fällt, wälzt sich im Schnee und kommt dann dampfend und gut gelaunt die Strasse durch den Wald vom Känzli abgefahren, die Stöcke schwingend. Schon von weitem erkennt er den blonden Etonkopf seiner Reisegefährtin.
„Skiheil!“ grüsst er. „Skiheil!“ gibt sie zurück. „Oh, Herr Olshausen, ich bin nun schon dreimal den Übhügel abgefahren, ohne zu purzeln. Ich bin mächtig stolz. Aber ich glühe auch schon wie ein Backofen.“
Der Berner Lehrer lobt sie sehr. Nur der Schnee sei schon so arg weich. Die Luft sei auch föhnig. Wahrscheinlich gebe es einen Umschlag.
„Tauwetter?“ fragt Bernt entsetzt.
„Aus Spiez und Thun und Frutigen wird schon Regen gemeldet heute vormittag.“
„Wehe Ihnen!“ droht Bernt. Besorgt hält er Umschau. Ein Wolkenkranz lagert am Horizont. Von den Dächern der Heuschober tropft es. Die Sonne schmort den Schnee.
„Heute nachmittag muss es noch halten,“ sagt Marion, „das ist das Berner Oberland mir schuldig.“ Eifrig nimmt sie ihre Übungen wieder auf, Bernt leistet ihr Gesellschaft.
Immer weicher wird der Schnee. Die Hotelgäste ziehen ermüdet ab, ein Trupp nach dem andern. Da und dort hört man auch schon den Gong zum Lunch rufen. Aber Marion übt noch immer weiter. Bernt bewundert ihre Ausdauer. Er ist schon etwas erschöpft und setzt sich auf seinen Ski in die Hocke. Endlich hat auch sie genug. Sie verabschiedet ihren Lehrer und kommt zu Bernt, seinem Beispiel folgend. Aber da sie die Ski nicht ganz horizontal ausgerichtet hat, gerät sie ins Rutschen. Er will ihr helfen, doch das duldet sie nicht, weil es nicht sportgemäss sei. Sie zwingt es dann auch.
„Fabelhaft selbständig!“ erkennt er an.
Nun sitzt sie in der Bratsonne nahe bei ihm. Das ganze Schneefeld ist leer geworden. Aus dem Dorf klingt das Juchzen der Kinder, die an dem Abhang eine waghalsige Kurvenbahn für ihre Rodel ausprobieren. Die Luft ist so warm geworden, dass man beim Sprechen nur noch ganz kleine Atemfähnchen sieht.
„Ich muss ja auch selbständig sein,“ sagt sie, „in allem. Hab’s nur leider viel zu spät gelernt. Wie alle Frauen. Ich sagte es Ihnen wohl noch nicht: ich kämpfe jetzt schon seit einem Jahr um meine Freiheit.“
„Oh — ein Scheidungsprozess?“ fragt er, unwillkürlich die Stimme etwas senkend, obwohl sie hier ganz allein sind.
Sie hat ihre Schienbeine mit den Armen umklammert, stützt das Kinn auf die Knie und blickt über das weite Tal hin. „Viel durchgemacht hab’ ich. Ich hab’ Zeiten erlebt — na, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal selig wie ein Kind in der Sonne sitzen und mich so meines Daseins freuen würde.“
„Das tun Sie also jetzt?“
Sie nickt heftig. „Die Aussicht, frei zu werden. Endlich, endlich. Und sein Leben neu geschenkt in der eigenen Hand haben. Ach, und es dann festhalten für immer, nie mehr, nie mehr abhängig werden. Ihr Männer wisst ja gar nicht, wie gut ihr’s habt. Ihr könnt euch eine nette kleine Paula nehmen, für ein fröhliches Weilchen, und sie dann wieder in die Ecke stellen, wenn’s euch nicht mehr passt. Für uns Frauen aber ist es gleich Schicksal.“
„Für alle?“
Sie zuckt die Achseln. „Vielleicht für Paula nicht. Aber das Risiko einer Ehe ist doch viel gefährlicher für uns als für euch. Am gefährlichsten das einer Liebe. Es kann die Vernichtung bringen.“
„Also haben Sie Ihren Mann sehr geliebt?“
„Sehr.“