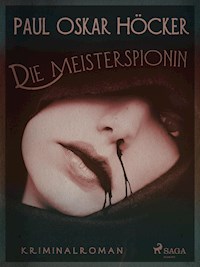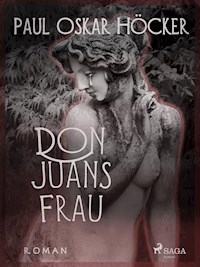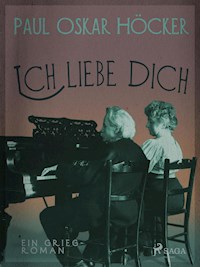
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Autor zeichnet ein lebendiges, romanhaft erzähltes Lebensbild des großen norwegischen Komponisten Edvard Grieg (1843–1907), in dessen Mittelpunkt seine Liebe zu Nina Hagerup steht. Da er in Norwegen nicht ausreichend musikalische Anregungen fand, zog der Komponist nach Kopenhagen. Ihn lockte das rege kulturelle Leben in der dänischen Hauptstadt. In Dänemark lernte Grieg auch seine große Liebe kennen, die Sängerin Nina Hagerup, die er 1867 heiratete. Sie ermunterte ihn, Lieder zu schreiben, und eine seiner schönsten Melodien hat er ihr gewidmet: "Ich liebe dich", die Vertonung eines Verses von Christian Andersen, einem seiner engsten Freunde.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Oskar Höcker
Ich liebe Dich
Ein Grieg-Roman
Saga
Edvard zählte knapp sechs Jahre, als seine Eltern das schmalfrontige Holzhaus in der Stadt Bergen, wo alle ihre Kinder zur Welt gekommen waren, verließen, um nach Landas hinauszuziehen. Vater Grieg wollte seinen fünfzigsten Geburtstag nicht mehr im kaufmännischen Geschäft verleben, sondern im Ruhestand. „Landas ist ein hübsches Bergnestchen, bloß ein paar tausend Meter von hier entfernt. Dort droben habt ihr größere Freiheit, mehr Bewegungsraum, vor allem bessere Luft als hier in der engstraßigen Hafenstadt, die heute ja schon an die dreißigtausend Einwohner zählt und immer so schrecklich nach Teer und Fischen riecht.“ Ein andermal meinte er: das verflixte Jahr 1848 habe mit den politischen Unruhen auch allerlei widerliche Handelswirren nach Norwegen hereingeschleppt, also müsse man sich freuen, nun endlich sein Leben in vollem Frieden genießen zu können.
Die grundgütige Art, die seinem Vater eigen war, wenn er bei den Hauptmahlzeiten das Wort führte, gewann ihm stets die Herzen der ganzen großen Familienrunde. Freilich wußte Edvard nicht, wozu er die größere Bewegungsfreiheit in Landas gebrauchen sollte. In Bergen hatte man doch ganz ungestört mit allen Nachbarstindern in der engen Gasse spielen können, und dort, wo sie ein wenig zu Tal führte, konnte man, sobald Schnee lag, auf den kleinen Holzschlittchen um die Wette hinabrutschen, denn von der Hafenstraße mit dem Polterverkehr der Lastfuhrwerke hinter den dampfenden Zugpferden blieb man ja weit genug entfernt.
Nach den aufregenden Umzugstagen und dem Lärm der hämmernden und sägenden Handwerker, nach den ersten Besuchen der neugierigen Verwandten und Bekannten, die kleine Geschenke für Küche und Keller sowie allerlei Spielzeug für die fünf Köpfe zählende Kinderschar mitbrachten und in ihren leichten Wägelchen dann wieder flink nach Bergen zurückkehrten, gab es manche Stunde, in der Edvard hier draußen kein lebendes Wesen zu sehen bekam. Er sollte auf der Wiese hinter dem Hause spielen. Aber allein machte das wenig Spaß. Die drei älteren Geschwister — Maren, John und Ingeborg — befanden sich in Bergen in der Schule. Der Schulweg war für sie jetzt erheblich weiter als bisher, doch Vater Grieg hielt diese täglichen Märsche aus Gesundheitsrücksichten für besonders erfreulich. Die kleine Elisabeth war noch ein Baby, mit dem ein Junge, der nun auch bald schulpflichtig wurde, nichts anfangen konnte. Manchmal empfand er also die Einsamkeit hier in Landas recht bedrückend, wenigstens auf der Spielwiese, die er durchaus nicht verlassen sollte. Wagte er sich um die Scheune herum, in der die großen Holzvorräte für den Winter aufgestapelt waren, dann änderte sich freilich das stille, feierliche, fast beängstigend starre Bild ganz seltsam — dann sah und hörte er plötzlich die lustigen Wasserstrahlen, die spritzend und schäumend die braungrauen Felsen über vielgezackte Stufen herabkamen und in den dunklen, tiefen Fjordkessel stürzten.
Das im Sonnenschein glitzernde Spiel der Fälle klang fröhlich lockend, und Edvard versuchte manchmal mitzusingen, vielleicht ähnlich, wie seine Mutter sang, wenn sie allein für sich am Flügel übte oder wenn Gäste im großen Musikzimmer saßen und sie ihnen eine Arie vortrug.
Die wöchentlichen Musikgesellschaften, die die Gattin des englischen Konsuls Grieg in Bergen veranstaltet hatte, fanden nun auch in Landas statt. An manchen Sonntagen fuhren drei, vier oder mehr Einspänner mit musikalischen Gästen hier vor. Frau Gesine entstammte dem angesehenen Hause Hagerup in Kristiania und hatte vor ihrer Heirat eine gründliche Ausbildung in Gesang, Klavierspiel und Theorie erfahren bei dem berühmten Professor Methfessel in Hamburg-Altona.
Einmal hörte Frau Grieg, während sie im Haushalt noch mit Einräumen beschäftigt war, das Stimmchen ihres Jüngsten in vielen kleinen hellen und hohen Singtönen von der Wasserfallseite her. Ihr war’s, als ob er die Koloraturen nachahmen wollte, die sie für die nächste Hausmusik probte. Sie lachte darüber. Doch unversehens ging der kleine Sänger dann in die Hornweise über, die der Hirt immer blies, wenn er inmitten seiner läutenden Kuhherde über die Wiese daherzog. Sie lehnte sich aus dem Fenster. Der Kleine saß am Fjordrand, also auf verbotenem Gebiet. Um ihn nicht zu erschrecken, fragte sie ihn in möglichst zutraulichem Ton, was er denn da sänge.
„Wie das hüpft, Mutter, nicht?“ gab er zurück und zeigte, in seinem kindlichen Gesang fortfahrend, zu den Fällen hinüber.
Nun erkannte sie, daß er bemüht war, den Rhythmus des Plätscherns wiederzugeben. Nach der Schneeschmelze war es immer besonders stark. „Und hinterher — das sollte wohl das Kuhhorn sein?“ fragte sie.
Er nickte. „Aber heute bläst er doch ganz anders, Mutter. Nicht? Es ist viel lustiger als sonst.“
Sie war überrascht, daß er den Wechsel der Tonart heraushörte. „Ja, Edvard, es ist heute nicht der alte Schäfer, der immer das große Horn bläst. Es ist sein Junge, der mit dem kleinen Horn, und das klingt höher. Kannst dir die paar Töne mal hernach auf dem Klavier zusammensuchen. Willst du? Aber wasch dir zuvor die Finger.“
Edvard empfand die Erlaubnis, die Klaviertasten zu berühren, als große Auszeichnung. Die älteren Geschwister hatten schon richtigen Unterricht bei der Mutter. Er sei noch nicht reif dafür, hieß es. Maren, John und Ingeborg neckten ihn oft, indem sie wiederholten, was die Eltern einmal den Besuchern anvertraut hatten: Der Kleine sei doch in allem ein bißchen zurückgeblieben, er habe ja erst mit achtzehn Monaten laufen gelernt und sprechen erst als Zweijähriger.
Mit seinem kleinen Zeigefinger durfte Edvard nun die Hornweise, die er dem Hirten nachzusingen versucht hatte, auf den Tasten wiedergeben. Seine Mutter war erstaunt, daß er nach zwei Fehlschlägen den richtigen Anfangston, den er also im Ohr behalten hatte, festhielt und dann mühelos die folgenden Töne anreihte.
Nach ein paar Wiederholungen brachte er auch den Rhythmus fehlerfrei heraus. Er war stolz und glücklich, als seine Mutter ihn lobte.
John, der bereits drei Jahre in die Schule ging und als Klavierschüler seiner Mutter bisher die größten Fortschritte der Geschwister gemacht hatte, fand es übertrieben, daß Edvard jetzt schon Unterricht bekommen sollte. „Bloß weil er die paar Kuhhorntöne behalten hat! Er hört hier draußen ja sonst den ganzen Tag nichts anderes!“
Aber für Edvard begann nun eine glückselige Zeit: seine Mutter brachte ihm und seinen Kinderfingern die Kunst bei, Tonleitern zu spielen. Am herrlichsten war es für ihn, wenn sie nach dem Unterricht wieder im Haushalt tätig war und er eine Weile allein vor dem Flügel sitzenblieb. Er hatte herausgebracht, daß man zwei Tasten gleichzeitig anschlagen konnte. Das erschloß ihm einen unermeßlichen Weltraum. Soviel Ruhe und Schönheit sprach zu ihm aus dem Instrument. Seine Mutter meinte lachend: nun habe er die große Terz entdeckt. Und den Dreiklang genoß er hernach wie eine Vollendung. Doch dann nahm er noch die rechte Hand hinzu und baute weiter. Es kam die Septime, die None. Weiter reichten seine Finger nicht. Dieser Zusammenklang von mehreren Stimmen begleitete ihn nun ins Bett, in die Träume. Er hörte nicht mehr die Flüstergespräche und das halbversteckte Lachen der Geschwister, wenn sie sich morgens für den Schulweg zurechtmachten. Und war er allein draußen im Freien, dann wuchs ihm das Klangbild von Tag zu Tag gewaltiger an. Tief unten vom Fjord her hörte er die Baßquint, fast dieselbe, wie sie die Musikanten spielten, wenn in der Schenke Tanz war, oder wie sie ein Teil der Burschen brummte, wenn Volkslieder gesungen wurden. Und aus der silbrigen Höhe der obersten Fälle sprudelten dazu lachende, lustige, wirbelnde Weisen. Je weiter er in den Tonleitern kam, desto mehr reizte es ihn, solche Vorbilder aus seiner Umwelt auf dem Klavier wiederzugeben. Auch Tanzweisen, die der Schäfer auf der Fiedel spielte. Da war die eine, die ihn nicht losließ, wenn er die C-dur-Tonleiter übte. In der Mitte machte sie plötzlich einen Sprung aufwärts über Fis ...
„Pfui, Edvard!“ rief die Mutter mit schallender Stimme aus dem Waschkeller herauf, wo sie dem Mädchen half. „Fis ist falsch! Du mußt F greifen!“
In der kurzen, unbarmherzigen Aussprache, die Edvard endlich von seiner Tante Hagerup gewährt wurde, ergab sich keine Möglichkeit einer Annäherung zwischen den beiden grundverschiedenen Menschen: der mit gewaltigen Stimmitteln ausgerüsteten Theaterfrau, die nun geradezu die Löwenmutter spielte, und dem äußerlich wie innerlich zarten Geistesarbeiter, der jeder Übertreibung abhold war und sich bald für Ninas Mutter heimlich schämte.
Hagerups hatten bei der Abfahrt nach St. Petersburg ihre Kopenhagener Wohnung weitervermietet; sie wurde erst zu Ostern wieder frei. Also blieb Ninas Mutter vorläufig in dem Notquartier, das sich ihr bei der alten Souffleuse bot. Nina schlug sich abends das Feldbett im Klavierzimmer auf. Den Tag über war sie wenig daheim. Seltsam, seitdem ein bißchen Klatsch um sie wob, stieg ihr Ruf als Künstlerin beträchtlich. Immer mehr Damen wandten sich an sie, um sich von ihr zum Gesang begleiten zu lassen. Und keine der Sängerinnen ruhte, bevor nicht Nina Hagerup ihr das neue Lied ihres Vetters zu singen gab. Die Noten von „Ich liebe dich!“ mußte sie immer wieder abschreiben, denn das Lied sollte ja erst übers Jahr mit anderen Arbeiten zusammen im Druck erscheinen.
Wenn Edvard und Nina in fremden Häusern zusammentrafen und miteinander musizierten, so wurden sie jetzt von allen Seiten noch viel aufmerksamer beobachtet als vorher. Es war natürlich bekannt geworden, daß ihre Verlobung durch ein Machtwort der Frau Hagerup auseinandergegangen sei. Aber man sah die beiden jungen Menschen jetzt eher noch herzlicher und vertrauensvoller miteinander verkehren als zuvor. Freilich niemals in Gegenwart von Ninas Mutter.
In der „Euterpe“ errang Edvard Grieg in diesem Konzertwinter mehrere Erfolge. Seine Klaviersonate hatte in seinem feinen, perlenden, klangwarmen Vortrag große Zustimmung gefunden. Und kurz vor Ostern dirigierte im Tioolikonzert Richard Nordraak, der das Orchester meisterlich beherrschte, die beiden Mittelsätze aus Griegs erster Sinfonie. In den jungen musikalischen Kreisen galt sie als ein Ereignis. Der Komponist hatte die Partitur noch vor der Einstudierung aus alter Verehrung dem Professor Gade ins Haus gebracht und war damit auf wenig Gegenliebe gestoßen; sie sei ihm „zu norwegisch!“, hatte der Klampenborger gesagt; doch das bedeutete bei der skandinavischen Jugend gerade ein charakteristisches Lob. Als Nordraak im Tivolikonzert den Stab sinken ließ, hallte der ganze Saal wider von starkem Beifall. Man ruhte nicht, als bis der zarte, etwas schüchterne, blauäugige, blonde junge Künstler aufs Podium kam, sich verbeugte und auch dem Kapellmeister dankbar die Hand schüttelte.
In einer Mittelreihe des großen Saales saß Nina, blaß, ergriffen, glückselig — und doch schmerzbewegt, denn sie saß ja zwischen ihrer Mutter und ihrer bisherigen Pflegemama, die beide eisern die Lippen zusammenpreßten und die Hände als Fäuste auf den Knien hielten.
Am andern Vormittag reiste Edvard mit dem Hardanger Boot nach Bergen ab. Er bekam an Bord gleich das Briefchen, das Nina durch einen Sonderboten hingeschickt hatte. Ein paar Blumen lagen in dem Umschlag, und ein paar Takte aus „Ich liebe dich!“ standen in Ninas Notenschrift auf dem kleinen Briefbogen.
Nun sollte es lange, lange Zeit währen, bis sie einander wiedersahen. Vielleicht reisten Hagerups nach Kristiania, falls die Geschäfte von Ninas Vater dies erforderten? Oder vielleicht schickten sie ihre Tochter in irgendeine Dienststellung auf dem Lande bei Verwandten oder Bekannten? Einen regelmäßigen Briefwechsel zu unterhalten war den heimlich Verlobten unmöglich gemacht. Nur auf dem Umweg über Feddersen, den Rungsteder Freund Edvards, konnten sie geistig miteinander in Verbindung bleiben.
Denn auch bei seinen eigenen Eltern fand Edvard keinerlei Verständnis für seine Absicht, Nina Hagerup zu seiner Frau zu machen.
„Daß du erst zweiundzwanzig Jahre alt bist, Nina noch nicht zwanzig, das würde mich weniger stören“, sagte Frau Gesinel „aber in diesen ganzen Kreis der Werlighs gehörst du nicht hinein.“
„Nina ist der denkbar größte Gegensatz ihrer Mutter“, versicherte ihr Edvard.
„Dann wirst du ewig in Zank und Streit mit deiner Schwiegermutter leben.“
„Sieh dir Nina doch einmal an!“ bat Edvard.
„Ihre Mutter würde es hochmütig ablehnen, sie mir herzuschicken. Und ich fahre in meinen Jahren kaum mehr nach Kopenhagen. Nach Kristiania schon gar nicht. Gerade Frau Hagerups wegen nicht.“
Vater Grieg gab Edvard zu bedenken, daß die neuere Wissenschaft es durchaus verwerfe, wenn Geschwisterkinder, überhaupt die Abkömmlinge von Verwandten miteinander die Ehe eingingen. Blindheit, Taubheit, allerlei Körpermängel oder Geistesschwächen seien im Nachwuchs zu befürchten. „Du hast dich aufs Rassegefühl der nordischen Musik verschworen, mein Sohn“, sagte der alte Konsul, der über Mozart, allenfalls Weber hinaus nicht „mitging“ und von den Kompositionen Edvards nicht allzusehr beglückt war, „nun beweise also dein Gefühl für Sippenreinheit auch in dieser noch viel wichtigeren Frage!“
Seine Lieblingsschwester war die einzige, die hundert Kleinigkeiten von seiner Auserwählten hören wollte. Die älteren Schwestern waren selbst verheiratet, lebten ziemlich weit von der Stadt Bergen und hatten schon eigene Kinder.
Aber John kam noch zu Ostern nach Landas und brachte auch sein hier lange nicht mehr gehörtes Cello mit. Er befand sich freilich in fast ebensolcher Unruhe und Unausgeglichenheit wie sein Bruder Edvard. Auch Johns Liebesgeschichte bildete — im Zusammenhang mit der für ihn schwierigen Lebensberufsfrage — den Mittelpunkt mancher Auseinandersetzung mit den Eltern.
Die Bergener Handelsfirma des Konsuls bedurfte einer jungen Kraft. Der Stellvertreter, den Vater Grieg eingesetzt hatte, als er sich aus dem Geschäftsleben mehr und mehr zurückzog, genügte seines Alters wegen nicht mehr. John aber hatte seine richtige Ausbildung als Kaufmann durchgemacht, bevor er bei Professor Grützmacher die Cellostudien aufnahm. Die Firma konnte nun durch allerlei gute Vertretungen sicheren Gewinn einbringen, wenn sie von einer zielbewußten Kraft geführt wurde. Also sollte John nach Bergen kommen. „Hier kann er seiner Dresdner Flamme einen schönen Altar in unserm alten Wohnhaus errichten!“ meinte der Konsul. „Es ist jetzt behaglich ausgebaut, neu ausgemalt, neu tapeziert, es hat sogar schon eine Wasserleitung seit dem letzten Brand.“
Die Brüder spielten viel Duos miteinander. Auf Edvards Vorschlag schrieb John auch an Ole Bull, der in Europa konzertierte, und fragte bei ihm an, ob er im Sommer seinen Bruder nach Valestrand begleiten dürfe. Nach wenigen Wochen traf die Antwort des Vielgereisten aus seinem norwegischen Landsitz ein, der zehn Fahrstunden östlich von Bergen lag. „Ich erwarte Euch beide hier. Ihr Jungen!“ schrieb Ole Bull. „Meine geliebte Frau ist nicht mehr am Leben, ich sitze hier also ganz allein in der wunderbaren Heimat. Kommt und bringt das Cello mit, den Flügel habe ich hier selbst gestimmt, wir spielen Trios von Mozart und Beethoven. Oder wir steigen zusammen auf den Felsenplatz zwischen den blühenden Rosenbüschen, von dem der Blick auf das große Meer und allerlei kleine Zauberseen unter den Schneeriesen trifft, und dort geige ich Euch vor, was mir der ‚Hulder‘ hier alles wieder erzählt hat. Aber Ihr dürft nur kommen, falls Ihr Euch darauf einrichtet, mindestens zweimal die Mondsichel im Abendsonnenglühen auftauchen zu sehen. Ich brauche junge Menschen, junge Stimmen, junge Herzen hier. Euer Ole Bull.“
Es wurde eine eindrucksreiche Zeit.
Ole Bull lebte auf Valestrand, wenn er aus der großen Welt in seine entlegene Kinderheimat zurückkehrte, tagsüber wie ein richtiger Bauer. Er liebte körperliche Arbeit, war trotz seinen bald sechzig Jahren noch immer äußerst rüstig, ernährte sich sehr einfach, trank nicht und rauchte nicht, die Feierstunden, die er oft die halbe helle nordische Nacht hindurch im Freien verbrachte, gehörten der Musik. Regnete es, dann beschäftigte er sich mit technischen Instrumentaldingen, vorzugsweise dem Geigenbau. Seine berühmten alten Violinen hatte er schon mehrmals auseinandergenommen und nach sorgfältiger Reparatur und Säuberung wieder kunstvoll zusammengesetzt. Seine Reiseabenteuer hatten die kostbaren Instrumente nicht eben geschont. Bei einem Schiffbruch im vergangenen Winter war er wieder einmal mitsamt dem Geigenkasten, worin sich seine schönste Guarneri befand, über Bord gesprungen. Das Staatsstück, das er besaß, war die Innsbrucker Museumsgeige, die dreihundert Jahre zählte und die bei der Eroberung von Innsbruck im Jahre 1809 in eine Wiener Raritätensammlung geraten war. Der letzte Besitzer hatte sie testamentarisch dem Nachfolger Paganinis vermacht.
Auf dieser Violine spielte Ole Bull das Mozart-Trio mit den beiden Brüdern Grieg, das ein Lieblingsstück von ihnen allen dreien war. Sie spielten es zunächst „klassisch“, das heißt, sie spielten es mit der ganzen Treue und Zurückhaltung, wie dies konzertmäßig von allen Meistern der Kammermusik in Wien und Leipzig, London und Paris verlangt wurde.
Ole Bull behielt das dunkelbraune kleine Instrument und den Fiedelbogen noch eine Weile in den Hünden und lauschte still für sich dem Klange nach, als das Stück zu Ende war.
„Das hab’ ich vor vierzig Jahren zum erstenmal gehört“, sagte er dann. „Der Schwede Landholm, bei dem ich den ersten richtigen Geigenunterricht hatte, spielte es so mit seinen Partnern. Zehn Jahre später hörte ich’s bei Spohr in Kassel. Doch da war ich sehr enttäuscht. Das Trio klang damals wie eine Spieluhr aus dem Schwarzwald. Gewiß: jeder Ton war da, zur rechten Zeit und in der vorgeschriebenen Höhe. Aber die Seele fehlte. Ich möchte es endlich einmal so spielen, wie es unter Spohr und im Gewandhaus verpönt gewesen wäre: ganz aus dem eigenen Herzen heraus! Möglich, daß es Mozart so gefiele. Aber er wird darüber ja nicht mehr mitreden, denn er ist tot. Wir wollen es also heute abend noch einmal spielen. Mit ganz winzigen Schwankungen im Zeitmaß. Dann folgt ihr mir immer, und ich folge euch —so beim Aufjauchzen im Allegro, beim schmerzlichen Atemholen im Adagio!“
Es wurde bei diesem nächtlichen Zusammenspiel ein ganz persönlich warmherzig, schwelgerisch, fröhlich und dann doch wieder schwermütig erfaßter Mozart.
„Ich danke euch. Jungen!“ sagte Ole Bull. Darauf wanderte er mit ihnen noch ein weites Stück durch die helle Nacht und führte sie zu manchem seiner Lieblingsplätze und Aussichtspunkte. Nicht nur das Meer sah man von hier aus, sondern auch die Gletscher, die aus der Kette der Fjordgebirge in den Himmel ragten. Viel Land war hier felsig und unfruchtbar, wo sich aber der Boden beackern ließ, da zeigte er die reiche Frucht fleißiger Arbeit. Zwischen den dichten Laubwäldern dehnten sich Felder, dehnten sich sattgrüne Wiesen, auf denen die Kühe weideten, und in der Umgebung der weißgestrichenen Holzhäuser, die zu Ole Bulls großväterlichem Besitz gehörten, gab es viel bunte Blumengärten.
Mit den Bauern verkehrte Ole Bull sehr herzlich. Sie waren alle stolz auf ihren Nachbar. Viele kannten ihn ja, seitdem er als kleiner Bub die erste goldgelbe Geige von seinem Onkel Iens geschenkt bekommen hatte. Oft hatte sich Ole da nachts aus dem Bett geschlichen und war mit seiner Spielzeuggeige weit ins Freie hinausgezogen, um heimlich darauf zu spielen. In stillen Nächten glaubten Spätkömmlinge dann den „Hulder“ aus den Fjorden oder Schären bis hier herauf zu hören. Bis sie dann doch einmal statt eines Gnomen oder Unholds das ganz in sein abenteuerliches Spiel versunkene Kind aus dem Gebüsch herauszogen.