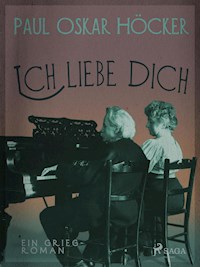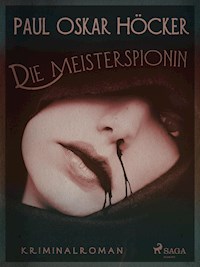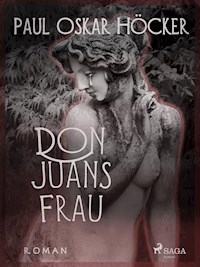Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die hübsche Dodo lernt auf ein Schiffreise den begabten und bald sehr erfolgreichen Architekten Percy kennen. Sie verlieben sich und heiraten, bald haben sie ein Kind. Das junge Eheidyll könnte ganz ungetrübt sein, wären da nicht die Schatten der Vergangenheit. Ein Erpresser taucht auf, der dunkle Punkte im Vorleben Percys entdeckt hat, und da ist auch noch die reiche Amerikanerin Mrs. Sly, die Percy nach Florida holt, um ihn dort große Bauprojekte verwirklichen zu lassen und mit ihm zu flirten beginnt. Zum Autor: Paul Oskar Höcker, geboren 1865 in Meiningen, gestorben 1944 in Rastatt, war ein deutscher Redakteur und Schriftsteller. Höcker verfasste Lustspiele, Kriminalromane, Unterhaltungsromane, historische Romane und auch etliche Jugenderzählungen. Er galt in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als überaus erfolgreicher Vielschreiber. Einige seiner Romane wurden verfilmt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Oskar Höcker
Musikstudenten
Roman
Saga
Musikstudenten
© 1937 Paul Oskar Höcker
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711498743
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Das Kolleg war aus. Unter dem Scharren seiner zahlreichen Zuhörer klappte Professor Philipp Spitta, der Sohn des Dichters von „Psalter und Harfe“, seine schwarze Mappe zu. Er war der einzige Dozent an der Berliner Universität, der über Geschichte und Ästhetik der Musik las. Seine Vorträge wurden namentlich von jungen Kunsthistorikern und Philosophen belegt, die in ihren Dissertationen musikalische Gebiete behandelten; man nannte sein Kolleg daher im Scherz die Doktorhutfabrik.
Aber es befanden sich unter den Hörern auch mehrere Studierende der Königlichen Akademischen Hochschule für Musik, deren Direktorium Philipp Spitta seit Beginn der achtziger Jahre vorstand. Diese jungen Künstler unterschieden sich von den Anwärtern auf den Doktortitel durch die genialere Haartracht und die kühne Flatterkrawatte.
Professor Spitta kannte die Mehrzahl der jungen Männer, die zu seinen Füssen sassen, beim Namen. Dass sich ab und zu auch „blinde Passagiere“ einfanden, wurde schweigend von ihm geduldet. Aber nach dem einen Studenten in der letzten Bankreihe, dem hochaufgeschossenen mit dem auffallenden Charakterkopf, hatte er sich nach seinem letzten Vortrag doch erkundigt. Der gespannte, fast leidenschaftliche Ausdruck seines Gesichts, der trotzige Zug um seinen Mund, das Leben in seinen grossen, grauen Augen fesselten ihn. Er wollte den einfach gekleideten jungen Menschen, der bei ihm kaum belegt hatte, nicht durch eine Ansprache in Verlegenheit setzen. So bat er den Studiosus Raith, Namen und Art des Fremdlings zu erkunden.
Raith, der Sohn des Bonner Universitätsprofessors und Geheimen Rates, war ein feiner, stiller Mensch. Er schwärmte für seinen berühmten Lehrer, jede Beziehung zu ihm beglückte ihn. Heute konnte er nach Schluss des Kollegs dem Professor schon Bericht erstatten. Spitta befand sich aber im Geiste noch bei Orlando di Lasso, den sein soeben beendeter Vortrag behandelt hatte; er musste also erst die Hand an die Stirn legen, die Augen schliessen und ein Weilchen nachsinnen.
„Richtig. Richtig. Ich danke Ihnen, lieber junger Freund. Haben Sie ihn kennen gelernt?“
„Nein, Herr Professor, aber ich kenne flüchtig seinen Banknachbar, den Warnekross, und den hab’ ich ein bisschen ausgefragt.“
„Warnekross. Hm. Das ist der ehemalige Schiffsingenieur? Der schon acht Semester auf der Technischen Hochschule hinter sich hatte, als er umsattelte?“
„Jawohl, Herr Professor. Er hatte sogar schon sein praktisches Probejahr auf dem Vulkan abgemacht.“
Spitta nickte. „Ich entsinne mich. Richtig. Er ist ja auch Subskribent der grossen Mozartausgabe. — Nun, und sein Begleiter?“
„Der heisst Nikoleit und kommt aus Hamburg. Sie wohnen Tür an Tür und sind miteinander befreundet. Nikoleit studiert im dritten Semester Geschichte. Sein Vater ist in Hamburg Orchestermitglied.“
„Ich kenne ein Trio für Holzblasinstrumente von Nikoleit. Ein feines Stück. Ob das von seinem Vater stammt?“
„Warnekross sagt, der alte Nikoleit sei ein vorzüglicher Klarinettist.“
„Das könnte stimmen. Die Klarinette in dem Trio ist wundervoll verwendet. Der junge Nikoleit ist also wohl selbst musikalisch? Nimmt er Unterricht? Bei wem?“
Raith lächelte. „Bei Warnekross.“
„Hat der sich schon als Lehrer aufgetan?“
„Sie arbeiten zusammen Kontrapunkt, sagt Warnekross.“
„So. Das ist ja höchst interessant. Und wer korrigiert ihre Arbeiten?“
„Warnekross korrigiert die Arbeiten von Nikoleit — und nun möchte er seine Korrekturen gern einmal von Ihnen durchsehen lassen, Herr Professor.“
Spitta lächelte und strich über seinen langen, spitz zulaufenden Vollbart. „Das will ich bei Gelegenheit gern tun.“ Er fragte den jungen Studenten noch nach dem Befinden seines Herrn Vaters und liess sich ihm empfehlen.
Damit war Raith entlassen und der Fall Nikoleit vorläufig für die Gedankenwelt des Professors erledigt.
Aber am Ausgangstor nach dem Opernhausplatz, zwischen den Standbildern der Gebrüder Humboldt, harrte seiner ein Überfall.
Warnekross, der stattliche, blondbärtige, derbknochige Westfale, hatte den schlanken, nervösen, blassen Nikoleit in die Nische am Gitter gedrängt und redete in seiner breiten, ruhigen und bestimmten Weise auf ihn ein. Unsinn — sich zu genieren! Professor Spitta kam hier vorbei, man zog den Schlapphut, sprach ihn kurz entschlossen an und trug sein Anliegen vor. Er hatte doch schon besonderes Interesse gezeigt, eigens durch den Studiosus Raith eine Erkundigung einziehen lassen.
„Denken Sie denn, sonst kümmert er sich um jeden schäbigen Zeitgenossen, der bei ihm Kolleg schindet? Da hätt’ er viel zu tun. Der vierte Mann von all seinen Hörern hat nicht berappt.“
Beim Sprechen gestikulierte Warnekross heftig mit der Rechten, die einen niemals zusammengerollten Regenschirm hielt. Unter dem linken Arm trug er einen Stoss Partituren. Anders war er auf der Strasse kaum zu sehen, denn entweder ging er zur Bibliothek oder er kam daher. Die alten Schwarten hatten ein stattliches Gewicht. Das zwang ihn, die Hüfte zur Stütze in Anspruch zu nehmen. Dadurch verschob sich wieder sein Hohenzollernmantel, von dem er nur die beiden untersten Knöpfe zu schliessen pflegte. Alles war Kraft an ihm: seine knochige, gedrungene Gestalt, sein derbes, herzliches Lachen, sein Bass. Nikoleit, um fünf Jahre jünger, wirkte zart, fast hilflos gegen ihn, trotzdem er ihn um halbe Haupteslänge überragte. Der junge Hamburger war bartlos. Charakteristisch war seine ziemlich grosse Nase und die auffallend hohe Stirn mit den starken Buckeln über den Augenbrauen und den etwas eingesunkenen Schläfen. Während man dem derben Westfalen anmerkte, dass er auf eine gute Mahlzeit hielt, wirkte Nikoleit fast unterernährt. Wenigstens liessen die blasse Hautfarbe, die überschlanke Gestalt darauf schliessen. Es kam auch der leidenschaftliche Ausdruck seiner Züge, seiner grossen, grauen Augen hinzu.
„Durch diese hohle Gasse muss er kommen!“ zitierte Warnekross noch einmal, lachte und gab seinem Schützling mit dem Notenbündel einen freundschaftlichen Rippenstoss.
Es herrschte viel Leben um diese Mittagsstunde vor der Universität. Gerade kam die Wachtparade die Linden herauf. Vor dem Eckfenster vom Kaiser Wilhelm-Palais staute sich die Menge. Es waren nur noch wenige Tage bis zum neunzigsten Geburtstag des alten Herrn: man schrieb 1887. Die Sonne schien, die rechte Vorfrühlingsstimmung lag über Berlin.
In dem Augenblick, in dem Professor Spitta den breiten Bürgersteig gewann, erschien drüben die rührendfeierliche Soldatengestalt am Eckfenster. Die Truppe marschierte mit angefasstem Gewehr vorbei, scharf die genagelten Stiefelsohlen auf das Holzpflaster aufschlagend. Die Zuschauer am Denkmal des Alten Fritzen schwenkten die Hüte. Auch hier vor der Universität nahm alles die Front nach dem berühmten Fenster — und auch der Professor blieb ein paar Augenblicke stehen, tief den breitkrempigen, schwarzen Schlapphut ziehend.
Grässlich war dem Gelehrten bei diesem patriotischen Schauspiel, das er wöchentlich mehrmals erlebte, immer nur die Musik. Das unsinnige Pauken verdarb den ganzen Schwung dieser charakteristischen friderizianischen Märsche. Ein etwas schmerzliches Lächeln in dem schönen, durchgeistigten Antlitz Spittas verriet sein Unbehagen.
Als er eben den Hut wieder aufsetzen wollte, sah er sich selbst als Gegenstand einer ausserordentlichen Huldigung.
Vor ihm stand der blondbärtige Warnekross, mit dem Stoss Partituren wie mit einem Schild bewehrt, und schwenkte Hut und Regenschirm zugleich in der Rechten. Was er sagte, war der lärmenden Musik halber nicht zu verstehen. Mit drei Schritten Abstand hielt hinter ihm der schlanke Hamburger, dem er mitten in der Rede durch ein fast ärgerliches Zucken mit Kopf und Schulter zuwinkte.
„Sie haben etwas für mich, lieber Herr Warnekross?“ fragte Spitta lächelnd, als die Musik sich entfernte. „Wollen Sie nicht lieber in meine Sprechstunde kommen?“
Warnekross gab ein paar Lachtöne im tiefsten Basse von sich. „Ach, Herr Professor, dazu bring’ ich den jungen Mann ja gar nicht. Der kratzt mir unterwegs wieder aus. Das ist eine solche Bangebüx.“
Ängstlich sah der junge Mann nun eben nicht aus. Im Gegenteil: eher trotzig und stolz. Er kam jetzt näher und zog noch einmal den Hut.
„Studiosus Nikoleit!“ stellte Warnekross vor.
Spitta reichte ihm väterlich wohlwollend die Hand. Die Augen dieses jungen Studenten interessierten ihn.
„Sind Sie verwandt mit dem Komponisten des Holzbläsertrios in E-Moll?“
„Das ist mein Vater, Herr Professor. Er ist zweiter Klarinettist an der Hamburger Oper.“
„Seit wann studieren Sie hier?“
„Ich stehe im dritten Semester.“
„Da haben Sie sehr jung das Abiturium gemacht?“
„Mit achtzehn Jahren. Ich studiere Geschichte.“
„Sie treiben auch Musik dabei?“
„Ich wollte bitten, bei Ihnen hospitieren zu dürfen, Herr Professor.“
Spitta nickte gnädig und wandte sich nach rechts. „Begleiten Sie mich ein Stück, meine Herren. Ich gehe bis zum Brandenburger Tor und nehme dort die Pferdebahn.“
Warnekross strahlte über seinen Erfolg. An die Bücherlast, die er nun noch eine gute Stunde länger mit sich herumschleppen musste, dachte er gar nicht. Er gab seinem Schützling bei der Wendung einen ermunternden Puff, liess ein kurzes Lachen in tiefem Basse ertönen und schlenderte neben dem Professor weiter.
„Haben Sie selber schon etwas komponiert, Herr Nikoleit?“
„Eine ganze Menge. Schon als Junge. Aber eigentlichen Unterricht hab’ ich nur wenig gehabt. Klavierstunden hatt’ ich bei meiner Mutter. Dann etwas Theorie und Geige bei einem Herrn vom Orchester. Das hörte dann wieder auf, weil Vater durchaus nicht wollte, dass ich Musiker werde. Und darum sollt’ ich auch nicht erst Schularbeiten versäumen.“
„Gerade wie bei mir!“ fiel Warnekross ein. „Aus mir wollten sie um alles in der Welt einen Schiffsbaumeister machen. Mein Alter hatte doch die kleine Bootswerft. Aber gelungen ist es ihnen nicht.“ Er lachte. „Und wenn ich schon ins Schwabenalter gekommen wär’ — ich hätte doch noch umgesattelt. Ja.“
Spitta kannte die Lebensgeschichte des jungen Westfalen und nickte gnädig zustimmend. Seine Leidenschaft für die Musik, besonders für alles, was Mozart war, hatte wirklich etwas Rührendes.
In kurzen Zügen legte Nikoleit seinen Bildungsgang dar. Es war der Wunsch seiner Eltern gewesen, dass er Philologie studierte. Zum Lehramt fühlte er aber gar keinen Beruf in sich. So hatte er nach vielem Hin und Her die Erlaubnis erhalten, sich auf das Studium der Geschichte zu werfen. Besonders das Mittelalter war ihm anziehend erschienen.
„Ich bin hier in Berlin der Musik ausgewichen, wo und wie ich irgend konnte,“ sagte er, tiefaufatmend. „Ein Klavier hab’ ich nicht. In die Oper, in Konzerte bin ich fast gar nicht gekommen. Ich hab’ ja auch die Mittel nicht dazu. Aber da hat’s der Zufall gewollt, dass ich neben den Herrn Warnekross zu wohnen kam, dass ich ihn musizieren hörte, alle Tage und alle Abende — und seitdem gehör’ ich nicht mehr mir selber. Es war eben stärker als ich. Und ich kann’s jetzt anfangen, wie ich will, die geschichtlichen Bilder verblassen, versinken, immer sind es Harmonien, die sich in meinem Kopf aufbauen, Stimmen, die ich in Gedanken nebeneinander führen muss: ich komme nicht mehr dazu, den andern Vorträgen zu folgen.“
„Wir haben zusammen angefangen, Kontrapunkt zu treiben,“ warf Warnekross ein. „In den alten Kirchentonarten natürlich — mit dem cantus firmus.“
„Es würde mich interessieren, die Arbeiten einmal zu sehen,“ sagte Spitta lächelnd.
Nikoleit zuckte die Achsel. „Im strengen Satz bin ich natürlich noch ein krasser Anfänger. Früher hab’ ich mich ja schon an grössere Aufgaben gewagt. Hauptsächlich für Klavier. Aber Herr Warnekross wollte durchaus keine Seitensprünge gestatten. So schrieb ich also bloss Kontrapunkt.“
„Sie haben einige Arbeiten bei sich?“ Spitta zeigte auf den Stoss Noten, den der Westfale unterm Arme trug.
„Einen ganzen Band drei- und vierstimmige Übungen.“
„Die können Sie mir nachher mitgeben. Ich will sie einmal durchlesen.“ Er wandte sich nun wieder dem jungen Nikoleit zu. „Schwere Lebensdinge sind das, lieber junger Freund, mit denen Sie sich da herumschlagen. Wie denken Sie sich die Praxis — die Zukunft?“
Nikoleit seufzte. „Noch gar nicht, Herr Professor. Ich stehe ja noch so in der Wirrsal drin. Dass ich mit meinen Leuten daheim die furchtbarsten Kämpfe durchmachen müsste, wollt’ ich nun noch ein zweites Mal umsatteln, gar zur Musik, das weiss ich wohl. Ich habe nur einen geringen Zuschuss von zu Hause. Selbst den aufzubringen, wird Vater schwer. Sie hatten früher eben damit gerechnet, dass ich als Lehrer bald eine Anstellung an einem Gymnasium fände. So rasch und so glatt geht’s beim Geschichtsstudium nicht. Das wussten sie daheim natürlich nicht zu beurteilen. Und nun erst bei der Musik. ... Oft bin ich ganz verzweifelt. So gar nicht zu wissen, was das Rechte für einen ist!“
Eine Weile schritten sie schweigend die Linden entlang. Auch dem sonst so lustigen, behaglich-respektlosen Westfalen ging der bittere Ton nahe, in dem der Budengenosse über seine Verhältnisse sprach. Und Spitta war fast etwas verstimmt. Er strich im Weiterschreiten nachdenklich seinen Bart. Endlich sagte er, fein lächelnd: „Im Grunde geschähe Ihnen also ein grosser Dienst, wenn man Ihnen mit gutem Gewissen erklären könnte, dass Sie gar kein Talent zur Musik besitzen?“
Warnekross hob fast erschrocken die Augenbrauen. Aber Nikoleit lächelte mit seltsam schmerzlichem Ausdrucke. „Wie die Dinge heute stehen, wäre es für mich fast eine Erlösung. Das heisst: wenn ich’s glauben könnte.“
„Nun — mir würden Sie’s doch wohl glauben?“
„Sie werden es aber nicht sagen, Herr Professor.“
„Hm. So sicher sind Sie Ihrer Fähigkeiten?“
Nikoleit hatte den Kopf erhoben. Mit seinen grossen, grauen Augen sah er über Menschen und Wagen auf der breiten, belebten Promenade weit hinweg. „Das ringt nun doch schon in mir, seitdem ich Kind war. Wo Vater merkte, dass die Musik zu viel Boden in mir gewann — damals hatte er gerade selber so schwere Enttäuschungen — da ward mir streng verboten, auch nur eine Taste anzurühren. Ich schlich mich noch lange Zeit heimlich zu meinem Lehrer. Der wollte keine Bezahlung; es machte ihm Freude, sagte er. Als er dann aber zu Vater ging und für mich bat, da gab’s einen grossen Ärger für ihn — und ich bekam Schläge. Als grosser Junge. Da liess ich’s also eine Weile. Aber dann entdeckt’ ich, dass ich Noten lesen konnte. Das war geräuschlos — und das merkten die Eltern nicht. Aber mir klang alles im Geiste. Und damals fing ich an zu komponieren. Zuerst heimlich. Hernach wagt’ ich’s aber doch noch, Vater die Sachen zu zeigen. Er war ehrlich erschrocken. Und natürlich böse. Meine Sachen gefielen ihm auch gar nicht. Er sprach mir sogar das Talent ab. Aber ich wusste natürlich gleich: es war die alte Opposition. Die Vorstellung, dass ich Musiker werden könnte, ist ihm eben gar so fürchterlich. Er hat es selbst sein ganzes Leben schon bereut, dass er sich dieser Hexe und Teufelin ergeben hat.“
Spitta hatte mit warmer Anteilnahme zugehört. Aber nun zog er doch die Stirn in Falten. „Andre nennen sie eine Göttin — unsre Muse, mein junger Freund.“
„Ich habe nur unter ihr gelitten bisher,“ sagte Nikoleit melancholisch.
Man war am Brandenburger Tore angelangt. Ein einspänniger, kleiner Pferdebahnwagen kam in gemächlichem Tempo von dem Bauzaun her, der das Gelände des künftigen Reichstagsgebäudes umschloss. Fast täglich benutzte Spitta diese Linie, die ihn zur Hochschule für Musik an der Potsdamer Brücke führte. „Kommen Sie übermorgen zwischen zwölf und ein Uhr in meine Wohnung, Herr Nikoleit. Landgrafenstrasse 11. Am Kanal.“ Er verabschiedete sich von den beiden jungen Leuten mit kurzem Händedruck und schob dann den etwas abgegriffenen Notenband mit Nikoleits kontrapunktischen Übungen unter den Arm zu seiner schwarzen Mappe.
Die beiden Studenten blieben mit gezogenen Hüten auf dem Platze stehen. Sie sahen noch, dass der Professor, gleich nachdem er sich im Wagen auf die Bank niedergelassen hatte, den Notenband aufschlug.
„Jetzt macht er bei jedem falschen Durchgang ein Kreuz,“ sagte Warnekross, behaglich lachend, „und wenn wir Ihr Manuskript zurückkriegen, dann sieht’s aus wie ein Totenacker.“
Während sein Stubennachbar in der Sprechstunde bei Spitta weilte, sass Warnekross am Klavier und las die dreistimmige Fuge, an die sich Nikoleit tags zuvor gewagt hatte. Einige Stellen spielte er mit harten Fingern mehrmals hintereinander. Je öfter er sie anschlug, desto greulicher klangen sie ihm. Er war noch nie so kritisch gewesen wie heute. In Nikoleit gärte und stürmte es, alles war Auflehnung in ihm. Er dagegen hatte nur Sinn und Liebe für Abgeklärtes. Sein Heiliger war neben Bach einzig und allein Mozart. Als er nach dem Tode seines Vaters in den Besitz des kleinen Vermögens gelangt war, das ihm ein Umsatteln und bescheidenes Auskommen ermöglichte, hatte er einen für seine Verhältnisse hohen Betrag daran gewandt, auf die Originalausgabe der Gesamtwerte seines himmlischen Wolfgang Amadeus zu subskribieren. Die — noch ungebundenen — Notenhefte füllten in hohen Stapeln seine ganze Stube. Es war nur eben noch Platz für Klavier, Bett, Waschständer, Schrank und Kommode. Von den beiden Anzügen, die Warnekross besass, hing der eine an einem Bildernagel; der Kleiderschrank war von oben bis unten mit Mozarts Kammermusik und den Partituren der Opern angefüllt. Orchesterstimmen der Sinfonien, Opern und Serenaden lagen in umfangreichen Bündeln unter dem Bett, in den Ecken der Dachschräge, vor dem Fenster. Das braune Tafelklavier trug die gewaltige Last von Mozarts Chorwerken, Messen, Sonaten und Liedern. Und jeden Monat kam noch ein neuer Posten hinzu, der soeben die Druckerei verlassen hatte. Warnekross war der einzige Privatmann, der auf die Gesamtausgabe subskribiert hatte; sonst besassen nur Bibliotheken das kostbare Werk. Es bildete seinen Lebensinhalt. Er konnte sich früh beim Waschen, noch mit dem Handtuch zwischen den Fäusten, auf den Bettrand setzen und in eine Motette vertiefen, ohne zu merken, wie die Zeit verging — bis Frau Knust voller Verzweiflung erschien, ihm verkündete, dass es Zwölf geschlagen hätte, und dass sie nun endlich das Zimmer in Ordnung bringen müsste. Er befand sich mit der gutmütigen, abgearbeiteten, alten Frau immer auf dem Kriegsfusse. Wegen solcher Störungen und wegen ihres Scheuerteufels. Wenn es nach ihm gegangen wäre, so hätte seine Wirtin auf jedes Staubwischen verzichten müssen. Er stand immer Todesängste aus, dass Frau Knust sich beim Feueranmachen an einem der wild durcheinander liegenden Notenhefte vergreifen könnte. „Ewige Verdammnis“ hatte er ihr für ein solches Verbrechen in Aussicht gestellt.
„Nee, wat so die Künstlers sind!“ stöhnte Frau Knust ihrem Manne vor, der Goldarbeiter war und hier in seiner Wohnung für kleinere Geschäfte Reparaturen ausführte. Von früh bis spät war er in der Küche am Lötkolben tätig. In der Küche stand auch sein Bett. Seine Frau schlief auf dem Hängeboden über dem verschwiegenen Kabinett neben der Küche. Das Vermieten der beiden Stuben, die zwar nach vornheraus lagen — nach dem Neuen Markte zu — aber schräge Wände hatten, brachte nicht viel ein. Zumeist waren es ärmere Studenten, die hier wohnten.
Schon mehrere Zimmerherren hatten den unglücklichen Knusts unter Zurückbehaltung eines Teiles der Monatsmiete die Wohnung und die Freundschaft wegen des ewigen, unausstehlichen Musizierens ihres Stammieters Warnekross gekündigt. Nikoleit war seit Jahren der erste gewesen, der sich nicht auflehnte. Als die Nachbarn dann miteinander bekannt wurden und sich sogar anfreundeten, fiel eine schwere Sorge von den Schultern des Ehepaares Knust.
Das Musizieren störte sonst niemand im Hause, nicht einmal nachts, denn in den unteren Stockwerken befand sich keine Privatwohnung. Zwei Treppen hoch lagen die Bureaus und Musterlager einer Kartonfabrik und einer auswärtigen Weberei. Das erste Stockwerk hatte die Stadt Berlin für Amtszwecke der Steuerverwaltung gemietet, und das Erdgeschoss mit dem kleinen Laden hatte ein halbtaubes altes Fräulein inne, das mit Nähzeug und Bänderkram handelte.
Die Freundschaft zwischen den beiden Studenten dauerte nun bald ein halbes Jahr. Hitzige Auseinandersetzungen hatte es aber oft genug zwischen ihnen gegeben. In den ersten Wochen war Frau Knust noch ängstlich aus der Küche auf den Korridor getreten, um zu lauschen. Jetzt focht sie’s nicht mehr an. Sie zankten sich nur um musikalische Dinge.
Aber temperamentvoll vertraten sie alle beide ihre Meinung. Jeder auf seine Weise. Nikoleit konnte dabei am meisten aus sich herausgehen. Er stürmte ans Klavier, schlug die Dissonanz an und die Auflösung, die er ihr geben wollte, und war verzweifelt darüber, dass Warnekross ihn nicht verstand. Der lachte ihn aus mit seinem dröhnenden Basse. Das war ja alles Unsinn, was Nikoleit da einführen wollte. Das war schlimmer als Unsinn — das war Richard Wagner!
Waren sie erst hier angelangt, dann gab es für Nikoleit kein Aufkommen mehr. Denn es war des Westfalen Tollpunkt. Seitdem vor fünf Jahren in Bayreuth der Parsifal herausgekommen war, gab es keine brennendere Frage als die Wagnerfrage. Man himmelte oder man schimpfte. Auch Wagners Tod hatte die Wagnerfrage nicht geklärt. Die seine Musik nicht mochten, unterliessen nie, zu erzählen, dass er Anno achtundvierzig unter den Revolutionären gestanden, und dass er seidene Wäsche und ein Barett getragen habe. Vieles von Wagner verstand Nikoleit nicht, es peinigte ihn sogar, das gab er dem hitzigen Freunde offen zu; aber an dem wunderbaren Abend in den Meistersingern zehrte er heute noch, nach Jahren.
Warnekross hatte einmal die Partitur aus der Hochschulbibliothek für ein paar Stunden geliehen bekommen. Da sassen sie denn am Klavier und studierten. Warnekross baute einige der Harmonieungeheuer auf, die sich darin befanden, Dissonanzen, eine hinter der andern, so dass man gar nicht zu Atem kam. Zudem entdeckte er bei der letzten Auflösung grobe Schnitzer gegen die Regeln der Satzlehre. Er lachte dröhnend, indem er dem Freund die Akkorde auf dem Klavier vorspielte. „Giftmischer, Brunnenvergifter, wahnsinnig gewordener Leierkasten, Gehörnervtöter —“ das waren noch seine milderen Bezeichnungen für den Bayreuther Komponisten. Aber Nikoleits geistiges Ohr hörte beim Durchfliegen einzelner Gesangsstellen, einzelner Violingänge wieder die schwelgerischen Melodien, die ihn so lange begleitet hatten, Tag und Nacht, und die wundersamen Orchesterwirkungen standen wieder vor ihm — wie durch einen freieren Luftzug ihm zugetragen. Er hatte Sehnsucht, ordentliche Sehnsucht danach, das Werk wieder einmal zu hören. Aber Warnekross übte eine Tyrannenherrschaft aus, die solch eine Ausschweifung nicht duldete: er hätte ihm ganz sicher die Freundschaft gekündigt. In vielen Dingen war Nikoleit der Gast des Westfalen. Dessen derbhumoristische Art schloss jede Zimperlichkeit bei seinem Freunde aus. Für die Bachkonzerte in der Garnisonkirche, einen Mozartabend der königlichen Kapelle, für eine Aufführung der Singakademie brachte Warnekross Eintrittskarten — natürlich zum billigsten Platze —, ab und zu nahm er den jungen Freund, der sein fleissiger Schüler geworden war, auch ins Konzerthaus zu Bilse mit, wo eine ganz tüchtige Musik gemacht ward. Hier kam Warnekross auch für Heftersche Würste und Bier auf. Er lebte einfach — aber die geradezu dürftige Lebensweise Nikoleits dauerte ihn. Der Hamburger bekam von seinem Alten sechzig Mark den Monat. Damit musste er auskommen. Ein Buch Notenpapier, eine Stiefelreparatur bedingte also stets eine Einschränkung der Mahlzeit. Warnekross fragte oft schon gar nicht, wo der Freund eigentlich zu Mittag gespeist habe. Aber abends lud er ihn zu seiner „Futterkiste“ ein, die ihm Verwandte vom Land zu schicken pflegten. Da gab es westfälischen Schinken und Pumpernickel, wie man ihn sonst in ganz Berlin kaum fand.
Der Westfale merkte, dass der Gehorsam seines Schülers zu schwinden begann, vielleicht auch sein Glaube an die gute Sache. An dem grossen Talent Nikoleits zweifelte er nicht. Aber dem jungen Menschen fehlte eine wichtige Gabe: die Freude an der edeln Linie. Wenigstens suchte er sie nicht in seinen Übungen.
„Wenn mir jetzt nur der Professor hilft! Zum Schwerebrett! Das ist ja eine Pferdearbeit, den Karren aus dem Dreck zu ziehen!“
Warnekross sprang immer wieder ungeduldig auf und schleuderte die Bogen auf den Stuhl. So wüst, so verzerrt hatte Nikoleit bisher überhaupt noch nichts geliefert. Ein Diabolus musste ihm im Nacken gesessen haben.
„Hätt’ ich das doch dem Spitta noch gezeigt! Der muss ihn scharf anfassen, sonst ist alles verratzt! Nur kein Nachgeben jetzt!“
Er horchte nach dem Treppenhaus. Nikoleit kam noch immer nicht. Jetzt hätte er ihn gern hier gehabt, um ihn zu zausen. Natürlich war er auch gespannt darauf, Spittas Urteil zu hören.
Aber der knurrende Magen trieb ihn endlich aus der Bude hinaus. Er ging essen, kehrte rascher als sonst zurück und wartete aufs neue. Um fünf Uhr musste er in die Probe der Singakademie, in deren gemischtem Chor er zweiten Bass sang. Von halb sieben bis sieben Uhr hatte er die Orgel in der Kirche seines Gönners, des dicken Organisten Hoffmann. Zunächst übte er dort einen wenig bekannten Orgelsatz von Mozart. Danach spielte er aus dem Gedächtnis die dreistimmige Fuge seines jungen Freundes. Es lag etwas darin, gewiss, sonst hätte sich ihm das Ding nicht so fest eingeprägt. Aber einige Stellen klangen ihm geradezu schauderhaft. Der Diabolus! Wie man sich solch wilde Durchgänge überhaupt nur ausdenken konnte, geschweige denn sie niederschreiben, damit die Missetat bestehen blieb, so lang der Fetzen Papier auf der Welt war!
Er summte auf dem Nachhauseweg und im Treppenhaus das eigenartige, besonders rhythmisch so frisch zupackende Fugenthema vor sich hin. Als er dann aber die Tür aufstiess und — wie stets — über einen der Notenstapel stolperte, brach er jäh ab: er sah Nikoleit nebenan auf dem Bettrand sitzen, die Ellbogen auf die Kniee aufgestützt, das Antlitz ganz vergraben in die krampfhaft ineinander verschlungenen Hände. Warnekross trat in den Türrahmen. „He, Sie, Nikoleit! — Bert! — Robert Nikoleit!“
Der junge Mensch fuhr auf. Feindselig, hasserfüllt sah er ihn an.
„Wo haben Sie denn gesteckt den ganzen Tag?“
Nikoleit antwortete nicht. Er schleuderte den Notenband, der neben seinem Schlapphut und seinem ärmellosen Havelock auf dem Bett lag, in die Ecke, erhob sich schroff und ging stampfenden Schrittes zum Dachfenster. Hier streckte er beide Arme aus, so dass seine Hände die weissgetünchten Wände des kleinen Erkers berührten, und starrte hinaus.
Die Sonne war schon hinunter. Doch über den Dächern des Häusergevierts, das den Neuen Markt vom Schlossplatz und Lustgarten trennte, stand eine ganz unmöglich rote Wolke. Sie wirkte wie die glühende Wand eines Riesenofens. In der Mitte unten das Feuerloch: der Ausgangspunkt von tausend elektrischen Strahlen. Die Ränder der im lichten Blau schwimmenden Wolke waren vielfach gezackt, Risse und Sprünge, durch die das Licht sich stehlen wollte, gab’s auf der ganzen Fläche.
So ein Bild hatte sie oft poetisch gestimmt. Besonders gegen Monatsschluss hin, wo andre Anregungen unerschwinglich waren.
„Also haben wir nicht prima abgeschnitten bei einer hohen Obrigkeit?“ meinte Warnekross trocken.
In Nikoleits Brust arbeitete es. Man sah’s an den Umrissen, wie sein schlanker Oberkörper mit dem charakteristischen Kopf sich gegen den lichten Abendhimmel abzeichnete. Noch immer schwieg er. Er kämpfte mit sich — gegen sich. Aber plötzlich wandte er sich um und stiess verzweifelt aus: „Nirgends hab’ ich Hilfe! Niemand versteht mich! Es wäre ja besser, ich hätte nie eine Note geschrieben!“
Inzwischen griff Warnekross nach dem Notenheft und durchblätterte es. Es wies nur wenig Korrekturen auf. „Was wollen Sie, Alterchen? Das ist ja noch ganz gnädig abgegangen. Und darum Mord und Totschlag?“
„Darum?“ Nikoleit zuckte die Achsel. „Meinetwegen hätt’ er in dem Zeug noch zehnmal mehr Fehler finden dürfen. Das hätte mich nicht gegrämt. Dass ich den strengen Satz noch nicht beherrsche, das weiss ich doch.“
„Haben Sie ihm auch von Ihren früheren Sachen vorgespielt?“
„Ja. Ein paar Lieder. Dann meine Konzertphantasie.“
„Nun, und was sagte er?“
„Nichts. Er lächelte gnädig verzeihend. Und endlich meinte er nur: ‚Nun, wenn Sie noch zwei Jahre Kontrapunkt gearbeitet haben, dann schreiben Sie das nicht mehr.‘“
„Darin hat er recht. Fraglos. Die Sachen wimmeln ja von Fehlern.“
„Ja, wenn er bloss auf das Schulgemässe achten kann —! Ich hungere doch nach einem einzigen guten Wort. Lohnt es überhaupt, dass ich weiterarbeite? Ich kann doch nicht lange Jahre für einen unsicheren Versuch hinopfern. Mir brennt es unter den Nägeln. ‚Verwirren Sie sich nicht,‘ sagte er. ‚Vergessen Sie Ihre früheren Versuche. Denken Sie vorläufig nicht anders als im reinen Satz.‘“
„Recht hat er. Das predige ich Ihnen doch auch immer.“
„Und ihr peinigt mich damit. Ihr verlangt etwas Unmögliches. Ich kann mich zwingen, solang ich Fugen schreibe, an alle Regeln und Gesetze zu denken. Aber Musikist das für mich nicht. Das sind für mich bloss Rechenexempel — Schachaufgaben.“
„So. So. Heiliger Strohsack. Also Bach, Johann Sebastian Bach, der ist nicht Musik für Sie?“
„Ich bewundere ihn. Aber mein Herz packt er nicht.“
„Weil Sie überhaupt kein Herz haben, Sie Lausbub!“ Warnekross nahm in seinem Zorn Nikoleits Schlapphut vom Bett auf und schleuderte ihn dem Ketzer an den Kopf. „Bach — Rechenexempel, Schachaufgaben! Fünfundzwanzig aufzählen sollt man Ihnen! — Der grässliche Wagner! — Sehen Sie, die grosse Gefahr, die der verflixte Giftmischer für Sie bedeutet, die hat der Professor aus Ihren früheren Arbeiten herauserkannt. Darum gibt er Ihnen den guten Rat, nur Kontrapunkt zu arbeiten. Auch nur zu denken darin.“
„Und wenn ich träume? Wenn’s in mir klingt? Wenn ich neuen Motiven folge, neue Harmonien höre? Soll denn all das nicht mehr für mich auf der Welt sein, was mir Freude macht? Nur noch das, was ich hasse, was mir die ganze Musik verleidet?“
„Quark. Das bisschen Schurigeln gehört zur Erziehung. Das ist gesund. Noch ein Jahr Kontrapunkt — oder anderthalb, höchstens zwei — und Sie haben den Diabolus in sich überwunden. Dann sollen Sie schreiben, was Sie wollen.“
„Ein Jahr — anderthalb — zwei Jahre! Nein, nein, nein, nein, das halt’ ich nicht aus! Lieber verzichte ich auf alles!“
„Nikoleit! Sie alter Querkopf!“ Erschrocken setzte er hinzu: „Haben Sie das etwa auch zum Professor gesagt?“
„Ich kam ja gar nicht dazu, etwas zu erwidern.“
„Ein wahres Glück. Aber er hat doch gesagt, dass er sich für Sie interessieren will, wie?“
„Ja.“ Zögernd berichtete er: „Er hat mir in Aussicht gestellt, ich könnte eine Freistelle auf der Hochschule bekommen. Mit dem Freiherrn von Herzogenberg hatte er auch schon über mich gesprochen und ihm meine Kompositionen gezeigt. Der wollte mich als Schüler annehmen.“
„Und Sie jubeln nicht? Nikoleit, Sie Erzhalunke, Sie jubeln nicht? Das ist doch ein Glück ohnegleichen! Die ersten Musikprofessoren von ganz Deutschland — ach was, von der ganzen Welt — machen Ihnen so ein glänzendes Anerbieten.... Sind Sie Herzogenberg vorgestellt worden? Wie war er? Reden Sie doch. Ein wundervoller Mensch, wie? Still und fein.... Was hat er zu Ihnen gesagt? Hat er die dreistimmige Motette gelesen?“
„Ja. Gerade davon sprach er. Ich müsste sie singen hören. Ob ich nicht ein Terzett zusammenbringen könnte: Alt, Tenor und Bass. Beim Einüben und beim Hören lernte man am allermeisten.“
„Klug ist das, sehr klug. Da rächt sich nämlich gleich jede Unreinheit im Satz. Grade wie bei der Orgel. Weiter, weiter. Seien Sie doch nicht so maulfaul, Nikoleit.“
Er liess sich jetzt jedes Wort abzwingen. Aber Warnekross gab nicht nach.
„Zufällig kam gerade der Raith zur Stunde. Wissen Sie: der aus Spittas Kolleg. Den fragte der Professor, ob er nicht ein paar junge Leute kennte, die Singstimme hätten. Es wären keine Berufssänger nötig, nur musikalisch müssten sie sein. Und der darauf gleich: ja, das liesse sich machen. In seiner Pension wären zwei Hochschüler, die viel Duette übten. Vielleicht hülfe auch seine Schwester mit. Die ist Schülerin von der Schulzen von Asten.“
Warnekross war sofort begeistert. Er kannte sie vom Sehen. „Fräulein Raith — ja, ja, sie singt im Hochschulchor mit. Ein prächtiges Kerlchen. Ein Paar Augen hat die im Kopf —! Wenn sie aufs Podium kommt, verrenkt sich immer der ganze Tenor die Hälse. ... Da wird mein Nikoleitchen auch schon die Lichter aufreissen. ... Sehen Sie mal an! Das hätt’ ich dem bocksteifen Raith gar nicht zugetraut, dass er so nett zu Ihnen sein kann!“
Nikoleit zuckte die Achsel. „Er tat das doch nicht meinetwegen. Bloss um sich bei Spitta lieb Kind zu machen. Übermorgen abend sollt’ ich also hinkommen. Sonntag um sieben Uhr. Da musizierten sie immer in der Pension alle zusammen. Sie hätten da häufig Besuch.“
„Also werden wir einen anständigen Schlips für Sie erstehen, Nikoleit, damit Sie die Damen des Hauses nicht erschrecken — den Sie jetzt tragen, der macht die frömmsten Gäule scheu — und Sie werden pünktlich um sieben Uhr dort antanzen.“
„Ich habe keine Lust.“
„Was heisst das?“
„Einmal: überhaupt. Und dann: das sind dort lauter Hochschüler. Die haben andre Götter als ich. Da würd’ ich mich schliesslich doch nur zanken. Nein, nein, es hat keinen Zweck. Am besten: gar nicht erst anfangen.“
„Dunnerschock, aber Sie beleidigen damit die Leute. Und gleichzeitig Herzogenberg und Spitta. Die bieten Ihnen die Hand — und Sie wollen sie ausschlagen?“
Nikoleit seufzte tief und schwer. „Ich denke, ich werde die Musik — überhaupt aufgeben.“
„Sind Sie bei Sinnen? Nikoleit! Mit Ihrem Talent!“
„Ich kann nicht noch zwei Jahre opfern. Mein Alter daheim rechnet damit, dass ich bald auf eigenen Füssen stehe. Nein, nein, ich werde mich jetzt auf die Hosen setzen und lieber fürs Examen pauken.“
„Trotzdem Sie Ihr Studium hassen?“
„Trotzdem.“
Warnekross steckte die Fäuste in die Taschen seiner Jacke. Lange überlegte er. Dann sagte er, immer noch in dem poltrigen Ton von zuvor: „Not sollen Sie nicht zu leiden haben, Nikoleit. Ob Ihr Alter nun einen Zuschuss geben will oder nicht: ich komme für die paar Jahre auf. Kerlchen, hören Sie? Ehrenwort: ich helf’ Ihnen durch. Also überlegen Sie sich’s. Wir teilen meine paar Kröten, wenn sie am Ersten von der Bank kommen. Bis Sie auf eigenen Füssen stehen. Still, reden Sie nicht. Erst einmal beschlafen. — Aber dann Mann gegen Mann, Sie alter Trotzkopf. Verstanden?“
Er duldete keine Antwort. Derb freundschaftlich klopfte er dem Hamburger auf die Schulter und verliess das Zimmer.
Es war spät geworden. Er hatte sich müde und matt geredet.
Als er in dieser Nacht einmal aufwachte, gewahrte er Lichtschein aus dem Nachbarzimmer. Er hörte das Knistern von Papier, das Rascheln des Bleistifts. Manchmal dazwischen ein Räuspern, ein halblautes Summen oder Trällern.
Nikoleit komponierte.
Beruhigt nickte Warnekross und legte sich auf die andre Seite: also es war klar, Nikoleit ging auf seinen Vorschlag ein!
Es schneite. Der Wind trieb die Flocken gegen das Fenster. Das sah sich lustig an. Es war auch blendendhell im Zimmer. Aber bitterkalt. Auf die Ausgabe für Heizmaterial hatte Nikoleit jetzt — Ende März — nicht mehr gerechnet. Es musste den heutigen Sonntag also ohne Feuer gehen. Er hätte eine kleine Anleihe bei seines Nachbars Brikettvorrat vornehmen können. Früher war das öfters vorgekommen. Jetzt widerstrebte es ihm. Er suchte heute geflissentlich jede Begegnung mit ihm zu vermeiden. Alles lehnte sich auf in ihm gegen eine weitere Bevormundung.
Warnekross war von halb acht Uhr an ausser dem Hause. Er vertrat bei zwei Gottesdiensten den Organisten Hoffmann an der Orgel. Weder von den Seelennöten seines Freundes noch von seinen blaugefrorenen Händen hatte er eine Ahnung.
Inzwischen packte sich Nikoleit bei der Arbeit in seinen ärmellosen Havelock, legte die wollene Bettdecke über die Knie und hauchte von Zeit zu Zeit die steifen Finger an, die den Bleistift kaum mehr halten konnten.
Seine neue Komposition war fertig. Es war ein in freier Liedform gehaltener Landsknechtgesang für drei Stimmen: die Altstimme eines ganz jungen Burschen, einen trompetenhellen Tenor und einen kräftigen Bass. Den Text hatte er bei literaturgeschichtlichen Studien aus der Lutherzeit aufgestöbert. Das Ding war ihm flott von der Hand gegangen. Der Rhythmus war marschartig; etwas Treibendes, sieghaft Vorwärtsstürmendes lag in der Melodie. Nun schrieb er noch rasch die drei Stimmen aus, in der Hoffnung, dass sich am Abend eine Gelegenheit finden würde, auch dieses kleine Stück vom Blatt zu singen.
Warnekross durfte die Komposition nicht sehen. Dem war das alles zu kühn, zu gewaltsam.
Vor dem Besuch in der Pension in der Königgrätzerstrasse hatte Nikoleit Lampenfieber. Aus mehreren Gründen. Er wusste, dass Raith dem Professor über die Wirkung der Motette Bericht erstatten würde. Dabei kam dann vielleicht auch die neue Komposition zur Sprache.
Und dann genierte ihn der Gedanke, dass er äusserlich eine klägliche Rolle neben Raith spielen würde, der ein verwöhntes Haussöhnchen zu sein schien, immer wie aus dem Ei gepellt ging, während sein eigener Aufzug recht fragwürdig war.
Er hatte sich wenigstens, dem Rat des Westfalen folgend, eine neue Krawatte gekauft. Die alte sah gar zu ruppig aus. Seine Mutter hatte sie seinerzeit aus den Abfällen ihrer rotbraunen Samtrobe selbst zusammengeschneidert, des berühmten Staatskleides, in dem sie nun durch mehrere Moden hindurch siegreich bei allen festlichen Gelegenheiten erschien — das heisst also im Theater und im Konzert, wenn ihr Gatte ein Klarinettensolo zu blasen hatte.
Die Ausgabe für die neue Anschaffung musste auf andre Weise eingebracht werden, denn es waren immer noch einige Tage bis zum Monatsersten zu überstehen. Noch bevor Warnekross vom Gottesdienst zurückkehrte, verliess Nikoleit sein „Eispalais“ — wie er seine Bude in einem Anfall von Galgenhumor nannte — und machte sich auf den Weg zu seinem Sonntagsmahl. Manchmal speiste er in den Akademischen Bierhallen hinter der Singakademie. Aber nur in der ersten Monatshälfte, wo er die Summe von siebzig bis achtzig Pfennigen dafür aufbringen konnte. Heute suchte er das Volksspeisehaus in der Alexanderstrasse auf, zwei Treppen hoch in einem Hofgebäude, wo er eine Mahlzeit für vier Groschen erhielt: Suppe, ein Stückchen Fleisch, reichlich Kartoffeln und Kompott. Der Wirt, ein Original, überwachte die Austeilung der Portionen mit grosser Gerechtigkeit. Er hatte die armen Studenten und kleinen Handlungsgehilfen besonders gern und verkehrte väterlich mit ihnen. Einmal hatte ein stämmiger junger Mensch eine zweite Portion Milchreis verlangt. Der Wirt war daraufhin bestürzt herbeigekommen und hatte sich den Unersättlichen angesehen. „Gebt’s ihm, gebt’s ihm!“ rief er dann mit schallender Stimme in den Anrichteraum hinein, „Platzt er, so platzt er!“ Das war unter den Stammgästen ein geflügeltes Wort geworden. Ebenso wie seine Auskunft auf eine Ausstellung, einmal, als der Nachtisch nur aus saurer Gurke bestand. Zornig raunzte er den kecken Beschwerdeführer an: „Student wollen Sie sein und haben keine Ahnung von der Botanik? Merken Sie sich, junger Mann: Gurken sind auch Kompott!“
Man ass an blankgescheuerten Tischen. Servietten gab es natürlich nicht. Getrunken wurde Wasser. Einzelne Schlemmer leisteten sich eine Berliner Weisse. Die Brotkörbe mussten immer wieder gefüllt werden. Daran sparte der Wirt nicht. Glänzend konnte seine Einnahme also nicht sein. „Am einzelnen setz’ ich zu — die Masse muss es bringen,“ pflegte er mit drolliger Selbstironie zu sagen.
Wenn Nikoleit sich rundum von Gleichaltrigen umgeben sah, dann schmeckte ihm das Essen — es war die richtige derbe Kasernenkost —, aber es fanden sich oft auch armselige Existenzen ein, heruntergekommene ältere Männer, die früher bessere Tage gesehen haben mochten und sich vor dem jungen Volk genierten. Dann packte ihn hier der Menschheit ganzer Jammer an, und die eigene, noch so unsichere Zukunft erschien ihm grau in grau.
Stundenlang trieb er sich heute nach dem Essen im Schnee im Tiergarten herum. In seinem Kopf spukte schon wieder ein neuer Entwurf. Es war besonders ein breites, wuchtiges, rhythmisch eigenartiges Thema, das er sich vom Cello gespielt dachte. Am liebsten hätte er es sofort zu Papier gebracht. Aber vor seiner eiskalten Bude hatte er ein wahres Grauen.
Die Sonntage im Winter waren ihm schon manchmal endlos vorgekommen. In der Woche konnte er wenigstens, wenn er zu Hause genug gearbeitet hatte, einer Orchester- oder Chorprobe in der Hochschule beiwohnen. Da hörte er und lernte zugleich — und befand sich dabei in einem gutgeheizten Raum. Aber wehe, wenn er sich an einem Sonntag wegen irgendeiner musikalischen Streitfrage mit Warnekross entzweit hatte, so dass der allein ausging. Auch der Bibliotheksaal war Sonntags geschlossen. Es blieb ihm da oft nichts übrig, als sich schon um acht Uhr in die Klappe zu legen.
Pünktlich um sieben Uhr fand er sich heute in der Königgrätzerstrasse ein. Die Pension wurde von Raiths Tante, der Witwe eines Oberstabsarztes, geführt. Sie hatte ein ganzes Stockwerk von vierzehn Zimmern mit Pensionären besetzt. Die Hälfte davon bestand aus Musikstudierenden. Raith, der sehr nervös war, hatte ihm neulich schon Auskunft darüber gegeben. Es wäre manchmal zum Davonlaufen, sagte er, wenn in verschiedenen Zimmern nebeneinander musiziert wird. Ein Wohnungswechsel war für ihn aber ausgeschlossen, seiner Schwester wegen, die den Anschluss nicht entbehren sollte.
Nun ward er Frau Grusovius, der Oberstabsarztwitwe, vorgestellt, die im allgemeinen Salon die Gäste in tadelloser Form empfing. Noch mehrere Pensionäre ausser Raith hatten Besuch für den Abend. Nikoleit erkannte jetzt erst, dass er zum Essen eingeladen war. Musiziert ward erst nach Tisch. Er kam sich beschämt vor. In Gesellschaft hätte er sich schon seines überbescheidenen Aufzugs halber nicht gewagt.