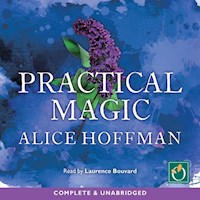5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Poetisch, kraftvoll, unvergesslich: Die Frauensaga »Die Geheimnisse der Sparrow-Frauen« von Bestsellerautorin Alice Hoffman als eBook bei dotbooks. Es sind tiefe Gefühle, die jede Familie zusammenhalten – aber sie können scharfe Dornen haben … Schon seit langer Zeit wird in der neuenglischen Kleinstadt Unity über die Frauen der Familie Sparrow geflüstert: Jede von ihnen wird im März geboren, eine Botin des nahenden Frühlings, berauschend schön und mit einer geheimnisvollen Gabe gesegnet. So können nun auch Elinor, ihre Tochter Jenny und Enkelin Stella durch einen einzigen Blick Lügner erkennen, in fremden Träumen wandeln und den Tod anderer Menschen vorhersagen. Doch sind diese Fähigkeiten ein Geschenk … oder ein Fluch, der schwer auf ihren Schultern lastet? Als Stella durch eine einzige unachtsame Äußerung in große Gefahr gerät, können nur die seit Jahren entzweiten Elinor und Jenny sie schützen – aber werden sie in der Lage sein, die Mauern zu überwinden, die sie voller Zorn und verzweifelter Liebe zwischen sich aufgebaut haben? Drei Frauen, die den Stolz und Schmerz vieler Generationen in sich tragen: »Ein verzauberndes Buch! Die Geschichte, die Alice Hoffman erzählt, ist spannend und dicht, zärtlich und voller Sinnlichkeit.« Booklist Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Geheimnisse der Sparrow-Frauen« der New-York-Times-Bestsellerautorin Alice Hoffman ist so fesselnd wie ihr Welterfolg »Practical Magic – Zauberhafte Schwestern« und ein Lesetipp für alle Fans von Delia Owens und Mariana Leky. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Es sind tiefe Gefühle, die jede Familie zusammenhalten – aber sie können scharfe Dornen haben … Schon seit langer Zeit wird in der neuenglischen Kleinstadt Unity über die Frauen der Familie Sparrow geflüstert: Jede von ihnen wird im März geboren, eine Botin des nahenden Frühlings, berauschend schön und mit einer geheimnisvollen Gabe gesegnet. So können nun auch Elinor, ihre Tochter Jenny und Enkelin Stella durch einen einzigen Blick Lügner erkennen, in fremden Träumen wandeln und den Tod anderer Menschen vorhersagen. Doch sind diese Fähigkeiten ein Geschenk … oder ein Fluch, der schwer auf ihren Schultern lastet? Als Stella durch eine einzige unachtsame Äußerung in große Gefahr gerät, können nur die seit Jahren entzweiten Elinor und Jenny sie schützen – aber werden sie in der Lage sein, die Mauern zu überwinden, die sie voller Zorn und verzweifelter Liebe zwischen sich aufgebaut haben?
Drei Frauen, die den Stolz und Schmerz vieler Generationen in sich tragen: »Ein verzauberndes Buch! Die Geschichte, die Alice Hoffman erzählt, ist spannend und dicht, zärtlich und voller Sinnlichkeit.« Booklist
Über die Autorin:
Alice Hoffman, geboren 1952 in New York, studierte Creative Writing an der Stanford University. Sie hat über vierzig Romane und Jugendbücher veröffentlicht, die mehrfach preisgekrönt, verfilmt und in viele Sprachen übersetzt wurden. Die besondere Eindringlichkeit, die ihr Werk auszeichnet, wurde von der amerikanischen Zeitschrift Entertainment Weekly treffend zusammengefasst: »Alice Hoffman scheint in die Haut ihrer Figuren zu schlüpfen, ihre Luft zu atmen und ihre Gedanken zu denken – und dies mit einer Könnerschaft, die einen vergessen lässt, dass es sich um erfundene Charaktere handelt.« Und auch das renommierte Nachrichtenmagazin Newsweek spricht LeserInnen und KritikerInnen gleichermaßen aus der Seele: »Alice Hoffman ist eine der besten Erzählerinnen ihrer Generation!«
Die Website der Autorin: alicehoffman.com
Bei dotbooks veröffentlichte Alice Hoffman ihre Romane »Die Frauen der Hemlock Street«, »Ein Sommer in Fox Hill« und »Am Ufer des Haddan River«.
***
eBook-Neuausgabe August 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »The Probable Future« bei Doubleday, New York. Die deutschsprachige Erstausausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Märzkinder« im Goldmann Verlag.
Copyright © der Originalausgabe 2003 by Alice Hoffman
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2005 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Bildmotives von shutterstock / photoagent
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-390-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Geheimnisse der Sparrow-Frauen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Alice Hoffman
Die Geheimnisse der Sparrow-Frauen
Roman
Aus dem Englischen von Sibylle Schmidt
dotbooks.
Im Gedenken an
meine Mutter, Sherry Hoffman, die nicht an Grenzen glaubte,
und meine liebe Freundin Maclin Bocock Guerard, eine wunderbare Autorin und wunderbare Seele.
ERSTER TEIL
Die Vision
Kapitel 1
Wer in Massachusetts geboren und aufgewachsen ist, hat von klein auf gelernt, das Ende des Winters zu erkennen. Babys, die noch nicht einmal krabbeln können, zeigen in ihrer Wiege zum Himmel, wenn das Licht heller wird. Gelassene Männer weinen beim ersten Ruf der Grasmücken. Ernsthafte Frauen reißen sich die Kleider vom Leib und springen in Bäche und Teiche, obwohl das Eis noch nicht geschmolzen ist, und scheren sich nicht darum, ob ihre Finger und Zehen blau anlaufen. Das Frühlingsfieber befällt Jung und Alt, niemand bleibt verschont, und es zeigt sich dann, wenn Glück schier unmöglich scheint, wenn Freude nur als weit entfernte Erinnerung vorkommt, wenn der Himmel wolkenverhangen und die Erde hart und gefroren und unter einer Schneedecke verschwunden ist.
Und wer könnte den Bewohnern von Massachusetts ihre Freude über das Nahen des Frühlings übel nehmen? Der Winter in Neuengland ist grausam und unerbittlich, eine Jahreszeit, in der die Menschen zur Schwermut neigen und zu einem Trübsinn, der sich nicht vertreiben lässt. In den kleinen Städten im Umkreis von Boston verursachen der bleigraue Himmel und die Schneemassen zeitweilig eine Farbenblindheit, die nur durch erste grüne Sprösslinge des Frühlings geheilt werden kann. Es kommt auch vor, dass alle Bewohner einer Stadt im März Tränen in den Augen haben, und manche behaupten, dass sie zum ersten Mal klar sehen können.
Andere dagegen begrüßen die Vorboten des Frühlings weniger überschwänglich. Sie misstrauen dem März und halten ihn für die gefahrvollste Zeit des Jahres. Diese starrköpfigen Gestalten tragen auch an den strahlendsten Tagen Wollmäntel und behaupten, selbst mit bestem Sehvermögen könne man in dieser wankelmütigen Jahreszeit ein Schneeglöckchenfeld nicht von einer Eisfläche unterscheiden. Solche Menschen kann man nicht davon überzeugen, dass Löwen sich jemals in Lämmer verwandeln. Sie sind der Meinung, alle März-Geborenen seien geprägt von der Unbeständigkeit jener launischen Jahreszeit, in der es gerade eben noch heiß und im nächsten Moment eiskalt sein kann. Gewiss ist der März ein wetterwendischer Monat, das kann niemand leugnen. Und seine Kinder gelten als ebenso unberechenbar.
In manchen Fällen trifft dies auch wirklich zu. Bei den Sparrows kamen, so weit man die Geschichte der Familie zurückverfolgen kann, immer nur Mädchen zur Welt, und jede einzelne dieser Töchter behielt den Familiennamen bei und feierte ihren Geburtstag im März. Selbst die Kinder, bei denen man sicher davon ausgehen konnte, dass sie in den schneereichen letzten Tagen des Februar oder im kargen Licht des April geboren würden, schafften es, im März zur Welt zu kommen. Wann das Kind auch erwartet wurde, sobald in Neuengland die ersten Schneeglöckchen aufblühten, wurden die Sparrow-Babys unruhig. Und wenn sich erst die Blätter entfalteten und die Sternhyazinthen aufblühten, hielt es keines dieser Kinder mehr im Bauch, denn das Frühlingsfieber nahte.
Dennoch waren die Sparrow-Mädchen so unterschiedlich wie die Tage des März. Manche waren still und großäugig und wurden mit offenen Händchen geboren, Zeichen ihrer künftigen Großmütigkeit, während andere aufgebracht und schreiend zur Welt kamen und so zornig waren, dass man sie rasch in eine blaue Decke wickelte, um Nervenkrankheiten und einer Neigung zu Schlaganfällen vorzubeugen. Manche Babys in der Sparrow-Familie kamen zur Welt, während draußen dicke weiße Schneeflocken vom Himmel fielen und der Hafen von Boston zugefroren war, andere wurden an sonnigen warmen Tagen geboren und taten ihren ersten Atemzug, während die Rotkehlchen aus Gräsern und Zweigen Nester bauten und der Rotahorn seine erste Blütenpracht zur Schau trug.
Doch ob das Wetter wüst oder sonnig war, in all den Jahren kam nur ein einziges Kind mit den Füßen zuerst auf die Welt, Zeichen eines Heilers, und dieses Kind war Stella Sparrow Avery. Seit dreizehn Generationen hatten die Sparrow-Mädchen bei ihrer Geburt blauschwarzes Haar und dunkle rätselhafte Augen, aber Stella war hell, und die Hebammen nahmen an, dass sie ihr aschblondes Haar und ihre hellbraunen Augen von ihrem gut aussehenden Vater geerbt hatte. Ihre Geburt war so schwierig, dass Mutter und Tochter in Lebensgefahr schwebten. Alle Versuche, das Baby im Mutterleib zu drehen, waren gescheitert, und die Ärzte fürchteten sich vor dem Ende des Tages. Die Mutter, Jenny Avery, eine selbstständige, nüchterne Frau, die mit siebzehn von zu Hause weggelaufen und so verstandesbetont wie unabhängig war, hörte sich zu ihrem eigenen Erstaunen nach ihrer Mutter rufen. Dass sie nach ihrer Mutter rief, die so kalt und distanziert gewesen war und mit der sie seit über zehn Jahren kein Wort mehr gewechselt hatte, überraschte Jenny mehr als die Qualen der Geburt. Es war verwunderlich, dass ihre Mutter sie nicht hörte, denn obwohl Elinor Sparrow fünfzig Meilen von Boston entfernt lebte, waren Jennys Schreie so schrill und verzweifelt, dass sie sogar verschlossenen und hartherzigen Menschen durch Mark und Bein gingen. Andere Frauen auf der Station, deren Wehen gerade eingesetzt hatten, steckten sich die Finger in die Ohren, wandten ihre Atemtechniken an und beteten, es möge ihnen besser ergehen. Pflegerinnen wünschten sich inständig, zu Hause unter ihrer Bettdecke zu liegen. Patienten auf der Herzstation spürten, wie ihr Puls zu rasen begann, und in der Cafeteria gerann der Zitronenpudding in allen Schalen und musste in den Müll geworfen werden.
Schließlich kam das Kind zur Welt, nach siebzehnstündigen brutalen Wehen. Der Dienst habende Geburtshelfer brach dem Baby ein Schulterblatt bei dem Versuch, die Geburt zu beschleunigen, denn der Puls der Mutter fiel rasch. In diesem Augenblick, als der Kopf des Babys sich befreite und Jenny Avery glaubte, sie würde ohnmächtig, klarte der wolkenverhangene Himmel auf und gab den Blick frei auf die silbrig leuchtende Milchstraße, das Herz des Universums. Jenny blinzelte in das helle Licht, das durchs Fenster drang, und die Schönheit der Welt lag vor ihr, als sähe sie alles zum ersten Mal. Das Sternengewölbe, der schwarze Nachthimmel, das Leben ihres Kindes, alles verwob sich zu einem einzigen Band aus Licht.
Weder hatte Jenny unbedingt ein Kind gewollt, noch wie manch andere Frauen sehnsüchtig darauf gewartet und verträumt Schaukelpferde und Wiegen beäugt. Ihre schwierige Beziehung zu ihrer eigenen Mutter hatte sie misstrauisch gemacht gegenüber Familienbindungen, und ihre Ehe mit Will Avery, gewiss einem der unzuverlässigsten Männer von ganz Neuengland, schien ihr nicht der richtige Hintergrund, um ein Kind großzuziehen. Und dennoch kam dieses Baby in einer Nacht im März zur Welt, in der zahllose Sterne am Himmel standen, im Monat der Sparrows, jener Zeit, in der Schnee und Frühling zugleich eintrafen, der Zeit der Löwen und Lämmer, des Abschieds und des Anfangs, in jenem Monat, der grün war und weiß war, der tiefen Schmerz brachte und großes Glück.
Das kleine Mädchen schrie nicht, bis man es in eine Flanelldecke wickelte; dann kamen kleine Quietscher aus dem winzigen Mund, wie von einem Kätzchen, das in eine Pfütze gefallen war. Sie ließ sich leicht beruhigen, der Arzt tätschelte der Kleinen nur ein-, zweimal den Rücken, doch da war es schon geschehen: Ihre Laute waren Jenny in die Seele gedrungen wie ein Haken, der durch Fleisch und Blut fährt. Jenny Sparrow Avery nahm ihren Mann nicht mehr wahr und auch nicht die Krankenschwestern, mit denen er flirtete. Die Blutflecken auf dem Boden, ihre zitternden Beine und sogar die Milchstraße dort oben am Himmel waren ihr einerlei. Blendende Lichtkreise funkelten in ihren Augen, helle Lichtpunkte, die unter ihren Lidern glimmerten. Nicht das Licht der Sterne war es, sondern etwas ganz anderes. Etwas, das sie erst begreifen konnte, als der Arzt ihr das Kind reichte, dessen schiefe linke Schulter wie ein gebrochener Flügel mit weißem Pflaster angeklebt war. Jenny blickte in das stille Gesicht ihres kleinen Mädchens. In diesem Moment empfand sie absolute Hingabe. Dort, im fünften Stock des Brigham and Women's Hospital, in jenem Augenblick spürte sie, was es heißt, von Liebe geblendet zu sein.
Die Hebammen drängten sich bald um sie, hätschelten und priesen das Baby. Sie hatten schon so viele Geburten erlebt, doch dieses Kind war außergewöhnlich. Nicht ihr helles Haar und ihre schimmernde Haut unterschieden sie von anderen, sondern ihre innere Ruhe. Was für ein Herzblatt, murmelten die Hebammen beeindruckt, so lieb und sanft. Selbst den stumpfesten Menschen musste auffallen, dass dieses Kind etwas Besonderes war. Vielleicht lag ihr Charakter im Zeitpunkt ihrer Geburt begründet, denn Jennys Tochter hatte am zwanzigsten März das Licht der Welt erblickt, der Tagundnachtgleiche, jenem einzigen Zeitpunkt des Jahres, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Und wahrhaftig schienen sich in diesem winzigen schwachen Körper alle Eigenschaften des März zu vereinen, das Gerade und das Ungerade, die Dunkelheit und das Licht, ein Wesen, das stets mit Löwen ebenso gut auskam wie mit Lämmern.
Jenny gab der Kleinen den Namen Stella, natürlich mit Wills Zustimmung. Denn trotz ihrer mannigfachen Eheprobleme waren sie sich in diesem einen Punkt einig: Dieses Kind war ihr strahlender und wunderbarer Stern. Es gab nichts, das Jenny nicht für ihre Tochter getan hätte. Sie, die seit Jahren mit ihrer Mutter kein Wort gewechselt hatte, die nicht einmal eine Postkarte nach Hause geschrieben hatte, seit sie mit Will durchgebrannt war, fühlte sich nun außerstande, sich ihrer mütterlichen Instinkte zu erwehren. Sie war diesem kleinen Wesen verfallen; der Rest der Welt verschwand im Nu, zurück blieb nur ihre Stella. Jennys Mädchen sollte keine Nacht von ihrer Mutter getrennt sein. Sogar in der Klinik behielt Jenny sie bei sich und ließ sie nicht auf die Kinderstation bringen. Jenny Sparrow Avery wusste genau, was geschehen konnte, wenn man nicht zur Stelle war und über sein Kind wachte. Sie war sich nur allzu deutlich bewusst, was zwischen Müttern und Töchtern alles schief laufen konnte.
Doch nicht jeder war dazu verurteilt, die Geschichte zu wiederholen. Fehler und Kummer in der Vergangenheit mussten nicht das weitere Leben bestimmen, das sagte sich Jenny jedenfalls jeden Abend, wenn sie nach ihrer schlafenden Tochter sah. Was war die Vergangenheit schon außer einer bleiernen Kette, die man sprengen und abschütteln musste? Es war möglich, sich ihrer zu entledigen, so alt oder rostig diese Kette auch sein mochte, davon war Jenny überzeugt. Es war möglich, ein ganz neues Leben zu schmieden. Doch Ketten, die aus Blut und Erinnerungen bestanden, waren tausendmal schwieriger zu zerstören als jene aus Eisen, und man konnte von der Vergangenheit eingeholt werden, wenn man sich nicht vorsah. Eine Frau musste wachsam sein, sonst beging sie womöglich dieselben Fehler wie die eigene Mutter und schuf denselben Zorn.
Jenny hatte nicht die Absicht, sich zu entspannen oder auch nur das winzigste Fetzchen Glück für selbstverständlich zu halten. Sie war tagtäglich auf der Hut. Sollten andere Mütter am Telefon plaudern oder Babysitter bestellen; sollten sie an sonnigen Tagen im Boston Common sitzen und an Wintertagen Schneeengel machen. Jenny hatte keine Zeit für solchen Unsinn. Ihr blieben nur dreizehn Jahre, um das Vermächtnis ihrer Familie abzuwehren, und genau das wollte sie tun, welchen Preis auch immer sie dafür bezahlen musste.
Im Handumdrehen wurde sie zu der Sorte von Mutter, die stets darauf achtete, dass nirgendwo ein Luftzug herrschte, die dafür sorgte, dass die Kleine nie zu spät ins Bett ging oder an Regentagen im Park spielte, wo man sich Bronchitis und Brustfellentzündung zuziehen konnte. Katzen hatten keinen Zutritt zum Haus, zu viele Haare; Hunde wurden gemieden, weil sie unberechenbar waren, Flöhe hatten und Allergien auslösen konnten. Jenny war es einerlei, dass sie einen Job in der Bank an der Charles Street annehmen musste, der ihr zuwider war, und dass sie keinerlei Privatleben mehr hatte. Freunde meldeten sich nicht mehr, Bekanntschaften gingen ihr aus dem Weg, sie langweilte sich fast zu Tode bei der Durchsicht der Hypothekanträge, doch Jenny schenkte diesen unwichtigen Dingen kaum Beachtung. Wichtig war nur Stella. Jenny verbrachte ganze Samstage damit, Brokkoli und Grünkohl für nährstoffreiche Suppen zu häckseln; nächtelang saß sie wach, wenn die Kleine Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen, Windpocken oder Grippe hatte. Sie band Schnürsenkel und sah die Schulaufgaben durch, und sie beklagte sich nicht ein einziges Mal. Enttäuschungen, wankelmütige Freunde, Mathehausaufgaben, Krankheiten aller Art wurden in Angriff genommen und bewältigt. Und wenn Stella nun zu einem argwöhnischen, ziemlich mürrischen Mädchen herangewachsen war, nun, dann war das immerhin besser, als wäre sie so wild gewesen wie Jenny, nicht wahr? Lieber auf Nummer Sicher gehen, oder? Selbstsüchtige Freuden verflüchtigten sich so rasch wie Träume, damit kannte sich Jenny aus; nur ein Abdruck auf dem Kopfkissen blieb zurück, ein Loch im Herzen, eine Liste von Dingen, die man bereute, so lang, dass man sich darin einwickeln konnte wie in einen Quilt mit einem besonders komplizierten Muster, Liebesknoten oder Taube im Fenster oder Krähenfuß.
Bald ging Jennys Ehe mit Will Avery in die Brüche, zerstört durch Misstrauen und Unehrlichkeit und Betrug. Eine ganze Weile schon hielt diese beiden nichts mehr zusammen außer ihrer gemeinsamen Geschichte, der Tatsache, dass sie zusammen aufgewachsen und als Kinder befreundet gewesen waren. Sie wahrten noch eine Weile den Schein für Stella, ihren Stern. Doch Kinder spüren genau, wo die Liebe verschwunden ist, sie wissen, wann Stille Friedlichkeit bedeutet und wann sie auf Verzweiflung hinweist. Jenny versuchte nicht daran zu denken, was ihre Mutter sagen würde, wenn sie erfuhr, wie übel ihre Ehe zu Ende gegangen war. Wie selbstgerecht Elinor Sparrow sein würde, wenn sie hörte, dass Will, für den Jenny so vieles geopfert hatte, nun in seiner eigenen Wohnung am anderen Ende der Marlborough Street wohnte, wo er wenigstens tun und lassen konnte, wonach ihm der Sinn stand, auch wenn er das sowieso schon lange zuvor getan hatte.
Dass Will untreu war, ließ sich leicht erkennen: wenn er log, erschienen weiße Flecken auf seinen Fingernägeln, und jedes Mal wenn er mit einer anderen Frau zusammen gewesen war, bekam er etwas, das Jennys Mutter »Lügnerhusten« nannte, ein ständiges Hüsteln, das ihn daran erinnerte, dass er die Wahrheit in einem Stück verschluckt hatte. Wenn Will zu Jenny zurückkehrte, schwor er, dass er ein anderer geworden sei, doch er war genau derselbe wie mit sechzehn Jahren, als Jenny aus ihrem Fenster geblickt und ihn unten auf dem Rasen entdeckt hatte. Der Junge, der stets nach Scherereien Ausschau gehalten hatte, musste nach einer Weile nicht mehr nach ihnen suchen: Sie fanden ihn von selbst, wo immer er steckte, des Tags oder in der Nacht. Sie folgten ihm nach Hause, glitten unter der Tür hindurch und legten sich zu ihm. Allerdings hatte Will Avery niemals behauptet, zuverlässiger zu sein, als er tatsächlich war. Er hatte nie vorgegeben, ein Gewissen zu haben. Er hatte überhaupt nie etwas vorgegeben. Jenny selbst hatte darauf bestanden, dass sie ohne ihn nicht mehr leben könne. Jenny hatte ihm immer wieder verziehen, war süchtig gewesen nach einem seiner Träume, der sie daran erinnern konnte, warum sie sich damals in ihn verliebt hatte.
Elinor Sparrow wäre tatsächlich nicht erstaunt gewesen, hätte sie von der Trennung gewusst. Sie hatte Will Avery auf den ersten Blick als Lügner entlarvt. Sie durchschaute ihn im ersten Moment. Das war schließlich ihre Gabe. Ein Satz, und sie wusste Bescheid. Ein Achselzucken. Eine falsche Ausrede. Sie hatte Will Avery schnurstracks zur Tür gebracht, als sie ihn im Salon entdeckte, und sie ließ ihn nie wieder über die Schwelle des Hauses, obwohl Jenny sie inständig bat, ein Einsehen zu haben. Elinor weigerte sich, ihre Meinung zu ändern. Sie nannte ihn immer nur »den Lügner«, auch noch an jenem strahlenden Nachmittag, an dem Jenny von zu Hause weglief. Das war in Jennys letztem Jahr auf der Highschool, im Frühling, jener unsteten Jahreszeit, in der die Menschen oft vorschnelle Entscheidungen treffen. Als Jenny Sparrows Klassenkameraden schließlich ihren Abschlussball feierten, arbeitete Jenny in Baileys Eisdiele in Cambridge, um Will finanziell zu unterstützen, dem es indessen mühelos gelang, seine akademische Laufbahn zu ruinieren. Jenny dagegen hatte nur ihren eisernen Willen, der sie durchhalten ließ. Am Ende ihres Arbeitstags spülte sie das Geschirr, samstags schleppte sie die Wäsche in den Waschsalon. Ohne Schulabschluss und mit ihren achtzehn Jahren gab sie die perfekte Ehefrau ab, die sogar zu erschöpft und überarbeitet war, um etwas zu bereuen. Nach einer Weile erschien ihr früheres Leben in Unity ihr wie ein Traum: der Park gegenüber vom Gemeindehaus und den Kriegsdenkmälern, die Linden, der würzige Duft der Lorbeersträucher, bevor sich die Blüten öffneten, das plötzliche Aufblühen der Natur, als sei der Winter selbst nur eine Einbildung, ein flüchtiger Albtraum aus Eis, Unbarmherzigkeit und Trauer.
Der März war in dem kleinen Ort Unity immer besonders unberechenbar gewesen; das Wetter konnte im Handumdrehen umschlagen, von dreißig Grad im Schatten am Mittag zu nächtlichen Schneestürmen. Das Ortszentrum, nur vierzig Minuten nördlich von Boston zwischen der Autobahn und den Sümpfen gelegen, befand sich auf der Flugroute der alljährlichen Vogelzüge. An einem Tag des Jahres verdeckten immer riesige Schwärme von Kuhstaren, Amseln und Sperlingen den Blick auf die Sonne und verdüsterten den fahlen unzuverlässigen Himmel. Die Einwohner von Unity hatten sich seit jeher für Cake House, das Heim der Sparrows, interessiert; während des Vogelzugs kamen viele, um am Wegrand ein Picknick zu machen. Die meisten Menschen im Ort waren sogar ein wenig stolz auf das Haus, das als eines der ältesten im County galt. Man führte Freunde und Verwandte gerne zu einer Anhöhe, von der man eine gute Aussicht auf Cake House hatte, sofern die Besucher nichts dagegen einzuwenden hatten, durch Lorbeersträucher zu spähen oder auf allen vieren durch die Buchsbaumhecken zu linsen, in die Kaninchen und Waschbären Löcher gefressen hatten.
Früher einmal war das Haus nur eine schlichte Hütte mit unbefestigtem Boden gewesen, das Blockhaus einer Wäscherin. Die Fugen zwischen den Balken waren mit Lehm und Gräsern verstopft, das Dach war strohgedeckt. Doch jede Generation hatte diesem Gebäude etwas hinzugefügt, hatte Veranden und Mansardenfenster angebaut, Erker und Rundöfen, als verziere man eine Hochzeitstorte mit Glasur. So war ein sonderbares Gebilde aus Mörtel und Ziegeln, grünem Glas und Tünche herangewachsen, als führe es ein Eigenleben. Die Einheimischen erklärten gerne, dass Cake House außer der Bäckerei, in der jetzt Hulls Teestube untergebracht war, als einziges Gebäude das Feuer von i 785 überstanden habe, in jenem Jahr, als der März so entsetzlich heiß war, dass alle Hölzer strohtrocken waren und ein einziger Funke von einer Laterne ausreichte, um die ganze Main Street in Brand zu setzen.
Geschichtskundige wiesen stets auf die drei schiefen Schornsteine von Cake House hin, von denen einer aus roten, einer aus grauen Ziegeln und einer aus Feldsteinen bestand und die jeweils in einem anderen Jahrhundert entstanden waren. Diese Experten achteten darauf, sich trotz der baulichen Attraktionen des Gebäudes nicht zu nahe an das Heim der Sparrows heranzuwagen, auch nicht bei einem Picknick. Und es war nicht das »Betreten verboten«-Schild oder das Dornengestrüpp im Wald, die sie fern hielten. In der Nähe von Cake House geriet das Verlockende schnell zur Gefahr. Jeden Schritt konnte man bitter bereuen. Trat man einen Stein beiseite, stieß man womöglich auf eine Schlange oder ein Wespennest. Gäste von auswärts wurden ausdrücklich angewiesen, keine Blumen zu pflücken; die Dornen der Rosen waren scharf wie Glassplitter und die Lorbeerhecken mit ihren hübschen rosa Knospen so giftig, dass Honig aus ihren Blüten einen Mann binnen Stunden vom Leben zum Tode befördern konnte.
Und vom Hourglass Lake, auf dessen reglosem grünem Wasser gelbe Seerosen trieben, wurde berichtet, die Welse, die dort in den Untiefen zu Hause waren, seien so bösartig, dass sie wahrhaftig aufs Gras hinaussprangen, um Kaninchen zu verschlingen, die sich zu nahe ans Ufer gewagt hatten. Nicht einmal die Einwohner von Unity, die sich sehr für die Vergangenheit des Orts interessierten – die Mitglieder des Vereins für Stadtgeschichte, die Stadträte, die Bibliotheksangestellten, die Akten und historische Objekte der Stadt betreuten –, wollten den unbefestigten Weg entlangfahren, denn in den schlammigen Furchen dösten Schnappschildkröten, und es gab Hornissen, die ohne jeden Grund zustachen. Selbst die ungebärdigsten Jungen der Stadt, die vom Anlegesteg in den Sumpf sprangen oder sich gegenseitig aufstachelten, durch Brennnesseln zu laufen, wagten es nicht, an heißen Sommertagen durchs Schilf zu streifen oder in jenem See zu schwimmen, in dem Rebecca Sparrow vor so vielen Jahren ertränkt wurde, mit hundert schwarzen Steinen im Saum ihrer Kleider.
Am Morgen ihres dreizehnten Geburtstags war Jenny Sparrow am Piepsen der Zirpfrösche erwacht, die an den flachen Ufern des Sees hockten. Damals trug sie für nichts Verantwortung. Sie wartete eher darauf, dass ihr Leben endlich begann. Sie wusste sofort, schon in den ersten Stunden ihres Geburtstags, dass sich etwas Unwiderrufliches ereignet hatte, und das war ihr mehr als recht. Jenny hatte keinerlei Hemmungen, ihre Kindheit zu beenden, in der sie schrecklich einsam gewesen war. Sie hatte unzählige Stunden mit ihren Wasserfarben und ihren Büchern in ihrem Zimmer verbracht, die Uhr beobachtet und Zeit vertrödelt. Auf diesen Morgen hatte sie ihr Leben lang gewartet, sie hatte die Tage auf dem Kalender abgestrichen und beim Einschlafen die Minuten gezählt. Die Kinder aus der Stadt beneideten Jenny Sparrow darum, dass sie in Cake House leben konnte; sie behaupteten, ihr Schlafzimmer sei größer als ein Klassenraum in der Schule. Sie besaß als Einzige ein Boot, mit dem sie an heißen Sommertagen auf dem Hourglass Lake rudern konnte, jenem Gewässer, in dem die Schildkröten jedem anderen Finger und Zehen abgebissen hätten. Ihr Vater nannte sie »Perle«, erzählten sich die Kinder, weil sie sein Kleinod war. Ihre Mutter, so raunte man, ließ sie tun und lassen, was sie wollte, vor allem seit der Vater bei einem Unfall ums Leben gekommen war, was Elinor Sparrow wohl völlig aus der Bahn geworfen hatte.
Niemand kümmerte sich darum, wo Jenny steckte, das stand fest; im alten Drugstore an der Main Street war sie oft die Letzte, die am Tresen saß. Wenn die Kinder abends aus dem Fenster spähten, sahen sie Jenny häufig im Dunkeln nach Hause gehen, vorbei an der alten Eiche an der Ecke der Lockhart Avenue. Niemand beaufsichtigte sie, und sie schien sich nicht zu fürchten, obwohl sie zu einer Tageszeit unterwegs war, zu der andere Kinder in Schlafanzüge gesteckt und von ihren fürsorglichen Eltern ins Bett gebracht wurden, die nicht einmal im Traum auf die Idee gekommen wären, ein Kind um diese Uhrzeit draußen herumlaufen zu lassen.
Diese Jungen und Mädchen, die Jenny mit Neid betrachteten, hatten keine Ahnung, dass Jenny im Winter Eiskristalle vor ihrem Mund sah, wenn sie ausatmete, weil es in Cake House so kalt war. Die Rohre in den Wänden klapperten und versagten manchmal gänzlich, sodass man den Nachtstuhl nur spülen konnte, indem man eimerweise Wasser aus dem See hineinschüttete. In den Säulen auf der Veranda hausten Bienen, in den Schornsteinen nisteten Vögel, und Holzameisen machten sich an den Balken und am Fundament zu schaffen. Das Haus war nachlässig vernäht worden und begann sich nun aufzulösen wie eine Patchwork-Decke, die fadenscheinig und fransig geworden ist. Ständig ging etwas kaputt, und der äußere Anschein trog. Jenny, dieses freie und ungebundene Wesen, das die Kinder aus dem Ort an ihren Fenstern vorbeilaufen sahen, fürchtete sich entsetzlich vor der Dunkelheit. Sie litt an Asthmaanfällen, Magenschmerzen und Migräne und kaute Fingernägel. Sie wurde regelmäßig von Albträumen geplagt, und wenn sie in der Nacht laut schrie, war niemand da, der sich um sie kümmerte, wie bei anderen Kindern. Niemand kam den Flur entlanggelaufen und brachte ihr eine Tasse Tee oder hielt ihr die Hand, bis sie wieder einschlafen konnte. Es gab nicht einmal jemanden, der ihre Schreie hörte.
Jennys Vater war in dem Jahr ums Leben gekommen, als sie zehn wurde, und danach hatte ihre Mutter sich immer weiter von ihr entfernt, hatte sich hinter ihrer Schlafzimmertür verschanzt, dem Tor zu ihrem Garten, ihrer Rüstung aus Distanz und Unzufriedenheit. Elinor Sparrows Trauer über den Verlust ihres Gatten – der ein schlimmer Verlust war, ein übler Verlust mit unvorhersehbaren Folgen – machte sich zunächst als Verstörung und dann als Rückzug bemerkbar. Binnen kurzem hatte sie sich allem entfremdet, das sie an diese Welt band, auch von ihrer Tochter Jenny. Vor allem von Jenny, der am ehesten geholfen war, wenn sie es lernte, auf eigenen Füßen zu stehen und für sich selbst zu sorgen und sich nicht in Gefühlen zu verlieren, denn so kam man gewiss besser durchs Leben.
In Wahrheit war Cake House ein kalter Ort, er strahlte Kälte aus, und kalt war es in jedem einzelnen Raum. Durch die Ritzen unter den Fenstern und den Türen zog es ständig, ein feindseliger Luftstrom, der den Wunsch weckte, doch morgens lieber unter einem Stapel Decken im Bett zu bleiben, statt sich dem Tag zu stellen. Fern von anderen Menschen könnte man sich so wenigstens in seinen Träumen verlieren, wenn das Leben zu schwierig aussah, was, offen gestanden, tagtäglich der Fall war. Doch am Morgen von Jennys dreizehntem Geburtstag war das anders. An diesem Tag schien die Sonne, und es hatte fast zwanzig Grad. An diesem Tag setzte sich Jenny kerzengerade im Bett auf, in Erwartung ihres Lebens.
Ihr Haar war lang und schwarz und nun zerzaust vom unruhigen Schlaf und ihre Haut olivfarben wie die ihrer Mutter und Großmutter und aller Sparrow-Frauen vor ihr. Wie sie erwachte auch Jenny am Morgen ihres dreizehnten Geburtstags mit einer ganz besonderen Fähigkeit, die nur ihr zu eigen war. So geschah es seit damals, als Rebecca Sparrow am Morgen ihres dreizehnten Geburtstags feststellte, dass sie keinen Schmerz mehr empfand, ob sie nun durch ein Dornengestrüpp streifte, die Hand über eine Flamme hielt oder barfuß über Glassplitter ging.
Seit damals kamen in jeder Generation andere Gaben vor. Jennys Mutter erkannte jede Lüge, ihre Großmutter Amelia linderte die Schmerzen der Geburtswehen mit einem einzigen Handauflegen. Von Jennys Urgroßmutter Elisabeth hieß es, sie habe alles in etwas Essbares verwandeln können: Felsbrocken und Steine, Kartoffeln und Asche, in Elisabeths kundigen Händen wurde alles zu einer Mahlzeit. Elisabeths Mutter Coral hatte das Wetter vorhersagen können. Hannah, die Mutter von Coral, fand alles wieder, was verloren ging, ob es sich nun um einen Ring, einen irregeleiteten Verlobten oder ein überfälliges Buch aus der Leihbücherei handelte. Sophie Sparrow konnte im Dunkeln sehen. Constance Sparrow blieb so lange unter Wasser, ohne zu atmen, dass jeder andere blau angelaufen und ertrunken wäre. Leonie Sparrow konnte durch Flammen gehen und ihre Mutter Rosemary schneller rennen als jeder Mann in Neuengland. Rebecca Sparrows Tochter Sarah kam mit wenigen Minuten Schlaf aus; nach einem kurzen Nickerchen habe sie Kräfte gehabt wie zehn starke Männer, so hieß es, und sei so unerschrocken gewesen wie der wildeste Löwe des März.
Jenny jedoch erwachte an ihrem Geburtstagsmorgen und hatte einen Traum im Kopf, einen Traum von einem Engel mit schwarzem Haar, von einer Frau, die sich nicht vor Wasser fürchtete, und einem Mann, der eine Biene in der Hand halten konnte, ohne ihren Stich zu spüren. Der Traum war so sonderbar und angenehm, dass sie am liebsten zugleich geweint und laut gelacht hätte. Doch als Jenny die Augen aufschlug, wusste sie sofort, dass dieser Traum nicht von ihr stammte. Diese Dinge hatte ein anderer ersonnen; die Frau und die Biene, das stille Wasser und den Engel. Diese Bilder gehörten zu einem anderen Menschen. Und dieser Mensch, wer immer es sein mochte, interessierte Jenny.
Sie begriff, dass dies ihre Gabe war, die Fähigkeit, die Träume anderer zu träumen. Es war keine sinnvolle Gabe, wie das Wetter vorhersagen oder Lügen erkennen zu können. Sie war auch nicht nützlich, wie keine Schmerzen zu empfinden, im Dunkeln zu sehen oder so schnell zu laufen wie ein Hirsch. Was konnte man mit einem Traum anfangen, noch dazu, wenn er von jemand anderem stammte? Regen und Schnee, Babys und Lügner, das fügte sich ins unverwüstliche Dasein der alltäglichen Welt ein. Aber mit dem Traum eines Fremden im Kopf zu erwachen war, als ginge man auf einer Wolke spazieren. Ein Schritt, und sie konnte einbrechen. Bald würde sie sich nach Dingen sehnen, die ihr nicht zugänglich waren; sinnlose Träume würden ihr den Weg zu immer neuen Begehrlichkeiten weisen.
An diesem Morgen, mitten im unberechenbarsten Monat des Jahres, hörte Jenny zu ihrem Erstaunen Stimmen auf dem Weg vor dem Haus. Die Einheimischen mieden diesen Weg, der von den Kindern Dead Horse Lane genannt wurde. Höchstens zur Zeit der Vogelzüge im Frühling ließen sie sich dort einmal für ein Picknick nieder, aber an allen anderen Tagen des Jahres setzten sie keinen Fuß in den Wald, gingen Lorbeersträuchern und Schnappschildkröten aus dem Weg, machten einen weiten Bogen um das Hochzeitstortenhaus, auch wenn sie deshalb einen Umweg über die Lockhart Avenue in Kauf nehmen mussten. Schilder mit der Aufschrift »Betreten verboten« waren an die Bäume genagelt, und die Nachbarn von den angrenzenden Grundstücken, die Stewarts, Elliots und Fosters, achteten darauf, die Grenzen nicht zu überschreiten, da Elinor sonst die Polizei rufen oder sie wegen Hausfriedensbruch anzeigen würde.
Dennoch waren von dort unten Stimmen zu hören, und eine davon gehörte zu Jennys Träumer, der jenen Traum geträumt hatte, mit dem sie in ihrem neuen Leben erwacht war, jenem Träumer, nach dem sie verlangte. Schlaftrunken und erschöpft trat Jenny ans Fenster, um zu erkunden, in wessen Traum sie da geraten war. Die Luft war mild und roch nach Minze. Alles war grün und üppig, und Jenny wurde beinahe schwindlig von all dem Blütenstaub, der durch die Luft wehte. Die Bienen waren fleißig an der Arbeit, schwirrten über den Knospen der Lorbeersträucher, doch Jenny beachtete ihr Summen nicht. Denn dort am Wegrand stand Will Avery, ein sechzehnjähriger Junge aus dem Ort, der so früh am Morgen schon nach Scherereien Ausschau hielt. Sein jüngerer Bruder Matt, der so bedächtig war wie Will hemmungslos, wanderte hinter ihm her. Die beiden hatten als Mutprobe auf der anderen Seeseite übernachtet; Sieger sollte der sein, der es zwölf Stunden dort aushielt, auch wenn das tote Pferd aus dem Wasser auftauchte. Sie hatten es beide bis zum frühen Morgen geschafft, trotz der Frösche und des Schlamms und der ersten Stechmücken des Jahres, und nun wehte ihr Lachen durch die Luft.
Jenny starrte zu Will Avery hinunter, der in der moosgrünen dunstigen Frühlingsluft auf dem Rasen stand, und sie wusste, warum ihr schwindlig war. Sie hatte Will schon immer bewundert, war aber zu schüchtern gewesen, ihn anzusprechen. Er war begehrenswert, ein Junge mit goldener Haut und tollkühnem Auftreten; ein Junge, der viel zu versessen darauf war, sich zu amüsieren, als dass er Regeln einhalten oder an irgendwen außer sich selbst denken konnte. Wenn es etwas Gefährliches zu erleben oder einen halsbrecherischen Streich auszuhecken galt, war Will Avery zur Stelle. In der Schule brachte er gute Leistungen, ohne sich anstrengen zu müssen, obwohl er liebend gern auf Partys herumhing; er lebte für den Augenblick. Wenn es etwas zu feiern, kaputtzumachen oder abzufackeln gab, war Will mit von der Partie. Menschen, die Will kannten, machten sich Sorgen um ihn, doch diejenigen, die ihn gut kannten, machten sich eher Sorgen um die Menschen, mit denen er zu tun hatte.
Weil Jenny sich in seinem Traum aufgehalten hatte, fühlte sie sich mutig. Es schien ihr, als sei Will Avery schon ihr Eigen, als hätten ihrer beider Träume und ihr alltägliches Leben sich verflochten, seien ineinander versponnen, ein und dasselbe Gewebe. Jenny schüttelte ihr wirres Haar glatt und verschränkte die Finger, um sich Glück zu wünschen. Sie wollte die furchtlose Frau aus seinem Traum sein, die für den Menschen, den sie liebte, durchs Wasser gehen konnte, das Mädchen mit dem dunklen Haar, das keine Scheu hatte, ihren Herzenswunsch zu verlangen.
Komm her, sagte Jenny leise. Es waren die ersten Worte, die sie an diesem Morgen ihres dreizehnten Geburtstags sprach.
Ihr schwirrte der Kopf vom Piepsen der Zirpfrösche. Das Frühlingsfieber pulsierte in ihren Adern. Andere Mädchen in ihrem Alter wussten schon lange vor ihrem Geburtstag, was sie sich wünschten: Silberarmbänder, Goldringe, weiße Rosen, mit Seidenband umwickelte Geschenke. Für all das interessierte sich Jenny Sparrow nicht. Sie hatte keine Vorstellung davon, was sie sich am meisten wünschte, bis ihr Blick auf Will Avery fiel. Da wusste sie es: Er sollte es sein.
Dreh dich um, sagte sie, und da schaute Will zum Haus hinauf.
Jenny zog sich in Windeseile an. Barfuß lief sie nach unten, hinaus in die weiche grüne Luft. Ihr war, als fliege sie, als verschwinde Cake House hinter ihr, zerfalle zu Asche mit seinen feuchten einsamen Räumen. Wenn dies Verlangen war – das kalte Gras unter ihren Füßen, der Duft der Minze, den sie mit der Luft einsog, das Toben ihres Herzens –, dann wollte sie mehr davon. Und sie wollte es immer.
Vor ein paar Tagen erst hatten die Frühjahrsvogelzüge begonnen, und zahllose Vögel flatterten am Himmel umher. Kuhstare, Vögel, die zu faul waren, ihren Nachwuchs selbst großzuziehen, hockten schon neben den Nestern von Spatzen und Eichelhähern, um die blauen und gefleckten Eier hinauszubugsieren, die dort ihren angestammten Platz hatten, und durch ihre eigenen Nachkommen zu ersetzen, die früher schlüpfen würden. Die Sonne war erstaunlich kraftvoll und heiß für März; ihre Strahlen drangen durch die Kleider direkt ins Blut. Vor diesem Morgen war Jenny still und grüblerisch gewesen, hatte sich gefürchtet vor der Dunkelheit und ihrem eigenen Schatten. Jetzt war sie eine andere geworden: ein Mädchen, das ins glimmernde Licht blinzelte, eine Person, die fliegen konnte, wenn sie wollte, die so beherzt war, dass sie nicht einen Augenblick zögerte, als Will Avery fragte, ob er sich Cake House einmal von innen anschauen dürfte. Sie nahm seine Hand und führte ihn zur Tür.
Wills Bruder, der arme Junge, bekam Gänsehaut an den Armen und versteckte sich hinter der Forsythie. Will rief ihm zu, er solle doch mitkommen, aber Matt, der immer vorsichtig und besonnen war, blieb zurück. Ihm war zu Ohren gekommen, was Leuten zustoßen konnte, die es wagten, Cake House widerrechtlich zu betreten. Und Matt Avery achtete das Gesetz, obwohl er erst zwölf Jahre alt war. Ihn interessierte das Haus der Sparrows natürlich ebenso brennend, doch er kannte sich mit Geschichte aus und wusste, was vor über dreihundert Jahren mit Rebecca Sparrow geschehen war. Beim Gedanken an ihr Schicksal wurde ihm übel, und seine Kehle war wie ausgedörrt. Er hatte auch nicht vergessen, dass die Jungen aus dem Ort den Weg schon seit Jahrhunderten Dead Horse Lane nannten und dass die meisten Einwohner diese Gegend mieden; sogar die alten Männer im Ort schworen, unter den Seerosen und dem Schilf dümple ein Skelett. Matt rührte sich nicht von der Stelle, erbost und beschämt, weil es ihm nicht gelingen wollte, auch nur eine Regel zu missachten.
Will Avery dagegen würde sich weder von einem toten Pferd noch von einem alten Aberglauben daran hindern lassen, seinen Spaß zu haben. Er war sogar einmal im See geschwommen, als Henry Elliot zwanzig Dollar gewettet hatte, dass er es nicht schaffen würde, und es war nichts passiert, außer dass er sich eine Mittelohrentzündung zugezogen hatte. Jetzt marschierte er mit einem hübschen Mädchen über den Rasen, und er hatte nicht die Absicht, einen Rückzieher zu machen, was man in der Stadt auch munkelte. Er ging weiter, obwohl Matt hinter ihm schrie, er solle zurückkommen, ihre Mutter würde bald merken, dass sie nicht in ihren Betten geschlafen hatten. Sollte der gute alte Matt doch im Gebüsch hocken bleiben. Sollte er sich doch vor irgendeiner Hexe fürchten, die seit über dreihundert Jahren tot war. Am Montag würde Will seinen Freunden verkünden können, dass er im Haus der Sparrows gewesen war und das Abenteuer überlebt hatte. Unterwegs würde er vielleicht noch einen Kuss ergattern, mit dem er sich brüsten konnte, oder womöglich sogar ein Andenken mopsen, bei dessen Anblick sich die anderen stumm vor Staunen auf dem Schulhof um ihn scharen würden.
Allein der Gedanke an das bewundernde Staunen begeisterte Will. Er stand schon damals gerne im Mittelpunkt des Geschehens. Er lächelte Jenny an, als sie auf die Haustür zugingen, und sein Lächeln war ein wunderbarer Anblick. Jenny blinzelte, verblüfft über so viel Zuwendung, doch dann erwiderte sie das Lächeln. Diese Reaktion war Will vertraut. Er wusste bereits, dass es Mädchen nicht kalt ließ, wenn er sich für sie zu interessieren schien, und er drückte ihre Hand fester, nur ein klein wenig, um ihr zu zeigen, dass sie ihm gefiel. Die meisten Mädchen waren sehr angetan, wenn sie sein Interesse spürten, ob es nun echt war oder vorgetäuscht.
Habt ihr etwas, das Rebecca gehört hat?, fragte Will, als sie den Korridor entlanggingen, denn das wollten alle sehen: irgendetwas, das früher einmal der Hexe des Nordens gehört hatte.
Jenny nickte, obwohl ihr zumute war, als würde ihr Herz zerspringen. Wenn Will in diesem Augenblick von ihr verlangt hätte, das Haus in Brand zu stecken, so hätte sie es getan. Wenn er um einen Kuss gebeten hätte, wäre sie seinem Wunsch nur zu gerne nachgekommen. Das muss Liebe sein, dachte sie. Es kann nichts anderes bedeuten. Sie konnte nicht glauben, dass der Junge neben ihr wirklich Will Avery war. Sie, die keinerlei Freunde hatte, die einsamer war als Liza Hull, das unscheinbarste Mädchen der Schule, hatte Will ganz für sich alleine. Sie würde ihm nichts abschlagen. Sie brachte ihn in den Salon, obwohl sie wusste, dass niemand diesen Raum betreten durfte. In Cake House gab es keine Gäste, auch nicht an Feiertagen oder Geburtstagen. Und falls es irgendeinem Lieferanten oder Vertreter gelang, das Haus zu betreten, so würde man ihm niemals Zutritt zu jenem Salon mit den fadenscheinigen Läufern und alten Samtsofas gewähren, auf denen sich niemand mehr niederließ und aus deren Kissen Staubwolken aufstiegen, sobald man sie berührte. Sogar der Zeitungsbote warf den Unity Herald vom Weg aus vor die Haustür und bekam seinen Lohnscheck per Post, damit Elinor nichts mit ihm zu schaffen hatte. Manchmal kam Eddie Baldwin, der Klempner, ins Haus, doch er musste immer seine schmutzigen Stiefel ausziehen, und dann blieb Elinor hinter ihm stehen, während er Frösche aus der Toilette angelte oder Algen und Teeblätter aus der Spüle saugte.
Doch vor allem bekam kein Fremder jemals die Gegenstände zu Gesicht, die einst Rebecca Sparrow gehört hatten. Die aufdringlichen Gestalten von der Bibliothek, die ständig um ein Schmuckstück oder einen Stofffetzen für ihre Schaukästen über die Geschichte von Unity bettelten, hatten nie auch nur einen Fuß über die Schwelle gesetzt. Doch dieser Tag war anders alle anderen, und dieser Besucher war ein besonderer. War Jenny in den Bann von Will Averys Traum geraten? Brachte sie ihn deshalb zu jener Ecke im Salon, in der Rebeccas Dinge aufbewahrt wurden? War es Liebe, die sie dazu veranlasste, die kostbarsten Besitztümer ihrer Familie zu offenbaren, oder nur das Frühlingsfieber, dieses mit Blütenstaub getränkte verschwommene grüne Licht, die Zirpfrösche, deren verträumte Gesänge an den schlammigen Ufern des Sees sich anhörten, als beginne und ende die Welt in ein und demselben Moment?
Will Avery war wie alle Bewohner des Orts begierig darauf, das zu sehen, was Jenny gerne vergessen wollte: Sie nannte es das heimliche Kummermuseum der Familie Sparrow. Welche Familie war so verrückt, die Dinge aufzubewahren, die ihr am meisten Leid gebracht hatten? Die Sparrows, genau, obwohl Elinor und Jenny sich nach Kräften bemühten, dieses Leid zu vergessen. Die Ecke, in der das Schränkchen stand, war staubig und ungepflegt. An der Wand standen Eichenregale, doch die ledergebundenen Bücher hatte seit Jahrzehnten niemand mehr in die Hand genommen, die Muscheln, die einmal rosa geschimmert hatten, waren im Lauf der Zeit grau geworden, und über die handgeschnitzten Modelle von Bienen und Wespen waren Holzameisen hergefallen, sodass sie zerbröselten, sobald man sie berührte. Nur der Glaskasten war vor allem Unheil bewahrt geblieben.
Jenny zog die bestickte Decke herunter, mit der die Erbstücke ihrer Familie vor Sonne und Verfall geschützt werden sollten. Als Will sah, was da vor ihm lag, keuchte er, und es verschlug ihm zum ersten Mal in seinem Leben die Sprache. Was er immer für ein Gerücht gehalten hatte, entsprach der Wahrheit. Nun hatte er wahrhaftig etwas zu erzählen, und ein Grinsen trat auf sein Gesicht. Am Montag würden alle an seinen Lippen hängen, und wenn sie ihm nicht glauben wollten, was er von Rebecca Sparrow berichtete, dann wusste doch zumindest er selbst, dass es Wirklichkeit war.
Er beugte sich vor, fühlte sich auf eine Weise berührt, die er selbst nicht verstand, fast als hätte er tatsächlich ein Herz. Dort in dem Kasten vor ihm lagen die zehn Pfeilspitzen, von denen man immer hörte, weitergereicht von Generation zu Generation und unter Glas aufbewahrt, wie andere Familien es vielleicht mit Fotografien oder Zeitungsanzeigen von Hochzeiten und Geburten taten, um ihre Geschichte zu dokumentieren. Auf einem verblichenen einstmals roten Satintuch lagen, sorgfältig angeordnet, drei weitere Gegenstände aus den Archiven der Sparrows: ein silberner Kompass, eine angelaufene Glocke und etwas, das Will auf den ersten Blick für eine eingerollte Schlange hielt, das aber tatsächlich ein schwarzer Zopf war.
Doch die Pfeilspitzen zogen Will am meisten in Bann; sie waren von Hand gefeilt, aus dem Stein, den man hier in der Gegend fand. Jede einzelne war vorne blutbefleckt. Ob diese Andenken aufbewahrt wurden, um an menschliche Grausamkeit oder an menschliche Verletzlichkeit zu erinnern, ließ sich schwer sagen. Man wusste nur, was ein Farmer namens Hathaway in sein Tagebuch geschrieben hatte, das man im Archiv der Bibliothek an der Main Street einsehen konnte. Hathaway war zu den Docks gegangen, um einen Spiegel abzuholen, ein kostbares Geschenk für seine Frau, zu einer Zeit, als es anstelle der aus Schlamm und Schwemmsand bestehenden Sümpfe noch einen Hafen gegeben hatte. Doch als er das Kleinod in Empfang genommen hatte, das ein Jahr über die Meere geschippert war, bevor es zu ihm gelangte, stolperte er über die Wurzeln einer knorrigen Wasseresche und verlor das Gleichgewicht; der Spiegel fiel zu Boden und zersprang in tausend glitzernde Teile. Hathaway stand reglos da und sann darüber nach, was er seiner Frau nun sagen sollte; so lange blieb er dort stehen, dass er Zeuge wurde, wie Rebecca Sparrow, den Arm voller Wäsche, barfuß über die Scherben schritt und keinen Schmerzenslaut von sich gab, als Blut von ihren Sohlen tropfte.
Als die Jungen von den Farmen in der Gegend erfuhren, dass Rebecca Sparrow keinen Schmerz empfand, schossen sie zum Zeitvertreib mit Pfeilen auf sie. Sie lauerten ihr auf, als sei sie ein Fasan oder ein Hirsch, herzlos und ohne einen Funken Erbarmen. Munter legten sie auf sie an, wenn sie ihr auf der anderen Seite des Hourglass Lake begegneten, wo sie die Wäsche der Frauen aus dem Ort wusch, die es sich leisten konnten, schmutziges Köper und Linnen von einer Person säubern zu lassen, deren Hände schon wund von Lauge waren. Einige dieser Jungen hinterließen schuldbewusste Briefe, die in der Bibliothek archiviert waren, aus denen hervorging, dass ihr Opfer nicht einmal zuckte, wenn es getroffen wurde. Rebecca schlug nur nach den Wunden, als seien sie Stechmücken, und setzte ihre Arbeit fort, wusch die dicken Wollsachen mit der stärksten Seife, die aus Asche und Fett hergestellt wurde, und weichte zarte Seidenstoffe behutsam in grünem Tee ein. Sie merkte nicht, dass sie verletzt war, bis sie zu Hause ihre Kleider ablegte. Erst da sah sie, dass einer der Pfeile sie getroffen hatte, erst wenn sie mit dem Finger die Spur des Blutes nachzog, das aus der Wunde rann.
War es da ein Wunder, dass Jenny voller Unruhe den dreizehnten Geburtstag ihrer Tochter erwartete? Sie fürchtete sich so sehr vor diesem Tag, dass sie sich die Fingernägel bis aufs Fleisch abkaute, eine Angewohnheit aus Kindertagen, in die sie in schwierigen Zeiten wieder zurück verfiel. Andere mochten ihre Vergangenheit vergessen, doch Jenny hatte sie nur allzu genau vor Augen. Sie erinnerte sich so deutlich daran, wie sie über das kühle taubedeckte Gras gelaufen war, als seien seither nur wenige Stunden vergangen. Sie hörte noch das Piepsen der Zirpfrösche und wusste, wie ihr Herz in ihrer Brust pochte, als sie mit Will im Salon vor dem Glaskasten stand. Dieser Erinnerung war es zu verdanken, dass Jenny in der Nacht vor Stellas dreizehntem Geburtstag kein Auge zutat, sondern auf einem Stuhl am Bett ihrer Tochter saß. Lass sie so aufwachen, wie sie eingeschlafen ist, lautete Jennys sehnlichster Wunsch. Nur darum flehte sie in dieser Nacht, die genau gleich lang war wie der Tag, einer Nacht, wie sie nur einmal vorkommt im Jahr. Lass sie dasselbe liebe Mädchen sein, frei von Sorgen und besonderen Gaben.
Da waren sie, Beschützte und Beschützerin, doch die Zeit lässt sich nicht abweisen, so vorsichtig und wachsam ein Aufpasser auch sein mag. Jenny wusste, dass es soweit war, als sie den Verkehr von der Commonwealth Avenue und dem Storrow Drive hörte. Man blinzelt einmal, und die Jahre ziehen vorüber. Man dreht sich zweimal um und findet sich im Land der Zukunft wieder. Es dämmerte über der Marlborough Street, und der Tag brach an, auch wenn Jenny die Vorhänge nicht öffnete und die Tür verschlossen hielt. Zeitungen wurden ausgetragen, der Müll wurde abgeholt, auf Fenstersimsen und Telefonleitungen gurrten die Tauben. Der Tag hatte begonnen, kühl und klar und unaufhaltsam.
Stella schlug die Augen auf und sah ihre Mutter, die sie beobachtete. Wenn die Mutter einen schon frühmorgens anstarrt, mit zerrauften Haaren und wachsam wie eine Bulldogge, kann man sicher sein, dass es Stress gibt. Dann fängt der Tag schlecht an, ob es nun ein gewöhnlicher Tag ist oder der Geburtstag. Stella richtete sich verschlafen auf. Sie hatte ihre Zöpfe am Abend vorher nicht ausgekämmt, und nun standen die kürzeren Haare wirr vom Kopf ab. Sie hatte die ganze Nacht von dunklen Gewässern geträumt und blinzelte jetzt im hellen Morgenlicht.
»Was machst du hier?« Stellas Stimme kam von weit her, und Jenny war sogleich klar, dass sie kurz weggedöst war und einen Teil des Traums ihrer Tochter aufgeschnappt hatte, eine wenig tröstliche Angelegenheit. Jenny Sparrow wusste sehr genau, wo das Wasser am dunkelsten war, wo es endlos schien, und deshalb trank sie Kaffee und Cola und blieb wachsam. »Was schaust du so?«, fragte Stella mit gereiztem Unterton, als ihre Mutter nicht antwortete.
Wie sollte Jenny erklären, was sie selbst nicht wusste? Sie hielt Ausschau nach etwas, das in ihrem kleinen Stern aufloderte, das war alles. Nach einer Fähigkeit, die sie zu etwas Besonderem machte, als wäre sie eine Riesin, oder ein Mädchen, das Feuer schluckte, oder eine Frau, die über Glasscherben gehen konnte, ohne Schmerz zu empfinden.
»Ich wollte nur wissen, was du als Geburtstagsfrühstück haben möchtest. Toast? Waffeln? Spiegeleier? Es gibt auch Rosinenbrot. Mit Walnüssen.«
Wenn es schon geschehen muss, dann lass es etwas Einfaches, Nützliches sein, die Fähigkeit, Kleider mit einem einzigen Stich zu nähen vielleicht, oder ein Talent für Trigonometrie. Große Sprachbegabung, Offenherzigkeit oder Belastbarkeit. Wenn es ganz schlimm kam, dann wäre auch die Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen, noch annehmbar, oder die Gabe, wild gewordene Hunde mit einer einzigen Geste zu beruhigen.
»Ich frühstücke schon lange nicht mehr. Zu deiner Information. Und ich darf nicht zu spät kommen. Wir schreiben eine Mathearbeit, und Miss Hewitt schert sich nicht um Geburtstage. Nur um Mathematik.« Stella hatte sich aus dem Bett gehangelt und wühlte nun in einem Berg zerknüllter Kleider am Boden.
»Soll ich sie dir bügeln?«, fragte Jenny, als Stella zwischen Jeans und Unterwäsche ihre Schuluniform hervorzerrte.
Stella betrachtete den blauen Rock und die blaue Jacke, schüttelte dann beides aus. »So«, sagte sie mit diesem bockigen Unterton, den sie sich seit der neunten Klasse angewöhnt hatte. Stella hatte ein Schuljahr übersprungen. Sie hatte so leicht gelernt und so schnell gelesen, dass Jenny natürlich stolz auf ihre Leistungen gewesen war. Doch nun fragte sie sich, ob diese Entscheidung nicht ein Fehler gewesen war, ob Stella nicht in etwas hineingedrängt wurde, für das sie noch nicht reif war.
»Schon wieder glatt,« fügte Stella hinzu. Als sie sich umdrehte, starrte ihre Mutter sie schon wieder an. Diesmal mit einem unzufriedenen Gesichtsausdruck, als habe sie bei der prüfenden Betrachtung ihrer Tochter Flöhe oder Läuse entdeckt. »Stimmt irgendwas nicht mit mir? Schaust du mich deshalb ständig so an?«
»Nein, nein.« Wenigstens gab es hier nirgendwo grünes Licht, piepsende Frösche oder Weggabelungen, die zu Unheil führen mochten. »Aber die Haare könntest du dir bürsten.«
Stella beäugte sich im Spiegel. Zu groß, zu dünn, Zähne, die nicht schief genug waren für eine Spange, und Haare, die aussahen wie Stroh, das zu lange im Regen gelegen hat. Sie warf ihrem Spiegelbild einen finsteren Blick zu, dann wandte sie sich zu ihrer Mutter um, immer noch trotzig. »Meine Haare sehen gut aus, danke sehr.«
Nachts hatte Jenny die Jahre bis zu Rebecca Sparrow zurückgerechnet, dem unglückseligen Mädchen, das als ihre erste überlieferte Verwandte galt. Stella war die dreizehnte Generation in der Geschichte der Sparrows, hatte sie dabei bemerkt. Dreizehn, die Unglückszahl. Manche Menschen trugen immer dreizehn Dollar in der Tasche herum, manche Architekten ließen den dreizehnten Stock aus, damit an diesem Unheil bringenden Ort niemand aussteigen musste. Und nun war Stella ein ganzes Jahr mit dieser Zahl behaftet, gefangen in ihrem Schicksal. Dreizehn, wie man auch zählte. Dreizehn, bis die nächsten zwölf Monate vergangen waren.
»Wie wär's mit einem Geschenk?« Jenny brachte eine Geschenkschachtel zum Vorschein. Sie hatte lange hin und her überlegt, um etwas zu finden, das Stella gefallen würde, doch das war vergebliche Liebesmüh. Jenny war über Stellas enttäuschtes Gesicht nicht erstaunt, als sie den Kaschmirpullover auspackte.
»Rosa?«, sagte Stella.
Jenny konnte nichts richtig machen; das war das Einzige, worüber sie sich in letzter Zeit einig waren.
»Hast du überhaupt eine Ahnung, wer ich bin?« Stella legte den Pullover sorgfältig in die Schachtel zurück. Tatsächlich hatte Stella nur schwarze, dunkelblaue oder weiße Sachen im Schrank.
Etwas lief zwischen Mutter und Tochter entsetzlich schief, seit dem letzten Sommer, als Will ausgezogen war, oder vielleicht auch schon seit jenen letzten Monaten ihrer Ehe, als Will und Jenny sich nur noch gestritten hatten. Es war so schlimm geworden, dass Jenny ein Glas Milch nach Will warf, als sie die Telefonnummer einer anderen Frau in seiner Jackentasche fand. Er hatte daraufhin ihre Lieblingsporzellanplatte zerschmettert. Dann hielten sie beide inne, keuchend, umgeben von Scherben und Milchpfützen. In diesem Moment hatten sie begriffen, dass ihre Ehe am Ende war.
Will hatte noch am selben Abend gepackt. Er hatte sie verlassen, trotz Stellas Bemühungen, ihn zurückzuhalten. Sie hatte ihn angefleht zu bleiben, und als er sich nicht überreden ließ, lief sie zum Fenster und sah ihm zu, wie er auf ein Taxi wartete.
»Er geht bestimmt nicht«, flüsterte Stella, doch als das Taxi vorfuhr, gab sie die Hoffnung auf. Als es keinen Zweifel mehr daran gab, dass Will sie verließ, was schon seit Jahren überfällig war, wandte sich Stella zu Jenny um. »Hol ihn zurück.« Ihre Stimme klang bedrohlich schrill. »Er darf nicht weggehen!«
Doch Will war verschwunden, und zwar schon seit Ewigkeiten. Jenny dachte an den Tag, als sie ihn auf dem Rasen gesehen hatte; sein Traum war ihre erste Kostprobe des Verlangens gewesen. Seither hatten sie so viele Nächte zusammen verbracht, doch es war ihr nie wieder vergönnt gewesen, Zugang zu seinen Träumen zu finden. Sie schnappte die Träume ihrer Vermieterin auf und die Träume ihrer Nachbarn, die ihre eigenen Traumbilder überdeckten. Der junge Mann im ersten Stock hatte so hitzige Sexträume, dass es Jenny schwer fiel, ihm in die Augen zu sehen, wenn sie sich am Müllschlucker trafen. Die alte Frau am Ende des Gangs träumte Bilder von Landschaften vor fünfzig Jahren, blau wie die Wasser des Nil, die Jenny immer erfrischten, auch wenn sie bei der Arbeit den ganzen Tag auf den Beinen gewesen war. Wenn sie durch den Boston Common ging, nahm sie Fetzen aus den Träumen der obdachlosen Männer wahr, die dort auf den Bänken dösten, Träume von warmen Wollmänteln und gebratenem Truthahn, Träume von allem, was diese Männer verloren, was man ihnen genommen oder was sie fortgeworfen hatten.
Doch bei ihrem eigenen Mann herrschte nur Leere, die Ödnis eines Menschen, der ohne jegliche Gedanken und Vorhaben einschläft. Träume, so leer wie die Marlborough Street, nachdem Will an jenem Abend in das Taxi gestiegen war, so dunkel wie die braune Dämmerung von Boston, die immer so schnell hereinbrach, als ziehe man einen Vorhang vor ein Fenster.
»Ich hasse dich«, hatte Stella an jenem Abend gesagt. Sie war in ihr Zimmer gegangen und hatte die Tür zugemacht, und so war es seither, den verschlossenen Türen aus Jennys Kindheit nicht unähnlich, nur umgekehrt. Damals hatte die Mutter die Türen geschlossen, nun war es die Tochter. Nicht einmal heute an ihrem Geburtstag zeigte Stella Interesse an Jennys Anwesenheit.
»Hast du was dagegen, dass ich mich anziehe, oder musst du mir dabei auch zuschauen?« Stella hatte die Hände in die Hüften gestemmt, als spräche sie mit einem aufdringlichen Hausmädchen, das sich nicht an die Anweisungen hielt, einer bedauernswert dummen Person, mit der sie sich herumschlagen musste, bis sie selbst endlich erwachsen und ungebunden war.
Jenny ging in die Küche und machte sich eine Tasse Kaffee, toastete dann einen Maismuffin für Stella. Jenny hielt Frühstück für die wichtigste Mahlzeit des Tages, auch wenn Stella anderer Meinung war.
»Ich mach dir nur rasch einen Bissen zurecht«, rief Jenny, als sie Stella im Flur hörte. »Damit du was im Magen hast.«
Jenny nahm den Muffin und ein großes Glas Orangensaft und wollte ins Wohnzimmer gehen, doch in der Tür hielt sie abrupt inne. Stella hatte in dem Schrank im Flur nach ihren schwarzen Stiefeln gesucht, aber stattdessen etwas ganz anderes gefunden. Nun saß sie im Schneidersitz auf dem Fußboden und nahm den Karton in Augenschein, der aus Unity eingetroffen war. Der miserable Anfang eines wenig verheißungsvollen Tages.
Jenny hatte geglaubt, das große Geschenkpaket hinter all den Jacken und Mänteln gut versteckt zu haben. Sie war nicht auf die Idee gekommen, dass Stella dort etwas suchen würde, bevor sie dieses Paket ebenso verschwinden lassen konnte wie all die anderen in den vergangenen dreizehn Jahren. Jedes Mal wenn ein Geschenk von Elinor Sparrow eingetroffen war, hatte Jenny es entsorgt, bevor Stella es entdeckte und sich davon in Bann ziehen ließ. Es war einerlei, ob das Päckchen eine Puppe oder einen Pullover, eine Spieluhr oder ein Buch enthielt; alles, was aus Unity kam, landete im Müllschlucker. Doch jetzt holte die Vergangenheit sie ein, zog sie mit Macht zurück zu allem, was Jenny hinter sich gelassen hatte. An diesem Morgen hätte es sie nicht erstaunt, eine Schnappschildkröte in ihrem Waschbecken vorzufinden oder eine schlammige Pfütze unter dem Teppichboden im Flur, womöglich sogar ein Erinnerungsstück aus dem Kummermuseum, fein säuberlich in Seidenpapier verpackt und mit einem Stück Schnur umwickelt, das ihrer Tochter in die Hände fiel. Es gab kein Zurück mehr: Stella hatte bereits das Paketband abgerissen. Styroporstücke rieselten auf den Boden.
»Sieh an, sieh an«, sagte Stella, und sie hörte sich entzückt und wütend zugleich an.
Der Karton enthielt das Modell von Cake House, das Jennys Vater seiner Tochter zum Spielen gebaut hatte, eine Miniaturversion des Hauses mit allen drei Schornsteinen. Wie in Wirklichkeit war das Gartentor grün gesprenkelt, und die Vogelnester, aus Stöckchen und Schnur angefertigt, thronten auf dem Dach der Veranda. Nicht einmal Forsythie und Lorbeerhecke fehlten; die winzigen Filzblätter waren mit hauchdünnen Blüten beklebt, auf denen Bienen aus Satin und Kirschkernen saßen.
»Wann wolltest du mir das zeigen?« Das Verpackungsmaterial haftete in weißen Klumpen an Stellas Uniform. »Nie?«
Jennys Vater Saul hatte ein ganzes Jahr an diesem Haus gearbeitet, doch nach seinem Tod hatte Jenny nie wieder damit gespielt. Das kleine Haus war von einem Regal in ihrem Zimmer in eine Ecke des Salons und von dort aus in einen Lagerraum im Keller befördert worden, wo es jahrelang vor sich hin gemodert hatte. Nun hatte jemand mit einer Zahnbürste die Böden geschrubbt. Die Teppiche waren gewaschen worden, der Küchentisch, aus einheimischem Kiefernholz geschnitzt, war mit Möbelpolitur behandelt worden und glänzte. Nach Zitronenöl roch er, bemerkte Jenny, und dieser Geruch erinnerte sie an ihren Vater und brachte sie häufig zum Weinen.
Stella hob das Modell aus dem Karton und stellte es auf den Tisch im Flur.
»Wolltest du es kaputtmachen, wie alles, was meine Großmutter mir geschickt hat?«
Jenny trat einen Schritt zurück, als habe man sie geschlagen. Das Zitronenöl hatte ihr Tränen in die Augen getrieben. Sie öffnete den Mund, um sich zu rechtfertigen, doch es gab keine Entschuldigung. Genau wie Stella vermutet hatte. Keinen anderen Grund außer selbstsüchtigem Stolz.
»Sag mir nicht, du hättest es nicht gewusst.« Rote Flecken erschienen auf Stellas Wangen. War sie über Nacht größer geworden? Hatte sie schon immer so erwachsen ausgesehen? So selbstgerecht? »Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Ich weiß das schon seit meinem siebten Geburtstag. Ich bin dir nachgegangen und habe zugesehen, wie du mein Geschenk in den Müllschlucker geworfen hast.«
»Ich halte dich überhaupt nicht für dumm«, sagte Jenny. »Ich wollte nur ...«
»Mich beschützen? Sichergehen, dass ich nicht infiziert werde? Von was? Einem Teddybären? Einem Puppenhaus? Oder dachtest du, sie vergiftet meine Geschenke? Vielleicht würde Arsen in mein Blut gelangen, wenn ich eines anfassen würde. War es das? Oder vielleicht hätte ich auch einfach gemerkt, dass es jemanden gibt, der mich gern hat.«