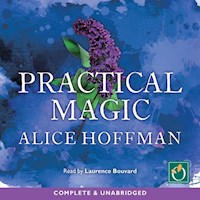5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Gefühlen, Besessenheit und Hoffnung: der meisterhafte Roman »Ein Sommer in Fox Hill« von Bestsellerautorin Alice Hoffman als eBook bei dotbooks. Die eine große Liebe, die alles bestimmt: Ist es möglich, sie jemals zu vergessen – und muss man es vielleicht, um weiterleben zu können? Fast 20 Jahre sind vergangen, seit March ihr Elternhaus im wildromantischen Neuengland verlassen hat, um sich ein eigenes Leben aufzubauen. Doch nun kehrt sie heim, um Abschied zu nehmen von der Frau, die sie wie eine Mutter geliebt hat … und so sehr sie auch hofft, dass es nicht geschehen mag: Sie wird dabei Hollis wiedertreffen, den ihr Vater einst als Ziehsohn in die Familie brachte; Hollis, mit dem sie lange Gefühle verbanden, die so warm leuchten konnten wie ein endloser Sommer und ihr doch die Luft zum Atmen nahmen. Als er nun plötzlich wieder vor ihr steht, weiß March, dass sie nichts lieber möchte, als sich in seine offenen Arme zu werfen – aber kann es für sie und Hollis wirklich eine Zukunft geben? Von Oprah Winfrey empfohlen: »Meisterhaft erzählt – Alice Hoffmans Schreibstil lässt uns sprachlos zurück.« The Denver Post Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die New-York-Times-Bestsellerautorin Alice Hoffman verwebt in »Ein Sommer in Fox Hill« Motive aus Emily Brontës Klassiker »Wuthering Heights – Sturmhöhe« mit ihrer ganz eigenen Sprachmagie – ein bewegendes Lesevergnügen für die Fans von Alice Munro, Delia Owens und Elizabeth Strout. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die eine große Liebe, die alles bestimmt: Ist es möglich, sie jemals zu vergessen – und muss man es vielleicht, um weiterleben zu können? Fast 20 Jahre sind vergangen, seit March ihr Elternhaus im wildromantischen Neuengland verlassen hat, um sich ein eigenes Leben aufzubauen. Doch nun kehrt sie heim, um Abschied zu nehmen von der Frau, die sie wie eine Mutter geliebt hat … und so sehr sie auch hofft, dass es nicht geschehen mag: Sie wird dabei Hollis wiedertreffen, den ihr Vater einst als Ziehsohn in die Familie brachte; Hollis, mit dem sie lange Gefühle verbanden, die so warm leuchten konnten wie ein endloser Sommer und ihr doch die Luft zum Atmen nahmen. Als er nun plötzlich wieder vor ihr steht, weiß March, dass sie nichts lieber möchte, als sich in seine offenen Arme zu werfen – aber kann es für sie und Hollis wirklich eine Zukunft geben?
Von Oprah Winfrey empfohlen: »Meisterhaft erzählt – Alice Hoffmans Schreibstil lässt uns sprachlos zurück.« The Denver Post
Über die Autorin:
Alice Hoffman, geboren 1952 in New York, studierte Creative Writing an der Stanford University. Sie hat über vierzig Romane und Jugendbücher veröffentlicht, die mehrfach preisgekrönt, verfilmt und in viele Sprachen übersetzt wurden. Die besondere Eindringlichkeit, die ihr Werk auszeichnet, wurde von der amerikanischen Zeitschrift Entertainment Weekly treffend zusammengefasst: »Alice Hoffman scheint in die Haut ihrer Figuren zu schlüpfen, ihre Luft zu atmen und ihre Gedanken zu denken – und dies mit einer Könnerschaft, die einen vergessen lässt, dass es sich um erfundene Charaktere handelt.« Und auch das renommierte Nachrichtenmagazin Newsweek spricht LeserInnen und KritikerInnen gleichermaßen aus der Seele: »Alice Hoffman ist eine der besten Erzählerinnen ihrer Generation!«
Die Website der Autorin: alicehoffman.com
Bei dotbooks veröffentlichte Alice Hoffman ihre Romane »Die Frauen der Hemlock Street«, »Die Geheimnisse der Sparrow-Frauen« und »Am Ufer des Haddon River«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »Here on Earth« bei G. P. Putnam's Sons, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Hier auf Erden« im Goldmann Verlag, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1997 by Alice Hoffman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Bildmotives von shutterstock/Maleo
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-391-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Fox Hill« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Alice Hoffman
Ein Sommer in Fox Hill
Roman
Aus dem Englischen von Elke vom Scheidt
dotbooks.
Teil 1
Kapitel 1
Heute abend ist das Heu auf den Feldern brüchig vom Frost, besonders westlich von Fox Hill, wo die Weiden glänzen wie mit Sternen übersät. Im Oktober fängt es um halb fünf an zu dämmern, und obwohl die Blätter sich scharlachrot und golden gefärbt haben, ist im Zwielicht alles nur noch ein Schatten seiner selbst, grau mit purpurnem Rand. Um diese Jahreszeit geht man besser nicht in den Wald; das behaupten jedenfalls die Jungen aus der Gegend. Sogar die mutigsten unter ihnen würden es nicht wagen, nach dem Fußballtraining auf dem Firemen's Field die High Road zu verlassen, und selbst die, die alt genug sind, um am dunklen Wasser des Olive Tree Lake zu stehen und ihre Freundinnen um Küsse anzubetteln, haben es immer eilig, nach Hause zu kommen. Um die Wahrheit zu sagen, ein paar rennen sogar. Denn hier oben könnte man sich leicht verirren. Wenn man oft genug die falschen Wegbiegungen nimmt, findet man sich womöglich in den Marshes wieder, und wenn jemand erst einmal dort in den Sümpfen ist, kann er ewig zwischen Elritzen und Riedgras herumwandern, und seine Seele sucht vielleicht auch dann noch nach dem Weg, wenn seine Knochen schon längst entdeckt und auf dem Hügelkamm begraben worden sind, dort, wo die wilden Blaubeeren wachsen.
Leute von außerhalb des Ortes mögen vielleicht über Jungen lachen, die an solche Sachen glauben; sie gehen vielleicht sogar so weit, sie als Dummköpfe zu bezeichnen. Und doch gibt es erwachsene Männer in Jenkintown, die sehr wenige Dinge auf dieser Welt fürchten, aber nach Einbruch der Dunkelheit nicht über den Hügel gehen würden. Sogar die Feuerwehrleute unten in der Wache in der Main Street, mutige Freiwillige, die zweimal vom Gouverneur persönlich für besondere Tapferkeit belobigt wurden, sind immer erleichtert, wenn sie feststellen, daß die Feuerglocken wegen Bränden in der Richdale oder der Seventh Street läuten – jedes Haus verdient es, daß man schnellstens hinfahrt, solange es nicht auf dem Hügel liegt.
Der Stadtgründer persönlich, Aaron Jenkins, ein siebzehnjähriger Junge aus Warwick, England, erkannte als erster, daß gewisse Örtlichkeiten Unglück bringen. Jenkins baute sein Haus in den Marshes im Jahre 1663. In einer Oktobernacht, als die Flut gefror und sich weigerte, ins Meer zurückzukehren, empfing er im Traum die Botschaft, schleunigst zu fliehen. So ließ er das wenige, was er besaß, zurück und rannte über den Hügel, obwohl gerade ein schreckliches Gewitter niederging, mit Donner direkt über ihm und Hagelkörnern so groß wie Äpfel. In seinem Tagebuch, das im Leseraum der Bibliothek ausgestellt ist, schwört Aaron Jenkins, tausend Füchse seien ihm auf den Fersen gewesen. Trotzdem hielt er erst inne, als er die Stelle erreichte, die heute der Marktplatz ist; dort baute er sich ein neues Heim, ein solides, aus einem Zimmer bestehendes Haus; heute befindet sich darin das Fremdenverkehrsbüro, wo Touristen aus New York und Boston Landkarten kaufen können.
Die Füchse, die Aaron Jenkins nachjagten, sind heute nahezu ausgerottet, aber ein paar der älteren Einwohner können sich noch an die Zeit erinnern, als es überall in den Wäldern Füchse gab. Man sah sie in die Hühnerställe schlüpfen oder draußen am Olive Tree Lake Jagd auf Welse machen. Manche Leute behaupten, wenn ein Hund ausgesetzt wurde, hätten sich die Füchse jedesmal mit dem Streuner angefreundet, und daraus sei eine Rasse eigenartig rötlicher Hunde mit rauhem Fell entstanden. Tatsächlich kamen solche Hunde in dieser Gegend einst sehr häufig vor, damals, als noch Farmen die Route 22 säumten und der Ort von so vielen Obstgärten umgeben war, daß an manchen Oktobernachmittagen die ganze Welt wie ein Obstkuchen roch.
Vor fünfundzwanzig Jahren lebten in den Wäldern noch Hunderte von Füchsen. Jeden Abend in der Dämmerung versammelten sie sich und stimmten ein Geheul an, und zwar so regelmäßig, daß die Bewohner der kleinen Stadt ihre Uhren danach stellen konnten. Dann wurde in irgendeiner schrecklichen Saison das Jagdverbot aufgehoben, und die Leute drehten durch; sie schossen auf alles, was sich bewegte. Die meisten bedauern noch heute, was da passierte; sie bedauern es aufrichtig. Die Kaninchen in dieser Gegend sind nämlich inzwischen so furchtlos, daß man sie auf den Stufen der Bibliothek sitzen sehen kann, mitten am hellichten Tag. Man erwischt sie in seinem Garten, wo sie die feinsten Salatköpfe und Bohnen mümmeln. Man kann sie auf dem Parkplatz hinter dem Eisenwarenladen sehen, wo sie an heißen Nachmittagen seelenruhig im Schatten der dort abgestellten Autos liegen. Sie sind eine Plage, das steht zweifelsfrei fest, und selbst die allerfreundlichsten Damen vom Bibliothekskomitee bringen es hin und wieder übers Herz, Gift auszulegen.
An der Straße nach Fox Hill gibt es so viele Kaninchen, daß selbst die vorsichtigsten Autofahrer Gefahr laufen, eines zu überfahren. Ein Grund mehr, den Hügel zu meiden. March Murray, die hier aufgewachsen ist, ist wie alle anderen der Meinung, daß man sich am besten von ihm fernhält, und genau das hat sie neunzehn Jahre lang auch getan. So lange hat sie in Kalifornien gelebt, wo das Licht derart zitronengelb und klar ist, daß man fast vergessen könnte, daß es auch noch andere Orte auf der Welt gibt; diese Wälder zum Beispiel, wo man an einem Oktobernachmittag den Tag leicht für Nacht halten kann und der Regen wie eine nasse Wand ist, so daß nicht einmal die Vögel fliehen können. Genau so ein Tag ist es – der Himmel hat die Farbe von Stein, und der Regen ist so kalt, daß er auf der Haut sticht –, als March nach Hause kommt. Und obwohl sie nicht vorhatte, hierher zurückzukehren, ist sie doch aus freiem Willen gekommen.
Der schlichte Akt der Wiederkehr bedeutet allerdings nicht, daß sie sich sofort wieder heimisch fühlt und jeden Ladenbesitzer im Ort beim Namen nennt, wie das früher einmal war. In der Zeit, in der sie fort war, hat March viel vergessen, beispielsweise auch, was Regen mit einer Straße machen kann. Früher ging sie diesen Weg jeden Tag, aber in ihrer Erinnerung sind die Gräben nicht so tief wie jetzt, und als sie über vom Sturm abgerissene Äste fährt, hört sie ein schreckliches Geräusch, wie das Splittern von Knochen oder von einem brechenden Herz. Der Mietwagen hat zu rucken angefangen; er kämpft sich hügelaufwärts, und der Motor gerät ins Stottern, wenn sie eine tiefe Pfütze durchqueren müssen.
»Gleich bleiben wir stecken«, verkündet Marchs Tochter Gwen. Immer die Stimme des drohenden Unheils.
»Nein, bleiben wir nicht«, behauptet March.
Wenn March nicht solchen Wert darauf gelegt hätte, recht zu behalten, wären sie vielleicht tatsächlich nicht steckengeblieben. Aber sie tritt hart aufs Gas, in Eile wie immer, und kaum tut sie das, schießt der Wagen vorwärts in den tiefsten aller Gräben, wo er einsinkt und den Geist aufgibt.
Gwen stöhnt laut. Sie stecken bis zu den Radkappen in schlammigem Wasser, und das zwei Meilen von allem und jedem entfernt. »Ich kann es nicht fassen, wie du das geschafft hast«, sagt sie zu ihrer Mutter.
Gwen ist fünfzehn und hat sich vor kurzem den größten Teil ihrer Haare abgeschnitten und den Rest schwarz gefärbt. Sie ist trotzdem hübsch, so sehr sie das auch zu sabotieren versucht. Ihre Stimme klingt ein bißchen heiser von all den Zigaretten, die sie heimlich raucht. »Jetzt kommen wir nie mehr hier raus.«
March merkt, daß ihre Nerven bloßliegen. Sie sind seit der Morgendämmerung unterwegs, von San Francisco zum Flughafen und dann von Boston aus in diesem Mietwagen weiter. Ihr letzter Halt beim Beerdigungsinstitut hat ihr den Rest gegeben. Als March sich zufällig im Rückspiegel sieht, runzelt sie die Stirn. Schlimmer als üblich. Sie hat immer sehr wenig Wertschätzung für das an den Tag gelegt, was andere als ihre besten Merkmale ansehen – ihren großzügigen Mund, ihre dunklen Augen, ihr dichtes Haar, das sie seit Jahren färbt, um die weißen Strähnen zu verbergen, die schon kamen, als sie kaum mehr als ein Mädchen war. March sieht jetzt im Spiegel nur, daß sie blaß und abgespannt und neunzehn Jahre älter ist als damals, als sie fortging.
»Wir kommen schon hier raus«, sagt sie zu ihrer Tochter, »keine Angst.« Aber als sie den Schlüssel dreht, springt der Motor nicht an.
»Ich hab's dir ja gleich gesagt«, mault Gwen halblaut.
Ohne Scheibenwischer kann man überhaupt nichts sehen, und der Regen hört sich an wie Musik von einem fernen Planeten. March lehnt den Kopf an die Kopfstütze und schließt die Augen. Sie braucht nichts zu sehen, um zu wissen, daß direkt zu ihrer Linken die Felder der Guardian Farm liegen sowie die Steinmauern, auf denen sie zu balancieren pflegte, mit ausgestreckten Armen, zu allem bereit. Sie glaubte damals wirklich, daß sie ihr eigenes Schicksal auf der Handfläche trug, als wäre Schicksal nichts weiter als eine grüne Murmel oder ein Rotkehlchenei oder ein kleines, billiges Schmuckstück, das jedes dumme Mädchen aufheben und behalten kann. Daß man alles, was man wollte, am Ende auch bekommen würde und daß das Schicksal eine Kraft wäre, die mit dir und nicht gegen dich arbeitet.
March versucht erneut, den Motor anzulassen. »Komm schon, Baby«, murmelt sie. Diese Straße ist kein Ort, an dem sie steckenbleiben möchte. Sie kennt den nächsten Nachbarn zu gut, und seine Tür ist eine, an die zu klopfen sie nicht die Absicht hat. Sie tritt immer wieder aufs Gaspedal und gibt sich alle Mühe, und schließlich schafft sie es: Der Motor springt an.
Gwen wirft die Arme um den Hals ihrer Mutter, und für den Augenblick vergessen sie allen Streit und die Gründe, warum March darauf bestanden hat, Gwen mitzuschleppen, statt sie zu Hause bei Richard zu lassen. Eine Mutter hat also kein Vertrauen zu ihrer Tochter? Ist das ein Verbrechen? Beweisstück A – Antibabypillen auf dem Grund von Gwens Rucksack zwischen der Kleenexschachtel und einem Riegel Snickers. Beweisstück B – Hasch und Zigarettenpapier in der Schublade ihres Nachttischs. Und C natürlich – der definitivste Beweis von allen –, der träumerische Ausdruck auf dem Gesicht eines fünfzehnjährigen Mädchens. D wie durchweinte Nächte. E wie endlose Schwierigkeiten und eisige Kühle der eigenen Mutter gegenüber. Wie sollte Gwen auch ahnen, daß March sehr wohl weiß, wie man sich mit fünfzehn Jahren fühlt; daß sie beispielsweise weiß, daß das, was man in diesem Alter als das Dringendste und Unausweichlichste empfindet, einen für immer verfolgen kann, wenn man sich umdreht und wegrennt.
»Je eher wir hier wegkommen, desto besser«, läßt Gwen ihre Mutter wissen. Sie stirbt vor Verlangen nach einer Zigarette, aber sie wird sich beherrschen müssen. Was nicht gerade zu den Dingen gehört, die sie am besten kann.
March tritt aufs Gas, doch die Räder graben sich immer tiefer in den Schlamm. Es besteht keine Hoffnung mehr, voranzukommen; tatsächlich werden sie ohne Hilfe eines Traktors nirgends mehr hinfahren.
»Verdammt«, sagt March.
Gwen gefällt es nicht, wie ihre Mutter sich anhört. Die ganze Situation gefällt ihr nicht. Es ist leicht zu begreifen, warum Touristen sich gewöhnlich nicht hierher verirren und warum die Landkarten im Fremdenverkehrsbüro ganz vergilbt sind. In diesen Wäldern bringt der Herbst Geister hervor. Man sieht oder hört sie vielleicht nicht, aber sie sind trotzdem da. Man weiß, daß sie da sind, wenn das eigene Herz anfängt, zu schnell zu schlagen. Man weiß es, wenn man über seine Schulter blickt und die Tatsache, daß man niemanden sieht, einen nicht davon überzeugen kann, daß da wirklich keiner ist.
Schnell versperrt Gwen ihre Tür. Hier draußen gibt es nicht einmal Straßenlaternen, meilenweit. Wenn man nicht wüßte, wohin man will, wäre man verloren. Aber Gwens Mutter kennt natürlich den Weg. Sie ist hier aufgewachsen. Sie muß ihn wissen.
»Und was machen wir jetzt?« fragt Gwen.
March zieht den Schlüssel aus dem Zündschloß. »Jetzt«, sagt sie zu ihrer Tochter, »gehen wir zu Fuß.«
»Durch den Wald?« Gwens Stimme bricht.
Ohne ihre Tochter zu beachten, steigt March aus dem Wagen und steht wadentief im Wasser. Sie patscht durch die Pfütze zum Kofferraum, um ihr Gepäck herauszunehmen. Sie hatte vergessen, wie kalt und süß die Luft im Oktober ist. Sie hatte vergessen, wie verstörend richtige Dunkelheit sein kann. Es ist unmöglich, mehr als einen halben Meter weit zu sehen, und der Regen schlägt einem ins Gesicht, als sei man ein unartiges Mädchen gewesen und nicht genug bestraft worden.
»Ich gehe nicht durch den Wald.« Gwen ist ausgestiegen, aber sie drückt sich an den Wagen. Das Mascara, das sie so sorgfältig aufgetragen hat, während sie vor dem Beerdigungsinstitut auf ihre Mutter wartete, läuft ihr jetzt in dicken schwarzen Streifen übers Gesicht.
March hat nicht die Absicht, mit Gwen darüber zu streiten; sie weiß, daß das nichts bringt, und in aller Aufrichtigkeit, schlichte Logik hat auch sie nie von irgend etwas überzeugt, als sie in Gwens Alter war. Die Leute versuchten ihr zu sagen, sie solle sich besser benehmen, sie solle die Dinge lieber langsam angehen und zweimal darüber nachdenken, aber sie hörte nie ein einziges Wort davon.
March greift nach ihrem Koffer und schließt den Wagen ab. »Du entscheidest, was du machen willst. Wenn du hier warten willst, okay. Ich gehe zum Haus.«
»Also gut«, gibt Gwen nach. »Gut. Ich gehe mit dir, wenn du unbedingt willst.«
Gwen nimmt ihren Rucksack. Kommt nicht in Frage, daß sie allein hier draußen bleibt. Nicht für eine Million Dollar. Jetzt versteht sie, warum ihre Mutter – genau wie ihr Vater, der auch hier aufwuchs, gleich die Straße hinunter – nie zurückgegangen ist. Der Grund, warum sie hier sind, ist tatsächlich ziemlich gräßlich; wenn Gwen es zuließe, hätte sie auf der Stelle einen mittleren Nervenzusammenbruch. Sie zittert so sehr, daß ihre Zähne richtig klappern. Sie wartet bloß darauf, Minnie Gilbert anzurufen, ihre beste Freundin, um es ihr zu erzählen: Meine Zähne haben geklappert wie die Knochen von einem Skelett, und ich konnte nicht mal eine gottverdammte Zigarette rauchen, weil meine Mutter dauernd dabei war. Und das alles wegen der Beerdigung irgendeiner alten Frau, mit der ich nicht mal verwandt bin.
»Bist du okay?« fragt March, als sie die Straße entlanggehen.
»Mir geht es bestens«, sagt Gwen.
Am Donnerstag ist die Beerdigung, und Gwen wird vielleicht in Ohnmacht fallen, vor allem, wenn sie ihr enges schwarzes Kleid trägt, das zu einem Ball zusammengerollt ganz unten in ihrem Rucksack liegt. Judith Dale war die Haushälterin, die March nach dem Tod ihrer Mutter aufgezogen hat, und obwohl Mrs. Dale einmal im Jahr nach Kalifornien zu Besuch kam, kann Gwen sich ihr Gesicht nicht mehr vorstellen. Vielleicht blockt sie es ab, vielleicht hat sie keine Lust, an scheußliche Dinge zu denken wie tot zu sein, alt zu werden oder mit der eigenen Mutter an einem so schrecklichen Ort festzusitzen.
»Glaubst du, daß der Sarg offen sein wird?« fragt Gwen. Endlich läßt der Regen nach.
»Das bezweifle ich«, sagt March. Schließlich war Judith Dale einer der diskretesten Menschen, die March je gekannt hat. Man konnte Judith alles anvertrauen, man konnte seine Seele offenbaren, und erst viel später, vielleicht erst nach Jahren wurde einem klar, daß sie einem nie etwas über sich selbst erzählte und daß man nicht wußte, was ihre Lieblingsnachspeise war, ganz zu schweigen davon, wen sie liebte oder woran sie glaubte.
Jetzt, da der Regen aufhört, können sie Geräusche aus dem Wald hören. Mäuse vermutlich. Waschbären, die kommen, um aus den Pfützen zu trinken.
»Mom«, sagt Gwen, als über ihnen etwas hinwegfliegt.
»Keine Angst«, versichert ihr March. »Nur eine Eule.«
Vor nicht langer Zeit streunten Berglöwen durch diese Wälder und Schwarzbären, die im Oktober bis in die Gemüsegärten kamen, um sich vollzufressen. Es gab Elche, die auf alles losgingen, was sich bewegte. Noch als March ein Mädchen war, war der Himmel so klar, daß Kinder im Ort oft enttäuscht waren, wenn sie entdeckten, daß sie nicht die Sterne vom Himmel pflücken konnten, wenn sie die Hände ausstreckten.
»Sind wir bald da?« fragt Gwen. Ihre Vorstellung von körperlicher Bewegung besteht darin, auf dem Soziussitz einer Honda mitzufahren.
Jetzt setzt die Dämmerung ein. Es ist die seltsame und trügerische Stunde, in der man Dinge sieht, die gar nicht da sind, zumindest nicht in der Gegenwart. Beinahe kann March die Leiter erkennen, die ihr Bruder Alan neben diesen Zuckerahornbäumen stehen ließ. Diese dunkle Form zwischen den Bäumen könnte der Eimer sein, den Judith Dale benutzte, um Blaubeeren zu sammeln. Und da, an der Steinmauer, steht der Junge, den March einst liebte. Wenn sie sich nicht sehr irrt, hat er angefangen, ihr zu folgen. Wenn sie langsamer wird, wird er sie einholen, wenn sie nicht aufpaßt, wird er endgültig bleiben.
»Warum rennst du denn so?« beschwert sich Gwen. Sie ist außer Atem und bemüht sich, mit ihrer Mutter Schritt zu halten.
»Ich renne gar nicht«, behauptet March. Trotzdem nennt sie ihrer Tochter eine Reihe von Gründen, warum sie es eilig haben: Sie müssen telefonieren, damit der Mietwagen abgeschleppt wird. Sie muß Richard anrufen, um ihm mitzuteilen, daß all seine Sorgen grundlos waren – es geht ihnen gut, und sie sind heil angekommen. Sie muß den Richter anrufen, um zu vereinbaren, wann sie Judiths Hinterlassenschaft durchgehen können. Sie muß Ken Helm anrufen, der immer kleine Arbeiten für die Familie verrichtet hat, damit er überprüft, ob Reparaturen am Haus notwendig sind. Sicher sind Eichhörnchen auf dem Speicher, wie immer um diese Jahreszeit.
Gwens gute Stiefel sind schlammverkrustet, und sie friert erbärmlich. »Jetzt verstehe ich, warum du und Dad nie hierher zurückkommen. Es ist widerlich.«
Marchs Schultern schmerzen vom Tragen des Koffers; vielleicht ist es auch bloß die Anspannung. Diese alte, unbefestigte Straße führt nur bergauf. Vermutlich hätten sie die Route 22 nehmen und an einer Stelle, die die Leute Teufelsecke nennen, links abbiegen sollen. Wenn Richard nicht mitten in einem Schulsemester gewesen, sondern mit ihr gekommen wäre, hätte sie vielleicht diesen Weg genommen, aber sie ist nicht bereit, solche Dinge allein zu machen, noch nicht. Sie hat sowohl Richard als auch sich selbst gesagt, daß die Vergangenheit vergangen ist, aber wenn das stimmt, warum fühlt sie sich dann, als wäre ihr soeben jemand mit einem Eiswürfel über die Haut gefahren?
»Ich glaube, ich sehe das Haus«, verkündet Gwen.
Es ist Ken Helm gewesen, der Handwerker, der Mrs. Dale gefunden hat. Er hatte am frühen Montag abend, nachdem er die zur Reparatur des Schornsteins benötigten Ziegelsteine geliefert hatte, an die Tür geklopft. Da hatte der Himmel die Farbe eines Samtbandes gehabt, das sich über die Hügel legt. Zuerst hatte er gedacht, es sei niemand zu Hause, aber dann war Wind aufgekommen und hatte die angelehnte Tür aufgestoßen, und Judith hatte in einem Sessel am Kamin gesessen und war nicht mehr unter den Lebenden gewesen. Der alte Partner und Freund von Marchs Vater, Bill Justice, im ganzen Commonwealth als »der Richter« bekannt, hat March all das erzählt, als er am nächsten Morgen anrief. Zumindest sei Mrs. Dale ein Krankenhausaufenthalt erspart geblieben, und sie habe keine Schmerzen gehabt. Trotzdem kann dies March nicht trösten, vor allem, weil sie glaubt, daß Bill Justice die Sprechmuschel seines Telefons zugehalten hat, um die Tatsache zu verbergen, daß er weinte.
»Das ist eindeutig ein Schornstein.« Gwen späht in die Dunkelheit. »Ich sehe ihn jetzt. Und da ist ein Tor.«
Auf dem Flug hierher ist March eingeschlafen, was sie bei Reisen immer fürchtet, weil sie sich hinterher stets matt und desorientiert fühlt. In ihrem Traum hat sie ihren Vater gesehen, der seit fast fünfundzwanzig Jahren tot ist: Henry Murray stand in der Tür zum Wohnzimmer und trug den Pullover, den March am liebsten gehabt hatte, den braunen Wollpullover mit den tiefen Taschen, in denen er immer Pfefferminzdrops aufbewahrte. Er und Bill Justice waren die einzigen Anwälte im Städtchen, und obwohl sie Partner waren, lagen sie in einem freundschaftlichen Wettstreit darum, wer von ihnen der Beliebtere war.
»Wollt ihr Murray oder wollt ihr Justice?« pflegte Bill scherzhaft zu fragen, damit spielend, dass Justice auch Gerechtigkeit bedeutete; vielleicht brauchte er diesen Witz, denn Henry Murray war klar der Favorit. Kinder bettelten ihn jedesmal, wenn er in den Ort ging, um Pfefferminzdrops an, und sie liefen ihm nach und verlangten ein zweites und drittes. Als er plötzlich starb, während er noch spät in seinem Büro arbeitete, erzählten hinterher alle Jungen und Mädchen des Städtchens, sie hätten in der Nachtluft Pfefferminze gerochen, als sei auf einmal etwas Süßes direkt an ihnen vorbeigezogen.
Jedesmal, wenn March an ihren Vater denkt, empfindet sie einen scharfen Schmerz in der Seite. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Verluste ein einziges Individuum aushalten kann. Richard hat überhaupt keine Familie mehr, außer March und Gwen, und March hat kaum mehr – nur ihren Bruder Alan, dem sie sich so entfremdet hat, daß es nicht mehr viel Sinn macht, von Blutsverwandtschaft zu sprechen, was natürlich auch für Alans Sohn gilt, einen Jungen, den sie nie auch nur kennengelernt hat.
»Das ist es also«, sagt Gwen.
Sie stehen am Tor.
March stellt ihren Koffer ab, um sich alles eingehend anzusehen.
»Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, daß du je hier gelebt hast«, sagt Gwen.
Im Dunkeln sieht das Haus alt und schief aus. Der Teil, der abgebrannt war, die ursprüngliche Küche und das Eßzimmer, ist als bescheidener Anbau wieder erneuert worden. March hat in diesem Haus gewohnt, bis sie einundzwanzig war. Ihr Fenster ist das über dem Dach der Veranda, das mit den schwarzen Läden, die man nach dem Öffnen einklappen und verriegeln muß. Dort hat sie in den letzten Jahren vor ihrem Weggehen die meiste Zeit verbracht. Wartend am Fenster.
Ist sie überrascht, sich dabei zu ertappen, daß sie an Hollis denkt, als sie dieses Fenster jetzt wiedersieht? Sie war erst siebzehn, als er fortging, aber schon fast ihr halbes Leben lang in ihn verliebt gewesen. In diesem schrecklichen Winter, in dem er fortging, als der Himmel immer die Farbe von Asche hatte und der Kastanienbaum im Vorgarten in Eis gehüllt war, fing sie an, weiße Strähnen in ihrem dunklen Haar zu finden.
Heute abend, im gleichen Vorgarten, in dem noch immer der Kastanienbaum wächst, raschelt etwas in den Hagebuttenbüschen. Gwen rückt so nahe wie möglich an ihre Mutter heran; ihr ist eiskalt, innerlich und äußerlich.
»Mom?«
Wenn Gwen sich erschrocken anhört, dann deshalb, weil sie es wirklich ist. Das hier entspricht nicht dem, was sie erwartet hatte, als sie sich bereit erklärte, zur Beerdigung mit ihrer Mutter in den Osten zu reisen. Sie hatte es sich so schön vorgestellt, eine Woche lang nicht zur Schule zu müssen; sie hatte vorgehabt, jeden Tag bis Mittag zu schlafen, nichts außer Schokoriegeln und Getreideflocken zu essen und die Pause vom realen Leben richtig zu genießen. Jetzt, an diesem dunklen Abend, fühlt sie sich viel zu weit von zu Hause entfernt. Wer ist diese Frau neben ihr mit dem langen, dunklen Haar und dem traurigen Gesicht? Gwen, die mutig – oder draufgängerisch – genug ist, sich mit den Wachleuten anzulegen, wenn sie im Palo Alto Shopping Center beim Ladendiebstahl erwischt wird, zittert jetzt. Auf was hat sie sich da eingelassen?
»Schau«, sagt March zu ihrer Tochter. »Das sind bloß ein paar Kaninchen.«
Tatsächlich, mehrere braune Kaninchen hocken unter der Hagebuttenhecke. Das größte von ihnen kommt heraus, als wolle es sich mit March und Gwen bekriegen, als gehöre der ganze Hügel ihm, einem Geschöpf, das klein genug ist, um in einen großen Sonnenhut oder einen gußeisernen Topf zu passen.
»Hau ab«, sagt March zu dem Kaninchen. »Verschwinde.« Als es sich nicht rührt, schwenkt sie ihren Koffer hin und her, und das Kaninchen hoppelt davon und verschwindet in den Wäldern. »Siehst du?« sagt sie zu ihrer Tochter. »Kein Problem.«
Aber Gwen ist durchaus noch nicht von diesem Ort überzeugt. »Sollen wir reingehen?« Sie flüstert, und ihre Stimme klingt brüchig.
»Wenn nicht, müssen wir auf der Veranda schlafen.«
Darüber müssen sie beide lachen; es ist nicht zu dunkel, um zu sehen, daß wegen der kaputten Regenrinnen auf der ganzen Veranda das Wasser steht. Kein Ort, wo man die Nacht verbringen möchte, es sei denn, man ist ein Tausendfüßler oder sonst etwas Unheimliches, das krabbelt. March greift unter den Briefkasten, und da ist der Schlüssel, mit Klebeband darunter befestigt, wie immer.
»Du hast wirklich hier gewohnt«, sagt Gwen.
Früher nahm March diese Verandastufen immer zwei auf einmal, immer in Eile, immer mit dem Hunger nach mehr. Von da aus, wo sie stehen, kann March Judiths Garten sehen, und sofort fühlt sie sich getröstet. Trotz allem, einige Dinge sind gleich geblieben. Der Garten ist noch ganz genauso, wie er zu Marchs Kinderzeiten war. Die Minze sprießt noch immer in grasartigen Büscheln, und die Zwiebeln mit ihrem scharfen, bitteren Geruch haben kein bißchen unter dem kalten Wetter gelitten. Die letzten Kohlköpfe ducken sich am Zaun, wie immer im Oktober, in sauberen, ordentlichen Reihen, wohlerzogenen grünen Kröten gleich.
Vielleicht wird sie bedauern, daß sie zurückgekommen ist, aber jetzt im Augenblick gibt es keinen Ort auf der Welt, der sich vertrauter anfühlen könnte. Dort, im tiefer gelegenen Teil des Gartens, kann March die Wiese mit den Obstbäumen erkennen, ihr Lieblingsplatz. Die Apfelbäume sind knorrig wie kleine alte Männer, die dem Wind den Rücken zudrehen. March pflegte um diese Jahreszeit jeden Nachmittag auf die Bäume zu klettern und Macintoshs und Macouns zu pflücken, wobei sie den Stiel jedes Apfels genau achtmal drehte, während sie das Alphabet aufsagte, wie es Mädchen tun, um den Namen ihres Liebsten zu erfahren, und ihn erst dann vom Zweig abriß, wenn sie den ersten Buchstaben seines Namens erreicht hatte.
Kapitel 2
Er kam an wie ein Postpaket, an einem grauen und windigen Tag. March erinnert sich noch ganz genau: Es war ein Samstag, und ihr Vater war fast eine Woche fort gewesen, zu einer Konferenz in Boston. Während des größten Teils der Woche war March krank gewesen, mit Fieber und Schnupfen, und Mrs. Dale hatte sie mit Orangensaft und Pfefferminztee versorgt. March war an diesem Tag spät aufgewacht, etwas, das ihr im Alter von elf Jahren selten passierte, als es noch so aussah, als liege die ganze Welt vor ihr, wartend und bereit für sie allein.
An diesem Samstag war Marchs Bruder Alan, normalerweise der Langschläfer der Familie, schon in der Küche und trank Kaffee, als March hereingetrottet kam. Alan, der zehn Jahre älter war als March, hatte an der Boston University seinen Abschluß gemacht, aber der war nicht gut gewesen. Er hatte sich für ein paar Kurse an der Derry Law School eingeschrieben, da er immer noch hoffte, seinem Vater in seinem Beruf nachzufolgen, was ihm aber nie gelingen sollte.
»Wir haben einen Jungen gekriegt«, sagte Alan.
»Nein, haben wir nicht«, sagte March. Sogar mit elf wußte sie schon, daß ihr Bruder ein Aufschneider war, und sie gab sich Mühe, möglichst wenig von dem zu glauben, was er sagte.
»Nein, wirklich«, behauptete Alan. Er hatte gerade angefangen, mit Julie zu gehen, dem Mädchen, das er später heiraten sollte, und war gutmütiger gestimmt als gewöhnlich. Er nannte March nicht wie sonst Dummkopf oder Idiotin oder redete sie, um sie zu ärgern, mit ihrem Taufnamen Marcheline an. »Dad hat ihn aus Boston mitgebracht. Er hat ihn von der Straße aufgelesen oder so.«
»Na klar«, sagte March. »Lügner.«
»Um was wetten wir?« sagte Alan. »Wie wär's mit deinem Taschengeld für den Rest deines Lebens?«
Judith Dale kam mit einem Korb Wäsche herein, die sie von der Leine genommen hatte. Sie trug damals das Haar hochgesteckt, und an Hosen und Strickjacken lag ihr ebensoviel wie an Ruhe und Frieden.
»Leute können doch nicht einfach so andere Leute kriegen«, sagte March. »Oder?« Sie wandte sich immer an Judith, um sich Rückendeckung zu holen, aber diesmal zuckte Judith nur mit den Schultern. Sie blieb vage in den Details, aber sie gab zu, daß sie das Gästezimmer mit sauberen Laken und einem Quilt hergerichtet hatte, der normalerweise auf dem Speicher aufbewahrt wurde.
March ging ans Fenster, konnte aber nichts sehen. Alan trat hinter sie, wobei er eine Scheibe gebutterten Toast aß und sich die Krümel von der Brust streifte.
»Da ist er«, sagte Alan und deutete hinaus in den Obstgarten.
Und tatsächlich, da war er, gleich jenseits des Tors. Er war dreizehn und mager und hatte lange, dunkle Haare, die seit Wochen nicht gewaschen worden waren.
»Ein echter Gewinn«, sagte Alan mit seiner üblichen Verachtung.
Der Junge mußte gespürt haben, daß er beobachtet wurde, weil er sich plötzlich umdrehte und zum Fenster schaute. Die Wolken waren an diesem Tag dünn und zerrissen und wurden vom Wind umhergetrieben.
Als March winkte, war der Junge so überrascht, daß er einfach nur blinzelte. March hätte über seine Verlegenheit gelacht, wenn sie nicht sofort gemerkt hätte, daß sie nicht aufhören wollte, ihn anzusehen.
»Behalten wir ihn für immer?« March spürte tief in ihrem Inneren, daß es besser war zu flüstern.
»Gott, hoffentlich nicht«, sagte Alan.
Draußen im Obstgarten starrte der Junge sie weiter an. Das Gras war in dieser Saison noch nicht gemäht worden, und alle Narzissen waren fest geschlossen, um sich vor dem unbeständigen Wetter zu schützen.
»Ich nehme ihn«, erbot sich March.
»Red keinen Mist«, hatte Alan gesagt, aber als er gegangen war, blieb March genau da stehen, wo sie war.
»Ich rede keinen Mist«, sagte sie laut, obwohl niemand mehr da war, der sie hören konnte. Fast dreißig Jahre später kann sie noch immer spüren, wie diese Worte sich in ihrem Mund anfühlten, wie köstlich sie waren, wie absolut süß. »Von jetzt an gehört er mir.«
Alles, was sie über ihn wußte, erfuhr sie von Judith Dale. Er war ein Waisenjunge aus Boston, so arm, daß er sich nur von Crackers und dem ernährte, was er sonst noch stehlen konnte. Bis Marchs gutherziger Vater beschloß, ihn nach Hause mitzunehmen.
»Und das ist alles, was wir wissen?« Sie saßen an einem schönen, blauen Tag draußen auf der Veranda und füllten die Futterhäuschen für die Vögel, die Judith gern in den Kastanienbaum hängte. »Was ist mit seinen Eltern? Hat er Geschwister? Wissen wir genau, daß er dreizehn ist?«
»Du bist so naseweis«, sagte Judith. »Er heißt Hollis, und er bleibt bei uns. Das ist alles, was du wissen mußt.«
Zuerst wollte der neue Junge kein Abendbrot essen – nicht einmal, wenn es Lammkoteletts und Spargel und zum Nachtisch Erdbeeren gab. Er sah niemandem in die Augen, nicht einmal Henry Murray, vor dem er offensichtlich Respekt hatte; Mr. Murray war der einzige Mensch, dem Hollis keine Widerworte gab. Sonst war er zu den meisten Leuten frech, auf eine abweisende, verschlossene Art. Was einen nervös machen konnte, war der Blick, mit dem er einen dabei ansah. Darin lag alles, was er nicht sagte.
Nach drei Monaten ging Hollis ihnen noch immer aus dem Weg. Doch March fand ihn immer interessanter. Sie wünschte sich dauernd, ihn zufällig zu treffen, aber wenn es dazu kam – einmal, als er Steine auf irgendein unsichtbares Ziel jenseits des Obstgartens warf, und einmal, als sie eines Abends auf dem Weg ins Badezimmer im Flur fast aufeinanderprallten –, bekam sie in seiner Gegenwart kein Wort heraus. Da March sonst immer äußerst gesprächig gewesen war, war dieses Verhalten besonders erstaunlich.
»Sprich lauter«, forderte Judith sie immer auf, wenn Hollis in der Nähe war, aber March brachte es nicht fertig. Sie ging sogar soweit, Regenwasser zu trinken, was, wie sie von Mrs. Hartwig wußte, die in der Schulcafeteria arbeitete, ein sicheres Heilmittel für sprechfaule Kinder sei.
Trotzdem hatten Hollis und March noch nicht miteinander gesprochen, nicht einmal, um beim Abendessen um Brot und Butter zu bitten. Aber dann, eines Tages im Sommer, erfüllte sich ihr Wunsch. Es war im Juli, vielleicht auch in der ersten Augustwoche. Jedenfalls war es entsetzlich heiß, und das seit Ewigkeiten. March ging barfuß, und ihre Fußsohlen waren schwarz. Sie schenkte sich gerade ein Glas von Judiths geeistem Pfefferminztee ein, als sie über sich eine Libelle vorbeifliegen sah. Sie war größer als die, die man gewöhnlich über der Wasserfläche des Olive Tree Lake schweben sah, und so blau, daß March ungläubig blinzelte. Sie folgte der Libelle ins Wohnzimmer, wo diese sich auf die Vorhänge setzte, und da war Hollis, im Sessel ihres Vaters, und las eines von Henry Murrays Lehrbüchern, eine komplizierte Abhandlung über Totschlag.
»Ich möchte diese Libelle fangen«, sagte March.
Hollis starrte sie an. Seine Augen waren absolut schwarz. »Na, und?« antwortete er endlich.
Die Libelle schlug mit ihren schillernden Flügeln gegen den Stoff der Vorhänge.
»Du mußt mir helfen.« March war erstaunt, wie selbstsicher sie sich anhörte, und vielleicht war Hollis das auch, denn er legte sein Buch hin und kam, um ihr zu helfen.
In panischer Angst versuchte die Libelle zu entkommen; sie prallte gegen die Fensterscheibe, und dann verfing sie sich in den langen Strähnen von Marchs Haar. March konnte die Libelle fühlen, die fast nichts wog; sie konnte sie noch fühlen, nachdem Hollis sie aus ihrem wirren Haar gepflückt, das Fenster geöffnet und sie hinausgelassen hatte, wo sie sofort verschwand, als habe der Himmel sie verschluckt.
»Bist du jetzt zufrieden?« fragte Hollis.
Er roch ziemlich stark nach Seife, da Mrs. Dale darauf bestand, daß er jeden Tag duschte. Aber er hatte noch einen anderen, sengenden Geruch, von dem March später entdecken sollte, daß es Wut war.
»Nein. Aber bald«, sagte March, nahm ihn mit in die Küche und holte zwei Becher Pistazieneiscreme aus dem Kühlschrank. Sie aßen jeder eine riesige Portion, und als sie fertig waren, fröstelten sie, obwohl die Hitze so drückend war wie zuvor. March kann sich noch immer erinnern, wie kalt ihre Zunge sich anfühlte von all dem Eis.
»Du solltest dich besser von ihm fernhalten«, warnte Alan seine Schwester. Er berichtete von einigen häßlichen Gerüchten: daß Hollis jemanden ermordet habe und darum in die Obhut ihres Vaters gegeben worden sei. Daß seine Mutter eine inzwischen ermordete Prostituierte gewesen sei. Daß March die paar Wertsachen, die sie besaß, besser wegsperren solle – einen silbernen Kamm, den ihre Mutter ihr hinterlassen hatte, und ein vergoldetes Armband mit Anhängern –, da Hollis ganz bestimmt ein Dieb sei.
Aber March wußte, daß ihr Bruder eifersüchtig war. Wenn Henry Murray Hollis als seinen Sohn vorstellte, wurde Alan immer blaß. Alan war nie mit seinem Vater klargekommen und hatte ihn in jeder Weise enttäuscht, und nun war er durch jemanden ersetzt worden, der früher nicht gewußt hatte, was Shampoo war, und der noch immer nicht die leiseste Ahnung hatte, wie man sich in Gesellschaft benahm. Bei Essenseinladungen oder an Feiertagen pflegte Hollis dazusitzen und in einem dieser elenden juristischen Lehrbücher zu lesen, und wenn man ihn ansprach, gab er keine Antwort; die einzigen Menschen, denen er überhaupt Beachtung schenkte, waren Henry Murray und March.
»Warum gehst du nicht irgendwohin, wo man dich haben will?« fragte Alan Hollis.
»Warum hältst du nicht die Klappe?« erwiderte Hollis prompt, und er machte sich nicht einmal die Mühe, Alan, der acht Jahre älter und ein erwachsener Mann war, dabei anzusehen.
Alan nahm jede Gelegenheit wahr, Hollis zu demütigen. In der Öffentlichkeit behandelte er ihn, als sei er ein Dienstbote; zu Hause ließ er den Jungen spüren, daß er ein Eindringling war. Oft schlich sich Alan in Hollis' Zimmer und richtete dort so viel Schaden an, wie er nur konnte. Er goß Kälberblut in die Schreibtischschubladen und ruinierte Hollis' bescheidene Garderobe, weil er sehr genau wußte, daß Hollis lieber jeden Tag die gleichen Sachen tragen als eine Niederlage zugeben würde. Er legte einen Haufen Kuhfladen in den Wandschrank, und als Hollis herausfand, woher der Gestank kam, war alles, was Henry Murray ihm gegeben hatte – die Bücher, die Lampen und die Bettdecken –, von dem Geruch verseucht.
Je freundlicher Henry Murray zu Hollis war, desto verbitterter wurde Alan. Obwohl die Familie Weihnachten nicht feierte, überraschte Henry Murray seine Kinder an diesem Tag immer mit kleinen Geschenken, und in dem ersten Winter, in dem Hollis bei ihnen war, schenkte er March eine dünne goldene Halskette und den beiden Jungen hübsche Taschenmesser mit Perlmuttgriffen. Alan hatte seine Kurse an der juristischen Fakultät nicht bestanden, und die Tatsache, daß er und diese Kreatur gleich behandelt wurden, tatsächlich wie Brüder, erbitterte ihn. Als sie sich an diesem Abend zum Dinner hinsetzten, schäumte Alan vor Wut.
»Er ist zu jung für ein Messer«, sagte Alan zu seinem Vater. »Man kann ihm kein Messer anvertrauen.«
»Das ist schon in Ordnung«, sagte Henry Murray freundlich zu Hollis, der links von ihm saß, und ignorierte Alan.
»Gott, bist du blind«, erklärte Alan. Judith Dale hatte ihren freien Tag, aber sie hatte ihnen das Dinner hergerichtet: gebratenes Huhn und Kartoffeln und grüne Bohnen. Alan schob seinen Teller weg und stieß dabei sein Wasserglas um. »Keiner, der bei Trost ist, würde ihm eine Waffe anvertrauen. Du mußt verrückt sein.«
Wenn es etwas gab, das Henry Murray nicht ausstehen konnte, dann einen Menschen, der nicht fair war, und genau das schien sein Sohn zu sein. Hollis sagte nichts zu seiner Verteidigung, und das wiederum konnte March nicht mitansehen. Die Art, wie er keinem in die Augen schauen konnte; die Art, wie er sich immer tiefer in sich selbst zurückzuziehen schien, bis der Teil von ihm, der mit ihnen beim Essen am Tisch saß, nur noch ein winziges Stückchen seiner selbst war.
»Halt die Klappe, Alan«, sagte March. »Du bist derjenige, der verrückt ist.«
March saß rechts von ihrem Vater, und jetzt legte dieser ihr eine Hand auf den Arm. »Ich möchte nicht, daß du so redest«, sagte er. »Nicht zu Alan. Überhaupt zu niemandem.«
Hollis hatte sein Essen noch immer nicht angerührt. Er starrte auf seinen Teller, aber March hatte das Gefühl, daß er alles beobachtete. »Du bist ja bloß eifersüchtig«, sagte sie zu Alan.
Alan stieß ein kurzes, verächtliches Lachen aus. Er nickte in Hollis' Richtung. »Auf das da?«
Henry Murray legte sein Messer und seine Gabel hin. »Du verläßt auf der Stelle den Tisch«, sagte er.
»Ich?« Alan war schockiert. »Du willst, daß ich gehe?«
»Komm zurück, wenn du dich anständig benehmen kannst«, sagte Henry Murray, und sein Ton machte deutlich, daß er das in nächster Zeit nicht erwartete, ganz bestimmt nicht an diesem Abend.
Alan stand so hastig auf, daß sein Stuhl polternd nach hinten fiel. March hatte die ganze Zeit Hollis angestarrt, daher bemerkte sie, daß er in diesem Augenblick zu essen begann. Sorgfältig zerkleinerte er seine Speisen und erwiderte ihren Blick, ohne zu blinzeln. Da kam March auf einmal die Idee, Hollis zum Lachen zu bringen; sie würde sehen, ob sie das fertigbrachte. Schielend verdrehte sie die Augen und streckte ihm die Zunge heraus.
»Was soll denn das?« fragte ihr Vater sie.
March hatte nicht damit gerechnet, daß ihr Vater ihre Grimasse mitbekommen würde. »Nichts«, antwortete sie rasch.
Ein Blick in Hollis' Richtung bestätigte ihr, daß sie ihm zwar kein Lachen, aber wenigstens ein Grinsen entlockt hatte.
»Sie hat nichts gemacht«, sagte nun auch Hollis.
»Das will ich hoffen.« Endlich wandte Henry Murray sich seinem Essen zu. »Ein ungezogenes Kind ist mehr als genug.«
Alan hätte über den Dingen stehen sollen, er hätte sich darauf konzentrieren sollen, einen Job zu finden oder für seine Kurse zu büffeln, aber nach diesem Essen sann er nur noch auf Rache. Er wartete auf den richtigen Moment, und endlich, an einem kalten Wintertag, als schöner, leichter Schnee fiel, schnappten sich Alan und ein paar seiner Kumpel Hollis auf dem Weg, der zum Olive Tree Lake führte. Sie packten ihn und spuckten ihm ins Gesicht, hielten ihn fest und schlugen und traten abwechselnd auf ihn ein, wobei sie mit ihren Fäusten und Stiefeln sorgfältig zielten.
Der Himmel war grau an diesem Tag, und Krähen kreisten am Horizont. Alan und seine Freunde prügelten Hollis, bis ihm das Blut aus Mund und Nase strömte. Sie wollten, daß er um Gnade flehte, und sie bat aufzuhören, aber er tat nichts dergleichen. Er schloß die Augen, damit er nicht versehentlich von einem ihrer Schläge blind gemacht wurde. Er verfluchte sie so tief in seinem Inneren, daß sein Ausdruck nichts verriet. Blut rann in den Schnee, und von der anderen Seite des Sees kam ein dröhnendes Geräusch, als Mr. Judson, dem da oben so viel Land gehörte, mit seinem Schneemobil durch den Wald fuhr.
Endlich, als sie es leid waren, ihn zu schlagen, fesselten sie ihn an einen Baum, wo er blieb, bis es dunkel wurde, ohne ein einziges Mal um Hilfe zu rufen. Als er nicht zum Abendessen erschien, nutzte Alan die Gelegenheit, ihn als verantwortungslos und gedankenlos hinzustellen. Da er um neun noch immer nicht aufgetaucht war, ging March ihn suchen. Sie fand ihn immer noch an den Baum gebunden, glühend vor Wut und Verlegenheit. Mit dem perlmutternen Taschenmesser, von dem sie wußte, daß er es bei sich trug, schnitt sie die Stricke durch, während Hollis das Gesicht wegdrehte.
»Du sollst mich nicht bemitleiden«, sagte er, als sie fertig war.
An seinen Handgelenken, wo sie die Knoten zu fest angezogen hatten, waren rote, blutige Striemen.
»Tue ich gar nicht«, sagte March, und das stimmte. Selbst in diesem Moment war Alan derjenige, der ihr leid tat; für Hollis empfand sie etwas ganz anderes als Mitleid. »Ich weiß, daß Alan das getan hat. Verpetz ihn. Ich werde sagen, daß ich alles gesehen habe.«
»Aber das hast du nicht«, sagte Hollis. Er wischte sich mit den Handrücken das Blut aus dem Gesicht und wusch sich dann mit Schnee die Wangen und die Hände. Seine Jacke war zerrissen, und jetzt riß er an seinem Hemdsärmel. »Das hast du auch nicht gesehen.« Mit einer Geste forderte er sie auf, ihm das Messer zurückzugeben. Er nahm es in die linke Hand und schnitt sich mit einer raschen Bewegung tief in den rechten Arm.
»Hör auf!« schrie March.
Hollis stand auf und warf die Stricke, mit denen sie ihn gefesselt hatten, so weit weg, wie er konnte. Sie verschwanden in einer entfernten Schneewehe. Auf halbem Weg nach Hause begannen Hollis' Zähne zu klappern, obwohl er sich die Jacke über die Schultern geworfen hatte; als sie die Haustür hinter sich schlossen und endlich sicher in der warmen Diele standen, brach er zusammen.
Henry Murray fuhr sie zum St. Bridget's Hospital, wo die Wunde in Hollis' Arm mit dreiundzwanzig Stichen genäht werden mußte.
»Wer hat das getan?« wollte Henry Murray wissen, als er und March im Wartezimmer saßen. »Alan?«
March starrte zu Boden und konnte sich keine Antwort abringen, und diese Reaktion faßte ihr Vater als Ja auf.
In dieser Nacht teilte Henry Murray Alan mit, wenn er weiter in seinem Haus wohnen wolle, müsse er Hollis mit Respekt behandeln. Außerdem müsse er einen Entschuldigungsbrief schreiben, und von seinem eigenen Geld müsse er die Krankenhausrechnung und eine neue Jacke bezahlen. Das Messer wurde natürlich beschlagnahmt, trotz Alans Beteuerungen, er sei es nicht gewesen.
»Du solltest zu allem anderen nicht auch noch lügen«, sagte Henry Murray, und danach hörte Alan auf, seine Unschuld zu beteuern.
In dieser Nacht konnte March nicht schlafen. Sie ging in die Küche, um sich ein Glas Milch zu holen, und auf dem Rückweg in ihr Zimmer blieb sie vor Hollis' Tür stehen; schließlich klopfte sie an und stieß die Tür auf. Er lag im Bett, schlief aber noch nicht. March trat ein und zog die Tür hinter sich zu. Im Mondlicht, das vom Schnee im Garten reflektiert wurde, konnte sie sehen, daß Hollis' rechter Arm einen weißen Verband trug.
»Weißt du, warum ich mir in den Arm schneiden mußte?« fragte Hollis. Er hatte sorgfältig darüber nachgedacht, während er gefesselt am Baum gestanden hatte. »Damit keiner denkt, daß ich es selbst getan habe.«
»Wie hast du das geschafft?« fragte March. Sie setzte sich auf sein Bett, um den Arm besser sehen zu können. »Hat das nicht weh getan?«
»Blöde Frage.«
Hollis' Stimme hatte einen gehässigen Unterton, und vielleicht hätte March sich umgedreht und wäre gegangen, wenn sie nicht in diesem Moment gemerkt hätte, daß er weinte. Sie streckte sich neben ihm aus, den Kopf auf seinem Kissen. Sie blieb dort lange liegen und beobachtete ihn, und so fand sie heraus, wie weh es tat.
Sie blieb bei ihm, bis er einschlief, und obwohl sie nie über diese Nacht oder die Tatsache sprachen, daß sie da neben ihm im Bett gelegen hatte, waren sie Verbündete geworden. Wann immer irgendeine Schulkameradin March einlud oder ihr Vater darauf bestand, daß sie Zeit mit Mädchen ihres Alters verbrachte – mit Susanne beispielsweise, der Tochter seines Partners –, litt March und zählte die Minuten, bis sie wieder bei Hollis sein konnte. Manchmal erfand sie Vorwände und sagte, sie habe Fieber oder ihr sei schlecht, und dann rannte sie den ganzen Heimweg nach Fox Hill.
Besonders deutlich erinnert sie sich an den Sommer, in dem ihr Vater starb. Da war sie vierzehn. Nachts schien der Mond riesig, der silberne Augustmond, der aufgeht, wenn der Eremitenvogel in den Gärten auftaucht. In dem Jahr spielten die Frösche in den Wäldern verrückt. Sie riefen vom anderen Ufer des Olive Tree Lake und aus jeder Pfütze im Garten. Sie kamen zu den Beeten, wo Judiths Minze wuchs, und quakten die ganze Nacht ein schlammiges Lied, so daß man nur schwer schlafen konnte. Wann immer March die Augen schloß, hörte sie die Frösche wie einen lebenden Puls, den Hintergrund heißer Augustnächte, die so schwarz und tief sind, daß an friedliche Träume nicht zu denken ist.
Immer, wenn sie aus ihrem Fenster kletterte, war Hollis schon da, auf dem flachen Teil des Daches. Sie mußten leise sein dort draußen, um niemanden zu wecken. Zuerst küßten sie sich mit geschlossenen Augen, als sei das leiser und heimlicher. March erzählte es niemandem, nicht Mrs. Dale, der sie sich sonst anvertraute, und auch nicht Susanna Justice, die immer die intimsten Details von allem erfahren wollte. Es war die Art von Sommer, in der man nichts wahrnimmt als sich selbst und den Menschen, den man liebt, und so war Marchs Fassungslosigkeit um so größer, als Alan sie eines Morgens weckte, indem er sie an der Schulter rüttelte, und verkündete, ihr Vater sei gestorben.
Obwohl Henry Murray Hunderte von Testamenten für seine Mandanten aufgesetzt hatte, hatte er sein eigenes seit der Zeit vor Marchs Geburt nicht mehr geändert. Deshalb erbte Alan alles in Fox Hill. Mrs. Dale blieb natürlich bei ihnen, und sämtliche Auslagen von March wurden bezahlt, aber Hollis mußte auf den Speicher ziehen. Jetzt konnte Alan sich benehmen, wie es ihm gefiel, und er fing an, eine wöchentliche Rechnung zu schreiben, in der er Hollis' Kosten für Essen und Wohnen zusammenstellte. Nach der High-School brauchte Hollis zwei Jahre, bis er Alan Murray alles zurückzahlen konnte, aber er tat es. Er arbeitete in der Bäckerei in der Main Street und leistete bis Mittag einen vollen Arbeitstag, und dann ging er zum Olympia Race Track, wo er lernte, daß ein Mann die Chance hatte, sein Geld zu verdoppeln, wenn er nur risikofreudig genug war. An Abenden und Wochenenden fuhr er einen Lastwagen für die Stadtwerke, streute im Winter Salz auf die Straßen und schnitt Äste zurück und sammelte Müll von der Route 22, wenn das Wetter gut war.
An dem Tag, an dem er fortging, war das Wetter ganz besonders schön. March sollte bald die High-School abschließen, und sie erinnert sich, wie sie und Judith Dale über ihre Zukunft sprachen, die damals völlig offen schien; sie beschlossen, die Fenster zu putzen, um den herrlichen blauen Himmel besser zu sehen. Welche Möglichkeiten March auch in den Sinn kamen – College, Reisen, ein Job in Boston –, immer gehörte Hollis zu ihrer Zukunft, soviel stand fest.
Als Hollis nach Hause kam und verkündete, er habe alle seine Jobs gekündigt, hatte er das Gefühl, nie zuvor so frei gewesen zu sein. Er hatte seine Schulden bei Alan mit Hilfe eines Wallachs namens Sandpaper bezahlt, der ein Rennen mit einer Quote von fünfundzwanzig zu eins auf dem Olympia Track gelaufen war und zum Erstaunen aller, Hollis eingeschlossen, gewonnen hatte. Jetzt konnte Hollis fortgehen und brauchte nicht zurückzukommen. Es war der wichtigste Tag in seinem Leben: der Moment, auf den er seit Henry Murrays Tod hingearbeitet hatte. Aber das hatte March nicht erkannt. In letzter Zeit hatte Hollis so viel gearbeitet, daß sie sich daran gewöhnt hatte, ihn zu vermissen; sie hatte angefangen, sich anderswo nach Gesellschaft umzusehen. Häufig ging sie nach nebenan zu den Coopers zum Abendessen; sie hatte sich mit der Tochter angefreundet, der blassen, rothaarigen Belinda, und dachte an nichts anderes als das, was sie an diesem Abend tragen würde. Sie hatte ihr blaues Kleid im Kopf, und so achtete sie nicht in der Weise auf Hollis, wie sie es vielleicht hätte tun sollen.
»Willst du lieber nach nebenan zu denen gehen oder hier bei mir sein?« wollte Hollis wissen.
Seine Frage hatte sie überrascht, als sie gerade ein Paar Ohrringe aus ihrem Schmuckkästchen wählte, und sie antwortete zu langsam – sie mußte zu langsam geantwortet haben, denn er packte sie; das hatte er noch nie zuvor getan.
»Laß das«, sagte sie zu ihm. Er war immer eifersüchtig auf ihre Freundschaft mit den Coopers gewesen, aber sie hatte nie sonderlich darauf geachtet, bis heute. Er verdrehte ihr das Handgelenk; sobald sie sich losgerissen hatte, wich sie zurück. »Laß mich in Ruhe«, schrie sie.
So hatte March noch nie mit ihm gesprochen, und ihre Reaktion erschreckte sie beide. Es war nur so, daß er immer so fordernd war; er ließ ihr keine Zeit zum Nachdenken.
»Ist das deine Entscheidung?« sagte Hollis da zu ihr.
»Nein«, hatte March schnippisch erwidert und nicht daran gedacht, wie leicht er zu verletzen war. »Deine.«
Es ist immer ein Fehler, jemandem zu sagen. Wage es bloß nicht, aus dieser Tür zu gehen; und es ist ein noch viel schlimmerer Fehler, selbst die Schwelle zu überschreiten und jemanden zurückzulassen, den man liebt. Seit jenem Tag hat March darüber nachgegrübelt, was sie hätte anders machen können. Nicht zu den Coopers gehen, sondern zu Hause zu Abend essen? Hollis die Arme um den Hals werfen? Zugeben, daß sie den ganzen Tag lang ihre Zukunft mit ihm geplant hatte? Während des Essens hatte sie gespürt, wie sehr sie im Unrecht gewesen war; sie war gegangen und den ganzen Weg nach Hause gerannt, aber es war schon zu spät.
Nachdem er fort war, wartete sie oben an ihrem Fenster, Tag für Tag, Woche für Woche. Es kam kein Brief, nicht mal eine Postkarte, und als March die High-School abschloß, machte sie sich nicht mehr die Mühe, die Einfahrt hinunterzugehen, um in den Briefkasten zu schauen. Trotzdem kehrten die Tauben, die in dem Kastanienbaum im Garten nisteten, jedes Frühjahr zurück, und March nahm das als Zeichen für Hollis' Loyalität und Liebe. Die Mädchen, mit denen sie zur Schule gegangen war, besuchten Colleges, nahmen Jobs in Jenkintown an oder heirateten die Jungen, die sie liebten. Aber March blieb an ihrem Fenster, und ehe sie sich versah, war die Scheibe ihr Universum und die leere Straße ihr Schicksal geworden.
Nach drei Jahren erkannte sie sich nicht wieder, wenn sie in den Spiegel sah. Sie wußte nicht genau, wie es passiert war, aber sie war nicht mehr jung. Endlich, am Morgen ihres einundzwanzigsten Geburtstags, trat March Murray nicht mehr an ihr Fenster. Sie würde nie wissen, ob in diesem Jahr die Tauben zurückgekehrt waren, um im Kastanienbaum zu nisten, oder nicht. Sie hörte in diesem Frühjahr nicht die Frösche quaken und roch nicht die Minze, die neben der Tür wuchs. Statt dessen packte sie ihren Koffer und bat Mrs. Dale, ihr ein Taxi zu rufen, das sie zum Flughafen bringen sollte. Alan hatte March das Geld für ein Ticket nach Kalifornien und zurück geliehen, aber noch bevor sie an Bord ging, riß March den Rückflugteil ihres Tickets in kleine Stücke und warf sie in den Papierkorb.
Ein ganzes Leben hatte March oben in ihrem Zimmer verbracht, auf Hollis gewartet und herauszufinden versucht, was sie falsch gemacht hatte. Ein weiteres Leben hat sie seither als Ehefrau und Mutter verbracht; sie ist jetzt ein völlig anderer Mensch. Hier ist sie, macht die Betten in diesem kalten, leeren Haus auf Fox Hill, wo sie so lange nicht gewesen ist. Ihre Hände sind flink, als sie die sauberen Laken über die Matratze zieht. Sie war ein junges Mädchen, als sie in diesem Bett schlief; ein Mädchen, das leicht weinte und in den Nächten, in denen es nicht schlafen konnte, die Sterne statt Schafe zählte. Jetzt weint March nicht mehr; für so etwas hat sie viel zuviel zu tun. Trotzdem kommt es vor, daß sie mit Tränen in den Augen aufwacht. Dann weiß sie, daß sie von ihm geträumt hat. Und obwohl sie sich nie an ihre Träume erinnert, ist da immer der Geruch von Gras auf ihrem Kissen, als sei die Vergangenheit etwas, das zu einem zurückkommen kann, wenn man es sich nur stark genug wünscht, wenn man nur mutig genug ist, sie herbeizurufen.