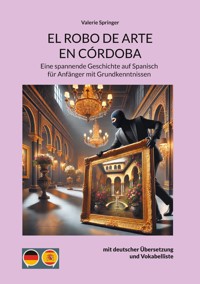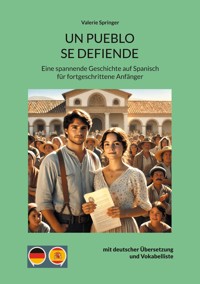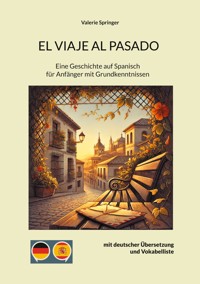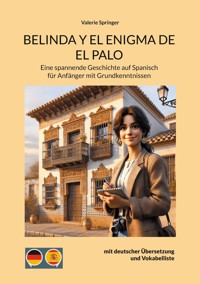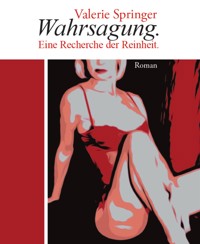9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nikolaus liebt Sylvie. Sylvie liebt Maximilian und Ritz und Nikolaus. Und Ritz, wie er sich nennt, liebt die hübsche Anette. Und Fanny? Die liebt Nikolaus. Und Max. Fanny liebt jeden und jeder liebt Fanny. Vor allem anderen aber liebt Fanny die physikalische Größe der Zeit. Eine tragische Liebe, wie sich zeigen wird. „Panta rhei“, zitiert Fanny Heraklit, „Alles fließt“. Und sie meint damit die Zeit, die Ereignisse innerhalb der Zeit und vielleicht auch noch mehr.
"Romantisch, märchenhaft ... überraschend und bezaubernd"
"Eine Erzählung, die viele Fragen stellt und viele Antworten gibt. Aber nicht auf die Fragen, die sie stellt."
"Die Zeit ist mehr als eine physikalische Größe. Sie ist ein Mysterium für Physiker und für Philosophen."
„Was Zukunft für Sie ist, kann Vergangenheit für mich sein oder umgekehrt. Dass es ein Jetzt, ein Vergangen und ein Zukünftig gibt, ist nichts als Illusion.“ (Brian Greene, Physiker an der New Yorker Columbia University)
Ausgezeichnet mit dem Theodor-Körner-Preis für Literatur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Die Geliebte, der Mann, dessen Frau und die zwei Söhne.
Eine Erzählung vom Ende der Zeit.
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorwort
Eine Belanglosigkeit, gleich zu Beginn:
Wovon hier berichtet wird, ist keine runde Geschichte. Tatsächlich hat dieses Geschehen keinen Anfang und kein Ende. Zumindest insofern, als nun – fast unbedacht – einfach angefangen wird zu berichten, zumindest insofern, als das erbarmungslose Ereignis am Ende dieser Erzählung als dramaturgischer Höhepunkt gelten könnte, es aber nicht ist. Man mag sich bemüßigt fühlen, einen inneren Diskurs darüber zu führen. Das sei jedem selbst überlassen.
Nebenbei bemerkt begann dies alles vor so langer Zeit, dass es sich erübrigt, darauf näher einzugehen.
Kapitel 1
„Was ich zu wissen begehre, sind Kraft und Wesen der Zeit.“
(aus „Quid est tempus?“, entnommen den „Confessiones XI“ von Augustinus von Hippo, bekannt als Aurelius Augustinus, geboren 354 in Thagaste, gestorben 430 in Hippo Regius)
Das erste, wovon hier also erzählt wird, ist eine zufällig gewählte Episode aus dem Berufsalltag von Fanny.
Fanny:
Die Arbeit in der Werbeagentur gefiel ihr gut. Warum auch nicht. Man ließ sie in Ruhe. Abgesehen von den rüden Manieren, die in dieser gestylten Atmosphäre herrschten. Die waren weit derber, als sie es sich von diesen schicken Typen in den teuren Anzügen erwartet hätte. Nun ja, eine gewisse Direktheit war ihr nicht unangenehm. Immerhin konterte sie genau so direkt. Wie es überhaupt ihre Art war, stets das zu sagen, was sie sich dachte.
Sie lackierte sich ihre Fingernägel, mit der linken Hand war sie gerade fertig. Joey kam in ihr Büro, wie immer klopfte er nicht an: „Komm mal mit in die Grafik, Alfred hat das Layout für die Waschmittel-Packung fertig.“
„Und wie ist es geworden?“, fragte Fanny ihn.
„Na ja, geht so, du wirst ja selber sehen.“
Sie nahm die Füße vom Tisch, schlüpfte nicht in ihre hohen Schuhe, sondern ging barfüßig an ihm vorbei, durch die Tür, die er ihr respektvoll aufhielt. Sie war die Geliebte vom Chef und seit einem knappen halben Jahr Joeys Vorgesetzte.
Warum er nicht anklopfte? Weil sie es nicht wollte. Sie hatte ausdrücklich darauf bestanden, dass jeder in ihr Büro könnte, jederzeit. Sie hatte nichts zu verbergen.
Wer etwas zu verbergen hatte, war der Chef. Nikolaus Romanowski, der Kopf der umsatzstärksten Werbeagentur des Landes, war verheiratet und hatte zwei Söhne. Die waren nur um ein knappes Jahr jünger als Fanny. Dieser geringe Altersunterschied hat indes nur dann Gültigkeit, wenn man (dies muss der Verständlichkeit halber ausdrücklich festgehalten werden) unsere beengte Denkweise über die Zeit als Grundlage wählt. Sollte sich Nikolaus tatsächlich scheiden lassen – was Fanny realistisch gesehen für unwahrscheinlich hielt –, so wäre die potentielle Stiefmutter fast gleich alt wie ihre Stiefkinder. Zu jenem Zeitpunkt, als diese Geschichte prekär zu werden begann, wusste Frau Romanowski nichts von der Geliebten ihres Mannes.
Fanny hätte nichts dagegen gehabt, den Status Quo beizubehalten. Das waren ihre Gedanken, als sie neben Joey im Lift stand. Dem Lift, der sie in den oberen Stock führte, wo die Grafik-Abteilung untergebracht war.
„Magst du die Farbe?“ Fanny hielt Joey ihre linke, frisch lackierte Hand hin.
„Ja, warum nicht? Ist schon okay.“
„Sei ehrlich, du Idiot. Das ist die neue Herbstfarbe von meinem Kunden. Ich mache einen Selbstversuch.“
Er lachte.
Sie gingen an den Schreibtischen vorbei, an gebückten Häuptern, nach hinten, in den letzten Raum, in dem Alfred saß. Die drei Räume der Grafik-Abteilung gingen türenlos ineinander über. An den Wänden, am Boden, lehnten Pappkartons mit aufkaschierten Layouts, verworfene Entwürfe, die nicht weggeworfen wurden. An den Wänden hingen, mit Klebestreifen achtlos aufgehängt, Anzeigen von Konkurrenzprodukten und den eigenen Produkten, Briefe, Memos, Zettelchen. Es herrschte ein heilloses Durcheinander in dieser Bastion der Kreativität. Die einzigen, die nicht kreativ aussahen, waren die Grafiker selbst. Die sahen fast wie Beamte aus. In gewissem Sinne waren sie das auch. Einfache Angestellte in einer Werbeagentur, die mit ihrem Potential und ihren Idealen nicht weitergekommen waren als eben hier her. Den Traum vom Künstlerdasein hatten sie allesamt ausgeträumt, eingetauscht gegen den lukrativen, wenn auch nicht sehr angesehenen Status eines Kommerzkünstlers. Wahrscheinlich darum die gebückten Häupter.
Alfred war so um die dreißig, hatte schütteres rotes Haar und war bebrillt. Fanny besah sich mit Joey den Entwurf für die Waschmittel-Packung.
„Und?“, fragte Alfred.
Fanny schwieg. Überlegte.
Joey schwieg auch. Er wollte, aus Sicherheitsgründen, abwarten, was Fanny sagte.
„Warum hast du die Farben geändert?“, fragte Fanny.
„So halt, ist doch entsetzlich, die Farbkonstellation vom Original.“
„Das kriegen wir nicht durch. Du musst es genauso machen, wie der Kunde es wollte. Tut mir Leid. Wenn es in allen anderen Ländern so entsetzlich ausschaut, muss es bei uns auch so entsetzlich ausschauen. Ansonsten okay, würde ich sagen.“ Fanny gab noch ein paar Kommentare über die Schriftgröße der verschiedenen kleingedruckten Hinweise ab. Sonst gab es nichts zu tun. Die Vorgaben waren so eindeutig gewesen, dass selbst ein Volksschüler die Packung gestalten könnte.
Das war der öde Teil ihrer Arbeit in der Werbeagentur: Waschmittel-Layouts begutachten. Seifenverpackungen planen, Geschirrspülmittel-Flaschen entwickeln. Es gab nichts Neues mehr. Die Traumfabrik Werbung hatte sich selbst ad absurdum geführt. Die Globalisierung hatte es unmöglich gemacht, etwas Eigenständiges auf die Beine zu stellen. Soviel zur Corporate Identity.
Der spannende Teil ihres neuen Jobs, den sie seit nunmehr einem knappen halben Jahr innehatte, war der, wenn sie das fertig gestellte Layout ihrem Kunden überbrachte. Es war nicht wirklich ihr Kunde, sondern natürlich der Kunde der Werbeagentur. Ein großer Konzern, der mit der internationalen Werbeagentur, Zweigniederlassung H2W-XII, einen Vertrag über die werbliche Betreuung für zwei Budgetjahre vertraglich festgelegt hatte.
Fanny war das, was man Kundenbetreuer nannte. Das Bindeglied zwischen der Werbeagentur und dem Produkthersteller. Sozusagen ein Agent in Sachen „Kreativen-Kram-Verkaufen“.
Nikolaus:
Nikolaus Romanowski war auf dem Weg zum Friseur. Es war ihm zuwider, wenn jemand an ihm herumarbeitete. Hingegen, seine Stellung verlangte einen angemessenen Haarschnitt. Zudem genoss er den Zustand der meditativen Zurückgezogenheit, den er sich selbst erschuf, wenn der Friseur seine Kopfhaut massierte. Er war ehrlich genug zu sich selbst, um sich einzugestehen, dass diese Kopfmassage der eigentliche Grund war, warum er regelmäßig zum Friseur ging. Ja, wahrscheinlich hätte er lange Zotteln, wie in seiner gewollt verwegenen Zeit auf der Wirtschaftsuni.
„Einmal wie immer?“, fragte der Chef des Salons, der nur Herren bediente und nur von männlichen Angestellten bevölkert war.
Nikolaus nickte, setzte sich in den für ihn reservierten Sessel und schloss die Augen.
Die Räume der Werbeagentur waren nur ein paar Schritte von dem Salon entfernt. Nikolaus Romanowski war zu Fuß spaziert, gemächlich. Er war kein Mann von Eile. Ach, falsch, er war kein Mann der Hektik. Eile war wohl des Öfteren angebracht, nie jedoch Hektik. Das war sein Credo.
Sylvie:
Ihr Garten befand sich in einem paradiesischen Zustand. Wie sie selbst, wenn sie sich darein begab. Es war doch in der Tat ein bisschen lachhaft, dachte sich Sylvie, aber ein wenig erinnerte es sie an die Geschichte vom Paradies, vom Garten Eden, von dem ihr Großvater ihr erzählt hatte, damals, als sie noch ein Kind war. Sylvie und ihr Garten. Sylvie und ihr Großvater. Ach ja, Sylvie und ihr Mann. Den gab es ja auch noch. Obwohl sie ihn nicht so vermisste, wie sie es sich ausgemalt hatte. Als sie ihn vor drei Jahrzehnten kennen gelernt hatte.
Sie stand also in ihrem Garten. Rechtmäßig ihrer, weil das Haus auch ihr rechtmäßig gehörte. Und also auch der das Haus umgebende, umwindende, umwuchernde grünbuntblumige Garten.
Was in ihr vor sich ging, als sie so da stand, mitten im Sommer, mitten im Garten? Nicht so viel. Und das nicht deswegen, weil sie dazu nicht imstande gewesen wäre. Sylvie war reich, gebildet, blitzgescheit. Das wären ihre Drei Knappen Worte. Außerdem war sie gut aussehend. Vielleicht als Resultat der reich-gebildet-klug-Kombination. Das hinterlässt nach Jahrzehnten seine ansehnlichen Spuren, selbst wenn Sylvie in der Pubertät recht unscheinbar gewesen sein konnte. Geld macht reife Frauen, die an sich schon ihrer Reife wegen strahlen, glitzern und glimmern, noch bezaubernder.
Und warum nun ging wirklich nicht viel in ihr vor? Weil sie meditierte. Stehend, schlendernd, ohne irgendein psychedelisch-esoterisches Brimborium war sie in der Lage, einfach abzuschalten. Sich wegzuklinken. Sich abzusondern. Beneidenswert. Allerdings: Zu dem Zeitpunkt, als diese Geschichte prekär zu werden begann, hätte niemand sie beneidet. Nicht mal um ihre hübschen Stilettos.
Sylvie blinzelte sich die Überreste ihres Zustandes der Abgeschiedenheit aus den Augen, atmete tief durch und nahm ihr Handy aus der Gesäßtasche ihrer Hose.
„Was hältst du von einem Löwenzahn-Beet?“, fragte sie ihren Gärtner, nachdem der sich gemeldet hatte.
„Schräg. Frag mal die Nachbarn, was die dazu sagen“, antwortete er.
„Oh“, meinte sie, „deren Meinung ist mir nicht so wichtig. Wie du weißt.“
„Nein, ich meine, wenn die Samen dann zu ihnen rüberfliegen, auf ihre teuren Grünflächen, und sich dort austoben.“
„Oh“, meinte sie wieder. Überlegte, wie sich ihre Menschenfreundlichkeit, ihr Wunsch nach Harmonie mit Mensch, Tier und Pflanze mit der so plötzlich aufgetauchten verlockenden Vision einer Löwenzahnblüteninvasion in fremden Gefilden vereinbaren ließe.
Das überlegte sie in weniger als einer Sekunde. Sie zögerte also nicht einmal, als sie ihrem Gärtner dann antwortete: „Ich denke darüber nach.“
Dann fragte sie ihn, ob er zum Abendessen kommen würde. Sie hoffte es inständig. Vermissen? Ja, ihn schon.
Er antwortete: „Geht nicht, muss lernen. Nächsten Freitag, vielleicht. Kann ich eine Freundin mitbringen?“
„Natürlich. Jederzeit.“
„Super. Bis dann, Mama.“
Dann machte sie einen kleinen Rundgang, barfüßig, die Stilettos neben dem Gänseblümchenbeet. Sie liebte das Barfußgehen in gleichem Maße wie Fanny. Das sollten die beiden Frauen aneinander erkennen, wenn sie sich begegnen würden. Was bald geschehen sollte. Ob sie darüber reden würden, über diese an sich einfältige Vorliebe zur nackten Fußsohle? Mitnichten. Wer Sylvie kennt, wer Fanny kennt, der weiß, dass manches – oder vieles? – im Reich des Unerwähnten besser aufgehoben ist. So wie eben auch das Barfußgehen Sylvies in ihrem Garten: Sie liebte es, das grüne Gras auf ihren Fußsohlen zu spüren. Als plauderte jedes einzelne Hälmchen auf seine Weise mit ihren Rezeptoren. Sie blieb stehen, krallte sich mit den Zehen im Gras fest, kippte sich leicht auf ihre Fersen. Riss das zarte Grün aus. Es knirschte und mampfte zwischen ihren Zehen.
Als das Telefon wieder läutete, hob sie ab, ohne auf die Nummer zu achten, die das Display pflichtschuldig offenbarte: „Ja?“
„Hier ist Fanny. Aus der Agentur.“
Kapitel 2
„Auch wenn ich in der Lage bin, alles der Reihe nach zu schildern, sind mir die Tropfen der Zeit dafür zu kostbar.“
(aus „Quid est tempus?“, entnommen den „Confessiones XI“ von Augustinus von Hippo, bekannt als Aurelius Augustinus, geboren 354 in Thagaste, gestorben 430 in Hippo Regius)
Nikolaus:
Der Nachmittag schleppte sich dahin, hastete, trippelte und raste. Gleichförmigkeit gab es nicht in der Welt der Reklame. Es war entweder anödend langweilig oder betörend kurzweilig. Ein aufmunternder Tummelplatz, wie geschaffen dafür, den Gauklern der neuen Welt etwas vorzugaukeln.
Nun, ob Kurzweil oder Langeweile, ob Betörung oder Ödnis vorherrschten: Dem stetigen Pendel des Sekundenlaufs war das herzlich egal, denn der Nachmittag verging für Nikolaus so planmäßig und resolut, wie das nun einmal das Charakteristikum der Zeit ist: Sie fließt so vor sich hin, unbeirrbar, als hätte sie ein Ziel.
Nikolaus‘ Kopf war gut durchmassiert, er duftete, sah aus und fühlte sich wie ein Agenturboss. Dergestalt gestylt, innerlich wie äußerlich, verbrachte er seinen Nachmittag in seinem Agenturboss-Büro, hinter seinem mächtigen Schreibtisch. Nein, der Schreibtisch war nicht überschwemmt mit Entwürfen, Fotos von neckischen Nackten oder wichtigen Memos aus Amerika. Nein, er war auch nicht gewollt leergefegt, es lag kein obligates einzelnes Büttenblatt mit dem obligaten teuren Füllfederhalter da. Um Nikolaus‘ Büro zu beschreiben, bedarf es eines Fingerspitzengefühls, das keine Stereotypien erlaubt. Denn er war selbst auch kein Klischee. Er war ein intelligenter Mann, nicht mehr jung, aber er hatte noch ein oder zwei Illusionen. Und er spürte eine Jugendlichkeit, nicht nur in seinen Lenden. Das war Fannys Werk. Fanny war an allem schuld. Aber nein, natürlich nicht. Nikolaus hatte sich in sie verliebt. Und nun war das so. Und nicht anders. Aber er war ein kluger Mann. Und daher dachte er an diesem Nachmittag nicht an Fannys Formen, sondern an seine Agentur-Arbeit.
Morgen sollte die Präsentation stattfinden, die darüber entschied, ob der potentielle Neukunde willig war, sein 100-Millionen-Euro-Budget an Werbegeldern für die strategischen Winkelzüge von Nikolaus Romanowskis Mannen locker zu machen. Wie immer vor solch entscheidenden emotionalen Engpässen zog Nikolaus es vor, sich zurückzuziehen. Schrieb mit seinem schönen Füller (ja, er hatte doch tatsächlich einen) die eine oder andere Bemerkung auf seinen Notizblock, die eine oder andere Idee, entwarf und verwarf Formulierungen. Stand auf, spazierte durch sein Büro. Kreuz und quer. Hin und her. Wie ein Raubtier im Käfig? Ach, was. Er war doch kein Gefangener. Er war nervös, positiv nervös, falls er seinen Gemütszustand benennen sollte.
Präsentationen stellten für ihn ein Match dar, in dessen Verlauf zwei sich messen konnten. Nicht ihr Können. In den Bereichen, in denen Nikolaus tätig war, gab es nur Könner. Wer so weit war, über ein Budget von 100 Millionen Euro zu entscheiden, war kein Stümper. Nikolaus hatte nichts von der herablassenden Blasiertheit des typischen Werbemannes an sich, der seine Kreativitätsgelüste und deren Scheitern – weil eben nun im kommerziellen, kommerzialisierten Werbegeschäft tätig – mit Dünkelhaftigkeit zu kaschieren trachtete. Er achtete seine Match-Gegner und spielte nicht mit deren trotzig-demütiger Haltung gegenüber den feschen Werbefreaks. Ja, durchaus, er verkörperte einen dieser feschen Werbefreaks. Hingegen: Sein erfolgreicher Werdegang lag darin begründet, dass er dieses Image eben nicht brauchte, nicht pflegte. Nicht ablehnte, nicht einmal darüber spekulierte.
Er trat ein Match an, er trat seinem Gegner entgegen, er betrat die Kampfarena wie ein braver Mann. Tapfer, Aug in Aug, von Mann zu Mann. Keine Winkelzüge. Ja, darin war er gut. Denn das musste er nicht einmal üben. Das war er.
„Fanny, gib mir ein paar Zahlen“, sagte er, als sie abhob, „du weißt schon, irgendwas Griffiges. Für morgen.“
„Komme gleich“, sagte sie.
Eine Belanglosigkeit:
Hier würde ich, als Berichterstatter der Begebnisse und somit zum stetigen Weitererzählen gezwungen, gerne stehen bleiben, dieses geschmeidige Bild in mir glimmen lassen, es festhalten und nicht mehr loslassen. Auch das noch, denke ich mir, denn es tut weh, etwas nicht zu schätzen zu wissen. Die Versuchung, der Kitschigkeit nachzugeben, breitet sich aus, wie die Zellteilung, der man im Zeitraffer zusieht. Ich nehme nicht wirklich an, dass eine Botschaft in diesem Bild steckte (geschweige denn, dass irgend jemand sie deuten könnte). Ich nehme nicht wirklich an, dass eine zukünftige Macht über die Zeit die gegenwärtige Macht der Uhr abzulösen vermag. Das Flickwerk der porenlosen Zeitnutzung macht mich atemlos.
Und das nimmt mir jede Hoffnung.
Nikolaus und Fanny:
Sie führten ein Gespräch über Zahlen, ließen dabei einiges anklingen und anderes ungesagt. Und dieses Gespräch erweckte bei beiden den Anschein, als sei alles bestens. Was es denn auch war, angesichts dessen, was bisher geschehen war. Nicht jedoch angesichts dessen, was im weiteren Verlauf geschehen würde.
Noch einmal Nikolaus:
Das war der Nachmittag gewesen. Des Abends hatte Nikolaus vor, seiner Frau Sylvie ein bisschen dem näher zu bringen, was Nikolaus für unausweichlich hielt. Morgen würde in seinen Büroräumen die Agentur-Präsentation stattfinden. Er wollte sie klaren Kopfes begehen. Er wollte sie klaren Gemüts gewinnen. Dazu war eine Klärung mit Sylvie unausweichlich.
Kapitel 3
„Vielleicht ist es so, dass alles, was zu sein anfängt und zu sein aufhört, dann zu sein anfängt und aufhört, wenn in der ewigen Vernunft, in der nichts anfängt oder aufhört, erkannt wird, dass es anzufangen oder aufzuhören hat.“
(aus „Quid est tempus?“ entnommen den „Confessiones XI“ von Augustinus von Hippo, bekannt als Aurelius Augustinus, geboren 354 in Thagaste, gestorben 430 in Hippo Regius)
Fanny:
In einem Land, das es nicht mehr gibt, lebte einmal ein Kind. Zu einer Zeit, die nicht mehr fließt, entdeckte das Kind, dass es den Lauf der Zeit anhalten konnte. Es entdeckte noch mehr, im Laufe der vielen Jahre, die folgten. Zu der Zeit, in der diese Geschichte spielt, zu jenem Zeitpunkt, an dem diese Geschichte begann, prekär zu werden, war das Kind schon seit unvorstellbar langer Zeit kein Kind mehr.
Eine junge Frau blickte auf ihre eigene Geschichte zurück, ohne sie zu sehen. Sie wollte sie nicht sehen, weil ihr vieles egal geworden war. Ihre schamlose Dreistigkeit, den Gegebenheiten entfliehen zu können, war ihr drückendes Schicksal geworden.
Sie hatte die Liebe zu ihrem leuchtenden Stern erkoren. Der führte sie durch die Jahre, gaukelte ihr vor, erreichbar zu sein, einem Irrlicht gleich lockte er sie in Tiefen und Untiefen obskurer Tändeleien. Sie hatte nichts vergessen von dem, was Teil ihrer selbst war.