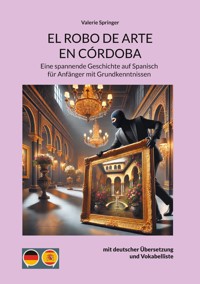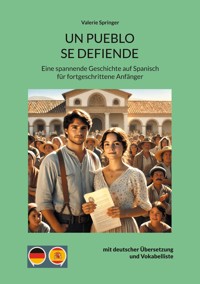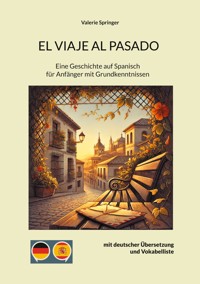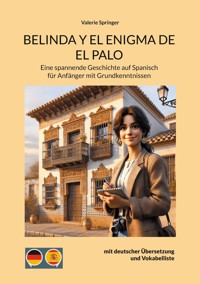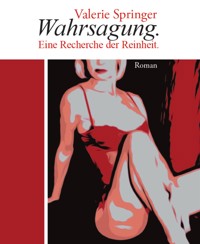Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zehn Jahre lang hat Sophia gehofft, ihrer Vergangenheit nie wieder begegnen zu müssen. Weitab vom kleinkarierten Unterwollerndorf glaubt sie sich in Indien sicher vor dem, wovor sie geflüchtet ist. Doch dann wird sie in ihrem geheimen Zufluchtsort aufgespürt. Einfühlsam und melancholisch lässt Valerie Springer die Ich-Erzählerin Sophia von ihrer Rückkehr in das Dorf ihrer Kindheit erzählen, wo die junge Frau ihre Entfremdung von ihren Wurzeln erkennt. Etwas aber gibt es, das Sophia nicht fremd ist: ein mysteriöses Kind, das sie jede Nacht besucht und sie an das gemahnt, was vor zehn Jahren zu ihrer überstürzten Abreise geführt hat. Sophia muss sich stellen. Dem, was sie mit ihrer geheimen Flucht verursacht hat. Und dem, was sie in ihrem Innersten verdrängt hat. "Kann ich das, was mich zum Weggehen bewogen hat, jemandem erzählen? Die Vergangenheit kommt zurück, klebrig und zäh, das beharrlich Verdrängte kehrt mit Sack und Pack dort ein, wo es nie willkommen war, an den einzigen Platz im Universum, wo es zu Hause ist." Valerie Springer beschreibt den Weg einer jungen Frau zu Selbsterkenntnis und Ehrlichkeit in behutsamen Bildern, mit Zuversicht und Zukunftsvertrauen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Kind, gekleidet in einen eleganten Panzer aus pechschwarzem Chitin, hatte sich mit seinen zarten, blassen Fingern an ihr Herz gekrallt. Friedlich, schläfrig und durchaus nicht unfreundlich wartete es darauf, sie daran zu erinnern, dass es etwas zu erinnern gab. Dass es etwas gab, das nicht in Vergessenheit geraten wollte. Ein Etwas, das nichts mit den Geschehnissen zu tun hatte. Ein Etwas, das über dem Geschehenen stand. Ein archaisches Wissen.
Inhaltsverzeichnis
Tag 1 - Sonntag. Ankunft in Unterwollerndorf.
Tag 2 - Montag. Liesi lässt Blumen sprechen.
Tag 3 - Dienstag. Tante Kathi verschenkt eine Leberkässemmel.
Tag 4 - Mittwoch. Friedhofskerzen leuchten wind- und wetterfest.
Tag 5 - Donnerstag. Kaffee aus einer zerkratzten und eingedellten Caffettiera.
Tag 6 - Freitag. Der Versuch, über eine Reise zu schreiben.
Tag 7 - Samstag. Radiergummi-Futzerln.
Tag 8 - Sonntag. Leinensäckchen, mit ausgespuckten Kirschkernen befüllt.
Tag 9 - Montag. Zeichnungen, Skizzen und Strukturen.
Tag 10 - Dienstag. Ein Gespräch mit einem Steinklotz.
Tag 11 - Mittwoch. Sachspenden aus dem Hause Herzogsbacher.
Tag 12 - Donnerstag. Fotos des Hauses, von innen und von außen.
Tag 13 - Freitag. Und nochmals Sachspenden.
Tag 14 - Samstag. Eine Wanderung und viele Erinnerungen.
Tag 15 - Sonntag. Nützlichkeit und Kauflust.
Tag 16 - Montag. Jause mit einem Ehepaar ohne Kind.
Tag 17 - Dienstag. Weltgewandt und weitgereist.
Immer noch Tag 17 - Dienstagabend. Schlussszenario mit Vollmond.
Tag 1 - Sonntag. Ankunft in Unterwollerndorf.
Ich sitze im Zug, in Fahrtrichtung. Abgesehen von mir ist das Abteil leer. Zwischen meinen Beinen ist der Koffer festgeklemmt, damit er nicht davon rutscht. Den Rucksack auf meinem Schoß halte ich umarmt. Eine halbe Stunde Zugfahrt noch, eine halbe Stunde Nichtstun. Ich nehme den Flyer eines Taxiunternehmens zur Hand, der neben mir auf dem Nachbarsitz liegt, speichere die Nummer in meinem Mobiltelefon. Dann sehe ich einfach nur zum Fenster hinaus, betrachte die vorbeiziehende heimatliche Landschaft. Ich lege meine rechte Schläfe ans Glas, gebe mich dem Rucken und Ruckeln des Zuges hin. Ich denke an die Zeit zurück, in der ich diese Strecke täglich gefahren bin, in der Früh zur Schule nach Wien, abends zurück aufs Land. Nach Hause. Der Zug fährt in den Bahnhof ein, die Eisenbahnräder quietschen, schließlich hält er an. Heimkommen, nach zehn Jahren. Mein Blick heftet sich an das Schild mit dem Schriftzug Unterwollerndorf. Weiße Schrift auf blauem Grund.
Kurz nur habe ich gezögert, dann bin ich ausgestiegen. Nun stehe ich neben meinem Koffer auf dem Bahnsteig, nachdem sich hinter mir die Türen des Zuges geschlossen haben. Die wenigen anderen Fahrgäste streben an mir vorbei. Ich sehe mich um, nichts scheint vertraut. Keine Anhaltspunkte für das, was mich erwartet.
Langsam atme ich den ländlichen Geruch ein. Es ist schon dämmrig, aber in ein paar Wochen wird es um diese Tageszeit noch hell sein. Der Frühling kündigt sich an. Die Luft ist lau, es riecht nach jungem Gras und Blüten, die sich entfalten wollen. Ich muss niesen. Meine Atemwege sind ausgetrocknet vom langen Flug. „Scheißklimaanlage, Scheißschnupfen!“, sage ich, und während ich mit dem Handrücken leicht über meine Nase wische, staune ich, wie selbstverständlich mir die deutschen Worte über die Lippen gekommen sind. Meine Sprache existiert noch in mir. Ich habe laut gesprochen, aber niemand blickt sich nach mir um. Die anderen Fahrgäste sind schon zu weit von mir entfernt, um mich gehört zu haben. Niemand hat mich erkannt. Ich mache mich auf den Weg zu meinem Elternhaus, meinen Rucksack auf dem Rücken, den abgewetzten Koffer mit den lädierten Rollen hinter mir herziehend.
Unterwollerndorf. Ich werde das Haus betreten. Ich werde Dinge berühren, die ich jahrelang nicht berührt habe. Ich werde Bilder an den Wänden sehen, Kleider in Schränken, verdorbene Lebensmittel im Kühlschrank. Das Ehebett der Eltern. Das Sofa in der Zirbenstube.
Ich stehe vor der naturhölzernen Haustür, bücke mich, hebe die Fußmatte an, nehme den Schlüssel, stecke ihn ins Schloss und sperre auf. Sperre ein Leben auf, das es nicht mehr gibt. Als ich die Tür einen Spalt öffne, sehe ich schwaches Licht. Im Flur ist die Deckenbeleuchtung eingeschaltet. In leichten Schwaden kommt mir der Geruch des Inneren entgegen. Ich bleibe draußen stehen, ziehe die Tür wieder zu. Eine Weile stehe ich einfach nur da und starre die geschlossene Tür an, vielleicht zwei Handbreit nur zwischen meiner Nasenspitze und dem Verschlossenen. Vor meinen Augen verschwimmt alles zu seltsamen Mustern. Dann drehe ich mich um, lehne mich mit dem Rücken an die Tür, der Rucksack wie eine willkommene Pufferzone zwischen meinem Körper und dem Holz. So stehe ich und betrachte den Himmel, der dunkler und dunkler wird, denke nichts, höre mein Herz vor sich hin pochen, höre die Nacht hereinbrechen, die Vögel verstummen. Dann öffne ich die Tür.
Das Schlafzimmer der Eltern. Im Erdgeschoss. Ein kleines Zimmer, fast quadratisch, mit niedriger Decke. Ein kleines Zimmer in einem kleinen Haus in einem kleinen Garten in einem kleinen Dorf, in der beginnenden Nacht. Glattgestrichener Bettüberwurf, ausgewaschenes Blümchenmuster. Ich stelle den Koffer neben das Bett, platziere meinen Rucksack darauf, lege mich mitten hinein in die verblasste Blumenwiese. Atme einen Geruch ein, den ich nicht vergessen habe. Ich liege, vollständig angezogen, mit geschlossenen Augen auf dem Rücken, im Bett der Eltern, die jetzt schon seit Monaten unter der Erde liegen. Ich aber bin lebendig und hellwach, habe Arme und Beine ausgestreckt. Wie wenn ich gekreuzigt worden wäre, denke ich. Ich atme tief ein. Durch das gekippte Fenster dringt dieser ländliche Geruch.
Ich öffne die Augen, sehe zur Zimmerdecke, auf der kaum sichtbar nachtschattige Lichtlein tanzen. Ich blicke durch die Lichtlein, durch die Zimmerdecke, in den dunklen Himmel hinauf, schwimme durch die lichtlose Leere hinein in die Unvergänglichkeit des Alls, spüre der Leichtigkeit nach, die dort oben wohl herrschen mag. Ich schließe die Augen wieder. Wenn es ein Orakel gäbe, was würde es zu mir sagen?, frage ich mich in Gedanken.
„Orakel? So etwas gibt’s bei uns nicht. Hast du Schokolade?", höre ich eine kleine Stimme sagen, leise und doch fordernd, klar und eindeutig und real und gar nicht aus der Unendlichkeit und Unbegreiflichkeit des Alls, sondern hier und jetzt in diesem Schlafzimmer.
Ich reiße die Augen auf, schrecke hoch, sitze nun aufrecht und blicke ein gänzlich unbekanntes Kind an, blond schimmerndes Haar, im blütenweißen Kleidchen wie auf kitschigen Votivbildern.
Kälte frisst sich durch meinen Körper, mein Herz rast, ich glaube zu ersticken. Ich sitze, unfähig mich zu bewegen, bis ich mich endlich aus dem Bett fallen lassen kann und rückwärts in die Zimmerecke krieche, mein Blick auf das Bett geheftet, auf das Kind, am Fußende, im Schneidersitz. Es sieht mich einfach nur an.
Ich presse meinen Rücken gegen die Zimmerwand, schließe die Augen, reiße sie wieder auf. Das Kind sitzt noch dort. Ich will sprechen, wer bist du, will ich fragen. Kein Ton kommt aus meinem Mund. Ich überwinde mich, wieder meine Augen zu schließen, drücke meine Handflächen an die Wand, taste mit den Fingern die Tapete ab, fühle den Boden unter meinen Füßen. Wieder öffne ich meine Augen. Das Kind ist noch da.
Ich stolpere zum Bett, packe Rucksack und Koffer und renne aus dem Haus, als hätte ich nicht eine engelsgleiche Erscheinung, sondern den Leibhaftigen selbst gesehen. Die Haustür werfe ich mit Wucht zu, die Schallwelle des donnernden Knalls ein Weckruf der Wirklichkeit. Ich schaffe es zum Gartentor, fasse die Klinke an, schließe meine Finger um das kalte Eisen, drücke zu, bis meine Hand schmerzt. Realität. Gegenwart. Ich atme ein paar Mal tief ein und aus, löse meine Hand von der kalten Klinke. Nehme mein kaum noch funktionstüchtiges indisches Mobiltelefon zur Hand. Ich bin froh, auf dem Flughafen in kluger Voraussicht eine österreichische SIM-Karte gekauft zu haben. Ich bestelle ein Taxi und lasse mich zum Gasthaus ins Nachbardorf Kleintalbach bringen.
Gelblich warmes Licht fällt aus den gekippten Fenstern des Stinglerwirts auf die Straße. Leises Stimmengewirr sickert mir entgegen.
Ich betrete die Gaststube, setze mich an einen Ecktisch. Am Stammtisch im gegenüberliegenden Winkel der Stube sitzen ein paar Männer vor ihren Bierkrügen und reden aufeinander ein. Ich verstehe nicht, worüber sie sich unterhalten, aber ich nehme an, dass über die Lokal- und Weltpolitik geschimpft wird. Ton und Gestik der Gruppe rufen alte Erinnerungen hervor.
„Bist wieder da?!", sagt die Wirtin. Es ist keine Frage, sondern eine Feststellung. Rosemarie Stingler steht vor mir, stramm, erdverbunden, sicher. Und neugierig, obwohl anscheinend nicht wirklich eine Antwort erwartend. Als Kind war sie die Tante Rosi für mich. Ich blicke sie an, nicke nur.
„Spät ist es schon. Warum bist nicht zu Hause? Warum schläfst nicht? Mitternacht ist gleich um. Die da", die Wirtin deutet zum Stammtisch und senkt die Stimme, „die sind auch schon viel zu lang da. Ich bin müd’."
„Im Zug und am Bahnhof hat mich niemand erkannt", sage ich, als wäre das eine Antwort. Ich frage um ein Glas Wein und Würstel mit Saft. „Oder ist es dafür schon zu spät?"
„Ich bring’s gleich."
„Kann ich im Zimmer oben übernachten?"
„Warum wohnst nicht im Haus?"
Ich sage nichts, sehe auf das Tischtuch, auf dem meine Hände liegen. Ich spüre ihren Blick auf meinem gebeugten Kopf. Schließlich geht Tante Rosi das Bestellte holen.
Ich trinke den Wein, esse die Würstel. Tunke mit der Semmel die Gulaschsauce auf, bis der Teller restlos sauber ist. Ich sehe zum Stammtisch, an dem trotz Rauchverbots geraucht wird, zünde mir eine Zigarette an und halte mein leeres Glas in Richtung der Wirtin hoch, um noch eines zu bestellen.
„Tante Rosi?"
„Ja?“
„Setzt dich zu mir?"
Die Semmelkrümel auf dem karierten Tischtuch forme ich zu einer akkuraten Linie. Blicke die Linie an, als könnte die mir etwas erklären. Tante Rosi bringt den Wein, wischt mit einer resoluten Handbewegung die Krümel vom Tisch und setzt sich neben mich auf die Bank.
„Also, warum bist nicht im Haus?"
„Morgen. Heute noch nicht."
„Aber morgen musst du. Irgendwer muss da aufräumen. Willst, dass ich mitkomm?"
„Lieb von dir, aber das mach ich schon allein."
„Na gut, wennst meinst." Tante Rosi tätschelt meinen Arm. Die Berührung kommt mir seltsam vor, wie ein Wink aus einer vergangenen Zeit. Warum tätscheln ältere Frauen gerne jüngere? Ich betrachte Tante Rosis Hand. Die abgearbeiteten Finger und die rissige Haut zeugen von Zähigkeit und Durchsetzungskraft. Und davon, für Albernheiten nicht viel Verständnis zu haben.
Langsam kommt ein Gespräch zustande. Ich erzähle ein bisschen von Indien, nicht viel, die Sätze kommen mühsam. Tante Rosi berichtet vom Begräbnis, dass sehr viele Leute gekommen wären, und wie schön und elegant die vielen Kränze gewesen seien. Und dass der Pfarrer eine sehr bewegende und berührende Rede gehalten habe, was für anständige Leute die Eltern gewesen wären. Bewegend, sagt sie, und berührend. Sie meint, dass sich alle freuten, dass ich wieder da sei, und dass ich mich sicherlich schnell wieder ins schöne Dorfleben eingewöhnen würde. Ich weiß, dass die Tante gerne etwas anderes gesagt hätte. Dass es eine Schande ist, dass ich so lange weg war. Und niemanden habe wissen lassen, wo ich war. Zehn Jahre lang. Und dass jeder wissen will, warum ich einfach verschwunden bin. Dass speziell die Tante wissen will, warum ich einfach verschwunden bin.
„Kann ich oben übernachten?", frage ich noch einmal. Die Tante nickt, steht auf, bringt den Schlüssel, ich wisse ja, wo das Zimmer sei, sagt sie. Sie selbst muss noch aufräumen, nachdem die letzten Gäste schon gegangen sind.
Ich gehe die alte Holztreppe hinauf in das einzige Gästezimmer des Stingierwirts. Die Holzdielen ächzen unter meinen Schritten. Ich ziehe mich bis auf die Unterwäsche aus, lege mich ins kühle Bett. Ich liege mit offenen Augen, starre die schiefe Decke an. Ich denke an das Kind. Eine engelsgleiche Erscheinung im blütenweißen Kleid. Im Schneidersitz auf dem Elternbett. Kenne ich dieses Kind? Es schien mir seltsam vertraut.
Lange liege ich einfach nur da, reglos, bis ich einschlafe. Traumlos verrinnt die Nacht.
Tag 2 - Montag. Liesi lässt Blumen sprechen.
Bedachtsam schneide ich die Frühstückssemmel auf, bestreiche die beiden Hälften mit Butter, dann mit Tante Rosis selbstgemachter Marillenmarmelade. Vor mir steht brühheißer schwarzer Kaffee in einer dickwandigen Keramiktasse. Gediegenes Frühstück in einem gediegenen Landgasthaus in einem gediegenen Dorf. Zuverlässigkeit durch das schlichte Ritual des alltäglichen morgendlichen Mahls. Eine Semmel, Butter und Marmelade, Kaffee.
Das Frühstück zu Hause, in der Küche. Die Mutter stand am Herd, wärmte die Milch für meinen Kakao, Kaffeeduft zog verheißend durchs Haus. Der Vater war schon für die Arbeit angezogen, der Großvater saß mit einem Suppenteller vor sich am Tisch, im Teller wenig Kaffee und viel Milch, auf seiner Serviette neben dem Teller lag sein Briochekipferl. Der Großvater schob das Kipferl zur Seite, nahm die Serviette, steckte sie in seinen Hemdkragen. Sein Blick glitt zum Rücken der Mutter, die für die Eierspeis des Vaters die Eier in die Pfanne schlug. Würde sie die bäuerliche Unsitte der Serviette im Hemdkragen noch immer missbilligen?
Ich, Erstklässlerin, über meinen Kakao gebeugt, den Dampf einatmend. Erst später wusste ich die abwägenden Blicke des Großvaters zu deuten, verstand sein leises Kichern, seine Augen, die um Einverständnis heischend zu mir wanderten, nachdem der Rücken der Mutter ihm keine Hinweise gegeben hatte, wie sie diesmal reagieren würde.
Tante Rosi hat sich neben mich gesetzt, auf ihrem Schoß ein Fotoalbum. Sie legt es auf den Tisch, schlägt es auf, darin alte Aufnahmen von meinen Eltern, der Hochzeitstag, meine Geburt. Kindergeburtstage mit meinen Freunden, den Zwillingen Liesi und Markus. Mein erster Schultag. Ich lege die angebissene Semmel auf den Teller, wische mir die klebrigen Finger mit der karierten Stoffserviette ab, greife nach dem Album, blättere zur letzten Seite. Keine Fotos mehr ab dem Zeitpunkt meiner Abreise vor zehnJahren. Ich blättere zurück bis zu einem Foto, auf dem ich mit den Eltern, Liesi und Markus, Tante Rosi und deren Schwester Antonia abgebildet bin. „Da war ich zehn, glaub ich", murmle ich, sehe mir mein Gesicht an, erinnere mich an damals, an den dampfbeschlagenen Badezimmerspiegel im Elternhaus.
Mein Spiegelbild, ich starrte es an, versuchte herauszufinden, was dieses Spiegelkind wohl dachte, fühlte, wusste. Was aus diesem Kind werden könnte, das mich da aus dem Spiegel ansah, sein Blick genauso verwundert wie mein eigener. Wie aus einem rätselhaften Universum hinter kaltem Glas schaute mich dieses Kind an, als wäre ich selbst - die wirkliche Sophia in der wirklichen Welt - die mysteriöse Erscheinung.
„Und wie geht es der Tante Toni?" frage ich schließlich Tante Rosi.
„Die Antonia, ja, die ist jetzt beim Pfarrer. Als ihr der Herbert davongelaufen ist, hat sie sich in den Glauben verrannt."
„In den Glauben verrannt?" Ich muss leise lachen. „Ich habe geglaubt, dass du auch eine Kirchgängerin bist."
„Bin ich auch, und meinen Glauben hab ich auch. Aber das heißt nicht, dass ich jeden Sonntag in der Kirche knien muss, um dem lieben Gott zu zeigen, dass ich ein guter Mensch bin."
„Ein guter Mensch, wer ist das schon."
„Jeder, der sich fragt, ob’s richtig oder falsch ist, was er macht."
Und du, bist du ein guter Mensch, frage ich, ohne es auszusprechen. Ich wage nicht, die Frage an mich selbst zu richten.
„Ich bin vor dem lieben Gott vielleicht kein guter Mensch", sagt Tante Rosi, als hätte sie meine Gedanken gehört, „aber ich möcht versuchen, einer zu sein."
Und das zeigst dem lieben Gott ohne knien in der Kirche, sondern beim Kochen und beim Bedienen, und dann doch auf den Knien, wenn du den Boden aufwischst, sobald nachts die Gäste endlich weg sind, denke ich, ich lache laut heraus. Mein Lachen ist kein nettes, ich spüre, wie meine Augen funkeln. Tante Rosi sieht mich missbilligend an. Die Männer dort drüben am Stammtisch - sind es dieselben wie in der vorangegangenen Nacht? - blicken herüber, aufgeweckt von meinem lauten Lachen. Auf ihrem Tisch sehe ich Kaffeetassen, man trinkt offenbar noch nicht Bier oder Wein oder G'spritzte. Diese Männer sehen wie Komparsen in einem Heimatfilm aus, austauschbar. Ich kenne keinen von ihnen. Sie sitzen dort, wie wenn sie zum Mobiliar gehörten, unterhalten sich, als folgten sie dem Heile-Welt-Drehbuch des Alpenvereins. Tante Rosi nickt den Männern zu, sagt leise und durchaus streng zu mir: „Sei brav, Kind! Das sind alles ehrbare Leut’. Und du bist noch genauso schlimm wie früher." Der Griff um meinen Arm wird kräftiger, tut mir weh. Wir blicken uns an, bis schließlich doch ein annehmbares Lächeln in unseren Gesichtern zu wachsen beginnt.
Ehrbare Leut’, denke ich und sage: „Das mit dem Schlimm- und Bravsein, das hab ich schon als Kind nicht gemocht. Wer beurteilt denn, ob ich schlimm oder brav bin? Ich tue Sachen, die mir gefallen, solange ich niemanden damit belästige. Auch wenn sie in den Augen der anderen schlimm wirken. Jede Gesellschaft will, dass ich mich anpasse. Dass ich funktioniere. Dass ich nichts tue, was das Gleichgewicht des Immergleichen stören könnte."
„Mei, du machst es dir schwer. Sind doch alle so nett und haben dich doch alle so lieb. Und deine Eltern waren sehr anständige Leut’. Fleißig und brav."
„Da ist es ja schon wieder, das Brav", sage ich, aber Tante Rosi hört es nicht mehr. Sie ist aufgestanden, um zum Stammtisch zu gehen, man will noch bestellen, vielleicht jetzt doch ein Bier und einen Schnaps.
Ich beende mein Frühstück. Der Kaffee hat jetzt eine trinkbare Temperatur.
Ich fahre mit dem Zug nach Unterwollerndorf zurück, eine Station nur. Beim Greißler kaufe ich eine Flasche Wein, Gebäck und Käse. Wie eine Fremde - die ich wohl inzwischen auch bin - gehe ich durch das kleine Geschäft, besehe mir erstaunt das vielfältige Käsesortiment in der neuen, eleganten Feinkost-Vitrine. Früher gab's nur Emmentaler. Und der war scharf und vertrocknet und wie Gummi zwischen den Zähnen. Das Brot habe ich vermisst in Indien, das schon. Labberige Toastbrotscheiben in Plastikverpackung sind mir kein befriedigender Ersatz für die überbordende Mannigfaltigkeit der europäischen Brotkultur gewesen. Das Krachen des Schusterlaibchens, als ich, noch an der Kassa stehend, ein Stück abbreche und hineinbeiße, klingt wie ein knuspriges Lied der Heimatlichkeit.
Kurz vor der Mittagspause komme ich am Blumenladen vorbei, vor dessen Tür Plastikkübel mit Rosen stehen, rotes und gelbes und rosa und lila Langstieliges, daneben in schweren, großen Keramiktöpfen dicht gewachsene blaue Trichterwinden, Oleander und Clematis. Die Verkäuferin ist gerade dabei, die Rosen-Kübel über Mittag ins Geschäft zu tragen.
„Liesi, bist du das?“ frage ich. Die junge Frau stellt den Kübel wieder auf den Gehsteig, darüber gebeugt blickt sie auf und sieht in meine Augen - nicht abgeneigt, und dennoch hat ihr Blick, von unten herauf, etwas Lauerndes.
„Kennst mich nimmer?“, frage ich Liesi, „ich bins, die Sophia.“
Mit einem Freudenschrei, der die ganze Marktstraße entlang bis zum Kirchenplatz tiriliert, stolpert Liesi über den Rosenkübel auf mich zu, drückt, küsst und herzt mich, dreht sich mit mir im Kreis, zwischen unseren Körpern meine Einkaufstasche, unter unseren Füßen die zarten Blütenköpfe, langen Stiele, Blätter und Dornen aus dem umgekippten Kübel.
„Wow, da bist du ja, na so was, ich wusste ja, dass du kommst, der Markus hat mir gesagt, dass du kommst, wow, das ist so schön, dass ich dich endlich wieder seh, du hast mir so gefehlt, was war das nur für eine Idee, so lang weg zu sein, und nix hast du von dir hören lassen, ach, wie ich mich freu.“
Ich löse mich aus der Umarmung, grinse mein breitestes Lächeln, komme nicht dazu, den Redeschwall meiner liebsten Jugendfreundin auch nur für eine Sekunde zu unterbrechen. So stelle ich meine Einkaufstasche auf den Gehsteig und bücke mich, um die wenigen vom Freudentanz unversehrten Rosen wieder in den Kübel zu geben. Den trage ich in das Geschäft, ganz nach hinten, vor die offene Tür des Kühlraumes, und dort stelle ich ihn ab, weil ich nicht weiß, was ich damit tun soll.
„Hast mich nicht gleich erkannt, oder?" frage ich.
„Mein Gott, deine schönen Haare ...", sagt Liesi, die mir nachgekommen ist. Sie streicht über meinen Kopf. Meine Haare sind kurz geschnitten, mit einer Küchenschere, es sieht tatsächlich ziemlich zerrupft aus. Am Meer, in der Sonne, in der Hitze, habe ich meine langen Haare nicht ertragen. Liesi schüttelt mit unverhohlenem Tadel den Kopf, wie könne man so etwas nur tun, Haare seien schließlich die Zierde einer Frau. Sie fährt sich mit ihren Fingern durch ihre eigenen langen Haare, ihre rot lackierten Fingernägel leuchten zwischen den blond gebleichten Strähnen hervor.
Die Nägel haben wir uns knallrot lackiert, Liesi und ich, damals, an meinem fünfzehnten Geburtstag. Wimperntusche, Lidschatten, Lippenstift. Am Nachmittag nach der Schule bei ihr zu Hause in ihrem Mädchenzimmer, über der Fleischhauerei ihrer Eltern. Partymusik aus ihrem Rekorder. Wir haben getanzt, gelacht. Dann musste ich nach Hause, ich durfte nicht zu spät zum Abendessen kommen. Ich habe den Nagellack wieder entfernt, mir mit einem Waschlappen das Make-up abgewaschen, bin nach Hause gelaufen, angstvoll. Die Mutter hat die Spuren in meinem Gesicht entdeckt, geschimpft. Der Vater hat mir eine Ohrfeige gegeben, hat gesagt, ich würde wie eine Schlampe aussehen.
„Ich sperr jetzt zu, Mittagspause“, sagt Liesi, „kommst mit was essen? Zu mir nach Haus’? Ich wohn gleich über dem Geschäft.“ Ich weiß nicht, was ich Liesi erzählen soll. Indien, Goa. Sonne. Strand. Meer. Schönheit und Schmutz. Reichtum und Armut. Heilige Kühe auf den Straßen. Verwahrloste Hunde am Strand. Touristen. Hindutempel. Frauen in Saris. Männer im Dhoti. Hindustani-Musik. Sitar-Klänge. Chai trinken. Verkehrschaos. Und ich in dieser spektralen Gesamtheit unterwegs, auf staubigen Straßen, zwischen hupenden Tuk-Tuks, am nahen Strand, zum Markt, zum Internet-Café. Mit Sonnenbrille und Sonnenhut. Mit Büchern, Quartheft und Füller in meinem Rucksack. Ich erzähle von meinem Alltagsleben in Palolem, von meinem Überleben, von meiner Arbeit als Serviererin in einem Touristenlokal. Und ich mäandere geschickt um die Gründe für meine Abwesenheit herum. Als Liesi ansetzt nachzuforschen, frage ich: „Du hast es also gemacht. Das mit den Blumen. Floristin bist du? Ist das dein Geschäft? Und deine Eltern, haben die die Fleischhauerei zugesperrt?“
„Ja, der Blumenladen gehört mir. Lasst Blumen sprechen.