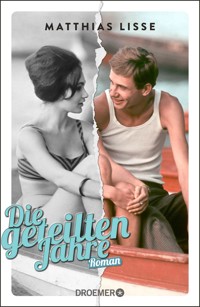
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman über eine abenteuerliche Flucht, der auf der wahren Geschichte des Autors Matthias Lisse basiert, und eine anrührende Familiengeschichte Berlin 13. August 1961 Der Traum vom "Arbeiter- und Bauernparadies" ist ausgeträumt, und wie viele andere haben Wolfgang Leipold und seine Frau nur ein Ziel: die DDR, zusammen mit ihrem kleinen Sohn Marcus, so schnell wie möglich zu verlassen. Doch ihr Entschluss kommt zu spät, denn mit der Errichtung der Mauer ist ihnen der Weg in die Freiheit versperrt und jeder Gedanke an eine Flucht aus der DDR so gut wie unmöglich. Jahre später träumt Marcus, inzwischen verheiratet und Vater einer Tochter, ebenfalls davon, in den Westen zu gehen, doch zunächst gelingt es nur ihm, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Wie aber soll er es schaffen, seine Frau Imke und die kleine Jessica zu sich zu holen? Neue Hoffnung keimt auf, als im September 89 Tausende DDR-Flüchtlinge die Prager Botschaft stürmen – darunter auch Imke und ihre Tochter … Ein beeindruckender und authentischer Roman zum Jahrestag 30 Jahre Mauerfall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Matthias Lisse
Die geteilten Jahre
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Berlin 13. August 1961
Der Traum vom »Arbeiter- und Bauernparadies« ist ausgeträumt, und wie viele andere haben Wolfgang Leipold und seine Frau nur ein Ziel: die DDR, zusammen mit ihrem kleinen Sohn Marcus, so schnell wie möglich zu verlassen. Doch ihr Entschluss kommt zu spät, denn mit der Errichtung der Mauer ist ihnen der Weg in die Freiheit versperrt.
Jahre später träumt Marcus, inzwischen verheiratet und Vater einer Tochter, ebenfalls davon, in den Westen zu gehen, doch zunächst gelingt es nur ihm, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Wie aber soll er es schaffen, seine Frau Imke und die kleine Jessica zu sich zu holen?
Neue Hoffnung keimt auf, als im September 89 Tausende DDR-Flüchtlinge die Prager Botschaft stürmen – darunter auch Imke und ihre Tochter …
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Epilog
Glossar
Für all diejenigen, die das Schicksal der DDR mit ihren Füßen besiegelt haben
Prolog
Berlin, Staatsrat der DDR, 15. Juni 1961
»Ich will den Erich hier haben! Sofort!«
»Sie meinen den Genossen Honecker, Genosse Staatsratsvorsitzender?«, vergewisserte sich die Sekretärin.
»Wen denn sonst?«, knurrte der Gefragte ungnädig und setzte in Gedanken hinzu: Du blöde Kuh!
Walter Ulbricht war nach der total aus dem Ruder gelaufenen Pressekonferenz völlig aus dem Häuschen. In Situationen wie dieser schlug schon einmal seine proletarische – ihm weniger wohlgesonnene Zeitgenossen sagten auch gern proletenhafte – Herkunft durch.
Der ehemalige Tischlergeselle aus Leipzig, heute der Erste Mann der DDR, schätzte es gar nicht, von Journalisten mit nicht zuvor abgesprochenen Fragen konfrontiert zu werden. Und genau das hatte diese unverschämte Schnepfe von der Frankfurter Rundschau am Ende der Veranstaltung, als eigentlich schon alle ihre Papiere und Notizen ordneten und zusammenpackten, getan.
Etwa dreihundert Journalisten waren zu der internationalen Pressekonferenz in den großen Festsaal im Haus der Ministerien, ehemals Görings Reichsluftfahrtministerium, geladen worden. Aus diesen Mauern heraus hatten die jeweils Herrschenden schon unzählige Lügen verbreitet, aber diejenige, die an diesem Tag hier ausgesprochen werden würde, sollte Geschichte schreiben.
Der Staatsratsvorsitzende und Erste Sekretär des ZK der SED, Genosse Walter Ulbricht, wollte über die Fortschritte beim Aufbau des Sozialismus im ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat referieren. Weiterhin stand ein unlängst von der Sowjetunion vorgeschlagener Friedensvertrag mit Deutschland auf der Tagesordnung. Nur wenn unbedingt nötig, würde Ulbricht auch zur Berlin-Frage Stellung nehmen, denn Genosse Chruschtschow hatte gerade erneut gefordert, dass sich die Westalliierten aus ihren Sektoren zurückziehen sollten und Berlin zur freien Stadt erklärt wird, deren Zugangswege allesamt von der DDR kontrolliert werden. Wohlgemerkt auch der Luftraum, was zwar völlig illusorisch war, aber man konnte diese Forderung ja wenigstens einmal als Verhandlungsmasse mit auf den Tisch legen.
Die Konferenz war mehr oder weniger ohne Zwischenfälle verlaufen, bis diese ältliche Tussi, die sich als Annamarie Doherr vorgestellt hatte, mit ihrer provokanten Frage herausplatzte. Da fragte ihn doch diese Journalistin aus Frankfurt allen Ernstes vor der gesamten versammelten Presse und damit der Weltöffentlichkeit, ob demnächst die Staatsgrenze der DDR am Brandenburger Tor errichtet werden würde und ob er, der Vorsitzende des Staatsrates der DDR und damit Regierungschef, entschlossen wäre, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen.
Ulbricht, der die ganze Zeit über wie auf Kohlen gesessen hatte und auf seinem Stuhl hin und her gerutscht war, hatte genau das kommen sehen und befürchtet. Als es dann tatsächlich passierte, war er trotzdem erschrocken, hatte sich aber unter größter Anstrengung zusammengenommen und versucht, so süffisant wie möglich verneinend zu antworten.
Natürlich war das, was er leugnete, schon lange beschlossene Sache, wurde sorgfältig und vor allem völlig im Geheimen vorbereitet, konnte aber selbstverständlich nicht eingestanden werden. Ulbricht hatte sich um Schadensbegrenzung bei der Beantwortung bemüht, war dabei aber wohl trotzdem über das Ziel hinausgeschossen. Jetzt musste er zu seinem eigenen Entsetzen schleunigst zusehen, dass kein größerer Schaden aus seiner unbedachten Wortwahl entstand.
Der Alte war wohl wahnsinnig geworden! Erich Honecker, der die vom Rundfunk der DDR übertragene Pressekonferenz auf dem kleinen Fernsehgerät in seinem Arbeitszimmer mitverfolgt hatte, konnte es nicht fassen. Was faselte denn Ulbricht da von einem Mauerbau? Danach hatte ihn doch die Journalistin überhaupt nicht gefragt! War er jetzt schon so senil, dass er die streng geheimen Pläne öffentlich vor aller Welt ausplauderte?
»Das kann doch alles einfach nicht wahr sein«, fluchte Honecker leise vor sich hin, während er sich das Jackett überstreifte. Auf dem schnellsten Wege wollte er zu Ulbricht, um zu retten, was noch zu retten war. Da klingelte auch schon das Telefon, und man befahl ihn zu seinem Chef.
Kaum hatte Honecker das Büro des Staatsratsvorsitzenden betreten, wurde er mit einer Handbewegung zum Sitzen aufgefordert. Ulbricht hing mehr, als dass er saß, in seinem Sessel hinter dem monströsen Schreibtisch und wirkte müde und zerschlagen. Bevor der herbeizitierte Sekretär für Militär- und Sicherheitsfragen überhaupt etwas sagen konnte, begann der SED-Chef schon in seinem bekannten sächselnden Singsang zu reden.
»Spar dir deine Vorwürfe, Erich. Ich weiß selbst, was ich gesagt habe. Kaum waren die Worte über meine Lippen, wollte ich sie schon zurückholen. ›Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!‹ Meine Güte, wie konnte mir das nur herausrutschen? Nun wird doch in allen westlichen Presseorganen genau das Gegenteil von dem stehen, was ich gesagt habe, und in den Fernseh- und Rundfunksendern darüber spekuliert werden, wann wir nun tatsächlich die Grenze dichtmachen.«
»Walter, was geschehen ist, ist geschehen. Jetzt müssen wir klug, angemessen und entschlossen handeln. Auf keinen Fall dürfen in den nächsten Tagen die Kontrollen auf den Zufahrtswegen nach Berlin und an den Sektorenübergängen verstärkt werden. Ich hoffe, das wird die Lage beruhigen. Und dann sollten wir völlig überraschend zuschlagen. Zur Not auch ohne die Einwilligung von Chruschtschow. Die sowjetischen Genossen werden sich schon auf unsere Seite stellen, wenn wir unumkehrbare Tatsachen schaffen. Es bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig.«
»Du hast ja recht. Aber einmal werde ich noch versuchen, Nikita zu überzeugen. Nicht am Telefon, sondern beim Treffen der Staatschefs der sozialistischen Bruderländer Anfang August in Moskau. So lange müssen wir zumindest noch warten, bis wir die Teilung Deutschlands auf viele Jahre, wenn nicht gar für immer durchsetzen. Und sollte es je zu einer Wiedervereinigung kommen, dann nur unter dem Banner des Sozialismus. Wie weit sind denn die Vorbereitungen gediehen?«
»Die Befehle sind getippt, nur das Datum fehlt noch. Innerhalb weniger Stunden können wir die Kampfgruppen der Arbeiterklasse alarmieren, damit sie die Grenzpolizei und die Nationale Volksarmee bei der Sicherung unserer Staatsgrenze unterstützen. Stacheldraht steht für den Anfang in ausreichender Menge zur Verfügung. Ebenso Zement, Steine und Betonplatten, um die Bahnhofs- und Hauseingänge zu vermauern, die direkt in den Westen führen. Der Zugverkehr zwischen Ost und West wird als Erstes unterbrochen. In kürzester Zeit sollten die Westsektoren zumindest provisorisch völlig abgeriegelt sein. Hoffen wir nur, dass die Amerikaner, Briten und Franzosen stillhalten.«
»Darüber mache ich mir wenig Sorgen. Solange wir ihre Sektoren nicht verletzen und ihren Militärangehörigen den freien Zugang in die Hauptstadt der DDR nicht verwehren, haben sie keine Handhabe. Du bist dir völlig sicher, dass vor dem noch festzulegenden Termin nichts, aber auch gar nichts durchsickert? Denn wenn das passiert, kann es eine Massenflucht ungeahnten Ausmaßes auslösen, ja geradezu eine wahre Hysterie und Panik.«
»Keine Sorge! Nicht eine einzige Sekretärin ist mit der Sache befasst, nur ausnehmend vertrauensvolle Genossen. Die meisten Befehle habe ich selbst auf meiner Schreibmaschine getippt, sie danach versiegelt und das Farbband vernichtet. Da dringt nichts nach außen, das versichere ich dir, Genosse Staatsratsvorsitzender.«
»Wollen wir es hoffen, Erich, wollen wir es hoffen! Gut, dann machen wir es so. Sollten Nachfragen zu der Pressekonferenz und meinem verunglückten Satz kommen, werden wir mit allem Nachdruck dementieren. Und du forcierst die Vorbereitungen für die Grenzschließung und den Mauerbau. In aller Heimlichkeit, versteht sich. Damit wir sofort losschlagen können, sobald ich das Einverständnis vom Genossen Chruschtschow bekomme. Oder auch ohne, sollte es gar nicht anders gehen. Spätestens im August müssen wir Fakten schaffen, sonst stehen wir bald selbst an der Drehbank oder als Pfleger im Krankenhaus. Kann ich mich darauf verlassen, Erich?«
»Selbstverständlich, Walter. Ich versichere dir, dass alle Genossen, die mit der Aktion Rose befasst sind, ihr absolut Bestes geben werden.«
Walter Ulbricht lehnte sich seufzend zurück. Endlich fiel etwas von der Anspannung, die ihm in den letzten Stunden regelrecht das Herz zugeschnürt hatte, von ihm ab.
»Noch was, Erich. Ich will, dass dieser provokanten Journalistin – den Namen habe ich mir nicht gemerkt, aber du weißt schon, wen ich meine – die Akkreditierung entzogen wird. Noch einmal lasse ich mich nicht in so eine Situation hineinmanövrieren. Kannst du dich bitte darum kümmern?«
Das könnte auch jedem anderen Journalisten bei dir gelingen, dachte Honecker, nickte aber bejahend.
»Ich sehe da kein Problem. Aber wir sollten noch etwas damit warten, damit der Entzug nicht mit ihrer Frage in Zusammenhang gebracht werden kann. Spätestens nach der Grenzschließung erhält sie ein Einreiseverbot, das verspreche ich dir.«
Mit einem Kopfnicken entließ Walter Ulbricht seinen knapp zwanzig Jahre jüngeren Erfüllungsgehilfen für den längst beschlossenen Mauerbau. Nur zwei Monate sollte es noch dauern, bis sich seine Lüge vom 15. Juni 1961 durch sichtbare Fakten entlarvte.
1. Kapitel
Berlin, Sonntag, 13. August 1961
Marcus rieb sich verschlafen die Augen, als er von seinem Vater liebevoll geweckt wurde. Der Vierjährige schlang seine dünnen Ärmchen um Wolfgang Leipolds Nacken und ließ sich von ihm aus dem Bett heben und auf den Stuhl setzen, neben dem seine Mutter bereits mit den Anziehsachen wartete.
»Ich mag noch nicht nach Hause«, quengelte der Junge und gähnte dabei herzhaft. »Da gibt es keinen See und keinen Sand zum Buddeln. Es war doch so schön hier.«
»Jeder Urlaub geht einmal zu Ende, Marcus«, erklärte Wolfgang seinem Sohn geduldig. »Aber ich verspreche dir, es wird einen neuen geben, und vielleicht wohnen wir ja sogar bald an einem See wie diesem hier und können viel öfter baden gehen als bisher.«
»Setz dem Jungen nicht solche Flausen in den Kopf«, fuhr Christine Leipold ihren Mann an. Sie wirkte hochgradig nervös und schaffte es kaum, ihrem Sohn die Schnürsenkel zuzubinden, so stark zitterten ihr die Hände. »Was, wenn sie uns an der Grenze festnehmen? Das soll in letzter Zeit schließlich öfter vorgekommen sein. Wir können doch keinen plausiblen Grund vorbringen, warum wir auf der Rückreise von unserem Urlaub noch nach Westberlin wollen! Bei der Übergabe der Reisescheine hat die FDGB-Tante uns noch ausdrücklich davor gewarnt und gedroht, dass wir nie wieder eine Urlaubsreise bekommen, wenn ihr etwas Derartiges zu Ohren kommt.«
»Die wir hoffentlich auch nicht mehr nötig haben werden. Sieh dich doch nur einmal hier in dieser schäbigen Hütte um, die sie uns als Bungalow am See angepriesen haben! Kaum dreißig Quadratmeter, Stockbetten, eine winzige Küche, wackeliger Tisch, ebensolche Stühle – und mehr als hundert Meter durch von Mücken verseuchtes Gelände bis zum See. Für diesen Urlaubsplatz mussten wir uns vor einem Jahr bewerben und sollen ewig dankbar sein, dass wir ihn bekommen haben! Das ist es offenbar, was uns der Sozialismus auf Jahre hinaus zu bieten hat! Von Jürgen kam im Juli eine Karte aus Spanien, und von deiner Schwester aus Tirol. Warst du nicht diejenige, die gesagt hat, dass du spätestens nächstes Jahr ebenfalls dorthin fahren möchtest?«
Christines jüngere Schwester Ursula und Wolfgangs Bruder Jürgen waren schon seit Jahren im Westen. Zu Letzterem wollten sie jetzt fahren. Ihre Flucht hatten sie lange und ausgiebig geplant, und in Hannover war bereits alles für ihre Ankunft vorbereitet. Jürgen hatte ihnen eine Wohnung in Steinhude unweit des Sees besorgt, und am Mittwoch war bereits ein Vorstellungsgespräch bei einer Baufirma für Wolfgang vereinbart, der sich im Abendstudium vom Maurer zum Bauingenieur qualifiziert hatte und Spezialist für Wasserversorgung und Abwasser war. Solche Leute wie er, das hatte Jürgen seinem Bruder versichert, würden händeringend gesucht und ausgesprochen gut bezahlt werden. Er selbst hatte in der DDR eine Lehre zum Offsetdrucker absolviert, aber was man ihm danach angeboten hatte, war lediglich eine Stelle in der Druckerei des Parteiorgans der SED-Bezirksleitung, der Leipziger Volkszeitung, gewesen. Ständig die Propagandaartikel, die nichts als Lug und Trug verbreiteten, vor Augen – das hatte Jürgen bald nicht mehr ausgehalten. Mit einem Freund war er am 8. Mai vor zwei Jahren – dem Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus und damit Feiertag in der DDR – von Leipzig-Mockau nach Berlin Schönefeld geflogen. Auf diese Weise umgingen die beiden Flüchtlinge den Berliner Ring, auf dem Autos, aber auch Busse kontrolliert und gerade junge Leute von den Vopos herausgefischt und wieder nach Hause geschickt wurden. Oft nahm man ihnen auch die Ausweise ab und stempelte Ungültig für Berlin hinein, womit ihnen der Zugang zur Hauptstadt der DDR verwehrt wurde. Ebenso hätte es ihnen in der Deutschen Reichsbahn ergehen können.
Den Tipp zu fliegen bekamen sie unter der Hand von dem Pfarrer der Gemeinde, in der die Eltern von Jürgen und Wolfgang sehr aktiv waren. So stiegen die beiden nach ihrer Landung in Schönefeld in den Flughafenbus, der sie direkt ins Zentrum und vor den Bahnhof Friedrichstraße brachte. Hier reichte es, eine Fahrkarte nach Gesundbrunnen, der ersten Station im Westen, zu lösen, und schon war man in der Freiheit. Oder besser gesagt in dem, was viele DDR-Bürger dafür hielten. Von Tempelhof, dem Flughafen in Westberlin, flogen die Freunde dann nach Hannover, kamen bei Verwandten unter, sodass sie nicht durch das Aufnahmelager zu gehen brauchten, und hatten schon wenige Tage später Arbeit in einem großen Verlagshaus. Christines Schwester war einen ähnlichen Weg gegangen, mittlerweile verheiratet, und lebte in Kassel.
Wolfgang, seine Frau und ihr kleiner Sohn Marcus würden also nicht allein in der Fremde sein. Auch deshalb nicht, weil die Familie ursprünglich aus der Umgebung von Hannover stammte und dort noch andere, weitläufige Verwandtschaft besaß. Die Kriegswirren hatten sie einst nach Leipzig verschlagen. Nun wollten sie letztlich dorthin zurück, wo sie einst hergekommen waren, auch wenn dies, zumindest vorerst, bedeutete, ihre Eltern zurücklassen zu müssen. Aber die Flucht war natürlich mit ihnen abgesprochen, und sie würden so schnell wie irgend möglich nachkommen. Die Väter von Wolfgang und Christine standen mit dem Regime der DDR sowieso auf Kriegsfuß und wollten lieber heute als morgen das Land verlassen.
Christine hatte eine Zeit lang nichts gesagt und nur nachdenklich auf der Unterlippe herumgekaut, während sie das Frühstück zubereitete. Wolfgang half ihr, während Marcus versuchte, seine Förmchen, mit denen er am See im Sand gespielt hatte, in den Campingbeutel zu packen, was ihm allerdings nur halbwegs gelang.
»Bist du ganz sicher, dass es ungefährlich ist?«, vergewisserte sich Christine noch einmal bei ihrem Mann. »Wenn sie uns nun kontrollieren und das Geld finden? Auf Schwarztausch steht Gefängnis, das weißt du ganz genau. Was soll dann aus Marcus werden, wenn sie uns wegen versuchter Republikflucht in den Knast stecken? Kannst du mir das vielleicht einmal sagen?«
»Christine, das haben wir doch schon tausend Mal besprochen! Glaub mir endlich, ich bin den Weg schließlich schon des Öfteren gegangen. Wir steigen in Neuruppin in den gleichen Zug ein, mit dem ich immer aus Stralsund nach Hause gefahren bin.« Wolfgang war von seinem Betrieb in Leipzig an die Ostseeküste »ausgeliehen« worden, weil dort der Arbeitskräftemangel noch gravierender war als in Leipzig. »Er bringt uns nach Berlin Ostbahnhof. Von dort ist es nicht weit bis zur Friedrichstraße. Wir brauchen dann nur auszusteigen, über den Bahnsteig zu gehen und in die S-Bahn nach Westberlin einzusteigen. Ich bin dort noch nie kontrolliert worden und immer zum Ku’damm gefahren, um die Wartezeit zwischen den Zügen zu überbrücken.«
»Ja, ich weiß. Und als Marcus geboren wurde, saßt du im Kino und hast dir einen Western angesehen, während ich in den Wehen lag.«
Das allerdings war Wolfgang bis heute unangenehm. Aber was hätte er denn tun sollen? Sein Sohn war überraschend fast einen Monat zu früh geboren worden, und als man ihn verständigen wollte, dass Christine ins Krankenhaus gekommen war, saß er bereits im Zug. In Westberlin hatte er sich dann Veracruz mit Gary Cooper und Burt Lancaster angeschaut, wie immer anschließend Bananen und Apfelsinen gekauft und war später in den Nachmittagszug nach Leipzig gestiegen. Als er endlich zu Hause ankam, erfuhr er von seinen Eltern, mit denen er Tür an Tür in einem sanierungsbedürftigen Altbau wohnte, dass er Vater geworden war und Christine eine schwere Geburt gehabt hatte. Obwohl er sofort in die Klinik geeilt war, warf ihm seine Frau bis heute vor, dass er ihr damals in den schweren Stunden nicht beigestanden hatte. Wolfgang empfand das als unfair, aber so war es nun einmal, und er hoffte nur, dass sich das irgendwann einmal geben würde.
»Darüber haben wir nun wirklich schon mehr als genug gesprochen, und ich habe mich zigfach dafür entschuldigt. Musst du immer wieder davon anfangen? Zudem kenne ich dadurch auch den Weg und weiß, dass niemand an den Bahnhöfen aufgehalten wird, der eine Arbeitsbescheinigung oder einen FDGB-Urlaubsschein vorweisen kann.«
»Aber das Geld? Wenn sie uns damit erwischen!«
Wolfgang und Christine hatten ihre ganzen Ersparnisse mithilfe der Kirche, die über entsprechende Kanäle verfügte, zum inoffiziellen Kurs von vier Ostmark zu einer Westmark umgetauscht, um wenigstens etwas Startkapital für ihr neues Leben zu haben.
»Christine, jetzt wollen wir doch mal eins klarstellen. Du warst es letztlich, die ständig gedrängt hat, dass wir in den Westen gehen sollten. Ich wollte meine Eltern und vor allem meinen angeschlagenen Vater nur ungern allein lassen. Erinnerst du dich? Und jetzt, wo wir eigentlich nicht mehr zurückkönnen und so gut wie alle Brücken hinter uns abgebrochen haben, bekommst du auf einmal Muffensausen. Dafür ist es nun ehrlich gesagt zu spät. Willst du zurück in eine fast leere Wohnung und unser Erspartes unter großem Verlust wieder zurücktauschen? Wenn ja, dann sag es bitte jetzt und mach mir später nicht wieder Vorwürfe. Davon habe ich langsam wirklich genug. Wenn nein, dann steck dir deinen Teil des Geldes wie abgesprochen in den BH, ich mir meinen in die Unterhose. Natürlich finden sie es, wenn sie uns einer Leibesvisitation unterziehen, doch dann ist es sowieso zu spät. Aber wir sind eine Familie, die im Sommer von einem FDGB-Urlaub zurückkommt. Genauso wie viele andere auch. Es gibt überhaupt keinen Grund, uns anzuhalten. Anders wäre es auf der Hinfahrt gewesen. Aber jetzt? Wer einen Blick in unsere Koffer wirft, sieht nur verschmutzte Strand- und Urlaubssachen. Das dürfte sogar die Stasi nicht mit Misstrauen erfüllen.«
Wolfgangs Stimme war zum Schluss immer lauter geworden, sodass Marcus sich erschrocken hatte und zu weinen begann. Das war nun das Letzte, was sein Vater wollte, und so beugte er sich zu seinem Sohn hinunter, nahm ihn auf den Arm und strich ihm beruhigend über das Köpfchen. Eine Aufgabe, die eigentlich der Mutter zugestanden hätte, aber Christine war viel zu sehr mit sich und ihren eigenen Sorgen beschäftigt, als sich um den Kleinen zu kümmern.
»Also gut, dann machen wir es wie geplant«, meinte sie schließlich mit unsicherer Stimme. »Du musst mir schon nachsehen, Wolfgang, dass mir nicht ganz wohl bei der Sache ist. Aber ich will dir vertrauen und beten, dass alles gut geht. Kommt, lasst uns frühstücken und dann aufbrechen, damit wir den Bus nicht verpassen. Aufräumen, abwaschen und den Schlüssel abgeben müssen wir auch noch.«
Marcus hatte sich mittlerweile wieder beruhigt, und zusammen mit seinem Vater strahlte er nun seine Mutter an, ganz so, als hätte er verstanden, welch schwerwiegende Entscheidung, auch über sein zukünftiges Leben, gerade gefallen war.
Der D-Zug nach Berlin von Stralsund kommend war pünktlich und nicht einmal überfüllt, sodass die kleine Familie sogar ein Abteil für sich allein hatte. Dass nach der Fahrkartenkontrolle auch noch zwei Transportpolizisten kamen, die die Ausweise sehen wollten und sich nach dem Woher und Wohin erkundigten, war nichts Ungewöhnliches. Allerdings studierten sie diesmal die Dokumente sehr ausführlich, was Wolfgang seltsam vorkam. Erst nachdem die Trapos die FDGB-Dokumente mit den Personalpapieren abgeglichen hatten, grüßten sie knapp und wandten sich dem nächsten Abteil zu.
Als der Zug durch die Vorortbahnhöfe von Berlin rollte, stellte Wolfgang außergewöhnliche Aktivitäten auf den Bahnsteigen fest, auf denen es Umsteigemöglichkeiten von Ost nach West mittels S- und U-Bahnen gab. Es waren keine Reisenden zu sehen, stattdessen aber jede Menge Polizei und sogar Angehörige der Kampfgruppen. Hielten die womöglich mal wieder eine gemeinsame Übung ab? Wolfgang beschloss, Christine, die mit Marcus spielte und nur gelegentlich aus dem Fenster schaute, nicht zu beunruhigen und seine Beobachtungen vorerst für sich zu behalten. Erstaunlicherweise fuhren sie aber auch nicht durch den Bahnhof an der Bornholmer Straße, sondern wurden über Nebengleise umgeleitet.
Seltsam, dachte Wolfgang bei sich. Was, zum Teufel, ist hier los? Langsam begann er sich Sorgen zu machen, aber als der Zug dann in den Ostbahnhof einrollte, waren wiederum keinerlei ungewöhnliche Aktivitäten – nur unverhältnismäßig viel Polizei – zu beobachten. Problemlos ließ man sie in die S-Bahn Richtung Friedrichstraße einsteigen, aber bereits an der Station Jannowitzbrücke entdeckte Wolfgang erneut viele Uniformierte. Hier hätte man in die U-Bahn in den Westen umsteigen können, doch offenbar waren die Abgänge versperrt. An den Stationen Alexanderplatz und Marx-Engels-Platz dagegen war nichts Beunruhigendes zu sehen. Als dann die Bahn in die Station Friedrichstraße einrollte – früher war sie in den Westteil der Stadt weitergefahren, doch seit einiger Zeit musste man hier ebenso wie bei Bussen und Straßenbahnen an der Sektorengrenze umsteigen –, öffneten sich die Türen der Waggons zur anderen Seite hinaus als sonst. Alle Fahrgäste verließen den Zug, und Wolfgang sah, dass der ganze Bahnsteig voller Grenzpolizei, Armee und Kampfgruppenangehörigen war. Jetzt erkannte auch Christine, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging, klammerte sich erschrocken an ihren Mann und nahm Marcus ganz fest bei der Hand.
Keiner der Reisenden wusste, dass Verkehrsminister Kramer selbst vor Ort war und die Aktion im bedeutendsten Umsteigebahnhof zwischen Ost- und Westberlin leitete. Am gestrigen Abend hatte Walter Ulbricht wichtige Funktionäre zu einem zwanglosen Zusammentreffen ins Regierungsgästehaus am Döllnsee, unweit der Stelle, wo sich einst Görings gewaltiges Jagdschloss Carinhall erhoben hatte, geladen. Erst zu diesem Zeitpunkt erfuhren die Spitzen des Staates von der bevorstehenden Schließung der Grenze zu Westberlin und erhielten ihre Einsatzbefehle.
Das Oberkommando über die einzuleitenden Maßnahmen war Erich Honecker, seit drei Jahren Mitglied des Politbüros der SED – der wahren Machtzentrale der DDR –, übertragen worden. Schon seit Monaten hatte er in aller Stille im Auftrag Walter Ulbrichts den Plan für die Grenzschließung zu den Westsektoren Berlins ausgearbeitet. Nur wenige sehr hochrangige Funktionäre, Militärs und Stasiangehörige waren anfangs in das Unternehmen, das den Decknamen Aktion Rose trug, überhaupt eingeweiht worden. Alle diesbezüglichen Unterlagen hatte Honecker nicht nur als »Geheime Verschlusssache«, sondern zusätzlich noch als »Geheime Kommandosache (persönlich)« deklarieren lassen. Das bedeutete, dass der Empfänger des derart gekennzeichneten Dokuments dieses erst nach telefonischer Durchsage eines zuvor vereinbarten Codewortes öffnen durfte und danach unverzüglich den darin formulierten Befehlen zu folgen hatte. Nur der Termin für die Durchführung der Grenzsicherungsmaßnahmen war nicht eingetragen und deshalb in den Papieren mit Platzhaltern gekennzeichnet worden.
Die DDR steckte seit ihrer Gründung in einer bedrohlichen Krise, doch jetzt stand sie unmittelbar vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, wenn es nicht gelänge, den Flüchtlingsstrom nach Westberlin zu unterbinden. Das einzusehen war den sowjetischen Genossen lange Zeit schwergefallen. Sie hatten geglaubt, dass sich das Problem durch Grenzsicherungsmaßnahmen zwischen der DDR und der BRD, wie sie seit Jahren vorgenommen wurden, lösen ließe.
Doch niemand musste mehr den mittlerweile gefährlich gewordenen Weg beispielsweise zwischen Thüringen und Bayern gehen, solange er sich in Berlin Ost in die S- oder U-Bahn setzen und für zwanzig Pfennig in den Westen fahren konnte. Die Kontrollen am Berliner Autobahnring hatten nur wenig Erfolg gezeitigt. Die Posten waren zwar angewiesen, alle Reisenden, die keinen akzeptablen Grund angeben konnten, warum sie nach Berlin wollten, zurückzuschicken, und ebenso verfuhren die Kontrolleure in den Zügen der Reichsbahn. Doch was brachte das? Mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein war es nicht, und wer es wirklich wollte, schaffte es jederzeit nach Berlin hinein.
Sogar mit der Kirche hatte Walter Ulbricht, der den Konflikt mit ihr scheute wie der Teufel das Weihwasser, sich anlegen müssen. Für den Juli war von den Evangelischen ein Kirchentag in Berlin einberufen worden, der in der gesamten Stadt hatte durchgeführt werden sollen. Der Zustrom aus allen Bezirken der DDR wäre in diesem Fall nicht zu kontrollieren und vor allem nicht mehr zu unterbinden gewesen! Wie viele – oder besser gesagt wie wenige – danach noch in ihre ostdeutsche Heimat zurückgekehrt wären, wollten sich die Genossen des Politbüros erst gar nicht ausmalen. Deshalb hatte Walter Ulbricht das Kirchentreffen für den Ostteil Berlins untersagen müssen, was natürlich zu geharnischten Protesten geführt hatte.
Aber war es denn ein Wunder, dass die Menschen zu Tausenden das Land verließen? Erst Anfang des Jahres hatte ZK-Sekretär Paul Fröhlich – derselbe, der damals am 17. Juni 1953 als Erster den Befehl gegeben hatte, auf die Demonstranten in Leipzig zu schießen –, einräumen müssen, dass das gesteckte Planziel, die Angleichung des Lebensstandards der Bürger der DDR an den des Westens bis Ende 1961, nicht erreicht werden konnte. Als neuer Termin für die Bewältigung dieser von der Partei- und Staatsführung formulierten Hauptaufgabe war nun das Jahr 1965 genannt worden. Doch dass die Menschen noch an diese von der SED und ihren Funktionären lauthals verkündete Botschaft glaubten, bezweifelten sogar die Genossen des Politbüros.
Seit 1949 hatte die DDR ein Fünftel, andere Berechnungen sagten sogar ein Viertel, ihrer Bevölkerung verloren. Dem musste ein Riegel vorgeschoben werden, und zwar schnellstens. Es hätte schon längst passieren können, wenn sich die Genossen in Moskau nicht so vehement gegen eine Grenzschließung in Berlin ausgesprochen hätten. Allen voran der Generalsekretär der KPdSU, Nikita Chruschtschow, der erst vor ein paar Tagen in Wien Kennedy getroffen und bis dahin immer noch gehofft hatte, zu einer Einigung mit dem amerikanischen Präsidenten zu kommen. Doch nachdem er nun erkannt hatte, dass dies reine Illusion war, hatte er Walter Ulbricht bei der Zusammenkunft der Staatschefs des Warschauer Vertragsbündnisses endgültig grünes Licht für die zuvor abgelehnten Maßnahmen gegeben. Die Mauer zwischen Ost- und Westberlin, deren geplanten Bau Ulbricht noch vor wenigen Wochen so vehement abgestritten hatte, musste nun endlich her – und das so schnell wie möglich.
Was dem Staatsratsvorsitzenden Ulbricht bei der Pressekonferenz Mitte Juni unbeabsichtigt herausgerutscht war, hätte, wäre es richtig interpretiert worden, zu einer kaum aufzuhaltenden Massenflucht in den Westen führen können, denn schließlich hatte er den Begriff »Mauer« erstmals ins Spiel gebracht, auch wenn er deren Bau eigentlich verneint hatte. Bei einer ehrlichen Antwort wäre das Land, dessen Regierung er vorstand, wohl binnen weniger Tage nahezu leer gewesen. Tagtäglich flohen bis zu zweitausend Menschen über die Sektorengrenzen in den Westen. Die Zahl war seit Anfang des Jahres stetig gestiegen, wie die Westpresse genüsslich berichtete. Im Januar und Februar hatten angeblich dreißigtausend Menschen dem Arbeiter-und-BauernStaat den Rücken gekehrt. Und es waren meist die Hochqualifizierten, die gingen, weniger die einfachen Arbeiter. Doch auch die, wie Genosse Erich Mielke, Chef der Staatsicherheit der DDR, erst unlängst dem Politbüro berichtet hatte, flohen in Scharen. Es gab mittlerweile sogar Probleme bei der Herstellung des Parteiorgans Neues Deutschland, weil Drucker fehlten. Was wäre daher erst gewesen, hätte sich das Gerücht verbreitet, dass die Grenze zu den Westsektoren Berlins endgültig geschlossen werden sollte? So wie die zur Bundesrepublik, die mittlerweile mit Stacheldraht und sogar Stabminen gesichert worden war und wo die Grenzsoldaten den Befehl hatten, auf Flüchtlinge ohne Abgabe eines Warnschusses gezielt zu schießen.
Erich Honecker hatte sich nach der Zusammenkunft am Döllnsee umgehend in seine Einsatzzentrale, das Polizeipräsidium in Ostberlin, begeben. Hier löste er genau um Mitternacht den Alarm für mehr als zwanzigtausend Bewaffnete – Kampfgruppen, Polizei, MfS und NVA – aus, die die einhundertsechsundfünfzig Kilometer lange Sektorengrenze zu Westberlin hermetisch abriegeln sollten. Die Aktion Rose war mit Beginn des 13. August 1961 angelaufen. Ein »Antifaschistischer Schutzwall« – wie die Mauer zukünftig im Jargon der SED genannt wurde – sollte angeblich die DDR vor Unterwanderung, Spionage, Sabotage, Schmuggel, Ausverkauf und Aggression aus dem Westen schützen. In Wahrheit aber hatte sie nur eine Aufgabe: zu verhindern, dass dem Arbeiter-und-Bauern-Staat das Volk davonlief.
Dass niemand, nicht einmal die ewig schnüffelnden Westjournalisten, etwas von der bevorstehenden Grenzschließung mitbekommen hatte, war der absoluten Geheimhaltung Honeckers und seiner akribischen Planung zu verdanken. Er vertraute niemandem restlos, schon gar nicht dem weiblichen Personal in den Ministerien und zuständigen Organisationen. Dafür gab es einen triftigen Grund, denn erst vor Kurzem war es zu einem Spionagefall gekommen, der das ganze Machtgefüge der SED erschüttert hatte.
Elli Barczatis, die frühere Chefsekretärin von Ministerpräsident Otto Grotewohl, war vor einigen Jahren von einem Mitglied der westdeutschen Organisation Gehlen, der Vorgängereinrichtung des Bundesnachrichtendienstes, umworben worden und hatte dem Agenten streng vertrauliche Informationen aus dem innersten Machtzirkel der DDR übergeben. Von der Stasi war die Spionagetätigkeit zwar letztlich aufgedeckt, die beiden verhaftet und später mit dem Fallbeil hingerichtet worden, aber nichtdestotrotz hatten sie einen immensen Schaden angerichtet. Walter Ulbrichts und auch Erich Honeckers Vertrauen in ihre Mitarbeiterinnen war seither schwer erschüttert und nahm manchmal regelrecht paranoide Züge an. Andererseits hatte der Staatsratsvorsitzende den jungen und dynamischen Chef der Hauptverwaltung Aufklärung beim Ministerium für Staatssicherheit, Markus Wolf, beauftragt, ebenso zu verfahren und eigene Kundschafter des Friedens, in diesem Fall »Romeos« genannt, auf Mitarbeiterinnen von hochrangigen Politikern und Wirtschaftslenkern im Westen anzusetzen. Was der aus der Organisation Gehlen hervorgegangene Bundesnachrichtendienst vermochte, meinte Ulbricht, das könnte man doch sicherlich auch, wenn nicht sogar besser, indem man den Spieß einfach umkehrte. Und so war zumindest den hochrangigen, informierten Mitarbeitern des MfS und der unmittelbaren Parteispitze der SED bekannt, dass im Westen niemand, nicht einmal die Alliierten oder gar die verhasste Springer-Presse, etwas von dem bevorstehenden Mauerbau ahnte.
Von alldem wussten natürlich Wolfgang, Christine und Marcus nichts, auch wenn ihnen in letzter Zeit das eine oder andere Gerücht zu Ohren gekommen war. Zusammen mit den anderen Fahrgästen wurden sie nach dem Verlassen des Zuges in Richtung auf die im Osten liegenden Ausgänge gedrängt.
»Weitergehen, nicht stehen bleiben«, hörten sie eine befehlsgewohnte Stimme über die Bahnsteiglautsprecher sagen und erkannten, dass alle Übergänge zu den in den Westen fahrenden Zügen gesperrt waren. Ebenso die Ausgänge bis auf einen, der zur Friedrichstraße hinunterführte. Die Uniformierten waren schwer bewaffnet und machten mit ihren entschlossenen Gesichtern auch den Eindruck, als ob sie notfalls von ihren Schusswaffen Gebrauch machen würden. Maschinenpistolen mit Trommelmagazinen waren ebenso zu sehen wie Karabiner mit aufgepflanzten Bajonetten.
Marcus starrte auf all das mit großem Interesse. Er war noch zu klein, um die Gefahr, die von den Bewaffneten ausging, zu erkennen. Unlängst erst hatten NVA-Angehörige seinen Kindergarten besucht und dabei Blumen überreicht bekommen, während die Erzieherin mit den Älteren aus der Gruppe ihnen zu Ehren ein Lied sang. Die Melodie und ein paar Worte klangen dem Jungen noch in den Ohren: »Soldaten sind vorbeimarschiert, im gleichen Schritt und Tritt …«
Dem kleinen Jungen hatte das imponiert. Die Männer waren doch ganz nett gewesen, hatten mit den Knirpsen gespielt und ihnen Geschenke überreicht. Als er zu Hause versuchte, das Lied nachzusingen, und dabei im Stechschritt und mit der Hand an der Schläfe wie ein Soldat durch das Zimmer stolzierte, verstand er gar nicht, wieso seine Eltern mit ihm schimpften. Für diese war das Maß nun endgültig voll. Der Vorfall hatte sie in ihrem Entschluss, das Land schnellstmöglich zu verlassen, nur bestärkt.
Marcus gelang es, sich von der schweißnassen Hand seiner Mutter loszumachen, aber bevor er zu den einen Kordon bildenden Uniformierten hinlaufen konnte, griff sich Wolfgang seinen Sohn auch schon wieder und nahm ihn auf den Arm.
»Ganz ruhig, Marcus, du musst keine Angst haben. Die tun uns nichts.«
»Das weiß ich doch, Papa! Tante Gerda im Kindergarten hat gesagt, sie beschützen uns. Vor den bösen Imp… Imperia… Ich kann das Wort nicht aussprechen.«
Imperialisten, ergänzte Wolfgang in Gedanken. Ein Grund mehr, dass sein Sohn endlich aus diesem ideologieverseuchten Hort fortkam. Sein Bruder und seine Schwägerin zählten bestimmt nicht zu den sogenannten Imperialisten, und bei seinen Besuchen in Westdeutschland – er war als Jugendlicher bis in die Alpen getrampt, was damals noch möglich gewesen war – hatte er auch nie jemanden getroffen, vor dem er sich hätte fürchten müssen. Aber was war hier eigentlich los? Als Wolfgang sich umdrehte, sah er, dass auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig, der die Gleise B, für die S-Bahn nach Westen, und C, für die nach Osten, voneinander trennte und auf dem man sonst umsteigen konnte, eine provisorische Mauer errichtet wurde. Die Bauarbeiter standen dabei unter ständiger Beobachtung von Bewaffneten, die Maschinenpistolen im Anschlag hielten.
Siedend heiß lief es Wolfgang den Rücken hinunter.
»Sie schließen die Grenze«, flüsterte er Christine zu. »Ausgerechnet heute! Macht Ulbricht also doch Ernst und lässt eine Mauer quer durch die Stadt bauen, was er erst unlängst noch so vehement abgestritten hat. Erwartet haben wir es ja alle, aber so schnell?«
»Was tun wir denn jetzt? O Gott, wenn sie uns erwischen!«
»Niemand sieht uns an der Nasenspitze an, was wir vorhaben. Ich habe eine Idee. Alle Übergänge können sie unmöglich schon abgeriegelt haben. Komm, laufen wir zur U-Bahn. Am Potsdamer Platz gibt es einen Ausgang nach Osten und einen nach Westen. Vielleicht ist da noch ein Durchkommen.«
Die Eheleute hätten gar nicht zu flüstern brauchen. In dem allgemeinen Tumult achtete sowieso keiner auf sie. Angst und Wut paarten sich zu gleichen Teilen bei den Reisenden, die wie Vieh vom Bahnsteig gedrängt wurden. Tränen flossen, wahrscheinlich vergossen von denen, die ebenso wie Wolfgang, Christine und Marcus hatten flüchten wollen, aber auch Fäuste wurden drohend geschüttelt, doch niemand wurde handgreiflich. Stattdessen hagelte es Beschimpfungen und Flüche gegen die Uniformierten, die dies mit stoischer Gelassenheit über sich ergehen ließen. Aber wie lange noch, fragte sich Wolfgang. Wann würde die Stasi eingreifen, sich die lautesten Krakeeler und zur Not auch Unbeteiligte greifen, nur um andere davon abzuhalten, sich deren Protest anzuschließen?
Genauso hatte das SED-Regime schließlich auch am 17. Juni 1953 während des Volksaufstandes gehandelt. Damals war er als Neunzehnjähriger mit seinem Vater Franz und so gut wie allen Arbeitern aus dessen Betrieb und Tausenden anderen um den Leipziger Innenstadtring gezogen und hatte mit ihnen gemeinsam »Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes Wille!« gebrüllt. Gemeint gewesen waren damit natürlich der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht, Präsident Wilhelm Pieck und Ministerpräsident Otto Grotewohl, die nicht durch eine demokratische Wahl, sondern durch die Allmacht der SED an die Spitze der DDR gelangt waren.
Anfangs sah es so aus, als ob sich die Staatsmacht vor der geballten Arbeiterwut verkriechen würde, doch dann hatte der Bezirkssekretär Paul Fröhlich auf die Demonstranten schießen lassen. Im Schutze der NVA und Roten Armee waren Stasileute und Vopos über die unbewaffneten und friedlich Protestierenden hergefallen. Es hatte Tote gegeben, viele waren verhaftet, verurteilt und nicht wenige später hingerichtet worden. Glücklicherweise war ihm und seinem Vater dieses Schicksal erspart geblieben. Tagelang hatten sie gezittert und gebangt, ob sie erkannt und verraten worden wären. Vor allem Wolfgangs Vater Franz, der schon einmal jahrelang in einem kommunistischen Sonderstraflager eingesessen hatte und seiner Familie gegenüber klar äußerte, dass er sich eher das Leben nehmen würde, als diese Tortur noch einmal zu erdulden. Aber diesmal ging der Kelch an ihnen glücklicherweise vorüber. Zum eigenen Erstaunen der Leipolds kam niemand, um Vater und Sohn abzuholen.
Doch die Angst von damals saß Wolfgang noch immer in den Knochen. Sie mussten hier weg, so schnell als möglich. Er hastete den Abgang vom Bahnsteig hinunter – Marcus, der zu weinen begonnen hatte, weil ihm die vielen Menschen, die Enge und der Lärm Angst machten, auf dem einen Arm, den Koffer in der anderen Hand. Ihm auf den Fersen folgte Christine, die ihren Mann in dem Gewühl auf keinen Fall aus den Augen verlieren wollte. Zu ihrer Erleichterung war der Zugang zur U-Bahn möglich, aber deren nächste Station lag noch zur Gänze im Osten.
Andere schienen die gleiche Idee wie die Leipolds zu haben, denn das Gedränge war unvorstellbar. Nur schubweise wurden sie zum U-Bahnsteig gelassen, denn der Personenverkehr im Ostteil der Stadt konnte durch die auch für das Bahnpersonal überraschend eingeleiteten Maßnahmen einfach nicht mehr störungsfrei bewältigt werden. Als es der kleinen Familie endlich gelang, in einen Waggon einzusteigen, standen sie so dicht gedrängt zwischen den anderen Fahrgästen wie die sprichwörtlichen Sardinen in der Dose, die es in der DDR schon lange nicht mehr gab.
Der Zug fuhr in die Station Stadtmitte ein, und auch hier wimmelte es nur so von Uniformierten. Da es aber keinen Ausgang in die Westsektoren gab, ließ man die Reisenden unbehelligt, und auch ein Umstieg in die U-Bahn-Linie 2 war möglich. Nur eine Station lag von hier aus noch zwischen dem Potsdamer Platz, und vielleicht ginge ja der Plan der Flüchtlinge tatsächlich auf.
Was über ihnen in diesem Moment geschah, ahnten die Leipolds allerdings nicht. Das unweit gelegene Wahrzeichen Berlins, das Brandenburger Tor, war ebenso weiträumig abgesperrt wie alle anderen Möglichkeiten zum Grenzübertritt. Bewaffnete standen Schulter an Schulter davor, Maschinenpistolen vor der Brust, während hinter ihren Rücken Sperranlagen errichtet wurden und Panzerfahrzeuge der NVA die Plätze und Straßen für den Fall sicherten, dass es zu Ausschreitungen der Bevölkerung kommen würde.
Eine Haltestelle weiter war dann die Reise zu Ende. Alle Fahrgäste mussten die U-Bahn verlassen – und Wolfgang hatte es fast geahnt: Der Ausgang in den Westen war versperrt. Nur der zur Leipziger Straße hin konnte noch passiert werden. Vor dem Aufgang zum Potsdamer Platz standen Wachposten dicht an dicht, und mit Hohlblocksteinen wurden gerade die Aufgänge vermauert. Wieder trieb man die Fahrgäste mit harschen Befehlen nach oben, und auf der Straße angekommen, sahen die Leipolds erstmals das ganze Ausmaß der Katastrophe, die über Nacht hereingebrochen war.
Am Potsdamer Platz, vor dem Krieg einer der verkehrsreichsten in ganz Europa, waren das Pflaster und die Schwarzdecke aufgerissen worden. Soldaten gruben Löcher in den darunter befindlichen Untergrund für zum Aufstellen bereitliegende Betonpfähle, zwischen die Stacheldraht gespannt wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite wurde mit Farbe der Verlauf der Demarkationslinie markiert. Offiziere bewachten diejenigen, die die Arbeiten ausführten. Sie wirkten entschlossen, während die einfachen Soldaten, meist junge Männer, viele kaum älter als zwanzig Jahre oder gar noch jünger, ratlos und erschrocken die Menschen anstarrten, die sich auf beiden Seiten der Absperrungen zu sammeln begannen. Panzerspähwagen der NVA und Grenzpolizei ließen die Maschinengewehre in ihren Türmen hin- und herschwenken, und dass die Genossen nicht zögern würden, auf ihre Landsleute zu schießen, wenn sie den Befehl dazu bekamen, daran zweifelte zumindest auf Ostberliner Seite niemand. Schließlich waren den meisten die Ereignisse des 17. Juni noch in guter Erinnerung. Deshalb kam es auch nicht zu lautstarken Protesten und schon gar nicht zu Übergriffen auf diejenigen, die die Anweisungen Walter Ulbrichts und seiner Erfüllungsgehilfen ausführten.
Von der Westberliner Seite hingegen schallten Rufe wie »Für den Friedensstaat mit Panzern und Stacheldraht!« und auch unflätige Beschimpfungen der Grenzer herüber.
Die Leipolds sahen einen Offizier, der akribisch alles in ein Notizbuch schrieb, was er an Sprüchen hörte. Sicher würden diese am nächsten Tag in den Parteiorganen der SED stehen und die Redakteure sich furchtbar über die Provokateure aus dem Westen aufregen und ihnen Verbindungen zur verhassten Springer-Presse oder gar dem BND unterstellen.
Wolfgang, der seinen Sohn immer noch auf dem Arm hielt, und Christine blickten sich verstört um. Was sie sahen, ließ sie trotz der Sommerhitze frösteln. Es gab so gut wie kein Durchkommen mehr in den Westen – nirgends. In beide Richtungen vom Potsdamer Platz ausgehend wuchsen die Grenzsperren erschreckend schnell in die Höhe. Wolfgang allein, wäre er zu allem entschlossen gewesen, hätte es vielleicht geschafft. Ein schneller Sprint zwischen zwei noch nicht mit Stacheldraht verbundenen Pfeilern hindurch, ein Sprung über die bisher nur meterhohe Absperrung, und er wäre im Westen gewesen. Dass die Wachposten gezielt hinter ihm herschießen würden, wo sich doch auf der anderen Seite so viele Menschen eingefunden hatten, die das Geschehen ohnmächtig verfolgen mussten, wagte er zu bezweifeln. Aber ganz sicher konnte man sich da nie sein, und Gedanken in diese Richtung verboten sich von selbst. Wolfgang stand hier mit einem kleinen Jungen auf dem Arm und einer zierlichen Frau an seiner Seite. Die beiden zu verlassen kam für ihn niemals auch nur ansatzweise infrage. Und damit war die Sache erledigt, zumindest vorläufig. Jetzt blieb ihnen wirklich nichts anderes mehr übrig, als nach Leipzig zurückzukehren, ihr altes Leben dort wieder aufzunehmen und zu hoffen, dass ihre geplante Republikflucht nicht doch noch irgendwie ruchbar werden würde. Von einer schönen Wohnung am Steinhuder Meer, von Urlaubsreisen in ferne Länder und gefüllten Ladenregalen würden sie wohl auch zukünftig nur träumen können.
Auf einmal entstand Bewegung an den provisorischen Grenzsperren. Wolfgang und Christine, die sich bereits umgedreht hatten, um die Leipziger Straße hinunter zur nächsten Haltestelle zu gehen und zurück zum Ostbahnhof zu fahren, konnten gerade noch erkennen, wie ein Soldat urplötzlich in Richtung Westen losrannte. Er hielt genau auf die Lücke zu, die auch Wolfgang aufgefallen war. Sofort entstand Geschrei, Rufe wie »Halt! Stehen bleiben!« schallten über den Platz, und das Klicken von Gewehren, die durchgeladen wurden, war zu hören.
Doch der Flüchtende scherte sich nicht darum. Im Laufen riss er seine Maschinenpistole von der Schulter, warf sie von sich, sprang über eine am Boden liegende Stacheldrahtrolle, und bevor ihn jemand aufhalten konnte, tauchte er in der Menge unter, die sich auf der westlichen Seite des Potsdamer Platzes versammelt hatte. Laute Jubelrufe und Aufforderungen, es dem Soldaten gleichzutun, schallten herüber und lösten unbändige Wut bei dessen Vorgesetzten aus, die genau wussten, dass sie sich für die gelungene Flucht würden verantworten müssen.
Die Offiziere ließen sie an denen aus, die staunend dem Geschehen zugesehen hatten, und befahlen ihren Untergebenen, den Platz zu räumen und die Gaffer die Leipziger Straße hinunterzutreiben. Dabei kam die Menge auch an dem Gebäude vorbei, aus dem heraus Walter Ulbricht erst vor acht Wochen verkündet hatte, dass »niemand die Absicht habe, eine Mauer zu errichten« und »die Bauarbeiter in der Hauptstadt der DDR ausschließlich mit dem Wohnungsbau beschäftigt wären«. Unter diesem Vorwand war es letztlich gelungen, das ganze Material, das nun für den Antifaschistischen Schutzwall benötigt wurde, unbemerkt heranzuschaffen.
Auch die Leipolds waren unter denen, die nun gezwungen wurden, den Potsdamer Platz und damit die Sektorengrenze zu verlassen. Auf der Höhe des monströsen Hauses der Ministerien beugte Wolfgang sich zu seiner Frau hinab und flüsterte ihr zu: »Die Genossen verwandeln das Arbeiter-und-Bauern-Paradies«, er konnte und wollte den Sarkasmus in seiner Stimme nicht verbergen, »in ein einziges großes Gefängnis, aus dem man zukünftig nur unter Lebensgefahr wird fliehen können.«
Sie waren einen Tag, nur einen einzigen, zu spät gekommen.
Marcus verstand natürlich nicht, was vor sich ging. Er bekam nur mit, dass seine Eltern verstört und anders waren als sonst. Als er sie anblickte, sah er, dass diesmal ihnen, die ihn doch sonst immer trösteten, wenn er weinte, Tränen in den Augen standen. Wolfgang und Christine ahnten in diesem Augenblick, dass ihre Sehnsucht nach Freiheit wohl lange Zeit ungestillt bleiben und sie sich auf viele geteilte Jahre würden einstellen müssen.
2. Kapitel
1964 – 1969
»Aber Wolfgang, wenn wir jetzt umziehen, dann muss Marcus doch schon wieder die Schule wechseln.« Christine war richtiggehend entsetzt. »Das wäre das zweite Mal in nur drei Jahren, und noch dazu mitten im Schuljahr. Meinst du wirklich, dass er das verkraftet und seine Leistungen nicht darunter leiden? Gerade erst hat er neue Freunde gefunden, und die Lehrer mögen ihn auch. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du ihn da schon wieder herausreißen willst.«
»Ach was, der Junge ist intelligent und kontaktfreudig, der schafft das schon«, entgegnete ihr Mann unwirsch. »Für den Schulwechsel nach der ersten Klasse kannst du nur den Staat verantwortlich machen. Das war eine Fehlplanung der Behörden. Und nun muss es eben erneut sein. Weißt du, wie oft ich mit meinen Eltern umgezogen bin, wenn mein Vater wieder einmal versetzt wurde? Aber für uns kommt so eine Chance vielleicht nie wieder, dass solltest du dir vor Augen führen, Christine. Wenn wir jetzt nicht zuschlagen, dann hocken wir womöglich auf ewige Zeit hier in dieser Bruchbude. Du kannst dann noch für Jahre ins Westbad am Leuschnerplatz gehen, wenn du einmal baden oder duschen willst. Möchtest du das?«
»Nein, natürlich nicht. Aber die Wohnung, die sie uns anbieten, hat doch nur zwei Zimmer. Hier haben wir wenigstens drei. Marcus wird nicht gerade glücklich sein, wenn er sein kleines Reich aufgeben muss. Und uns bleibt dann auch kaum noch Raum für Zweisamkeit, wenn er mit uns in einem Zimmer schläft. Was wird denn, wenn ich wieder schwanger werde? Wir wollten doch beide noch ein Kind!«
»Christine, das haben wir doch nun schon zigfach besprochen. Ja, wir haben hier in diesem maroden Altbau drei Zimmer. Aber was für welche! Winzig, so verwinkelt, dass man kaum Möbel hineinstellen kann, und in unserem Schlafzimmer und in Marcus’ Kinderzimmer schimmelt es, weil es nur einen Ofen im Wohnzimmer und einen mit Holz zu befeuernden Kochherd in der Küche gibt. Das Klo ist auf der halben Etage und unbeheizt. Jedes Mal aufs Neue beschwerst du dich im Winter, wie kalt es dort ist. Gar nicht davon zu reden, was ich mir fast abfriere, wenn ich nur mal pinkeln gehe. Waschen können wir uns nur in einer Schüssel in der Küche oder in der kleinen Spüle. Da haben ja sogar die Leute im Mittelalter komfortabler gewohnt!«
»Du sagtest doch, du hättest Aussicht auf einen Elektroboiler oder sogar eine Duschkabine.«
»Wir wären mit der Zuteilung dran gewesen, ja. Doch das war, bevor der Betriebsparteisekretär, diese miese Ratte, seine Finger danach ausgestreckt hat. Fraglich außerdem, ob die Sicherungen bei den maroden Stromleitungen es überhaupt aushalten würden, Duschwasser elektrisch aufzuheizen. Doch es ist eh müßig, darüber nachzudenken. Wer weiß, wann es wieder einmal eine solche Kabine geben wird. Aber gerade weil ich wegen der Bevorzugung des Genossen so einen Krach geschlagen habe, hat man uns jetzt wenigstens die Wohnung in dem Neubau endlich zugeteilt. Seit Jahren bewerben wir uns darum, und jetzt willst du sie nicht mehr! Das soll noch einer verstehen.«
»Weil sie zu klein für drei oder vier Personen ist, begreifst du das nicht? Wir kriegen nie eine andere, wenn wir diese jetzt annehmen. Lass uns doch noch etwas warten, Wolfgang. Es ging doch bisher auch.«
»Christine, schau mal. Es ist ein Erstbezug, nach zwei Jahren dürfen wir eine Tauschanzeige aufgeben. Du hast natürlich recht, die Wohnung ist im Prinzip für eine Familie zu klein. Aber ideal für ein älteres Paar oder auch eine einzelne Person. Vielleicht eine Witwe oder einen Witwer. Sie ist in der zehnten Etage, aber das Haus hat einen Fahrstuhl. Von dort oben hat man einen Blick bis fast zum Auensee. Es gibt eine eingebaute Küche, ein Bad mit Badewanne und Zentralheizung. Nie mehr Kohlen schleppen, kein Holz mehr für den Herd mühsam besorgen und hacken müssen. War das nicht immer dein Wunsch?«
»Ja schon. Aber meinst du wirklich, dass jemand später mit uns tauscht? Eine kleine Wohnung gegen eine große?«
»Da bin ich mir sogar sehr sicher. Wir werden dann vielleicht ein paar Abstriche am Komfort machen müssen, aber möglich sollte das sein. Und dann haben wir endlich etwas Platz und ein eigenes Bad. Denkst du nicht, dass es dafür langsam Zeit wird?«
»Ich weiß es wirklich nicht, Wolfgang. Komm, lass uns noch ein oder auch zwei Nächte darüber schlafen. Schließlich sollte man so eine Entscheidung nicht übers Knie brechen.«
Christines Mann hatte sich abgewandt und schaute aus dem Fenster auf die trostlose Straße hinaus. Ein Haus sah hier so verfallen aus wie das andere, was ihm als Bauingenieur geradezu körperlich wehtat. Um die Jahrhundertwende errichtet, verfiel nun das ganze Viertel. Die Dächer der früher ansehnlichen Häuser waren löchrig, sodass es zumindest in die oberen Stockwerke hineinregnete. Der Putz bröckelte ab, Stuckverzierungen waren nur noch als Fragmente erhalten. Den Schutt ausgebombter Gebäude hatte noch immer niemand weggeräumt. Auf ihm wucherten jetzt Brennnesseln und anderes Unkraut, wuchsen sogar bereits Bäume. Wie gern hätte Wolfgang selbst mit angepackt, Pläne erstellt, um das durchaus erhaltenswerte Viertel zu sanieren. Doch überall war er nur auf taube Ohren gestoßen, hatte man ihm bedeutet, er solle sich gefälligst auf die ihm übertragenen Arbeiten konzentrieren und sich nicht um Dinge kümmern, die ihn nichts angingen. Statt die alten, einst schmucken Häuser instand zu setzen, hatten die Wohnungsbaubehörden begonnen, am Stadtrand Plattenbauten hochzuziehen, die zwar überhaupt nicht ins Landschaftsbild passten, aber vielen Menschen, die in ähnlichen Bruchbuden wie die Leipolds wohnen mussten, wie eine göttliche Verheißung vorkamen.
»Lange kannst du dir mit deiner Entscheidung nicht mehr Zeit lassen, Christine«, meinte Wolfgang nach längerem Schweigen. »Die Chance kommt vielleicht kein zweites Mal. Ich jedenfalls könnte damit leben, wenn wir für eine begrenzte Zeit mal etwas enger zusammenrücken müssen. Es wäre ja schließlich nicht für alle Ewigkeit.«
»Wenn du meinst«, stimmte seine Frau nach kurzem Zögern und keineswegs restlos überzeugt zu. »Dann ziehen wir halt um. Aber deinen Eltern und Marcus machst du das begreiflich, nicht ich. Deine Mutter würde sonst nur denken, dass ich dahinterstecke, weil ich es nicht länger ertrage, mich ständig von ihr bevormunden zu lassen.«
Was manchmal gar nicht so schlecht ist, dachte Wolfgang bei sich. Oder warum denkst du, dass Marcus lieber bei ihr und seiner Tante Hilde ist als bei dir? Er behielt seine Gedanken aber natürlich bei sich, denn ein handfester Ehekrach war das Letzte, was er jetzt brauchen konnte.
»Gut, dann gehe ich morgen zu dem Wohnungsbeauftragten im Betrieb und nehme sein Angebot an. Aber du musst auch wirklich dazu stehen und nicht nur widerwillig zustimmen. Wenn nicht, lassen wir es besser bleiben.«
»Ich habe doch Ja gesagt, reicht dir das nicht?« Christine wandte sich um und verließ das kleine Wohnzimmer, ohne ihren Mann noch einmal anzublicken, damit er nicht sah, dass ihre Augen in Tränen schwammen.
Begeisterung sieht jedenfalls anders aus, sinnierte Wolfgang und starrte erneut auf die Straße hinaus. Es hatte leicht zu regnen begonnen, und nun war alles noch grauer und trostloser als zuvor. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, ob es nicht vielleicht ein Fehler gewesen war, so schnell zu heiraten, nur weil Marcus unterwegs gewesen war. Zu unterschiedlich war oft das, was er und Christine dachten und wollten, auch wenn, wie er sich selbst eingestand, der Fehler keineswegs immer bei seiner Frau lag. Aber die ganze unbefriedigende politische Situation im Lande seit dem Mauerbau und der allgegenwärtige Mangel an allem und jedem strahlte auch auf das private Leben und tief in die Familien hinein aus und zerrüttete so manche einst glückliche Ehe.
Seit ihrer gescheiterten Flucht war seine Frau immer in sich gekehrter geworden und kaum noch mit etwas zufriedenzustellen. Sie trauerte der verlorenen Chance nach, obwohl sie auch damals zögerlich gewesen war. Im Nachhinein gab sie ihrem Mann die Schuld daran, dass sie noch immer in der DDR leben mussten, obwohl sie in ihrem Innersten wusste, wie ungerecht das war. Aber hätte er eher gehandelt, würden sie jetzt schon seit mehr als drei Jahren in einer schönen Wohnung am Steinhuder Meer leben, sie müsste vielleicht gar nicht mehr arbeiten, und ihr Mann brächte als Bauingenieur gutes Geld nach Hause.
Am Nachmittag des 13. August 1961 war die kleine Familie mit dem Zug nach Leipzig zurückgekehrt. Während der Bahnfahrt hatte jeder seinen eigenen Gedanken nachgehangen, und sogar Marcus war ganz entgegen seiner sonstigen Gewohnheit sehr schweigsam gewesen. Wolfgang und Christine hingegen hatten nur gehofft und gebangt, dass sie nicht schon von der Stasi erwartet wurden, die ihre Augen und Ohren schließlich überall hatte. Glücklicherweise aber war ihr Vorhaben unbemerkt geblieben, obwohl sie in aller Heimlichkeit einige Wertgegenstände und Möbel vor ihrer Reise verkauft oder zu ihren Eltern geschafft hatten. So kamen sie in eine halb leere Wohnung zurück, die an Tristesse kaum zu überbieten war.
Wolfgangs und auch Christines Eltern waren als Flüchtlinge aus Schlesien nach Leipzig gekommen. Die Leipolds stammten allerdings ursprünglich aus der Nähe von Hannover. Wolfgangs Vater Franz war einige Jahre vor dem Krieg in die alte preußische Garnisonsstadt Namslau versetzt worden, wo er als Offizier in einem Reiterregiment gedient und nach seiner Entlassung als Beamter in der Heeresversorgung gearbeitet hatte. Bei Kriegsbeginn war er dann allerdings sofort wieder eingezogen und später nach Italien versetzt worden. Nach der Landung der Alliierten hatten die Amerikaner die von ihm befehligte Versorgungseinheit gestellt und ihn in ein Kriegsgefangenenlager gesteckt. Jahrelang hatte er nichts von seiner Familie gehört und die Sorge um sie ihn fast umgebracht.
Seine Frau Helene hatte mit den zwei kleinen Kindern Wolfgang und Jürgen und mit einer schwerbehinderten Cousine, für die sie sich verantwortlich fühlte, aus Schlesien flüchten müssen und war schließlich, am Ende ihrer Kräfte und dem Zusammenbruch nahe, in Leipzig gestrandet. Über das Rote Kreuz hatte die Familie nach Kriegsende wieder zueinandergefunden. Franz wollte zurück nach Hannover, doch seine Frau nach den unendlichen Strapazen der Flucht nur noch zur Ruhe kommen und bleiben, wo sie war. Dass Franz bald darauf abgeholt und noch einmal für Jahre interniert werden sollte, hatte damals letztlich niemand ahnen können.
Als Wolfgang im entsprechenden Alter war und sich nach Mädchen umzuschauen begann, lernte er in der christlichen Gemeinde Christine kennen, der ein ähnliches Schicksal wie ihm beschieden gewesen war. Bald war Marcus unterwegs gewesen, und beide hatten rasch geheiratet. Nicht nur, aber auch, um ihren katholischen Familien Peinlichkeiten in der Gemeinde zu ersparen. Auf dem Wohnungsamt war Wolfgang regelrecht ausgelacht worden, als er einen Antrag auf angemessenen Wohnraum abgegeben hatte. In der jungen DDR herrschte an allem Mangel, am meisten aber an Wohnungen. Die Eheleute könnten ja weiterhin bei ihren Eltern leben, beschied man ihnen daher auf dem Amt. Notfalls auch getrennt, wenn nicht genügend Platz vorhanden wäre. Die Wartezeit auf eine Wohnung läge schließlich gegenwärtig bei drei bis fünf Jahren.
Doch dann war überraschend die Nachbarin von Wolfgangs Eltern in hohem, gesegnetem Alter verstorben. Im Einverständnis mit deren Kindern hatte Wolfgang mit seinen Eltern die Wohnung kurzerhand besetzt, die meisten Möbel gleich übernommen, und als das Wohnungsamt kam, um sie zu besichtigen und zu entscheiden, wem sie zugeteilt werden sollte, wohnte bereits eine neue Familie darin. Da Marcus mittlerweile geboren sowie die Wohnung auf die Schnelle renoviert worden war und Wolfgang die Miete in gleicher Höhe wie die Verstorbene auf das Konto bei der Staatsbank überwiesen hatte, fiel es den Vertretern des Amtes für Wohnungswesen schwer, die geschaffenen vollendeten Tatsachen wieder rückgängig zu machen. Sie drohten zwar mit der Vopo und dass diese Eigenmächtigkeit Konsequenzen haben würde, scheuten aber davor zurück, eine Familie mit Kleinkind gewaltsam aus der Wohnung zu entfernen. Noch dazu, wo Wolfgang mittlerweile bei der Wasserwirtschaft tätig war und dort als Experte für Abwasserbeseitigung – ein großes Problem für die Stadtverwaltung von Leipzig – und Kläranlagen galt. Er wurde zwar zum Parteisekretär des Betriebes einbestellt, der ihm schwere Vorwürfe machte und gleichzeitig wie schon viele Male zuvor versuchte, den jungen Mann zu bewegen, in die SED einzutreten. Denn dann, so wurde Wolfgang unter der Hand zu verstehen gegeben, könnte man vielleicht über das ungesetzliche Handeln hinwegsehen und im Nachhinein eine Zuweisung erwirken.
Doch wie stets zuvor erhielt der Funktionär eine Abfuhr mit dem Hinweis, dass es bei den Leipolds Familientradition war, keiner Partei anzugehören. Selbst als Offizier war Wolfgangs Vater nicht Mitglied der NSDAP gewesen und hatte, einst als Reiter in das im Versailler Vertrag auf hunderttausend Mann festgelegte sogenannte Friedensheer eingetreten, schnellstmöglich seinen Abschied genommen, als die Kavallerieregimenter von den Nazis bei der Mobilmachung der Wehrmacht in Vorbereitung auf den Überfall auf Polen aufgelöst worden waren.
Wolfgang hatte dies dem Partei-Fuzzi schon einmal dargelegt, war aber daraufhin nur angebrüllt worden, dass, wenn er noch einmal die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, also die SED, mit der NSDAP in einem Atemzug nannte, er sich ganz schnell woanders wiederfinden würde. Wo, brauchte er nicht weiter auszuführen, denn das war jedem DDR-Bürger klar. Wolfgang war aber nach der Zurechtweisung glücklicherweise nicht weiter traktiert worden. Auch diesmal gab er dem Drängen sehr zum Ärger des Parteisekretärs nicht nach, was in Bezug auf die nicht genehmigte Wohnungsbesetzung zwar eine schriftliche Rüge, aber zu Wolfgangs Erleichterung keine ernsthafteren Konsequenzen nach sich zog. Der Eintrag in die Kaderakte interessierte ihn zumindest im Moment herzlich wenig, hatte er doch mit Christine und Marcus endlich eine eigene Wohnung, auch wenn die sich in einem mehr als nur leicht sanierungsbedürftigen Altbau befand. Aber das ging vielen Leipzigern in der schwer vom Krieg gezeichneten Stadt genauso, und die kleine Familie konnte sich trotz allem glücklich schätzen. Außerdem wohnten sie Tür an Tür mit Wolfgangs Eltern, was zwar seiner Frau nicht immer recht war, die vor allem zu seiner Mutter ein etwas angespanntes Verhältnis hatte, aber doch zumindest zeitweise äußerst hilfreich sein konnte. So hatte Christine zumindest die Möglichkeit, sich ebenfalls nach einer Arbeit umzusehen. Schließlich war sie gelernte Buchhalterin und Marcus gerne bei seinen Großeltern und seiner Tante.
Franz, der während seiner Zeit in der Reichswehr eine Ausbildung zum Hufbeschlagschmied an der Kavallerieschule Hannover absolviert hatte, arbeitete im Schichtbetrieb in einem großen Stahl verarbeitenden Werk in Leipzig-Plagwitz als Pflugscharschmied an einem hydraulischen Hammer. Eine andere Tätigkeit gestand ihm das Regime aus verschiedenen Gründen, die in seiner Vergangenheit zu suchen waren, nicht mehr zu. Seine Frau hingegen hatte eine Stelle in der sich in ihrem Wohnhaus befindlichen Fleischerei als Aushilfsverkäuferin gefunden. Da sie stundenweise arbeitete und ihre Cousine Hilde, die seit ihrer Kindheit an einer Rückgratverkrümmung litt, nur eingeschränkt tätig sein konnte, kümmerten sie sich wechselseitig um Marcus, der auf diese Weise wohlbehütet aufwuchs, auch wenn er seinen Papa oft vermisste.
Ganz folgenlos war die Wohnungsaktion letztlich doch nicht geblieben. Wolfgang, dem man nach der Geburt seines Sohnes zugesagt hatte, dass er in Leipzig bleiben könnte und nicht mehr an das Klärwerk an der Ostsee ausgeliehen werden würde, musste weiterhin quer durch die Republik reisen und sah seine Familie manchmal nicht einmal an den Wochenenden, weil sich die Heimfahrt von weit entfernten Orten mit dem Zug einfach nicht lohnte. Doch das zumindest änderte sich nach dem Mauerbau zum Guten, da selbst die bornierte DDR-Führungsriege erkannte, dass Ideologie für den Aufbau des Sozialismus allein nicht ausreichte und man die Fachkräfte, die man noch hatte, auch motivieren musste und nicht restlos vergraulen durfte.
Während seine Eltern den Umzug natürlich ausgiebig diskutierten, fragte Marcus niemand, ob er seine bisherige Welt verlassen wollte. So fand er sich plötzlich mitten im dritten Schuljahr nicht nur in einer neuen Schule und Klasse, sondern noch dazu in einer ihm völlig unbekannten Umgebung wieder. Der Neubau, in dem Wolfgang eine Wohnung ergattert hatte und der als Errungenschaft des Sozialismus gefeiert wurde, stand am nördlichen Stadtrand von Leipzig, in Möckern. Davor, Richtung Zentrum, gab es gewachsene Viertel mit Häusern, die wie in Lindenau, wo die Leipolds bisher gelebt hatten, um die Jahrhundertwende erbaut worden waren. Damals hatte man sich noch Zeit für individuelle Gestaltung genommen. Jedes Haus sah anders aus und besaß auch jetzt noch Reste von Schmuckelementen an den Eingängen, zwischen den Etagen und an den Fenstern. Ganz anders der in Plattenbauweise hochgezogene Neubau, wo die kleine Familie im zehnten von insgesamt zwölf Stockwerken ihre Wohnung bezog. Hinter dem Hochhaus erstreckten sich Felder, die für eine spätere Bebauung vorgesehen waren und durch die eine von Weiden gesäumte Allee führte.
Das war aber auch das Einzige, was Marcus an seinem neuen Wohnort gefiel. Anfangs hatte ihm noch das Fahrstuhlfahren Spaß gemacht, doch schon bald seinen Reiz verloren. In dem Hochhaus wohnten kaum Kinder, weil die Wohnungen für Familien eigentlich zu klein waren, sodass ihm Spielkameraden fehlten. Die neue Schule war so weit weg, dass er nicht allein hingelangen konnte. Morgens brachte ihn sein Vater, mittags holte ihn seine Mutter ab, die mittlerweile in der unweit des Neubaublocks errichteten Kaufhalle arbeitete. Je nachdem wie ihre Kassenstunden lagen, war er viele Nachmittage allein. Früher war er da zu seiner Großmutter und Tante gegangen, die ihm bei seinen Hausaufgaben geholfen hatten. Jetzt hockte er stundenlang ohne Gesellschaft in der Wohnung, kaute auf seinem Stift herum, hatte oft Tränen in den Augen und trauerte den Jahren nach, in denen noch jemand Zeit für ihn gehabt hatte. Außerdem vermisste er sein eigenes Zimmer, das, so klein es auch gewesen war, immer noch Platz für ein Bett, einen Schrank und einen Tisch bot sowie als Rückzugsort gereicht hatte. Jetzt schlief er im Zimmer seiner Eltern und erledigte seine Hausaufgaben im Wohnzimmer oder am Küchentisch. Dass die neue Wohnung fließendes warmes Wasser, ein wenn auch kleines Bad und eine eingebaute Küche mit Elektroherd hatte, interessierte den Jungen wenig. Er vermisste seine Spielecke und die Großeltern nebst seiner Tante, die ihm Märchen vorgelesen oder Geschichten erzählt hatten.





























