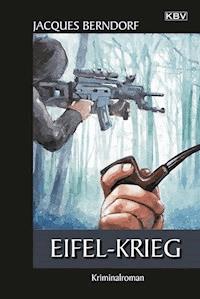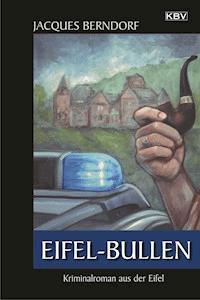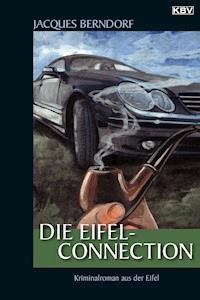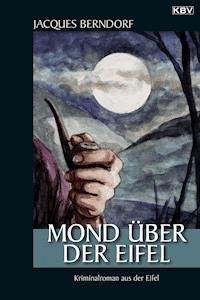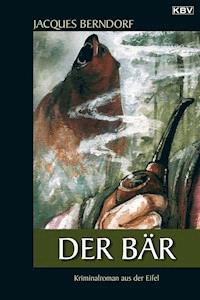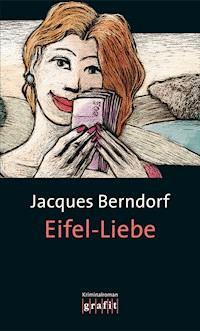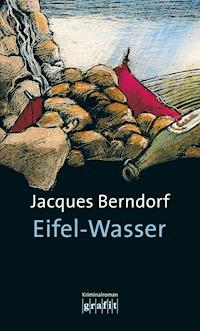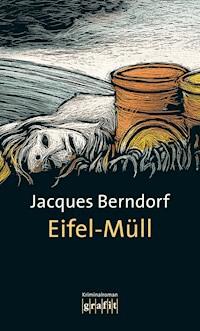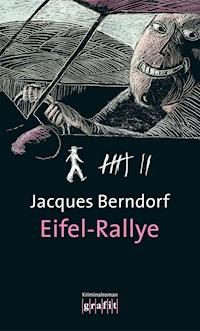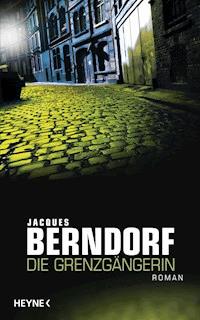
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Eine Frau, eintausend Kilo Sprengstoff, ein Ziel: Deutschland
Der deutsche Topagent Karl Müller geht bei einem Auftrag in Tripolis verloren. Prompt will ihm der BND fristlos kündigen – gegen den Widerstand seines Chefs Krause, der daraufhin selbst den Dienst quittiert. Die Situation im BND ist heillos verfahren, da trifft die Nachricht ein, dass eine Frau in Tschechien tausend Kilogramm Sprengstoff gekauft hat und damit auf dem Weg nach Deutschland ist. Wer ist sie? Was will sie? Und vor allem: Wer soll sie jetzt noch aufhalten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Ähnliche
Jacques Berndorf
DIE GRENZGÄNGERIN
Jacques Berndorf
DIE GRENZGÄNGERIN
Roman
Zitat S. 7 aus Pierre Boileau / Thomas Narcejac, Die Karten liegen falsch, Reinbek bei Hamburg 1965, übersetzt von Justus Franz Wittkop, mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt-VerlagsVorbemerkungDies ist ein Roman. Die nachfolgenden Schilderungen erheben keinen Faktizitätsanspruch. Sie behandeln trotz gelegentlicher Nennung vermeintlich realer Namen typisierte Personen, die es so oder so ähnlich geben könnte. Diese Urbilder werden durch künstlerische Ausgestaltung des Stoffs und dessen Ein- und Unterordnung in den Gesamtorganismus Teil eines Kunstwerks und gegenüber den im Text beschriebenen Abbildern so stark verselbstständigt, dass das Individuelle, Persönlich-Intime zugunsten des Allgemeinen, Zeichenhaften der Figuren objektiviert ist.Für die Leser erkennbar erschöpft sich der Text nicht in einer reportagehaften Schilderung von realen Personen und Ereignissen, sondern besitzt eine zweite Ebene hinter der realistischen Ebene.Es findet ein Spiel des Autors mit der Verschränkung von Wahrheit und Fiktion statt, das bewusst Grenzen verschwimmen lässt.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2012 by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.Umschlaggestaltung: Eisele Grafik · Design, München, unter Verwendung eines Fotos von Topaz/F1onlineSatz: C. Schaber Datentechnik, Wels
ISBN 978-3-641-05690-2V004
www.penguin.de
Für meine Frau Geli.
Für meine Nachbarin Uschi Müller, für ihren Mut und ihre Energie.
In Dankbarkeit für meinen Freund Dr. Matthias Nitzsche, der mir die Möglichkeit einer ziemlich komplexen Sicht auf ein Frauenleben ermöglichte. Sollte ich trotzdem Fehler gemacht haben, so fallen sie auf mich zurück.
Dank auch an Robert Honnacker und seine Frau im fernen Thüringen, von denen ich lernte, was deutsche Polizisten im Programm haben müssen, wenn sie säumige Steuerzahler auf diesem Erdball verfolgen.
»Ich denke oft über diese Tragödien nach. Sie haben etwas … Wie soll ich sagen? Etwas Tückisches, Verfängliches und Unerklärliches. Sie sind der schlammige und blutige Abfall beim Kampf im Untergrund. Ich habe Erfolge erzielen können. Ich habe sie vergessen. Dagegen verfolgt mich die Erinnerung an diese absurden Toten.«
Aus: PIERRE BOILEAU / THOMAS NARCEJAC,Die Karten liegen falsch
ERSTES KAPITEL
Karl Müllers Stimme kam keuchend mit einem Rauschen im Hintergrund und war kaum zu verstehen.
»Ich habe noch immer keinen Kontakt zu Quelle Sechs.«
»Er hat sich auch hier nicht gemeldet«, erwiderte Sowinski. »Tut mir leid, Junge. Wir nehmen an, er ist tot, in irgendeinem Gefecht erschossen oder schlicht von den Rebellen massakriert. Vielleicht sogar von den eigenen Leuten, weiß der Teufel. Soll ich dich zurückholen, hast du die Nase voll?«
Immer wenn er einen Agenten direkt steuerte, war es unvermeidlich, dass er ihn duzte. In einer Konferenz war er deswegen einmal scharf angegriffen worden, hatte den Vorwurf fehlender Distanz zu Untergebenen aber wütend zurückgewiesen. »Sie sind einsam da draußen. Ich bin in einer solchen Situation schließlich so was wie ihr Vater, verdammt noch mal!«
Müller war seit vierundzwanzig Stunden in der Stadt, er antwortete gelassen: »Dafür ist es zu früh, ich will noch nicht aufgeben. Heute Morgen hatte ich so was wie eine Erscheinung, ich habe gedacht, mich laust der Affe. Ich habe Atze gesehen.«
»Wie bitte? Wo denn?«
»In meinem Hotel, hier in Tripolis. Er hatte allerdings keine Haare mehr, stattdessen eine spiegelglatte sonnengebräunte Birne. Aber kein Zweifel: Er war es! Und er hatte eine junge Frau bei sich. Schön, schlank und ein bisschen wie aus der Retorte, mindestens zwanzig Jahre jünger als er.«
»Hat er dich erkannt?«
»Nein, ich glaube nicht. Er wirkte irgendwie abgehetzt und nicht sehr konzentriert. Er wird den Libyern in diesen Tagen die ganze Welt verkaufen, von Toilettenpapier bis zu Kühlschränken. Aber in erster Linie den ganzen Krankenhauskram, und natürlich Computer, vor allem billige und gebrauchte. Im Chaos läuft er immer zu Hochform auf.«
»Wo genau bist du jetzt?«
»In Gaddafis heiligem Bezirk, auf dem Gelände seines Palastes. Da gibt es eine Reihe von Garagen. Keine Autos mehr drin, aber Leichen, jede Menge Leichen …«
Müllers Stimme versagte, und Sowinski wartete geduldig.
»Sorry«, sagte Müller schließlich, jetzt war er besser zu verstehen. »Aber in den Garagen ist er auch nicht. Gaddafis Leute haben jeden Rebellen oder alle, die sie für Rebellen hielten, einfach sicherheitshalber ohne Anhörung erschossen und weggeräumt. Quelle Sechs kann überall sein. Ist er jemand, der sich den Rebellen anschließen würde?«
»Sein Psychogramm gibt das eigentlich nicht her. Er war schon immer Teil der Machtstruktur. Wir haben uns auch gewundert, dass er sich nicht meldet, obwohl seit Urzeiten festgelegt ist, dass er bei jeder persönlichen und politischen Umstellung eine Eilmeldung absetzt. Quelle Sechs ist ein Familientier, seine erste Sorge gilt immer dem Clan. Wie ist die Lage?«
»Sie sagen, die Rebellen wollen jetzt Sirte ausräuchern, weil der große Sohn der Nation da geboren ist. Gaddafi wird dort von ihnen vermutet. Wir wissen mit Sicherheit, dass er da ist. Ich sehe häufig Kampfjets, sie greifen hier an, aber sie kommen auch vom Mittelmeer rein und stoßen auf Sirte, auf die Raffinerien und Öllager runter. Das sagen die Quellen hier, aber keine ist wirklich gut. Sirte wird die nächste Schweinerei werden, denn die Regulären, die noch bei Gaddafi ausharren, haben nichts zu verlieren, und sie glauben fest daran, dass sie ehrenhaft sterben. Habe ich endlich die Erlaubnis, die private Villa von Nummer Sechs anzulaufen?«
»Hast du. Wir sollten jetzt Schluss machen«, entschied Sowinski. »Diese Handys sind nach zwei Minuten zu orten. Scheißtechnik. Ich melde mich gegen Abend wieder. Oder, besser noch: Du rufst mich, wenn es bei dir acht Uhr ist. Nur über Festnetz. Und geh keine Risiken ein.«
»Haha«, sagte Müller höhnisch. »Sie Scherzbold!« Dann kappte er die Verbindung.
In etwa zweihundert Metern Entfernung sah er so etwas wie einen großen grünen Fleck, eine Oase, die in der Hitze flirrte. Niedrige grüne Bäume oder Büsche. Das war genau das, was er brauchte: auf dem Rasen liegen und Erde riechen.
Er hatte in der letzten Garage sechs Tote im Zustand fortgeschrittener Verwesung vorgefunden. Als er eine der Leichen umgedreht hatte, um ihr Gesicht sehen zu können, sorgten die entweichenden Fäulnisgase dafür, dass er sich auf der Stelle übergeben musste.
»Ich stinke wie ein Schwein«, sagte er laut und machte sich auf den Weg.
Das Grün war eine Illusion, das mickrige Gras unter den Büschen voller Glasscherben und Holzsplitter. Jemand hatte sehr viele alte, blutige Verbände liegen lassen. Das Blut war braun. Da lag eine menschliche Hand, abgerissen im Gelenk. Hier ein riesiger beigefarbener Ledersessel, neu, durchaus elegant und mit Sicherheit teuer, vollkommen in Streifen aufgeschlitzt, als habe man Gaddafi verdächtigt, ein paar Dollarscheine in dem Möbel versteckt zu haben.
Verblüfft stellte er fest, dass er plötzlich Hunger und Sehnsucht nach einer Tasse Kaffee hatte, aber er konnte unmöglich in diesen verdreckten und stinkenden Kleidern in sein Hotel in der Innenstadt zurück. Er konnte sich so nicht einmal in ein Taxi setzen. Es war schon absurd: Hier hockte er in Gaddafis Palast in Tripolis auf einem miesen Stück besudelten Rasens und machte sich Gedanken über sein Outfit. Dann begann er leise zu lachen, weil er sich vorstellte, wie er in diesem Palast etwas zum Anziehen auftrieb. Am besten eine dieser größenwahnsinnigen Uniformen, die Gaddafi für sich hatte erfinden lassen.
Karl Müller, designed by Gaddafi.
Langsam machte er sich auf den Weg, um eine Straße mit viel Verkehr zu suchen. Er musste unbedingt einen Laden finden, in dem er ein paar einfache Klamotten kaufen konnte.
Er sah eine kleine Gruppe von Männern mit Kalaschnikows schnell auf ein Gebäude zugehen. Er hoffte, dass sie ihn nicht bemerkt hatten, aber die Hoffnung zerstob in Sekunden.
Eine schmale Gestalt löste sich aus der Gruppe und kam auf ihn zu. In schnellem Lauf nahm der Junge die Kalaschnikow erst quer vor den Bauch, dann seitlich und schrie auf ihn ein: »Stehen bleiben! Bleib gefälligst stehen!«
»Immer mit der Ruhe«, sagte Müller laut auf Arabisch. »Ich bin ein Freund, Mann. Beruhige dich.«
»Was willst du hier?«, fragte der Junge. Er war vielleicht sechzehn Jahre alt. Seine Stimme war zittrig und klang leicht hysterisch. »Hast du etwa den großen Schweinehund gestützt?«
»Ich schaue mich hier nur um, ich bin neugierig, ich war noch nie hier«, sagte Müller. Dann nahm er die Plastikkarte, die vor seinem Bauch baumelte, und hielt sie dem Jungen hin. »Du kannst nachsehen, alles okay.«
Der Junge schaute auf die Plastikkarte und sagte: »Überall die gleiche Scheiße. Jeder hat so eine Karte. Was soll das? Woher hast du diesen Ausweis?«
Müller sah ihn mit festem Blick an: »Deine Leute haben mir den Ausweis gegeben. Ich bin nicht dein Feind.«
»Wer mein Feind ist, bestimme ich«, bellte der Junge zornig. Aber seine Wut war gebrochen, er konnte Müller schon nicht mehr in die Augen schauen und wandte sich ab, weil er im Grunde hilflos war. Dann setzte er sich in Trab, um seine Gruppe wieder einzuholen.
Müller atmete ein paarmal tief durch. Man konnte in dieser Stadt sehr schnell sterben, einfach so, ganz ohne Grund.
Er war unter einer der ständigen Legenden unterwegs, die für solche Zwecke gedacht waren: Dr. Kai Dieckmann, Sicherheitsberater der Bundesrepublik Deutschland. Das stand auch auf dem Plastikschildchen, das er an einem langen schmalen Baumwollband um den Hals trug, gestempelt von der vorläufigen Verwaltung der Rebellen. Er hatte eine ausreichende Menge an US-Dollar in seinem Gürtel und trug im Rückenfach seiner beigefarbenen Anglerweste aus Sicherheitsgründen einen 38er Colt Special, obwohl er diese Waffe nicht mochte: Sie war zu klein, und es war nicht einfach, damit sicher zu treffen.
Er ging im Palastbereich von Gaddafi über schier endlose schmale Asphaltpisten, vorbei an kleinen und großen Gebäuden, Ummantelungen von Klimaanlagen und offen stehenden Einstiegen in das Bunkersystem des Palastes bis zu einem großen schmiedeeisernen Tor, das entweder durch Beschuss oder aber von einem aufgebrachten Mob aus den Angeln gerissen worden war. Dann stand er auf einem Gehsteig, vor sich eine Straße, auf der dichter Verkehr brauste. Er hielt einfach den rechten Daumen nach oben.
Beinahe augenblicklich stoppte ein Taxi, der Fahrer öffnete die Tür und sagte irgendetwas Unverständliches, wahrscheinlich in irgendeinem Dialekt dieser Stadt.
Müller beugte sich zu ihm hinunter und erklärte auf Arabisch, er sei dreckig und stinke nach Tod, und der Mann möge das nicht übel nehmen. Ob er ihm wohl neue, einfache Kleidung besorgen könne. Der sehr junge Fahrer nahm die angebotene Hundertdollarscheine und antwortete mit steinernem Gesicht, er würde das gerne tun und ob Müller so freundlich sein wolle, hier zu warten.
Mit Sicherheit würde er unterwegs anhalten und die Banknote einer genauen Betrachtung unterziehen. Echt oder nicht echt?
»And I need underwear!«, erklärte Müller mit erhobenem Zeigefinger.
Der junge Mann nickte lächelnd: »Okay, okay!«, und gab Gas.
Müller setzte sich auf einen großen, gelben Sandstein, der auf dem Gehsteig neben dem zerstörten Tor lag, und zündete sich eine Zigarette an. Normalerweise rauchte er nicht, aber Männer, die rauchten, signalisierten überall auf der Welt eine gewisse Sorglosigkeit. Nur deshalb trug er immer ein Päckchen in seiner Weste bei sich.
Erfahrungsgemäß war das Risiko, von dem jungen Taxifahrer betrogen zu werden, nahe null, richtige Kerle helfen einander. Und wo hundert US-Dollar riskiert wurden, um an lächerliche Billigkleidung zu gelangen, würde noch mehr zu holen sein.
Müller sah eindeutig europäisch aus wie all die unzähligen Journalisten, die auftragsgemäß zu beobachten hatten, wie Gaddafis Reich zerfiel. Er sah so aus wie all die Menschen ohne Namen, die im Laufe der Rebellion in diese Stadt gekommen waren und jetzt vom frühen Morgen bis spät in die Nacht irgendwelchen dunklen Aufträgen nachgingen, von denen sie so wenig wie möglich preisgaben. Irgendwann würden sie wieder verschwinden, und mit wenigen Ausnahmen würde sich kein Mensch an sie erinnern. Krise und Bürgerkrieg waren ihr Job.
Müller hatte einige CIA-Leute erkannt, ein paar Frauen und Männer des chinesischen Geheimdienstes, Männer des englischen MI6, Frauen und Männer des Geheimdienstes der Franzosen. Und zu seiner Erheiterung auch reichlich Personal des israelischen Mossad, das hastig irgendwelche Aufgaben hinter sich brachte, um bereits nach wenigen Stunden wieder ausgetauscht zu werden. Blitzschnell und ohne Spuren zu hinterlassen.
Einer von ihnen, ein schmaler Vierzigjähriger, war beim Frühstück hinter seinem Rücken vorbeigestrichen und hatte ihm leicht eine Hand auf die Schulter gelegt. »Mach deine Sache gut, Bruder!«, hatte er geflüstert.
»Wie immer«, hatte Müller geantwortet, und sie hatten beide gegrinst.
Müllers Haar war schütter, sandfarben, dünn, wahrscheinlich würde er spätestens mit fünfzig eine Glatze haben, jetzt war er vierundvierzig. Sein Gesicht war rundlich mit hellen grauen Augen und einem schmalen Mund. Er war knapp eins achtzig groß, schlank, körperlich in Höchstform, und er wirkte ungemein freundlich, wie alle Männer, die ein Kind liebevoll anschauen können. Müller hatte selbst ein Kind, und er wusste nicht, wie das Kind dachte und fühlte. Das machte ihn unsicher, manchmal muffig und wortlos. Er war nicht fähig, darüber zu reden, und gelegentlich kam es vor, dass er seinen Beruf dafür verantwortlich machte. Gleichzeitig wusste er, dass es ganz so einfach nicht war. Es war wohl so, dass er einen Fehler gemacht hatte, als er heiratete und Vater wurde. Für Agenten war ein bürgerliches Leben nicht geeignet. In ihrer Welt gab es einfach keinen Raum für herkömmliche Lebensweisen. Seine Tochter war jetzt zehn, und es bedrückte ihn, dass er so gut wie nichts von ihr wusste, nichts von ihrem Leben, nichts von ihren Wünschen, nichts von ihren Träumen. Er nannte ihre Mutter nur »meine Ex«, und auch von deren Leben wusste er sehr wenig. Selbst die Tatsache, dass er brav für dieses Kind bezahlte, machte die Sache nicht besser.
Er hatte viele Jahre in dem steten Bemühen verbracht, ungeheuer durchschnittlich und langweilig zu wirken, und die meisten Menschen, denen er begegnete, vergaßen ihn auch sofort wieder. Er war nichts als ein freundlicher, farbloser Mann.
Das Libyen dieser atemlosen Tage war ein Land der steinernen Gesichter, und noch herrschte Krieg. Niemand hier wusste, was morgen sein würde. Falls eine Stadt für Müller genau richtig war, so war es diese hier – Tripolis.
Der Taxifahrer kam nach einer guten halben Stunde zurück. Er rumpelte der Einfachheit halber mit seinem alten Toyota gleich auf den Gehsteig. Als er Müller drei sandfarbene Leinenhosen, drei T-Shirts in Militärgrün und zwei Garnituren Unterwäsche durch das heruntergekurbelte Fenster reichte, sagte er: »You can do it in my car!«
»Nein, nein, lass mal«, winkte Müller ab, »ich stinke wie der Teufel.« Er verschwand lieber hinter dem Tor und zog sich dort rasch um. Die Hosen waren etwas zu lang, er krempelte sie hoch. Die verdreckte und stinkende Kleidung ließ er einfach liegen. Nur die Weste nahm er mit. Sie war das Kleidungsstück, auf das er nicht verzichten konnte. Darin steckten drei sehr spezielle Handys, ein Satz Papiere, etwas Kleingeld, eingenäht für den Krisenfall zehntausend amerikanische Dollar, eine zweite klobige Brille, die seine Nacht zum grünen Tag machen konnte. Darüber hinaus ein paar chemische Hilfen wie ein starkes Schmerzmittel und ein höllisch aufputschendes Speed, vor dem er sich geradezu fürchtete – und natürlich die Zigaretten.
Schließlich setzte er sich in das Taxi und bekam von dem Fahrer einen Fünfzigdollarschein gereicht. »Das ist das Wechselgeld«, sagte der Junge.
»Gehört dir«, sagte Müller und gab sein Fahrtziel an.
Vor dem Hotel fragte er den Fahrer, ob er bereit sei, ihn in zwei Stunden wieder abzuholen und ihm dann etwa zwei bis drei Stunden lang zur Verfügung zu stehen. Der Junge nickte und sagte, er werde da sein.
Müller durchquerte die Eingangshalle, benutzte nicht den Lift, sondern rannte die Treppen hoch zu seinem Zimmer im dritten Stock. Er zog sich aus und stellte sich unter die Dusche. Obwohl er sich mehrmals von Kopf bis Fuß eingeseift hatte, war er immer noch überzeugt, nach der Garage der Toten zu riechen, und er wusste, dass das einige Zeit so bleiben würde. Der Geruch der Vernichtung ließ sich nicht so einfach abwaschen.
Er legte sich auf das Bett und dachte an Svenja, überlegte, ob er sie anrufen sollte. Aber er wusste, dass ihm wieder einmal die richtigen Worte fehlen würden, und er ließ es sein.
Gillian kam über Lautsprecher: »Hier ist der Stellvertreter, der Neue von den Haushältern, Chef. Er will ein Informationsgespräch.« Gillian kicherte leise. »Sein Spitzname ist hohle Nuss.«
»Ich habe noch nie eine hohle Nuss empfangen«, murmelte Krause nicht sonderlich konzentriert.
»Dann ist das eine Premiere«, stellte Gillian fest und lachte. »Der Mann hat das seinen Initialen zu verdanken, er heißt Herbert Nieswandt. Er ist schon ein paar Monate hier, macht mächtig Dampf und findet alles Mögliche unmöglich. Er macht sich die ganze Zeit übel bemerkbar, er kritisiert sogar, dass ein paar Leute in den Pausen runter unter die Bäume gehen, um diskret eine Zigarette zu rauchen. Er wünscht sich eine Stunde bei Ihnen.«
»Sagen Sie ihm, das ist zu viel. Mehr als zwanzig Minuten sind nicht drin. Wann?«
»Am besten jetzt. Dann haben Sie es hinter sich. Und anschließend Müller in Tripolis?«
»Also jetzt«, seufzte Krause. »Und anschließend Müller.«
Der Mann, der in sein Büro kam, war klein, hager und drahtig. Es war exakt der Typ, den Krause durchaus verächtlich Erbsenzähler nannte.
Man konnte sich vorstellen, dass der Mann morgens gegen fünf Uhr aufstand, sich in einen hässlichen, aber teuren Trainingsanzug warf, um dann fünf Kilometer zu rennen. Anschließend würde er duschen, danach eine Scheibe Vollkornknäckebrot mit einem halben Glas Milch zu sich nehmen und peinlich genau darauf achten, jeden Bissen sehr lange und gründlich zu kauen, sodass ein gesunder Speichelfluss gesichert wurde, der wiederum den gesamten Tag beeinflussen konnte.
Zwanghaft, dachte Krause. Vorsicht, zwanghaft!
»Mein Name ist Herbert Nieswandt«, erklärte der Mann leise. »Wir sind uns vor Wochen kurz begegnet, als ich hier eingeführt wurde.«
»Das ist schön«, dröhnte Krause. »Machen wir es uns doch bequem. Gillian, wir möchten bitte einen Kaffee. Und? Zufrieden hier mit uns?«
»Ja, doch, im Großen und Ganzen schon.«
»Gut«, sagte Krause. »Was kann ich denn für Sie tun?«
»Ich hätte da ein paar Fragen, Herr Doktor«, sagte der Mann, den man hohle Nuss nannte. »Da ist ein Problemfeld, das ich nicht verstehe.«
»Fragen Sie«, ermunterte ihn Krause. »Fragen sind das Salz des Lebens. Problemfelder wohl auch.«
Sie setzten sich in die Sitzgruppe aus schwarzem Leder, und Gillian brachte ihnen den Kaffee. Sie warteten, bis sie gegangen war, dann sagte Krause: »Also, mein Lieber. Tun Sie sich keinen Zwang an.«
»Wir haben da Agenteneinsätze, also das, was wir haushälterisch als AiE bezeichnen. Und Sie sind Chef der Operationen, Sie machen die Planungen, Sie legen die Dauer und die Wege fest.« Er machte eine kurze Pause und lächelte leicht. »Wenn ich das alles richtig sehe. Sie treffen die Entscheidung, Sie bestimmen, wie das läuft. Dabei entstehen hohe Kosten, außerordentlich hohe Kosten, wie ich meine. Könnte man diese Einsätze nicht stark verringern?«
»Das könnte man nicht«, sagte Krause und dachte resigniert: Schon wieder einer, der das Rad neu erfindet! »Anders gefragt: Wie sollen wir Ihrer Meinung nach die hohen Kosten denn vermeiden?«
»Wir haben Residenten des BND an den Botschaften. Einheimische, die uns über die aktuelle politische Lage informieren. Die könnten doch vieles vor Ort erledigen? Dadurch wären fast fünfzig Prozent der Kosten dieser Einsätze vermeidbar. Übers Jahr gesehen geht es dabei um viele Hunderttausende.«
»Sie bewegen sich jetzt auf dünnem Eis«, sagte Krause gefährlich leise und starrte auf seine Schuhe. Dieser Vorschlag kam mit jedem neuen Erbsenzähler erneut auf den Tisch. Es war weniger ein konstruktiver Vorschlag als ein lächerliches Mantra.
»Ich will es nur verstehen«, sagte der Mann sanft wie ein Lamm.
»Agenten sind absolute Spezialisten«, erklärte Krause geduldig. »Sie sind für Einsätze im Ausland ausgebildet. Sie sprechen mehrere Sprachen, ihr Wissen ist breit gefächert, sie sind in körperlicher Höchstform, und sie stehen extreme Situationen durch. Es sind Situationen, in die Sie und ich niemals geraten dürften, weil wir sie nicht überleben würden. Und sie sind geschult auf die besonderen Umstände, die jeder Informant bedeutet. Kein Resident kann Agenten ersetzen, die Leute in der Botschaft schon gar nicht. Sie haben andere Dinge zu erledigen, zum Beispiel wichtige Beurteilungen ihres Gastlandes zu liefern, die wiederum von den Agenten gebraucht werden. Ich erwähne das nur, weil Sie nicht zu wissen scheinen, über was Sie eigentlich mit mir reden wollen.« Dann wedelte er kurz mit beiden Händen. »Diese Agenten, mein Lieber, von denen Sie nichts zu wissen scheinen, halten im Dienst dieses deutschen Gemeinwesens ihren Arsch hin, um es mal poetisch auszudrücken.«
»Ich will lediglich mit Ihnen gemeinsam Geld sparen«, bemerkte Herbert Nieswandt. Seine dunklen Augen wirkten völlig leblos, wie Steine.
»Weiß Ihr Vorgesetzter, dass Sie mich in dieser Sache kontaktieren?«, fragte Krause scharf.
»Nein. Aber das muss er auch nicht.«
»Das muss er sehr wohl«, sagte Krause wütend. »Tut mir leid, aber für derartige Diskussionen sehe ich keinerlei Anlass.« Krause stand auf und setzte hinzu: »Ich nehme zu Ihren Gunsten an, dass Sie einfach mal auf den Busch klopfen wollten. Ausgerechnet auf einem Sektor, von dem Sie offensichtlich keine Ahnung haben. Das ist leider fehlgeschlagen.«
»Da ist noch etwas«, sagte Nieswandt leise und ohne erkennbare Regung. Er saß jetzt weit zurückgelehnt und hatte den Kopf ein wenig eingezogen, als würde er einen Angriff befürchten. »Es gibt da in den Einzelabrechnungen wiederholt einen Posten unter der Bezeichnung AX (d). Da sind einmal vierzigtausend Euro eingesetzt, dann dreimal sechzigtausend Euro, dann einmal hunderttausend, also insgesamt dreihundertzwanzigtausend Euro binnen drei Jahren. Und das in bar! Ich nehme an, dass es sich bei der Bezeichnung um einen Mann namens Arthur Schlauf handelt, der als international agierender Kaufmann bekannt ist, ohne eine feste Adresse. Er wird von einigen deutschen Finanzämtern wegen Steuerhinterziehung gesucht. Er ist des Weiteren unter der Bezeichnung ›großer Leichenfledderer‹ bekannt, weil er nach Katastrophen, Krisen und Kriegen in den jeweiligen Ländern auftaucht, um sämtlichen nur erdenkbaren Schund zu verkaufen, von Aspirin bis hin zu Lokusbürsten. Er hat eine, gelinde ausgedrückt, streng riechende und unangenehme Nähe zu unserer Regierung und der Kanzlerin und …«
»Stopp!« Krause war schnell aufgestanden und hatte beide Hände ausgebreitet, als würde er bedroht. Aber er sprach plötzlich sehr sanft. »Bevor Sie anfangen, über Dinge zu sprechen, von denen Sie absolut keine Ahnung haben können, sage ich Ihnen, dass ich den von Ihnen angesprochenen Mann nicht kenne, nicht einmal eine Ahnung von seiner Existenz habe. Tun Sie sich jetzt den Gefallen und verschwinden Sie ganz schnell aus meinem Büro.« Er zeigte mit einem kurzen, dicken Zeigefinger auf die Tür seines Büros. »Raus hier!«
Nieswandt erhob sich und verließ mit steinernem Gesicht den Raum.
Krause drückte eine Taste: »Gillian, ich brauche Esser und Sowinski. Jetzt.«
Sie kamen nach zwei Minuten, und sie sahen aus wie Männer, die hier zu Hause waren, was der Realität genau entsprach. Sie trugen beide einfache karierte Hemden und darüber ausgebeulte, offensichtlich uralte Strickwesten. Der eine in Blau, der andere in Grün.
Der eine war einundsechzig Jahre alt, der andere vierundfünfzig.
Esser sagte noch in der Tür erwartungsvoll: »Ich vermute, sie haben Gaddafi.«
»Irrtum. Ich verlasse vorübergehend dieses Haus«, bemerkte ihr Chef leise. Sein Gesicht wirkte auf einmal hager, obwohl er ein fetter kleiner Mann war.
Es kam keine Gegenfrage. Sie setzten sich.
»Wir haben einen neuen Haushälter hier, der mich gefragt hat, ob einige Zahlungen unter einem bestimmten Code unseren Freund Atze betreffen. Ich denke, das wirkt zunächst wie ein blödsinniger Angriff auf meine Integrität. Aber es ist wohl ein Generalangriff auf diese Abteilung hier, wenn nicht noch viel mehr. Das ist sehr hinterhältig, wie ich betonen möchte, durchaus eine Schweinerei. Aber trotzdem sollten wir ganz schnell untersuchen, wie ausgerechnet ein neuer Haushälter auf diesen Namen kommen kann und den auch noch aus den rechnerischen Belegen als Kürzel kennt. Ich benachrichtige den Präsidenten schriftlich, dann gehe ich heim.«
»Du hast gerade sechs Agenten draußen, wie soll das denn gehen?«, fragte Sowinski. Es klang nicht anklagend, sondern war eine ganz sachliche Frage. Schließlich war es eine oft bewiesene Tatsache: Allein Krauses Stimme in einem kurzen Telefonat konnte Agenten im Einsatz wieder ruhiger atmen lassen.
»Das müsst ihr übernehmen, was sonst?« Unvermittelt setzte er laut hinzu: »Gillian, wir möchten drei große Cognac. Und Puddingteilchen.«
»Müller hat Atze in Tripolis gesehen«, sagte Sowinski. »Heute, im Hotel.«
»Wie kann dieser idiotische Mensch überhaupt auf Arthur Schlauf kommen? Wer könnte da irgendetwas gesagt haben? Wir haben bar bezahlt, oder? Ist Schlauf jemals mit Klarnamen vorgekommen?« Krause hielt die Augen halb geschlossen, er schien am Ende seiner Weisheit.
»Niemals«, sagte Esser, »niemals hat irgendeiner in dieser Etage den Namen erwähnt. Und Goldhändchen, unser Computergenie, sicherlich auch nicht. Also wer, verdammt noch mal?« Dann lächelte er unvermittelt und fragte erheitert: »Du hast diese Euroerbse beleidigt, nicht wahr?«
»Ein bisschen«, gab Krause trocken zu. »Wo kommt der eigentlich her?«
»Das können wir herausfinden«, sagte Esser. »Vielleicht ist er ein Trojaner, vielleicht ist er jemand, der irgendeinen anderen im Haus beerben möchte? Vielleicht einer, der den Weg irgendeines anderen vorbereitet? Hat er sich so benommen?«
»Er setzte sich da auf den Sessel, wirkte klein und unscheinbar und forderte mich auf, mit ihm zusammen zu sparen, in meinem Budget. Und dann kam plötzlich die Erwähnung Atzes. Wer hat Atze eigentlich abgeschöpft und bezahlt?«
Die beiden Männer wussten, dass Krause hochgradig erregt und wütend war, aber er zeigte es nicht, weder durch die Stimmlage noch durch seine Mimik.
»Es war immer Müller«, antwortete Sowinski schnell. »Die beiden kommen gut miteinander aus. Atze ist ein gerissener Hund, und Müller manchmal auch.«
»Und wo wurde er bezahlt?«
»Niemals im Inland«, sagte Sowinski. »Immer draußen. Meistens Asien, einmal Washington. Und immer in Dollar. In Deutschland ist er nur vorübergehend mal aufgetaucht, wenn er seinen alten Vater besucht hat. Aber wir haben ihn hier niemals kontaktiert und auch niemals mit ihm gesprochen.«
Gillian kam mit dem Cognac und den Puddingteilchen und stellte alles vor ihnen ab, dann verschwand sie wieder.
Sie tranken einen Schluck.
Krause nahm ein Puddingteilchen und biss hinein. Dann erklärte er mit vollem Mund: »Das stelle man sich einmal vor: Er hat von einer unangenehmen, streng riechenden Nähe Atzes zu unserer Regierung und der Bundeskanzlerin gesprochen. Wie lange ist das eigentlich her?«
»Die Beleidigung?«, fragte Esser. »Da war sie gerade gewählt. Also nur ein paar Jahre. Kann es nicht sein, dass diese Geschichte von irgendjemandem im Kanzleramt gesteuert wird? Haben wir da einen Intimfeind?«
»Todsicher sogar. Das ist jetzt aber scheißegal«, stellte Sowinski resolut fest. »Was machen wir? Du gibst dem Präsidenten Nachricht und gehst heim. Was machen wir mit Atze? Lassen wir ihn sterben?«
»Niemals«, reagierte Esser schnell. »Der Mann ist viel zu gut, als dass man ihn sterben lassen könnte. Sollten wir Goldhändchen nicht überreden, sich mal in ein paar Rechner zu hacken?«
Krause nickte bedächtig. »Goldhändchen soll sofort damit beginnen, und er soll niemanden ausnehmen, nicht einmal das Kanzleramt. Gleichgültig, woher es kommt: Wir gehen auf dieses Problem nicht ein, wir reagieren mit Hochmut und satter Arroganz. Wir blinzeln nicht einmal, wenn jemand uns darauf anspricht. Und wenn ihr hausintern gefragt werdet, wer diese hohle Nuss ist, dann sagt einfach, ihr kennt ihn nicht und habt auch keine Lust, ihn kennenzulernen. Und ich werde Müller sagen, er soll mit Atze in Tripolis reden, nur auf den Busch klopfen. Atze muss gewarnt werden. Sonst noch was?«
»Dann muss ich dich in deinem trauten Heim technisch aufrüsten«, sagte Sowinski. »Drei, vier Handys, direkte Funkstrecke, offene Leitung, automatische Überwachung aller Geräte, Laserabschirmung aller Außenwände deiner Luxusvilla und so weiter und so fort. Da kannst du endlich einmal erleben, was alles nötig ist, damit du so arbeiten kannst, wie du es gewohnt bist. Es steckt nämlich eine Menge Technik dahinter, wenn der Krause meint, er drückt nur mal eben auf den Knopf und wartet, was passiert. Dann wirst du endlich mal begreifen, dass die Zeit von Telex und Telegramm vorbei ist, mein Alter. Und du musst deine Frau unbedingt vor dem anstehenden Chaos warnen.«
Krause verzog keine Miene. Er fragte: »Wo ist Svenja?«
»Wieder hier«, antwortete Esser. »Aus Syrien zurück. Ich mache mir Sorgen um sie. Wir haben täglich ein Zeitfenster von nur vier Minuten gehabt, und ich habe gemerkt, dass das viel zu wenig war. Sie wirkt abgehetzt, ist total geschafft. Aber sie ist hier in Berlin mit guten Ergebnissen von den Quellen Drei und Neun in Damaskus. Sie schreibt jetzt gerade zu Hause an den Memos. Sie kann sowieso noch nicht schlafen.«
»Und was sagen die Memos?«, fragte Krause.
Esser antwortete: »Assad hat keine Chance, er bekommt keine Ruhe mehr, und irgendwann wird er zu verschwinden versuchen, weil das Feuer unter seinem syrischen Arsch zu heiß wird. Und er hat nicht erkannte Widersacher im eigenen Haus. Zwei aus dem Sippenzirkus kennen wir jetzt, samt Psychogramm und Soziogramm.«
»Assad hat es schwer«, murmelte Esser. »Und er hat brutal reagiert. Er lässt auf Frauen und Kinder schießen, Soldaten laufen ihm weg, und er lässt auch sie unter Feuer nehmen. Die arabischen Brüder sind gegen ihn, er hat keinen Rückhalt mehr. Das ist seit Cäsar so: Wenn sie verlieren, verlieren sie auch jedes Maß.«
Sie schwiegen eine Weile.
»Hat Svenja einen Psychologen?«, fragte Krause.
»Hat sie. Er sagt, sie kommt gut voran, aber es wird dauern.« Sowinskis Stimme klang ungehalten. Es ärgerte ihn immer, wenn Agenten nach einem Einsatz therapeutische Hilfe brauchten. »Es wäre bestimmt ganz gut, wenn du dich um sie kümmern könntest. Vielleicht eine kurze Anhörung bei dir? Damit sie wieder besser klarkommt in dieser verdammten Welt.«
»War das ein XXL?«
»Du hast das so eingeschätzt. Sie hatte eine Waffe, aber sie brauchte sie nicht«, erklärte Esser. »Einmal war es heikel, weil jemand mit ihr schlafen wollte, aber sie hat den Mann bewusstlos geschlagen und konnte verschwinden.«
»Ist ihr Zustand als Burn-out eingestuft?«
»Nein«, sagte Sowinski. »Aber als ziemlich schwerer Erschöpfungszustand. Sie sagt, sie will sich nur noch die Decke über den Kopf ziehen.«
»Gut. Schick sie zu mir nach Hause, wenn Zeit dazu ist.«
»Dann sind wir ja beruhigt«, sagte Esser lächelnd. »Papa kümmert sich.«
»Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst«, bemerkte Krause mit starrer Miene.
»Das weißt du sehr wohl, also bitte keine Lügen«, sagte Sowinski bedächtig. »Auch nicht unter dem Aspekt, dass wir alle berufsmäßige Lügner sind.«
»Ich hab da nur so ein Gefühl«, meinte Krause vage.
Sie schwiegen wieder.
Müller und Svenja waren seit Jahren ein Liebespaar. Und sie waren an einem Punkt angelangt, an dem sie nicht mehr weiterwussten. Beide litten darunter und fühlten sich völlig hilflos.
Derartige Verbindungen im Dienst waren streng verboten. Aber es war passiert, und im Grunde waren sie drei besorgte Väter mit zwei Kindern, von denen sie nicht genau wussten, wie sie reagieren würden.
Esser sagte seufzend: »Sie müssen das allein schaffen, wir können da nichts tun.«
»Das ist wohl so«, antwortete Krause. »Dann schreibe ich jetzt dem Präsidenten, und ihr nehmt die gottverdammten Puddingteilchen mit. Ich werde zu fett.«
ZWEITES KAPITEL
Die Maschine aus München landete gegen Mittag in Berlin. Es goss in Strömen, und Thomas Dehner fühlte sich wie gerädert. Er kam aus der albanischen Hauptstadt Tirana, war total übermüdet und wollte unbedingt so schnell wie möglich in seine Wohnung und in sein Bett. Er wollte schlafen, tagelang nur schlafen.
Also rief er noch vom Flughafen aus Sowinski an. »Ich bin wieder hier und erbitte von meinen Vorgesetzten die Erlaubnis, sofort schlafen zu gehen, wenn Sie keine Einwände haben.«
»Ich habe nicht das Geringste dagegen. Gute Ergebnisse?«
»Ich weiß einiges, aber nicht alles. C4 ist für mich mittlerweile ein Albtraum. Das Zeug ist die Hölle, und Truud hat inzwischen eine Jahresproduktion von wahrscheinlich sechstausend Tonnen. Der Kerl ist ein richtig schmieriges Schätzchen. Immerhin kann ich Ihnen eine Frau anbieten, die rund zwanzig Zentner, also eintausend Kilogramm von dem Zeug gekauft hat. Gegen Bares. Und einer von Truuds Leuten sagte, sie wolle damit nach Deutschland.«
»Habe ich da Deutschland gehört?«
»Haben Sie.«
»Und was könnte man mit zwanzig Zentnern von dem Zeug in die Luft blasen?«
»Das Hotel Adlon nehme ich an, oder das Kanzleramt, den Stachus in München samt U-Bahn zum Beispiel, oder das Café Einstein mitsamt den Häusern rechts und links davon, oder irgendein Ministerium, das man nicht mag.«
»Eine Frau, bist du sicher?«
»Eine Frau«, bestätigte Dehner. »Komische Type, angeblich aus Schweden. Ich schreibe es auf. Ach ja, erschießen wollte sie mich auch.«
»Sieh mal einer an. Nichts Wichtiges getroffen, hoffe ich. Schlaf erst einmal aus!«, sagte Sowinski. »Bis morgen.«
Dehner kappte die Verbindung.
Er zog seine große Tasche in Richtung der Taxis, gab knapp seine Adresse an und kämpfte dann energisch gegen seine Müdigkeit, während der gut gelaunte Fahrer unermüdlich darüber schwafelte, dass es in Berlin mindestens zweitausend Taxis zu viel gebe und dass er von der Personenbeförderung nicht mehr leben könne und wahrscheinlich demnächst am Prenzlauer Berg auf irgendeinem dreckigen Gehsteig den Hut hinhalten müsse. Aber das sei vielleicht keine Katastrophe, denn seine Frau spiele hervorragend Akkordeon und er selbst sei nicht schlecht mit der Klarinette.
Als Dehner schließlich die Wohnungstür hinter sich zuzog und endlich allein war, ließ er sich einfach auf sein Bett fallen, zog eine Stunde später die Schuhe aus, zweieinhalb Stunden später seine Kleidung. Dann war er wach und fluchte vor sich hin. Das Fluchen steigerte sich, als er entdeckte, dass sich in seinem Kühlschrank nichts Essbares mehr befand.
Er rief Samy an und sagte: »Hilfe! Du musst herkommen und mir was zu essen bringen.«
»Bist du etwa zu Hause?«
»Bin ich. Und ich möchte Lachs und Krabben. Und vielleicht zwei Flaschen Prosecco, einen Kasten Wasser, einen Kasten Bier, Orangensaft. Dazu Brot und Butter und vielleicht etwas Leberpastete, einen Karton Eier, und, ja, wenn du das auftreiben kannst … Verdammt, dieses Scheißding!«
»Wie bitte?«, fragte Samy verstört.
»Schon gut, kauf das Zeug und komm her!«
Dehner hatte die ganzen Stunden über im Bett auf seiner Waffe gelegen und fragte sich jetzt, wie ihm das hatte passieren können. Er hatte die Tasche noch nicht ausgepackt, aber die Waffe sicherheitshalber herausgenommen und aufs Bett geworfen. Wie hieß es doch so schön über den Umgang mit der Waffe? »Achten Sie immer darauf, in jedem neuen Raum, den Sie während einer Reise mieten und dann betreten, zunächst die Waffe abzulegen und sie unbedingt so aufzubewahren, dass kein Fremder sie sehen oder ertasten kann.« Wer, um Gottes willen, ließ sich bloß solche Texte einfallen?
»Du bist blöde, Dehner!«, sagte er laut. An der rechten Hüfte hatte er eine große rote Druckstelle.
Anderthalb Stunden später kam Samy und schleppte die Einkäufe in mehreren Etappen keuchend in die Wohnung hinauf. Er freute sich, dass Thomas wieder zurück war, und wie üblich geriet er vor Aufregung ins Stottern, vergaß den Kühlschrank zu schließen und wollte etwas ganz Wichtiges erzählen, was ihm aber nicht auf Anhieb gelang.
Dehner legte ihm den Arm um die Schultern und sagte mit ruhiger Stimme: »Langsam, Samy, langsam. Das Tollste wäre, wenn du uns erst mal Brote machst. Und du darfst auch einen halben Prosecco mit Orangensaft trinken.«
Samy war vierzehn und so etwas wie ein Segen für die Straße. Er wurde von seiner alleinerziehenden Mama liebevoll betreut, und alle kannten und mochten ihn. Er kaufte für alte Damen ein, er hütete Kinder, und er durfte unter Aufsicht schon mal im Kiosk gegenüber bedienen. Man sagte, er sei in seiner Entwicklung im Alter von acht Jahren stecken geblieben. Dazu hatte er seit seiner Geburt einen leichten Hüftschaden.
Er himmelte Dehner an, weil der offensichtlich dauernd in fremden Ländern unterwegs war und immer mit den Fliegern durch die Lüfte ritt. Irgendwann hatte er einmal zu Dehner gesagt: »Also, so was wie du will ich auch mal werden.« Sie saßen sich in der Küche am Esstisch gegenüber und aßen zusammen.
»Wo warst du?«
»In Albanien.«
»Wo ist das denn?«
»Es liegt am Adriatischen Meer, gegenüber von Italien.«
»Was hast du da gemacht?«
»Ich habe Leute getroffen, die mit Sprengstoff umgehen und ihn herstellen. Das Zeug heißt C4 und ist so ähnlich wie Dynamit. Du erinnerst dich doch an die Knete, mit der du als Kind immer gespielt hast. C4 sieht ähnlich aus, mal bräunlich, mal dunkelgrün, man kann es formen, wie man will. Man kann damit Steine sprengen, also in Steinbrüchen. Mit den Steinen kannst du dann ein Haus bauen.«
»Willst du so was haben?«
»Ja, mal sehen. Mein Chef will wissen, was man damit alles machen kann. Vielleicht kaufen wir was von dem Zeug.«
Wieder entstand das Bild der Frau vor seinen Augen, diese Eiseskälte, mit der sie ihre Blicke abschätzend über den Frühstücksraum des Hotels hatte gleiten lassen. Nicht der Hauch eines Lächelns auf ihrem Gesicht. Sie widmete sich für einige Minuten der Morgenzeitung, nippte in einem festen Rhythmus an ihrem Kaffee, nahm eine Winzigkeit Müsli zu sich und schien ganz offensichtlich kein Interesse daran zu haben, mit irgendjemandem auch nur ein Wort zu wechseln.
»Ich muss jetzt arbeiten, Samy«, erklärte Dehner schließlich.
Als Samy gegangen war, setzte er sich an seinen Laptop und begann zu schreiben. Für ihn war es wichtig, das Memorandum über einen Einsatz dann zu schreiben, wenn es ihm auf den Nägeln brannte, nur so wurden die Schilderungen authentisch. Und die Frau brannte ihm auf den Nägeln, obwohl sie ihn in erotischer Hinsicht nicht interessierte. Thomas Dehner bezeichnete sich selbst als BS, was ihm zufolge »bekennender Schwuler« bedeutete.
»Mein Aufenthalt in Albanien galt im Wesentlichen der Erkundung eines Sprengstoffs, der weltweit unter der Bezeichnung C4 bekannt ist und ursprünglich von der Firma Semtex in Tschechien industriell hergestellt wurde (und immer noch wird). Mittlerweile sind Lizenzen zur Herstellung in alle Welt verkauft, aber der Stoff wird zunehmend und in hohem Maß auf der Welt kopiert und somit illegal hergestellt.
Selbstmordattentäter verwenden vorwiegend C4. Unsere diensteigenen Chemiker werden ihre wissenschaftlichen Bemerkungen hinzufügen, ich beschränke mich hier auf das Notwendigste und gebe eine Schilderung meiner Tage in Tirana wieder.
Ich hatte das Ziel, einen Mann zu untersuchen, der in der Szene der Sprengstoffhersteller eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Es handelt sich um Jongen Truud, einen gebürtigen Holländer, der bisher durch fahrbare Heroinküchen aufgefallen ist, nun aber auch auf dem Sektor Sprengstoff in das internationale Geschäft einsteigen will.
Dabei traf ich auf eine Frau, die im Hotel den Namen Britt Sauwer angegeben hatte, Geburtsland Schweden, wohnhaft in Stockholm. Alter ungefähr dreißig, etwa 163 Zentimeter groß, schlank, durchtrainiert. Die Frau kaufte zwanzig Zentner C4. Sie bezahlte bar in US-Dollar.
Ein Angestellter von Jongen Truud erwähnte mir gegenüber, dass die Frau geäußert habe, sie wolle den Sprengstoff nach Deutschland bringen. Wohin, wurde nicht erwähnt.
Einige Grunddaten über den Sprengstoff C4 (das heißt: Composite Compound 4): C4 ist in der Herstellung ziemlich einfach. Man braucht Hexogen, Bis-Ethylhexyl, Polyisobutylen und Mineralöl. Die genauen Anteile kann sich jeder aus dem Internet herunterladen. Die Stoffe sind jedem Chemiker zugänglich.
Die Besonderheit dieses Stoffes liegt darin, dass er vollkommen gefahrlos transportiert, gelagert und bearbeitet werden kann. Man kann damit also eine Zahnpastatube füllen oder eine Schuhcremedose, man kann Kinder damit kleine Figuren basteln lassen. Das alles ist vollkommen ungefährlich. (Bei Briefbomben wurde in den letzten Jahren häufig C4 nachgewiesen.)
Ein weitere Besonderheit des Stoffes: Bei keiner Fahrzeugkontrolle oder Zollstelle fällt das Zeug auf, es ist faktisch geruchlos und kann auch beim Röntgen durch entsprechende Anlagen zum Beispiel von Zollbehörden oder Polizei nicht festgestellt werden. Man könnte also buchstäblich einen ganzen Schuh damit modellieren und wird nicht auffallen, man könnte ebenso eine schusssichere Weste damit auskleiden, und niemand würde es merken.
Um eine annähernde Vorstellung der Masse C4 zu vermitteln, sei darauf hingewiesen, dass ein handelsübliches Paket Butter (250 Gramm) in etwa dem Verhältnis von Masse und Gewicht des Sprengstoffs gleicht.
Bei dem in Tschechien bei Semtex industriell gefertigten C4 setzt man Metallspäne hinzu, sodass der Stoff beim Röntgen gefunden wird bzw. Detektoren anschlagen. Man setzt des Weiteren starke Geruchsstoffe hinzu, sodass das C4 von Spürhunden gefunden werden kann. Beim illegal hergestellten C4 wird auf diese Zusätze selbstverständlich verzichtet, was bedeutet, dass C4 ohne Zusatzstoffe nahezu unbegrenzt, verdeckt unter anderer Ladung, über Grenzen transportiert werden kann.
Gezündet wird die Masse konventionell mittels einer Zündkapsel, die etwa so groß ist wie das Unterteil eines Kugelschreibers. Die Zündung erfolgt entweder per Draht oder aber mittels Handytastatur. Das Sprengstoffpaket enthält also einen Empfänger. Wenn man beim Handy eine bestimmte Nummer wählt, wird dadurch ein elektrischer Impuls ausgelöst. Dieser zündet die Kapsel und die wiederum das C4. Einen solchen Zünder kann mittlerweile jeder Elektroniker im eigenen Hobbyraum herstellen.
Zunehmend Verwendung findet dieser Sprengstoff bei Selbstmordattentätern, die sich in den meisten Fällen einen Gürtel aus C4 anlegen und in der Millisekunde vor der Sprengung einfach einen eingebauten Schalter betätigen.
Informationen zu Jongen Truud (48): Möglicherweise in Amsterdam geboren, seit etwa zwanzig Jahren zu Hause in Laos, Thailand, Kambodscha, Afghanistan, Pakistan. Nicht vorbestraft. Heroinhersteller, Drogentransporteur, Autoverleiher, Autoverkäufer, gegenwärtig in Tirana, Albanien, dort keine feste Adresse, ständig als Gast aus dem Ausland gemeldet in einer kleinen, elitären privaten Pension, in der auch Staatsgäste untergebracht werden.
Truud ist seit Kurzem ausgestattet mit Papieren auf den Namen Bert Neuwein, deutscher Staatsangehöriger, geboren am 1. Mai 1964 in Emden, Nordfriesland. (Achtung! Die Folien und Textdokumente aller dieser Papiere, einschließlich der Geburtsurkunde und des Familienstammbuches, sind echt, stammen wahrscheinlich aus einem Einbruch in einem Einwohnermeldeamt.)
Truud hat bereits als Jugendlicher in Amsterdam mit Drogen gehandelt. Er selbst nahm niemals Drogen, raucht nicht, trinkt keinen Alkohol, auffällige Frauengeschichten oder sexuelle Vorlieben sind nicht bekannt. Allerdings darf nicht unterschätzt werden, dass der Mann stets bewaffnet und als erstaunlich guter Schütze bekannt ist. Er trainiert mindestens einmal im Monat mit scharfer Munition und trägt die Waffe rechts am Gürtel.
Zuerst Gelegenheitsdealer, dann zunehmend eingesetzt von den in Amsterdam lebenden chinesischen Drogenhändlern, die mit festen Partnern im Goldenen Dreieck (Laos, Kambodscha, Thailand), aber auch mit Afghanistan und neuerdings mit Mexiko Handel treiben.
Truud wurde wahrscheinlich auf Empfehlung von Mi Wintan (Drogenhändler und Sippenältester in Amsterdam) in Laos, dann in Thailand, dann in Kambodscha fester Mitarbeiter eines Drogenhändlerrings mit dem Namen KETTE, DIE NICHT REISST (laotisch). Er wechselte dann ins Management der Firma und schickte in Wohnanhängern untergebrachte Heroinküchen samt den Chemikern in nahezu alle Staaten, die unmittelbar vor Österreich auf dem Weg von Kleinasien nach Europa liegen. Die Qualität seines Stoffes war besser als die der Konkurrenz, was ihm verstärkt Abnehmer brachte.
Sein Umsatz in den letzten fünfzehn Jahren wird auf etwa 650 Millionen Euro geschätzt, über sein persönliches Vermögen ist nichts bekannt.
Sein Status in Tirana kann als völlig abgesichert gelten. Er hat direkte Verbindungen bis in die Staatsspitze und ist damit beschäftigt, seine C4-Produktion auszubauen. Offiziell verleiht er Autos (hochwertige, darunter einen goldenen Rolls-Royce für Hochzeiten) und führt europäische Automarken nach Albanien ein, im Wesentlichen für hoch angesiedelte Bürokraten und die Staatsspitze. Diese Tätigkeiten scheinen allerdings Tarnung zu sein, wahrscheinlich wird er systematisch für eine andere und neue Managementtätigkeit vorbereitet.
Bei näherer Betrachtung von Truuds Arbeitstag kommt tatsächlich der Verdacht auf, dass er eigentlich in Tirana nichts anderes als hochbezahlte Ferien verbringt. Er hat ein sehr modernes Büro in der Stadt, beste Adresse (im Dienst bekannt), kommt morgens für eine Stunde dorthin und bespricht sich mit seiner Sekretärin, die dann für den Rest des Tages die anfallenden Arbeiten alleine erledigt. Wenn Truud telefoniert, verlässt er grundsätzlich das Büro und erledigt die Telefonate von seinem Auto auf dem Parkplatz des Bürogebäudes aus.
Der beste Handyladen der Stadt erteilte über einen Mittelsmann die Auskunft, dass Truud pro Monat etwa acht bis fünfzehn neue Handys bekommt, je nach Anforderung. Wir können also davon ausgehen, dass er die Handys nach jeweils wenigen Telefonaten zerstört, um jede Identifikation und Nachprüfbarkeit von Verbindungen zu vermeiden.
Abgesehen von der C4-Produktion kümmert sich Truud um ein sogenanntes Hygiene-Institut, das offensichtlich mit Suchtstoffen experimentiert (siehe Stadtplan und Fotos). Es gilt bei unseren Informanten als sicher, dass bestimmte Stoffe aus dem Institut an Strafgefangenen getestet werden. Insider vermuten, dass Truud mit neuen chemischen Stoffen auf den Drogenmarkt gehen will. Typisch für seine Vorgehensweise ist, dass seine Aktionen von staatlicher Seite abgesegnet sind.
Die Herstellung des C4 findet in einem alten, unauffälligen Firmengelände nordwestlich von Tirana in etwa fünfzehn Kilometern Entfernung von der Hauptstadt in bergigem Gebiet statt. Es handelt sich um drei Hallen. Das Gelände liegt offen neben einer kleinen Straße und ist von einem hochwertigen Starkstrom-Elektrozaun umgeben. Es wird zusätzlich mit automatischen Kameras (aus Deutschland) abgesichert. An einer Einfahrt steht ein Pförtner, der bewaffnet ist und niemals allein seinen Dienst versieht. Gewöhnlich habe ich drei Männer registriert. Der Betrieb läuft rund um die Uhr in zwei Schichten (siehe beigefügte Fotos und den aufgenommenen Bericht eines Informanten).
Wenn der Sprengstoff aus der Herstellung abgefahren wird, so werden dafür grundsätzlich Lastwagen einer Firma namens AUTOSILO benutzt. Besitzer der Firma und der Trucks ist Truud. Sie fahren den Stoff in einen südlichen Stadtteil von Tirana, entladen dort in eine Lagerhalle (genaue Adresse und Lageplan siehe aktuelles Archiv).
Aus diesem Lager werden die Käufer bedient. Die kommen jedoch mit diesem Zwischenlager des Stoffes niemals in Berührung. Der Stoff wird für sie in der Regel in einem weiteren Lager bereitgehalten (genaue Lage siehe Fotografien und Stadtplan). Die Trucks fahren dort vor, werden von Truuds Leuten beladen und verschwinden wieder.
Aufgrund der Nähe zum Meer werden sehr viele Frachten von Truud auf Schiffe verladen. Das sind in der Regel Kümos, Küstenmotorschiffe. Diese Art der Verfrachtung ist besonders gut geeignet, die Wege des Stoffes beständig in einer Grauzone zu halten. Die Regel ist, dass Trucks von AUTOSILO zu den Schiffen fahren und die Frachten, gewöhnlich auf Paletten, umgeladen werden.
Diese Schiffe fahren ständig in Küstennähe zwischen Staaten hin und her, sodass es möglich ist, mit drei bis vier oder mehr Umladungen die Ware von den offiziellen Listen langsam verschwinden zu lassen. Man hat also die Möglichkeit, in einem ganz unbedeutenden Hafen große Mengen des Stoffes anzulanden, die dann, wiederum in kleine Portionen aufgeteilt, erneut auf die Reise gehen oder aber von großen Transportschiffen zu anderen Kontinenten verfrachtet werden.
Im Wesentlichen wird der Sprengstoff unter der Bezeichnung EARTHCARE als hochwertiger Pflanzen- und Blumendünger in undurchsichtigen weißen Plastiktüten von jeweils acht Kilogramm gehandelt. Die Qualität des Sprengstoffs soll hervorragend sein.
Ich habe in der Verladestation für die Kunden, die die Ware in Trucks abfahren lassen, eine solche Plastiktüte an mich genommen, habe den Sprengstoff ausgeschüttet und nur einen Rest zur chemischen Untersuchung mitsamt der weißen Plastiktüte mit dem Logo EARTHCARE mit nach Berlin gebracht, damit die Möglichkeit besteht, den Stoff und die Verpackung genau zu untersuchen. Diese kurze nächtliche Aktion ist nicht bemerkt worden.
Meine persönliche Einschätzung von Truud läuft darauf hinaus, dass wir den Mann unter allen Umständen wie bisher mindestens einmal im Jahr einer Großen Anfrage unterwerfen sollten. Er sollte auch in die Listen der befreundeten Dienste Eingang finden. Der Mann ist eindeutig hochgradig gefährlich.
Ich komme jetzt zu der Frau, auf die ich anfangs einging: Britt Sauwer, schwedischer Herkunft, wohnhaft in Stockholm, Alter ungefähr dreißig. Der Dienst hat meiner Kenntnis nach über diese Frau keinerlei Angaben, sie ist also ein unbeschriebenes Blatt.
Nach den Quellen vor Ort ist eine Frau, die C4 kauft, ganz ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist, dass sie persönlich in Tirana auftauchte, die Ware bar bezahlte und sich darüber informierte, wie der Stoff an den Käufer gelangt. Sie tauchte also direkt am zweiten Zwischenlager auf, um sich nach Einzelheiten zu erkundigen.
Ich erwähnte bereits, dass diese Frau eintausend Kilogramm C4 kaufte und bar in US-Dollar bezahlte. Im Grunde ist das ein für Truud äußerst ungewöhnliches, ja unmögliches Geschäft, denn er verkauft sein C4 niemals an eine ihm unbekannte Person oder Adresse. Die Frau muss ihm also zumindest durch zuverlässige Dritte empfohlen worden sein.
Das allein reicht jedoch nicht: Er muss auch sicher sein, dass die Frau den Mund hält und dass der Kauf des C4 kein Scheinkauf durch irgendwelche ermittelnden Behörden ist.
Während meines siebentägigen Aufenthalts in Tirana war die Frau an den ersten drei Tagen dort. Sie fiel mir sofort auf, weil sie eine unbeschreibliche Kälte ausstrahlt. Wie bekannt, ermuntern uns unsere Psychologen immer wieder dazu, während des Einsatzes auch Dinge wahrzunehmen und aufzuschreiben, die mit den sichtbaren Fakten nichts zu tun haben, sondern im emotionalen Bereich angesiedelt sind. Bei dieser Frau bekam ich das Frösteln.
Auf den ersten Blick ist sie eine schlanke, zarte Person, bei genauerer Betrachtung relativiert sich das jedoch: Sie ist körperlich in bester Verfassung, strahlt Energie aus, bewegt sich langsam und selbstbewusst, hat aber offensichtlich nicht das Bedürfnis, irgendjemandem zu gefallen, sondern signalisiert im Gegenteil, dass sie keinerlei Kontakt wünscht.
Die Frau ist überaus attraktiv und macht sofort neugierig, ganz gleich, aus welcher Perspektive man sie auch betrachten mag.
Tirana ist nicht gerade ein Eldorado des Jetsets, dennoch findet man erstaunlich viele Besucher aus westlichen Ländern in den guten Hotels der Stadt. Die meisten sind wohl aus geschäftlichen Gründen dort. Und die Augen dieser Männer richteten sich beim Frühstück ausschließlich auf diese Frau, es war beinahe schon peinlich. Es war aber eindeutig, dass sie in keiner Weise darauf reagierte. Ein schönes, strenges Gesicht, oval, mit einem sehr sinnlichen Mund. Kein Make-up, oder so perfekt geschminkt, dass man es nicht bemerkte. Den Tisch hatte sie so gewählt, dass sie mit dem Rücken zur Wand saß, also alles kontrollieren konnte.
Ich traf die Frau wieder, als sie das zweite Lager besuchte, in dem der Sprengstoff auf die Trucks der Käufer geladen wird. Sie sprach perfekt und beinahe akzentfrei Englisch, und sie wollte wissen, wie sie ihren Truckfahrer instruieren muss, damit er vorfährt, sofort die Ladung aufnimmt und sich nicht unnötig aufhalten muss. Das hatte eindeutig etwas von Generalstabsarbeit.
Sie hatte einen Leihwagen (einen schweren Audi, natürlich von Truud), und ich sah sie darin, wie sie um das große Grundstück in den Bergen herumkurvte, in dem das C4 hergestellt wird. Die Tatsache, dass sie sich darum kümmerte, könnte darauf hinweisen, dass sie etwas in Erfahrung bringen wollte. Vielleicht ist sie eine penibel arbeitende Spionin, vielleicht von unserem Gewerbe. Auf jeden Fall aber ist sie gründlich.
Am Nachmittag des zweiten Tages verließ sie das Hotel gegen 14 Uhr, setzte sich in den Wagen und verließ die Stadt in Richtung Süden. Ich folgte ihr ungefähr zehn Kilometer, kehrte dann um. Ich wollte mir ihr Zimmer ansehen und hoffte dabei ausfindig machen zu können, wer sie ist.
Das Ergebnis der kurzen Inspektion ihres Zimmers war ausgesprochen dürftig. Eine geradezu mustergültige Aufgeräumtheit, nichts Besonderes in ihrem Koffer, abgesehen von ungefähr achttausend US-Dollar.
Sie kam überraschend schnell zurück, und ich musste auf einen flachen Außensims an der Rückwand des Gebäudes im ersten Stock ausweichen. Zwei Fenster waren vom Hotelpersonal zur Lüftung offen gelassen worden. Ich konnte die Frau durch die Spiegelung in der Scheibe beobachten.
Sie betrat das Zimmer, wurde gleich misstrauisch und hatte sofort eine kleine Waffe in der Hand. Ich vermute, dass es ein Derringer war, den sie in der Handtasche mit sich trug, und ich habe keinerlei Zweifel, dass sie mich erschossen hätte, falls nötig.
Wenn ich bei Truud auf die Notwendigkeit verwiesen habe, ihn nicht aus den Augen zu verlieren, so würde ich das bei dieser Frau ebenfalls dringend empfehlen.
gez. Thomas Dehner (nach der Rückkehr aus Tirana)«
DRITTES KAPITEL
Um 16 Uhr Ortszeit wartete Müller vor dem Hotel auf den Taxifahrer. Es war kühl, es regnete leicht, dazu wehte ein sanfter Wind.
Der Taxifahrer benutzte die Lichthupe seines uralten Toyota. Müller stieg zu ihm in den Wagen.
»Ich muss zu einer Villa im Palastbereich. Die Nummer ist sechzehn.«
»Das ist Militär, das ist gar nicht gut«, kommentierte der Junge, und seine Stimme wurde augenblicklich ein wenig schrill.
»Ja«, bestätigte Müller.
»Aber die Villa ist tot. Wir sagen, die Villa ist tot, wenn die Leute alle weg sind. Kein Mensch weiß, wohin.« Der Junge lächelte verkrampft, als könne er so erreichen, dass Müller ein anderes Ziel nannte.
»Ich muss trotzdem dorthin«, sagte Müller. »Er ist ein General, nicht wahr? Und was haltet ihr von ihm?«
»Ja, ein General. Aber er ist ein Schwein, ein Schinder, ein Killer. Onkel Tobruk nennen wir ihn. Hat viele Leute hingehängt. Ich hoffe, er ist krepiert. Man sagt, die Familie ist nach Paris ausgeflogen worden. Eine große Familie, fünfzig Leute oder so. Mit einer riesigen Privatmaschine. Sie sagen, das Flugzeug war von einer großen Bank. Was willst du da, das ist doch auf jeden Fall sehr gefährlich?«
»Ich muss herausfinden, wo dieser Mann ist. Das ist mein Auftrag, das kann ich nicht ändern, verstehst du?«
»Ja, gut, gut. Ich fahre aber nicht auf das Gelände, ich bleibe draußen«, sagte der Junge bestimmt, als sei darüber nicht zu verhandeln.
»Das ist okay. Aber du wartest?«
»Ich warte.« Der Junge nickte. »Ich warte so, dass ich dich sehe, wenn du wieder herauskommst.«
Er ist sehr nervös, er hat Angst, dachte Müller. »Hat man ihn gejagt, diesen General?«
»Ja, klar. Hat man. Er ist wie eine Schlange, sie haben ihn nicht gekriegt. Sie hätten ihn auf der Stelle erschossen.«
»Was glaubst du, wo ist dieser Mann?«
»Keine Ahnung. Aber wenn jemand es erfährt, ist er tot, das steht fest. Er hatte viele Feinde. Sieh mal, da ist es schon. Du musst durch das Tor. Ich warte auf der anderen Straßenseite, hundert Meter weiter. Weißt du ungefähr, wie lange das dauert?«
»Keine Ahnung. Soll ich dich schon bezahlen?«
»Nein, brauchst du nicht. Ich warte.«
Müller stieg aus. Er sah, wie der Junge eine kurze Strecke weiterfuhr und dann wendete. Die Straße war leer, kein Auto, kein Lieferwagen, kein Fußgänger, absolute Stille. Nur weit unten mitten auf der Straße ein Fernsehteam.
Müller ging durch das Tor.
Auf vereinzelten Grasinseln standen hohe Palmen, es gab schmale Kieswege und eine weit geschwungene asphaltierte Auffahrt. Müller wusste, dass der Abstand von der Straße zum Haus exakt einhundert Meter betrug.
Das Haupthaus war zweigeschossig, sechzig Meter breit und über vierzig Meter tief. Der Arbeitsraum des Generals lag in der Westecke des ersten Geschosses nach hinten hinaus und war einhundert Quadratmeter groß. Die Fenster bestanden aus Sicherheitsglas, stark genug, um Gewehrfeuer zu widerstehen.
Müller wusste das alles von einem Gebäudeplan, den Sowinski ihm in Berlin gezeigt hatte, und da er über ein präzises fotografisches Gedächtnis verfügte, konnte er alle diese Einzelheiten mühelos abrufen. Er vergaß nichts und würde es in einem Jahr noch wissen.
Müller wusste auch, dass der große Raum im Erdgeschoss den offiziellen Treffen und Feiern vorbehalten war. Die Küche lag im Kellergeschoss auf der der Straße abgewandten Seite. Sie war groß genug, um für etwa einhundert Gäste kochen zu können. Die Schlafzimmer und privaten Räume der Familie befanden sich im ersten Stock, um den Arbeitsraum des Generals herum angeordnet. Die ständige Wache war in einem kleinen Haus an der rechten Seite des Gebäudes untergebracht, groß genug, um sechs Soldaten und einem Sergeanten Platz zu bieten. Spiegelgleich lag auf der linken Seite ein weiteres kleines Gebäude, das ausschließlich den Kindern vorbehalten war. Dort wurden sie auch von privaten Lehrern, die man aus Europa einfliegen ließ, unterrichtet.
Gemessen an der Situation der libyschen Bevölkerung, war das alles von einem geradezu unanständigen Luxus. Nach Schätzungen des Dienstes in Berlin lag das angehäufte Vermögen der Familie bei etwa sechshundert Millionen Euro, denn der General stellte auch die Bewachungen für die Ölindustrie und war am Gewinn mit festen Margen beteiligt.
»Quelle Sechs hat Spaß an Brutalitäten«, hatte Sowinski erklärt. »Wir nehmen an, dass die Terrorverdächtigen, die die USA zu Verhören ins Gaddafi-Land fliegen ließen, der Folter unterzogen wurden, die Quelle Sechs erfunden hat und durchführen ließ. Waterboarding ist da noch ein harmloser Spaß. Er ließ bei aufmüpfigen Gefangenen Holzkeile unter die Fingernägel treiben, die dann angezündet wurden. Wir haben auch von einer Geliebten gehört, die er austauschen musste, weil er ihr beide Arme aus den Schultergelenken gehebelt hatte. Die Frau starb durch den extremen Schmerz an einem Schock. Geh also um Himmels willen erst sicherheitshalber durch das gesamte Gebäude, ehe du dich um irgendetwas anderes kümmerst. Wir können nicht wissen, wer sich dort versteckt. Die Rückseite des Anwesens dürfte dich allerdings weniger interessieren. Da ist nur ein großer Swimmingpool. Also ist dort nichts zu finden. Das Anwesen endet an einer drei Meter hohen Betonmauer. Jenseits dieser Mauer ist ein breiter Streifen, auf dem in Friedenszeiten Soldaten patrouillierten, um die kostbaren Bewohner zu schützen. Dann folgt eine weitere Betonmauer zur nächsten Villa. Ich würde dir raten, dich auf das offene Gelände zwischen der Villa und der Straße zu konzentrieren. Achte auf Gitter und Schächte, aber Quelle Sechs kann auch darauf verzichtet haben. Anweisung ist: Du konzentrierst dich zuerst auf das Haus und triffst erst dann deine Entscheidung, wenn es sauber und leer ist. Können wir uns darauf einigen?«
Müller ging also in engen Schleifen das Grundstück ab und achtete auf irgendwelche Unregelmäßigkeiten auf den Kieswegen und den Rasenflächen. Er fand keine.
Sicherheitshalber trat er durch das Tor auf die Straße hinaus und ging auf dem Trottoir die gesamte Breite des Grundstücks ab. Auch dort keine Kanaldeckel, keine Zugänge zu irgendwelchen Schächten.
Er grüßte flüchtig seinen Taxifahrer und rief: »Dauert nicht mehr lange.« Dann ging er auf das Grundstück zurück und direkt auf das Hauptgebäude im Hintergrund zu.
Das Haus war ein zweistöckiger Riesenklotz, und es war nahezu leer. Es gab vertrauliche Berichte aus den diplomatischen Diensten an den BND über die Umfänge der Plünderungen vonseiten der Rebellen und der Bevölkerung. Es war bekannt geworden, dass die Rebellen die Villen bestimmten Gruppierungen überlassen hatten, die im Gegenzug Waffen und Munition schleppten, Maschinengewehre und Schnellfeuerkanonen reparierten und auch dafür sorgten, dass die Kämpfenden weit draußen in der Wüste mit Nahrung und neuer Munition versorgt wurden.
Es gab aber auch eindeutige Hinweise darauf, dass aufgeputschte Rebellen Gaddafi-Anhänger erst entwaffnet und dann gleich gruppenweise erschossen hatten. Müller wusste also, dass seine möglichen Gegner nicht nur bei denen zu finden waren, die das Regime Gaddafi stützten, sondern auch bei denen, die sich schlicht in einem Machtrausch befanden und für die es geradezu atemberaubend faszinierend war, mit einer Waffe einen Menschen zu töten, einfach so.
Müller beeilte sich, huschte von Raum zu Raum und war beunruhigt durch das laute Echo, das seine Schritte in den großen leeren Räumen verursachten.
Die Lampen waren von den Decken und aus den Wänden gerissen worden und verschwunden, es gab überhaupt keine Möbel mehr, keine Schränke, keine Truhen, keine Sofas oder Sessel, keine Betten, nur noch die Reste von Regalen und kleinen Möbelstücken, die zu Bruch gegangen waren. Buchstäblich alles war herausgeschleppt worden, in drei riesigen Bädern gab es keine Spiegel mehr, und selbst die Waschbecken und Badewannen waren verschwunden.
Ehe er in den Keller hinunterging, hielt er auf dem Treppenabsatz inne und horchte mit gesenktem Kopf in das Haus hinein. Das musste sein, es gehörte zur Routine und war Vorschrift. Das Ganze dauerte drei endlose Minuten lang. Er hörte nichts.
Die Küche unter dem Haus war riesig, ebenso wie die begehbaren Kühlkammern. Es gab keinen Strom mehr, die Nahrungsmittel waren verschwunden, alle Türen standen weit auf, und die meisten Gerätschaften hatten wohl neue Besitzer gefunden.
An einem langen Gang lagen sechs kleine Räume, in denen wahrscheinlich Angestellte gehaust hatten. Auch dort gab es nichts mehr, keine Kleinmöbel, keine Betten, keine Schränke, nur ein paar persönliche Fotos an den Wänden, auf denen Menschen unterschiedlichen Alters in die Kamera blickten, einige von ihnen mit einem gequälten Lächeln im Gesicht.
»Wenn es irgendetwas zu verbergen gilt, dann kann Quelle Sechs das nur in dem Bereich zwischen dem Gebäude und der Straße versteckt halten. Er hatte bautechnisch keine andere Möglichkeit. Sei also vorsichtig, wenn du Dinge siehst, die darauf hindeuten.« So Sowinskis trockener, väterlicher Ratschlag, bevor sie sich trennten und Müller auf die Reise ging.
Müller bewegte sich sehr langsam, setzte mit übergroßer Vorsicht Fuß vor Fuß und hatte ständig das Gefühl, in einer Falle zu stecken. Das kannte er, das hatte er viele Male durchlebt, aber nur selten war es tatsächlich eine Falle gewesen.
Dann saß da beim nächsten Schritt, überraschend und grell wie ein Blitz, dieser alte Mann in einem winzigen Raum. Über ihm baumelte eine trübe Funzel von der Decke, nicht mehr als fünfzehn Watt, und über allem lag eine unbeschreibliche, beinahe greifbare Stille.
Der Mann war vielleicht sechzig oder siebzig Jahre alt, unmöglich, das genau zu sagen. Er hockte auf dem Betonboden, zwischen seinen Beinen stand eine dunkle, längliche Glasflasche. Rotwein. Auf dem Etikett stand MAROC. Er hielt den Kopf gesenkt und summte vor sich hin, als sei er selig in wonnige Träume gehüllt.
Ein wenig irritiert dachte Müller: Ein Penner in Tripolis!