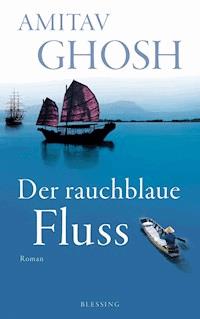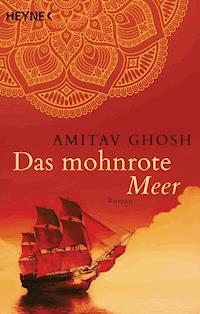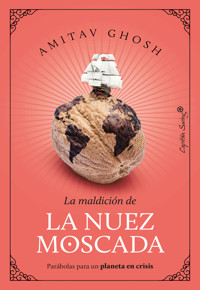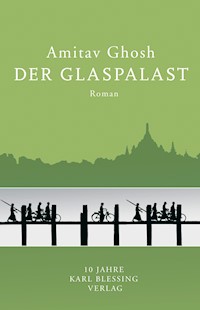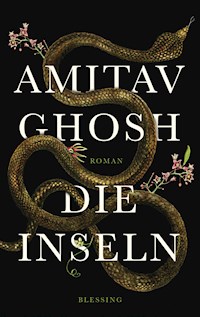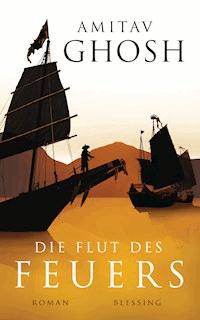19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
»Höchst selten besitzt ein Autor so erhellende Einsichten und Erzähltalente, dass ein leidlich bekanntes Thema sich plötzlich ganz neu eröffnet. Ghosh ist so ein Autor, und DIE GROSSE VERBLENDUNG ist genau diese Art von Buch.« Naomi Klein
Amitav Ghosh, "Meister der Sprache" (Die Zeit) und Romancier von Weltrang, fragt sich, warum der Klimawandel in der Literatur der Gegenwart nicht zur Sprache kommt. Woher rührt unsere große Verblendung, vor der künftige Generationen fassungslos stehen werden? Hat die Kunst in dieser epochalen Katastrophe ihren Meister gefunden?
Mit »Die große Verblendung« legt Ghosh ein Essay vor, das nicht nur seine Zunft, sondern uns alle auffordert, ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte zu schreiben und uns eine andere, bessere Welt auszumalen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Amitav Ghosh, »Meister der Sprache« (Die Zeit) und Romancier von Weltrang, fragt sich, warum der Klimawandel in der Literatur der Gegenwart nicht zur Sprache kommt. Woher rührt unsere große Verblendung, vor der künftige Generationen fassungslos stehen werden? Hat die Kunst in dieser epochalen Katastrophe ihren Meister gefunden?
Mit Die große Verblendung legt Ghosh ein Essay vor, das nicht nur seine Zunft, sondern uns alle auffordert, ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte zu schreiben und uns eine andere, bessere Welt auszumalen.
»Höchst selten besitzt ein Autor so erhellende Einsichten und Erzähltalente, dass ein leidlich bekanntes Thema sich plötzlich ganz neu eröffnet. Ghosh ist so ein Autor, und Die große Verblendung ist genau diese Art von Buch.« Naomi Klein
Zum Autor
Amitav Ghosh wurde 1956 in Kalkutta geboren und studierte Geschichte und Sozialanthropologie in Neu-Delhi. Nach seiner Promotion in Oxford unterrichtete er an verschiedenen Universitäten. Mit Der Glaspalast (Blessing, 2000) gelang dem schon vielfach ausgezeichneten Autor weltweit der Durchbruch. 2006 legte er den Essayband Zeiten des Glücks im Unglück (Blessing) vor. Zuletzt erschien seine Romantrilogie Das mohnrote Meer (2008), Der rauchblaue Fluss (2012) und Die Flut des Feuers (2016) bei Blessing. Ghosh lebt in Indien und den USA.
AMITAV GHOSH
DIE GROSSE
VERBLENDUNG
DER KLIMAWANDEL
ALS DAS
UNDENKBARE
Aus dem Englischen
von Yvonne Badal
Blessing
Originaltitel: The Great Derangement
Originalverlag: Penguin Books India, Gurgaon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2016 by Amitav Ghosh
Copyright © 2017 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie
Umschlagabbildungen: Oscar Keys/unsplash.com und Dancake/shutterstock.com
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-20555-3V001
www.blessing-verlag.de
Für Mukul Kesavan
Im Gedenken an den Tornado von 1978
INHALT
Teil I
Geschichten
Teil II
Geschichte
Teil III
Politik
Dank
Anmerkungen
TEIL I
GESCHICHTEN
1
Wie könnte man diese Momente vergessen, in denen etwas scheinbar Lebloses sich als äußerst oder gar gefährlich lebendig herausstellt? In denen sich eine Arabeske im Muster eines Teppichs unerwartet als der Schwanz eines Hundes entpuppt, der, tritt man drauf, zu einem Biss in den Knöchel führen könnte? Oder in denen man nach einer unschuldigen Ranke greift, die sich als Schlange erweist? In denen ein harmlos dahintreibendes Rundholz mit einem Mal zum Krokodil wird?
Ich nehme an, ein solcher Schockmoment hatte den Filmemachern von Das Imperium schlägt zurück vorgeschwebt, als sie die Szene konzipierten, in der Han Solo seinen »Millennium Falken« auf einem Asteroiden versteckt – nur um festzustellen, dass er im Schlund eines schlafenden Weltraummonsters gelandet ist.
Wenn man sich dieser Tage, mehr als fünfunddreißig Jahre nach der Produktion dieses Films, an diese denkwürdige Szene erinnert, erkennt man, wie fehl am Platz Solos Überraschung heute wäre. Denn wir ahnen es doch schon: Sollte es jemals einen Han Solo in naher oder ferner Zukunft geben, werden seine Vorstellungen von interplanetarischen Objekten bestimmt ganz andere sein als die der kalifornischen Filmproduktion von damals. Die Menschen der Zukunft werden vermutlich über die Geschichte ihrer Vorfahren auf Erden Bescheid wissen und deshalb sicher auch herausgefunden haben, dass eine beträchtliche Zahl ihrer Art während eines kurzen, sehr kurzen Zeitraums von nur knapp dreihundert Jahren tatsächlich geglaubt hatte, Planeten und Asteroiden seien leblos.
2
Meine Vorfahren waren Umweltflüchtlinge, lange bevor dieser Begriff erfunden wurde.
Sie stammten aus dem heutigen Bangladesch, aus einem Dorf am Ufer des Padma, einem der mächtigsten Ströme des Landes. Die Geschichte, die mein Vater erzählte, ging so: Eines Tages um die Mitte des 19. Jahrhunderts änderte der große Fluss plötzlich seinen Lauf und überflutete das Dorf. Nur wenigen Bewohnern gelang es, in höhere Lagen zu entkommen. Diese Katastrophe entwurzelte auch unsere Vorfahren. Sie zogen gen Westen und machten erst im Jahr 1856 wieder halt, um sich erneut an einem Flussufer niederzulassen, diesmal am Ganges in Bihar.
Zum ersten Mal hörte ich diese Geschichte bei einer nostalgischen Dampferfahrt der Familie auf dem Padma. Ich war noch ein Kind, und während ich auf das wirbelnde Gewässer herabblickte, stellte ich mir einen mächtigen Orkan vor, der die Kokospalmen krümmte und bog, bis ihre Wedel über die Erde peitschten, ich sah Frauen und Kinder gegen den heulenden Sturm anrennen, um den steigenden Fluten zu entkommen, sah meine Ahnen zusammengedrängt auf einer Anhöhe kauern und zusehen, wie ihre Häuser fortgeschwemmt wurden.
Wenn ich an die Umstände denke, die mein Leben prägten, dann denke ich bis heute an die Urgewalt, die meine Ahnen aus ihrer Heimat vertrieb, sie zu ihrer Wanderschaft zwang und somit auch mein Leben und meine Reisen möglich machte. Blicke ich in diese Vergangenheit zurück, scheint der Fluss mich anzusehen und meinem Blick standzuhalten, als wollte er fragen: Erkennst du mich wieder, wo immer du bist?
Erkenntnis ist bekanntlich der Übergang von Unkenntnis zu Kenntnis.1 Etwas wiederzuerkennen ist daher nicht dasselbe wie die Anbahnung neuen Wissens. »Wiedererkennung« bedarf auch keiner Worte, in den meisten Fällen geschieht sie stumm. Doch erkennt man etwas wieder, bedeutet das keineswegs, das Erkannte auch zu verstehen. Begreifen ist nicht notwendigerweise Bestandteil des Moments der Wiedererkennung.
Das Entscheidende im Wort Wiedererkennung sind die ersten beiden Silben, weil sie auf etwas Vorausgegangenes weisen, auf ein bereits vorhandenes tiefes Gewahrsein, das die Passage von der Unkenntnis zur Kenntnis ermöglicht. Das Moment der Wiedererkennung findet statt, wenn ein älteres Gewahrsein vor uns aufleuchtet und unser Verständnis vom Erblickten schlagartig verändert. Doch dieser Blitz der Erkenntnis trifft einen nicht spontan, er kann sich nur in der Präsenz seines verlorenen Anderen offenbaren. Wissen, das aus Wiedererkennung resultiert, ist also nicht das Gleiche wie das Wissen, das der Entdeckung von etwas Neuem folgt: Es entspringt immer dem wiedergewonnenen Gewahrsein von einer »Potenz«, die »sich sich selbst« gibt.2
Das, vermute ich, war es auch, was meine Vorfahren an jenem Tag erlebten, an dem der Fluss anschwoll und sich ihr Dorf holte. Sie erkannten eine Präsenz wieder, die ihr Leben so stark geprägt hatte, dass sie ebenso selbstverständlich für sie geworden war wie die Luft, die sie atmeten. Doch natürlich kann auch Luft mit plötzlicher und tödlicher Gewalt zum Leben erwachen – wie 1986 in Kamerun, als eine massive Kohlendioxidwolke aus dem Nyos-See aufstieg, die umgebenden Dörfer einhüllte und eintausendsiebenhundert Menschen samt ungezählter Tiere tötete. Häufiger tut sie es jedoch mit stiller Insistenz – wie die Einwohner von Neu-Delhi und Beijing nur allzu oft erfahren, wenn ihre entzündeten Lungen und Stirnhöhlen wieder einmal beweisen, dass es keinen Unterschied zwischen Außen und Innen gibt, zwischen verbrauchen und verbraucht werden. Auch das sind Momente der Wiedererkennung, denn in solchen Augenblicken dämmert uns, dass die Energie, von der wir umgeben sind – die auch unter unseren Füßen und durch die Kabel in unseren Wänden fließt, unsere Fahrzeuge antreibt und unsere Zimmer beleuchtet –, eine allumfassende Präsenz ist, die ihre eigenen Ziele, über welche wir nichts wissen, verfolgen könnte.
Auch ich wurde mir auf diese Weise der akuten Nähe nichtmenschlicher Präsenzen gewahr – durch Momente der Wiedererkennung, die mir von meiner Umwelt aufgezwungen wurden. Zufälligerweise schrieb ich gerade über die Sundarbans, den großen Mangrovenwald im Bengal-Delta. Wasser und Schlick durchfließen ihn in einem solchen Tempo, dass geologische Prozesse, die sich üblicherweise im Rahmen der Tiefenzeit entfalten, von Woche zu Woche und Monat zu Monat nachvollziehbar werden. Über Nacht verschwinden ganze Teile eines Flussufers, manchmal mitsamt den Häusern und Menschen darauf, derweil an anderer Stelle eine flache Schlammbank auftaucht und das Ufer binnen Wochen um mehrere Meter verbreitert. Natürlich finden solche Prozesse meist zyklisch statt, doch schon am Beginn des 21. Jahrhunderts ließen zurückweichende Uferstücke und das stete Eindringen von Salzwasser in die einstige Kulturlandschaft die sich häufenden Vorzeichen eines irreversiblen Wandels erkennen.
Diese Landschaft ist derart dynamisch, dass gerade ihre Wandelbarkeit zu unzähligen Momenten der Wiedererkennung führt. Einige davon hielt ich von Zeit zu Zeit in meinem Notizbuch fest, zum Beispiel diese Zeilen, geschrieben im Mai 2002: »Ich halte es für nachweislich wahr, dass dieses Land lebt, dass es nicht unabhängig für sich oder auch nur zufällig existiert, so als sei es ein Akt in der Inszenierung der Menschheitsgeschichte; dass es [selbst] Protagonist ist.« An anderer Stelle notierte ich: »Hier beginnt sogar ein Kind eine Geschichte über die Großmutter mit den Worten: ›Damals war der Fluss noch nicht hier, und das Dorf war noch nicht dort, wo es jetzt ist …‹«
Doch ich könnte von solchen Begegnungen nicht als Momente der Wiedererkennung sprechen, wäre mir nicht schon ein älteres Gewahrsein von dem, was ich jeweils gerade bezeugte, eingepflanzt worden – vielleicht durch Kindheitserlebnisse wie das unserer Suche nach dem Dorf meiner Vorfahren; oder durch Erinnerungen wie die an einen Zyklon in Dhaka, der den kleinen Fischteich hinter unseren Mauern plötzlich in einen See verwandelte und unser Haus fluten ließ; oder durch die Erzählungen meiner Großmutter, wie es war, neben einem mächtigen Strom aufzuwachsen; oder auch einfach nur durch die Beharrlichkeit, mit der sich die bengalische Landschaft den Malern, Schriftstellern und Filmemachern der Region aufdrängt.
Als es dann aber darum ging, solche Wahrnehmungen in das Medium meines imaginären Lebens zu übersetzen – in Erzählliteratur also –, sah ich mich plötzlich mit ganz anderen Herausforderungen als bei früheren Werken konfrontiert, denn diese Probleme schienen mir eindeutig mit meiner Arbeit an The Hungry Tide(Hunger der Gezeiten) zusammenzuhängen, dem Buch, das ich gerade schrieb. Nun jedoch, viele Jahre später und in einer Zeit, in der die Auswirkungen der globalen Erwärmung, die sich in immer kürzeren Abständen zeigen, bereits das schiere Dasein solcher flachen Areale wie das der Sundarbans bedrohen, scheint es mir, als seien solche Probleme die Folgen von etwas viel Umfassenderem. Ich erkenne, dass die Herausforderungen, vor die der Klimawandel einen zeitgenössischen Schriftsteller stellt – wiewohl sie für ihn in mancher Hinsicht sehr spezifisch sind –, von etwas Größerem und Älterem verursacht werden: Sie rühren von dem Raster an literarischen Formen und Konventionen her, das die narrative Imagination in genau der Periode prägte, in der die Anhäufung von Kohlendioxid in der Atmosphäre die Geschichte vom Schicksal der Erde umzuschreiben begann.
3
Dass der Klimawandel auf die Landschaften der literarischen Fiktion einen noch wesentlich kleineren Schatten wirft als auf die öffentlichen Arenen, ist unschwer festzustellen. Um es zu erkennen, brauchen wir bloß durch ein paar hoch angesehene Literaturjournale zu blättern: die Londoner Review of Books, die New Yorker Review of Books, die Los Angeles Review of Books, das Literary Journal oder die New York Times Review of Books. Denn wenn das Thema Klimawandel in solchen Publikationen überhaupt zur Sprache kommt, dann fast immer nur im Zusammenhang mit Sachbüchern; Romane und Kurzgeschichten sind vor diesem Horizont nur sehr selten zu entdecken. Man könnte sogar sagen, dass Erzählungen über den Klimawandel faktisch per definitionem nicht zu der Art von Belletristik zählen, die seriöse Literaturzeitschriften ernst nehmen. Allein die Erwähnung dieses Themas reicht oft schon aus, um einen Roman oder eine Kurzgeschichte in das Genre der Science-Fiction zu verbannen.3 Es scheint, als werde das Thema Klimawandel von der literarischen Imagination als irgendwie geistesverwandt mit Außerirdischen oder interplanetarischen Reisen empfunden.
Diese merkwürdige Rückkopplungsschleife ist irritierend.4 Man kann sich doch schwerlich ein Konzept von Ernsthaftigkeit vorstellen, das potenziell lebensverändernde Bedrohungen ausblendet. Und machte man die Dringlichkeit eines Themas tatsächlich zum Kriterium für dessen Ernsthaftigkeit, dann würde der Klimawandel angesichts der Omen, die er für die Zukunft der Erde parat hält, doch gewiss Schriftsteller in aller Welt dazu veranlassen, sich vordringlich ihm zu widmen. Doch das ist, wie ich feststellte, ganz und gar nicht der Fall.
Warum nur?
Sind die Strudel der globalen Erwärmung zu wild, um mit den gewohnten Barken der Narration navigiert werden zu können? Dabei ist die inzwischen weithin akzeptierte Wahrheit doch, dass »wild« in unserer Zeit zur Norm wurde.5 Wenn bestimmte literarische Formen außerstande sind, durch diese Wildwasser zu navigieren, dann werden sie Schiffbruch erleiden – und in diesem Scheitern wird man ein tieferes Versagen von Imagination und Kultur im Zentrum der Klimakrise erkennen müssen.
Zweifellos rührt dieses Problem nicht von einem Informationsmangel her. Mit Sicherheit sind sich heutzutage nur noch sehr wenige Schriftsteller der Störungen in den weltweiten Klimasystemen nicht bewusst. Und doch ist es erstaunlicherweise der Fall, dass Romanciers, die sich für das Thema Klimawandel entscheiden, dies fast immer außerhalb des erzählerischen Rahmens tun. Ein Paradebeispiel dafür ist das Werk von Arundhati Roy. Nicht nur ist sie eine der besten Prosastilistinnen unserer Zeit, sie ist auch eine leidenschaftliche und kenntnisreiche Umweltaktivistin. Dennoch sind all ihre Schriften über den Klimawandel Sachbücher der einen oder anderen Art.
Oder betrachten wir den noch faszinierenderen Fall von Paul Kingsnorth, Autor des hoch gepriesenen historischen Romans The Wake, der im England des 11. Jahrhunderts angesiedelt ist. Kingsnorth hatte Jahre seines Lebens als Klimaaktivist verbracht, bevor er das einflussreiche »Dark Mountain Project« ins Leben rief, »ein Netzwerk aus Schriftstellern, Malern und Denkern, die nicht mehr an die Geschichten glauben, die unsere Kultur sich selbst erzählt«.6 Kingsnorth veröffentlichte zwar ein beeindruckendes Sachbuch über das »Global Resistance Movement«, doch bis zu dem Zeitpunkt, da ich dies schreibe, hat er noch keinen Roman verfasst, in dem der Klimawandel eine Hauptrolle spielt.
Auch ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Klimawandel, und doch streifen meine Romane dieses Thema nur am Rande. Dieses Ungleichgewicht zwischen meinen persönlichen Anliegen und den Inhalten meiner publizierten Arbeiten brachte mich zum Nachdenken und schließlich zu der Überzeugung, dass diese Diskrepanz nicht das Ergebnis meiner persönlichen Vorlieben, sondern eine Folge des merkwürdigen Widerstands ist, den der Klimawandel der heute sogenannten ernsten Erzählliteratur leistet.
4
Der indische Historiker Dipesh Chakrabarty stellt in seinem bahnbrechenden Essay »The Climate of History« fest, dass Historiker, die sich mit unserer Zeit des menschengemachten Klimawandels befassen werden – in der »Menschen zu geologischen Akteuren wurden, die die elementarsten physikalischen Prozesse der Erde verändern« –, viele ihrer Grundthesen und Verfahrensweisen revidieren müssten.7 Ich würde sogar noch weiter gehen und dem hinzufügen, dass das Anthropozän8 nicht nur Kunst und Geisteswissenschaften vor eine Herausforderung stellt, sondern auch unseren sogenannten gesunden Menschenverstand und unsere zeitgenössische Kultur generell.
Es steht natürlich außer Frage, dass diese Herausforderung nicht zuletzt aus den Komplexitäten der technischen Sprache erwächst, die unser wichtigster Zugang zum Klimawandel ist. Aber zweifellos stellen uns auch die Praktiken und Prämissen vor Probleme, von denen Kunst und Geisteswissenschaften sich leiten lassen. Deshalb halte ich es für höchst dringlich geboten, dass wir herausfinden, auf genau welche Weise sie das tun – es könnte der Schlüssel zu der Erkenntnis sein, warum es der gegenwärtigen Kultur so schwerfällt, sich mit dem Thema Klimawandel auseinanderzusetzen. Tatsächlich ist es vielleicht sogar die wichtigste Frage, die sich der Kultur im weitesten Sinne jemals gestellt hat – denn täuschen wir uns nicht: Die Klimakrise ist auch eine Krise der Kultur und deshalb eine der Imagination.
Kultur weckt Begehrlichkeiten – zum Beispiel das Verlangen nach bestimmten Fahrzeugen und allen möglichen anderen Gerätschaften oder nach bestimmten Häusern und Gärten, die zu den Haupttriebkräften der Kohlenstoffwirtschaft zählen. Ein rasantes Cabrio begeistert uns nicht, weil wir Metall und Chrom so lieben oder weil wir über ein so gutes abstraktes technisches Verständnis verfügen. Es begeistert uns, weil es in uns das Bild einer Straße durch unberührte Landschaften hervorruft und uns an Freiheit und winddurchtostes Haar denken lässt9, weil wir dabei James Dean oder Peter Fonda vor Augen haben, die dem Horizont entgegenrasen, weil wir dabei an Jack Kerouac und Vladimir Nabokov denken. Wenn wir eine Reklame sehen, die das Bild einer tropischen Insel mit dem Wort Paradies verknüpft, dann löst das sofort eine ganze Kette an Übertragungssehnsüchten in uns aus, die zurückreichen bis zu Daniel Defoe und Jean-Jacques Rousseau. Das Flugzeug, das uns dann auf die Insel bringt, ist bloß noch die Glut dieses Feuers. Betrachten wir saftig grüne, von entsalzenem Wasser benetzte Rasenflächen in Abu Dhabi oder Südkalifornien oder irgendeiner anderen Gegend, in der sich die Menschen einst damit zufriedengaben, Wasser sparsam zur Pflege eines einzigen Rebstocks oder Strauchs zu verbrauchen, dann haben wir den Ausdruck einer Sehnsucht vor Augen, die Jane Austens Romanen Geburtshilfe geleistet haben könnte. Aber die Artefakte und Waren, die dank solcher Sehnsüchte hervorgezaubert werden, sind gewissermaßen zugleich Ausdrucksformen und Verschleierungen der kulturellen Matrix, die sie ins Leben rief.
Diese Kultur ist natürlich untrennbar mit den größeren, weltprägenden Geschichten von Imperialismus und Kapitalismus verknüpft. Doch dies zu wissen bedeutet noch lange nicht, die spezifische Wirkung dieser Matrix auf unsere diversen kulturellen Ausdrucksformen zu begreifen – Dichtung, Malerei, Architektur, Theater, Erzählprosa und anderes mehr. Im Lauf der Geschichte haben diese kulturellen Branchen auf schlicht alles reagiert, seien es Kriege oder Umweltkatastrophen oder Krisen anderer Art gewesen. Wie kommt es dann, dass der Klimawandel sich so eigenartig resistent gegen sie erweist?
Aus diesem Blickwinkel betrachtet, stellen sich den Schriftstellern und bildenden Künstlern heutzutage nicht nur Fragen, die die Kohlenstoffwirtschaftspolitik betreffen, sondern auch solche, die mit ihren eigenen Gepflogenheiten zu tun haben. Zum Beispiel die Frage, auf welche Weise sie sich zu Komplizen der Verschleierungstaktiken machen, derer sich die Breitenkultur bedient: Wenn zeitgenössische Trends in der Architektur sogar unter den heutigen Bedingungen des beschleunigten CO2-Ausstoßes noch stark spiegelnde, mit Glas und Metall verkleidete Hochhäuser favorisieren, dann müssen wir uns doch fragen, welche Wunschmuster durch solche Attitüden geschürt werden; wenn ich mich als Romancier entscheide, Markennamen als Elemente einer Charakterschilderung zu verwenden, dann muss auch ich mich fragen, in welchem Maße mich das zum Komplizen der Manipulationen des Marktes macht.
Im selben Geiste muss aus meiner Sicht aber auch die Frage gestellt werden: Was hat der Klimawandel an sich, dass allein schon seine erzählerische Erwähnung zur Verbannung aus den Domänen ernster Literatur führt? Was sagt uns das über die Kultur und ihre Vermeidungsmuster?
Wenn die Welt sich schließlich substanziell verändert hat, wenn der Anstieg der Meeresspiegel die Sundarbans verschluckt und Städte wie Kolkata, New York und Bangkok unbewohnbar gemacht hat10 und die Leser oder Museumsbesucher sich der Literatur und den bildenden Künsten unserer Zeit zuwenden – werden sie dann nicht als Erstes nach den Spuren und Vorzeichen für die verwandelte Welt suchen, die sie von uns geerbt haben? Und wenn sie keine finden, zu welchem anderen Schluss sollten – könnten – sie dann kommen als dem, dass die meisten künstlerischen Ausdrucksformen unserer heutigen Zeit in den Sog der Verschleierungsmethoden geraten waren, die uns daran hinderten, die Realitäten unserer Misere zu erkennen? Insofern ist es doch sehr wahrscheinlich, dass unsere Ära, die sich so gerne ihrer Selbsterkenntnis rühmt, als die Zeit der Großen Verblendung11 in die Geschichte eingehen wird.
5
Am Nachmittag des 17. März 1978 nahm das Wetter im Norden von Delhi eine seltsame Wendung. Mitte März ist für gewöhnlich eine angenehme Zeit in diesem Teil Indiens. Der frostige Winter ist vorbei, und die sengende Hitze des Sommers hat noch nicht eingesetzt, der Himmel ist klar und der Monsun weit weg. Doch an diesem Tag ballten sich mit einem Mal dunkle Wolken am Himmel, dann setzte peitschender Regen ein, gefolgt von einer sogar noch größeren Überraschung: einem Hagelsturm.
Ich bereitete mich gerade an der Universität von Delhi auf meinen Master vor und jobbte nebenbei als Journalist. Als der Hagelsturm losbrach, saß ich in einer Bibliothek, wo ich bis spätabends zu arbeiten geplant hatte. Doch angesichts des für diese Jahreszeit so unüblichen Wetters besann ich mich eines anderen und beschloss, nach Hause zu gehen. Auf dem Heimweg bog ich spontan in eine Seitenstraße ab, um noch bei einem Freund vorbeizusehen. Während wir uns unterhielten, verschlechterte sich das Wetter zusehends, ein paar Minuten später entschied ich, auf schnellstem Weg heimzukehren, und der führte über eine Straße, die ich nur gelegentlich nutzte.
Ich überquerte gerade die verkehrsreiche Kreuzung an der Maurice Nagar Road, als ich über mir ein tiefes Grollen hörte. Beim Blick über die Schulter sah ich, wie sich ein grauer, rüsselartiger Schlauch an der Unterseite einer dunklen Wolke bildete. Ich sah ihn länger und länger werden, dann plötzlich seine Richtung ändern, bis auf den Boden herunterpeitschen und mir entgegenrasen.
Auf der anderen Straßenseite stand ein großes Verwaltungsgebäude. Ich sprintete hinüber und rannte auf den Eingang zu. Doch die Glastüren waren verschlossen. Davor drängte sich eine kleine Menschenmenge dicht im Schutz des Überbaus zusammen. Es gab keinen Platz mehr für mich, also rannte ich um die Ecke zur Vorderseite des Gebäudes, entdeckte einen kleinen Vorbau, sprang über die Brüstung und kauerte mich auf den Boden.
Der Lärm steigerte sich schnell zu einem wilden Tosen, und der Sturm begann heftig an meiner Kleidung zu zerren. Ich wagte einen Blick über die Brüstung und stellte zu meinem Erstaunen fest, dass alles um mich herum in einem aufgewühlten dunklen Staubmeer versunken war. In einem fahlen Lichtstrahl, der von oben eindrang, sah ich eine unglaubliche Palette an Gegenständen vorbeistürmen – Fahrräder, Motorroller, Laternenpfähle, Wellblechstücke, sogar komplette Teebuden. Binnen einer Sekunde schien sich alle Schwerkraft in einem Spinnrad versammelt zu haben, das von einer unbekannten Macht zwischen den Fingerspitzen herumgewirbelt wurde.
Ich vergrub meinen Kopf in den Armen und rührte mich nicht. Momente später erstarb das Tosen, und eine unheimliche Stille trat ein. Als ich schließlich unter dem Vorbau hervorkletterte, stand ich vor einer Szene der Verwüstung, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Busse lagen auf dem Dach, Motorroller klemmten in Baumkronen fest, Wände waren aus Gebäuden herausgerissen worden und gaben den Blick auf Innenräume frei, deren Deckenventilatoren zu tulpenartigen Spiralen verformt waren. Die Stelle, an der ich zuerst Zuflucht gesucht hatte, die Eingangsbucht vor der Glastür, war ein Wirrwarr aus spitzen Trümmerteilen. Die Scheiben waren geborsten und viele Menschen dabei verletzt worden. Mir wurde bewusst, dass auch ich zu ihnen gezählt hätte, wäre ich dortgeblieben. Wie betäubt lief ich weg.
Lange danach, ich bin mir nicht sicher, wann oder wo genau, ergatterte ich eine Times of India, New-Delhi-Ausgabe, vom 18. März. Die Fotokopien, die ich damals machte, besitze ich noch immer.
»30 Tote« lautete die Balkenüberschrift, »700 Verletzte durch den Zyklon, der auf Nord-Delhi prallte.«
Hier ein paar Auszüge aus dem Bericht:
Delhi, 17. März: Mindestens 30 Menschen wurden getötet und 700 verletzt, viele von ihnen schwer, als heute Abend ein monströser trichterförmiger und von heftigem Niederschlag begleiteter Wirbelsturm Tod und Verwüstung über Maurice Nagar, einen Teil von Kingsway Camp, die Roshanara Road und den Kamla-Nagar-Distrikt in der Hauptstadt brachte. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser der Hauptstadt eingeliefert.
Der Wirbelsturm folgte einer nahezu geraden Linie […]. Augenzeugen berichten, der Sturm habe beim Aufprall auf den Yamuna 7 bis 9 Meter hohe Wellen ausgelöst […]. Die Maurice Nagar Road […] bot einen grauenvollen Anblick. Sie war übersät mit umgestürzten Laternenpfählen […], Bäumen, Ästen, Kabeln, Ziegeln aus den Grundstücksmauern diverser Institutionen, Blechdächern von Handwerksbetrieben und Dhabas, Mengen an Mofas, Bussen und einigen Autos. Nicht ein einziger Baum beiderseits der Straße blieb stehen.
Ein Augenzeuge wurde mit den Worten zitiert:
Ich sah mein eigenes Mofa, das ich in einem furchterregenden Moment stehen gelassen hatte, wie einen Drachen im Sturm davonfliegen. Wir sahen alles, was um uns geschah, völlig entgeistert. Wir sahen Menschen sterben […], waren aber nicht in der Lage, ihnen zu helfen. Die beiden Teebuden an der Ecke von Maurice Nagar wurden ins Nimmerwiedersehen geblasen. An dieser Stelle müssen mindestens 12 bis 15 Personen unter den Trümmern begraben sein. Als diese höllische Raserei nach nur vier Minuten nachließ, sahen wir Tod und Verwüstung um uns herum.
Das Vokabular dieses Berichts zeugt von der Beispiellosigkeit der Katastrophe. So unbekannt war dieses Phänomen, dass die Zeitungen buchstäblich nicht wussten, wie sie es nennen sollten. Und weil ihnen die Worte fehlten, griffen sie auf die Begriffe »Zyklon« und »trichterförmiger Wirbelsturm« zurück.
Das richtige Wort wurde erst am nächsten Tag gefunden. Die Schlagzeilen am 19. März lauteten:
›Ein sehr, sehr seltenes Phänomen‹, sagt das Wetteramt: ›Es war ein Tornado, der gestern auf die nördlichen Teile der Hauptstadt aufschlug – der erste seiner Art.‹ […] Laut dem Indischen Wetterdienst hatte der Tornado einen Durchmesser von etwa 50 Metern und legte innerhalb von 2 bis 3 Minuten eine Strecke von 5 Kilometern zurück.
Es war tatsächlich der erste Tornado gewesen, der seit Beginn der Wetteraufzeichnungen über Delhi – der gesamten Region – niederging.12 Und irgendwie war ich, der ich so gut wie nie diese Strecke lief und mich nur selten in diesem Komplex der Universität aufhielt, mitten in seine Bahn geraten.
Erst sehr viel später wurde mir klar, dass das Auge des Orkans direkt über mich hinweggezogen war. Die Metapher schien mir von gespenstischer Angemessenheit. Denn dieses Geschehen hatte in mir momentan die seltsame Vorstellung von einer Spezies geweckt, die Blickkontakt aufnimmt – das Gefühl, etwas zu erblicken und von etwas erblickt zu werden. In dieser Sekunde des Kontakts wurde irgendetwas tief in meine Seele eingepflanzt, etwas Geheimnisvolles, das sich auf nichts zurückführen lässt und auch nichts mehr zu tun hatte mit der Gefahr, in der ich mich befand, oder mit der Verwüstung, die ich bezeugte: etwas, das keine Eigenart des Dinges an sich war, sondern ein Merkmal seines Verhaltens in dem Moment, in dem sich mein Leben mit ihm kreuzte.
6
Wie so häufig, wenn man von einem unvorhersehbaren Ereignis überfallen wurde, kehrten meine Gedanken jahrelang wieder und wieder zu meiner Begegnung mit dem Tornado zurück. Warum hatte ich einen Weg eingeschlagen, den ich praktisch nie ging, kurz bevor diese Straße von einem historisch beispiellosen Phänomen heimgesucht wurde? Betrachtete ich das Ganze unter dem Aspekt von Zufall oder Fügung, schien es das Erlebte zu verarmen. Es war wie der Versuch, ein Gedicht zu verstehen, indem man die Wörter zählt. Ich ertappte mich, wie ich am anderen Ende des Bedeutungsspektrums zu suchen begann – in den Gefilden des Außergewöhnlichen, Unerklärlichen, Bestürzenden. Doch auch das wurde meiner Erinnerung an das Ereignis nicht gerecht.
Romanciers beuten beim Schreiben zwangsläufig ihre eigenen Erfahrungen aus. Und da die Zahl ungewöhnlicher Ereignisse begrenzt ist, graben sie diese wenigen natürlich wieder und wieder aus dem Gedächtnis, in der Hoffnung, dabei eine noch unentdeckte Goldader zu finden.
Auch ich pflegte wie jeder andere Schriftsteller bei der Niederschrift einer Erzählung in meiner Vergangenheit zu graben. Deshalb wäre es nur recht und billig gewesen, hätte sich meine Begegnung mit dem Tornado in eine Hauptader verwandelt, die ich bis zum letzten kleinen Nugget hätte ausbeuten können.
Es stimmt natürlich, dass Stürme, Fluten und ungewöhnliche Wetterphänomene immer wieder in meinen Büchern auftauchen, vielleicht ist ja auch das ein Vermächtnis des Tornados. Doch seltsamerweise hat noch kein einziger Tornado jemals eine Rolle in meinen Romanen gespielt, was aber nicht etwa an einem mangelnden Bemühen meinerseits liegt. Die Zeitungsausschnitte der Times of India habe ich nur deshalb aufbewahrt, weil ich im Lauf der Jahre immer wieder nach ihnen griff, stets in der Hoffnung, sie in einem Roman verwenden zu können. Aber jeder Versuch erwies sich als Fehlschlag.
Oberflächlich betrachtet gibt es keinen Grund, weshalb ein solches Ereignis so schwer in Erzählliteratur zu übersetzen sein sollte. Immerhin sind viele Romane mit seltsamen Ereignissen angefüllt. Warum will es mir dann trotz intensivster Mühen nicht gelingen, eine Figur eine Straße entlanggehen zu lassen, auf der Momente später ein Tornado niedergehen wird?
Denke ich darüber nach, kommt mir sofort die Frage in den Sinn, was ich mit einer solchen Szene anfangen würde, läse ich sie im Roman eines anderen Autors. Ich vermute, ich würde mit Skepsis reagieren, würde dazu neigen, sie als einen Kunstgriff oder letzten Ausweg zu betrachten. Es würde doch gewiss nur ein Schriftsteller, dessen Fantasie völlig erschöpft ist, auf eine Szene von solch extremer Unwahrscheinlichkeit zurückgreifen, nicht wahr?
Der Schlüsselbegriff ist hier Unwahrscheinlichkeit. Deshalb müssen wir uns zuerst einmal fragen, was dieses Wort überhaupt bedeutet.
Unwahrscheinlich ist nicht das Gegenteil von wahrscheinlich, sondern dessen Beugung: ein Gradient in einem Kontinuum von Wahrscheinlichkeiten. Aber was hat Wahrscheinlichkeit – eine mathematische Idee – mit Fiktion zu tun?
Die Antwort lautet: alles. Der kanadische Sprachphilosoph Ian Hacking, ein prominenter Historiker dieses Konzepts, schreibt, Wahrscheinlichkeit sei eine »Methode, die sich konstituierende Welt zu erfassen, ohne sich dessen bewusst zu sein«.13
Die Wahrscheinlichkeit und der moderne Roman sind genau genommen Zwillinge. Sie wurden in etwa zur gleichen Zeit im selben Volk unter demselben Stern geboren, der beide dazu bestimmte, Gefäße für die gleiche Art von Erfahrung zu sein. Vor der Geburt des modernen Romans ergötzte sich die Erzählliteratur überall, wo man sich Geschichten erzählte, am Niegehörten und Unwahrscheinlichen. Erzählungen wie 1001 Nacht, Eine Reise in den Westen oder das Dekameron springen unbekümmert von einem außergewöhnlichen Ereignis zum nächsten. Anders funktioniert das Geschichtenerzählen auch nicht, da es sich dabei ja um Nacherzählungen von bereits »Geschehenem« handelt – und das Bedürfnis nachzuerzählen, entsteht immer erst dann, wenn es dabei um etwas geht, das aus dem Rahmen fällt, was seinerseits nur eine andere Bezeichnung für das »Außergewöhnliche« oder »Unwahrscheinliche« ist. Im Wesentlichen entwickelt sich eine Geschichte, indem sie Momente und Szenen verbindet, die auf irgendeine Weise unverwechselbar oder »anders« sind, was natürlich wiederum heißt: Ausnahmemomente.
Auch Romane entwickeln sich auf diese Weise. Doch das Charakteristikum dieser literarischen Gattung ist die Verschleierung der Ausnahmemomente, die der Erzählung als Motor dienen. Und das wird durch die Einfügung von »Einschüben« (Füllsel) erreicht, wie der italienische Literaturwissenschaftler Franco Moretti schreibt:
So gesehen haben Einschübe eine ähnliche Funktion wie die guten Manieren, die die Romanciers des 19. Jahrhunderts [wie Jane Austen] ihre Figuren so gerne an den Tag legen ließen; sie sind ein Mechanismus, mit dem sich die ›Geschichtenhaftigkeit‹ des Lebens unter Kontrolle halten läßt; sie verleihen dem Geschehen eine Regelmäßigkeit, einen ›Stil‹.14
Durch ebendiesen Mechanismus werden ganze Welten hervorgezaubert – jedoch mithilfe von alltäglichen Details, die »als Kontrapunkt zum Narrativ« fungieren.
Indem der Roman »das Niegehörte in den Hintergrund verlagert […] und das Alltägliche in den Vordergrund rückt«, nimmt er seine moderne Form an.15
Somit wurde dem modernen Roman in aller Welt durch die Verbannung des Unwahrscheinlichen und die Einfügung des Alltäglichen zum Leben verholfen. Wie dieser Prozess funktioniert, lässt sich mit außerordentlicher Klarheit im Werk von Bankim Chandra Chattopadhyay (anglisiert: Chatterjee) verfolgen, dem bengalischen Schriftsteller und Kritiker aus dem 19. Jahrhundert, der so selbstbewusst das Projekt der Erschaffung eines Raums verfolgte, in dem sich eine Realfiktion europäischen Stils in den Umgangssprachen Indiens schreiben ließ. Bankim, der sich diesem Unterfangen in einem Kontext weit abseits des urbanen Mainstreams widmete, ist sozusagen die Personifikation eines solchen Falls, in dem ein Ausnahmemoment das wahre Leben eines ganzen Denk- und Sittensystems offenbart.16
Tatsächlich versuchte Bankim damit viele sehr einflussreiche alte Erzählformen abzulösen, von den klassischen indischen Epen bis hin zu den buddhistischen Jataka-Geschichten und der ungemein fruchtbaren islamischen Tradition der Urdu-Dastans. Im Lauf der Zeit hatten diese Erzählformen so große Bedeutung und vor allem eine solche Autorität erworben, dass sie weit über den indischen Subkontinent hinaus wirkten. Bankims Versuch, ein eigenes Territorium für eine neue Form von Fiktion zu beanspruchen, war deshalb auf seine Art ein wirklich heroisches Unterfangen. Aber von besonderem Interesse sind seine Explorationen vor allem deshalb, weil seine Kartografierung dieses neuen Territoriums die Gegensätze zwischen dem abendländischen Roman und den anderen, älteren Erzählformen noch reliefartiger hervortreten lässt.
Mit einem langen Essay über die bengalische Literatur startete Bankim 1871 einen Frontalangriff auf Schriftsteller, die ihre Werke im Muster traditioneller Erzählweisen schrieben. Seine Attacke gegen diese sogenannte Sanskritschule fokussierte sich auf das »bloße Erzählen«, wohingegen er für einen Stil plädierte, der »Charakterskizzen und Bildern aus dem bengalischen Leben« Vorrang einräumte.17
Was das praktisch bedeutete, wird vorzüglich in Bankims erstem Roman Rajmohan’s Wife illustriert, den er Anfang der 1860er-Jahre auf Englisch schrieb.18 Hier eine Passage daraus:
Das Haus des Mathur Ghose war ein wahres Musterbeispiel mofussiler [provinzieller] Pracht im Bunde mit einem mofussilen Mangel an Reinlichkeit. […] Von den weit abgelegenen Reisfeldern aus konnte man durch den Zwischenraum des Blattwerks seine hohen Palisaden und geschwärzten Mauern erblicken. Bei näherer Betrachtung ließen sich Teile eines Stucks ehrwürdigen Alters erkennen, bereit, ihrer bejahrten und wettergegerbten Wohnstatt Lebewohl zu sagen.19
Man vergleiche das mit diesen Zeilen aus Gustave Flauberts Madame Bovary:
Man verlässt die Landstraße […] und setzt seinen Weg gerade fort bis auf die Anhöhe bei Le Leux, von wo aus man das Tal überschaut. […] Die Wiesen erstrecken sich unter einem Wulst niedriger Hügel und stoßen dahinter auf die Weiden des Pays de Bray, während auf der Ostseite die Ebene sanft ansteigt, sich beständig dehnt und, so weit das Auge reicht, ihre gelben Weizenfelder ausrollt. Das Wasser, welches am Gras dahinströmt, trennt mit einem weißen Strich die Farbe der Auen von jener der Schollen, und so gleicht das Land einem großen ausgebreiteten Mantel, der einen grünen Samtkragen hat, gesäumt von einer Silberborte.20
In beiden Passagen wird der Leser durch das, was das Auge sieht, in eine »Szene« eingeführt. Wir sind aufgefordert, zu »erblicken«, zu »erkennen«, zu »überschauen«. Verglichen mit anderen Erzählformen war das in der Tat etwas Neues. Anstatt zu lesen, was geschah, erfahren wir, was es zu betrachten gab. Bankim drang gewissermaßen direkt zum Kern der »mimetischen Ambition« des realistischen Romans vor, und von zentraler Bedeutung für sein Experiment mit dieser neuen Form waren detaillierte Schilderungen des Alltäglichen (»Einschübe«).
Wie aber kam es, dass die Rhetorik des Alltäglichen genau zu der Zeit auftauchte, als ein statistisches, von Wahrscheinlichkeits- und Unwahrscheinlichkeitsideen beherrschtes System der Gesellschaft neue Gestalt zu geben begann? Wieso wurden »Einschübe« mit einem Mal so wichtig? Morettis Antwort darauf lautet: weil sie genau die Art Lesevergnügen boten, die zur neuen Regelmäßigkeit des bürgerlichen Lebens passte. »Einschübe« oder Füllsel verleihen dem Roman eine »ruhige Leidenschaft«; sie bewirken, was Max Weber die »Rationalisierung« des modernen Lebens nannte – ein Prozess, »der ausgehend von Wirtschaft und Verwaltung« auf die Freizeit, das Privatleben, das Vergnügen, die Gefühle übergreift. Oder anders gesagt, Einschübe sind ein Versuch, das novellistische Universum zu rationalisieren, es in eine Welt zu verwandeln, »in der es kaum noch Überraschungen gibt, kaum noch Abenteuer und überhaupt keine Wunder mehr«.21
Dieses Denksystem drängte sich nicht nur den Künsten, sondern auch den Naturwissenschaften auf. Genau das ist der Grund, weshalb Stephen Jay Goulds Entdeckung der Tiefenzeit, seine brillante Studie über die geologischen Theorien von Gradualismus und Katastrophismus, im Wesentlichen eine Betrachtung von Erzählweisen ist. Nach Goulds Darstellung der Geschichte wird die katastrophistische Erzählung der Erdgeschichte von Thomas Burnets Sacred Theory of the Earth (1690) exemplifiziert, weil sie sich ganz auf Ereignisse von »unwiederbringlicher Einzigartigkeit« konzentriert. Dem gegenüber steht der gradualistische Ansatz, der zum Beispiel von James Hutton und Charles Lyell vertreten wurde und sich auf die langsamen, in gleichbleibenden und vorhersagbaren Raten ablaufenden Prozesse fokussiert. Das zentrale Credo bei dieser Doktrin lautete, »nichts kann sich auf andere Weise verändern als auf die Art, in der man die Dinge sich gegenwärtig verändern sieht«.22 Oder einfacher ausgedrückt: »Die Natur macht keine Sprünge.«23
Das Problem ist nur, dass die Natur allemal hüpft, wenn nicht gar springt.24 Die geologische Geschichte bezeugt viele Brüche, von denen einige zu Artensterben und andere zu Katastrophen wie jener führten, welche die Erde in Gestalt des Chicxulub-Asteroiden ereilte, durch den wahrscheinlich die Dinosaurier ausgerottet wurden. Jedenfalls ist unbestreitbar, dass sowohl unser Planet als auch seine Bewohner in unvorhersehbaren Intervallen und auf höchst unwahrscheinliche Weisen von Katastrophen heimgesucht wurden und werden.
Welches von beidem hat also Vorrang in der real existierenden Welt – der vorhersehbare Prozess oder das unwahrscheinliche Ereignis? Gould erklärt, »daß die einzig mögliche Antwort nur sein kann: ›Beides oder keins von beiden.‹«25 Oder wie der National Research Council of the United States es formuliert: