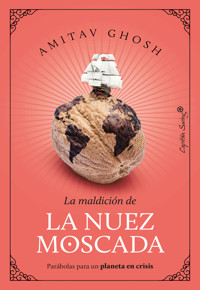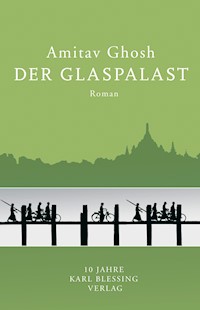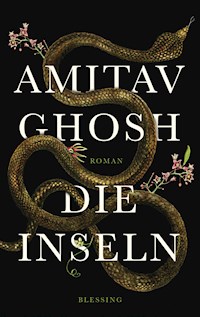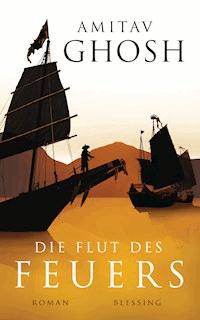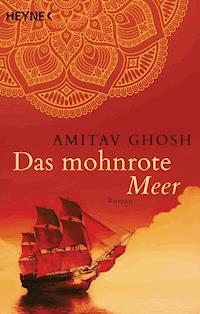
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ibis-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Wie ein großer Vogel gleitet das stolze Segelschiff den Ganges hinauf. Diti, die auf den Feldern am Flussufer für Englands Opiumhandel schuftet, kann sich die Vision nicht erklären. Hat das Schicksal ihr ein Zeichen gesandt? Sie flieht nach Kalkutta, wo die »Ibis«, ein ehemaliges Sklavenschiff, bereits auf sie zu warten scheint. Mit den anderen Passagieren hat die junge Frau nur eines gemeinsam: Sie alle müssen Indien und ihr bisheriges Leben für immer hinter sich lassen.
Historienepos, Gesellschafts- und Abenteuerroman zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 837
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
DAS BUCH
»Das Bild eines stolzen Schiffes unter vollen Segeln trat Diti an einem ganz gewöhnlichen Tag vor Augen, aber sie wusste sofort, dass die Vision ein Fingerzeig des Schicksals war.«
Als Diti nach dem Tod ihres Mannes erfährt, dass sie in der Hochzeitsnacht unter Drogen gesetzt und von ihrem Schwager vergewaltigt wurde, flieht sie mit ihrer kleinen Tochter nach Kalkutta, wo das Schiff aus ihrer Vision bereits auf sie zu warten scheint. Für die junge Frau bedeutet die »Ibis« Hoffnung und Neuanfang. Doch hinter der Mündung des Ganges wartet das »schwarze Wasser«, so dunkel und geheimnisvoll wie die Vergangenheit, der die Menschen an Bord entfliehen wollen.
»Ein erstaunliches Panorama bewegender Schicksale.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Amitav Ghosh ist ein umwerfender Erzähler.« Die Weltwoche
DER AUTOR
Amitav Ghosh, 1956 in Kolkata (früher Kalkutta) geboren, studierte Geschichte und Sozialanthropologie in Neu-Delhi und unterrichtete unter anderem an der Columbia und der Harvard University. Der große Durchbruch gelang dem schon vielfach ausgezeichneten Autor weltweit mit Der Glaspalast. Mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt er in New York, Kolkata und auf Goa.Vom Unterrichten hat er sich mittlerweile zurückgezogen, um den zweiten Teil der Ibis-Trilogie fertigzustellen.
Für Nayanzum fünfzehnten
Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL
Land
ERSTES KAPITEL
Das Bild eines stolzen Schiffes unter vollen Segeln auf hoher See trat Diti an einem ganz gewöhnlichen Tag vor Augen, aber sie wusste sofort, dass die Vision ein Fingerzeig des Schicksals war, denn sie hatte ein solches Schiff noch nie zuvor gesehen, nicht einmal im Traum. Wie auch, da sie doch im nördlichen Bihar lebte, vierhundert Meilen von der Küste entfernt? Ihr Dorf lag so weit im Landesinneren, dass das Meer so fern schien wie die Unterwelt: Es war der Abgrund der Finsternis, wo der heilige Ganges im kālā-pānī verschwand, im »Schwarzen Wasser«.
Es geschah am Ende des Winters, in einem Jahr, in dem die Mohnpflanzen merkwürdig lange zögerten, ihre Blütenblätter abzuwerfen: Meilenweit schien der Ganges, von Benares abwärts, zwischen zwei Gletschern dahinzufließen, denn seine Ufer waren mit dicken Teppichen weiß blühender Blumen bedeckt. Es war, als hätten sich die Schneemassen des Himalaja über die Ebenen gebreitet, um auf das Holi-Fest mit seinen üppigen Frühlingsfarben zu warten.
Das Dorf, in dem Diti lebte, lag unweit der Stadt Ghazipur, ungefähr fünfzig Meilen östlich von Benares. Wie alle ihre Nachbarn war Diti besorgt wegen der verspäteten Mohnernte. An dem bewussten Tag stand sie früh auf und erledigte mechanisch ihre täglichen Pflichten, legte für Hukam Singh, ihren Mann, frisch gewaschene Kleidung zurecht, einen Dhoti und eine kamīz, und stellte das eingelegte Gemüse und die rotīs bereit, die er zu Mittag essen würde. Als sie sein Essen eingepackt hatte, legte sie eine Pause ein, um rasch in ihren Schrein zu gehen. Später, wenn sie gebadet und sich umgezogen hatte, würde sie ihre pūjā verrichten, mit Blumen und Opfergaben; jetzt aber, noch im Nachtsari, trat sie nur unter die Tür und legte kurz die Hände aneinander.
Schon bald kündigte ein quietschendes Rad den Ochsenkarren an, der Hukam Singh in die Fabrik im drei Meilen entfernten Ghazipur bringen würde. Kein weiter Weg, aber doch so weit, dass Hukam Singh ihn nicht zu Fuß zurücklegen konnte, denn er war als Sepoy in einem britischen Regiment am Bein verwundet worden. Die Behinderung war jedoch nicht so schwer, dass er Krücken gebraucht hätte – er konnte ohne Hilfe bis zu dem Karren gehen. Diti, die ihm mit einem Schritt Abstand folgte, trug ihm in einem Tuch sein Essen und sein Wasser nach und händigte ihm das Päckchen aus, als er auf den Karren gestiegen war.
Kalua, der Fahrer des Ochsenkarrens, war ein Hüne, machte aber keine Anstalten, seinem Fahrgast zu helfen, und achtete darauf, sein Gesicht vor ihm zu verbergen: Er war Chamar, und für Hukam Singh als Angehörigem der hohen Rajput-Kaste wäre der Anblick seines Gesichts ein böses Omen für den bevorstehenden Tag gewesen. Nachdem er auf den Karren geklettert war, saß der frühere Sepoy nun mit dem Rücken zu Kalua und hielt sein Bündel auf dem Schoß, damit es nicht mit irgendwelchen Gegenständen des Fahrers in Berührung kam. So saßen sie, Fahrer und Fahrgast, während der Karren über die Straße nach Ghazipur rumpelte – in freundschaftlichem Gespräch zwar, doch ohne sich auch nur einmal anzusehen.
Auch Diti verbarg sorgsam ihr Gesicht vor Kalua; erst als sie wieder ins Haus ging, um Kabutri, ihre sechsjährige Tochter, zu wecken, ließ sie es zu, dass der ghūngat ihres Saris ihr vom Kopf rutschte. Kabutri lag zusammengerollt auf ihrer Matte, und Diti erkannte an ihrem rasch wechselnden Gesichtsausdruck – bald schmollte, bald lächelte sie –, dass sie tief in einem Traum befangen war. Sie wollte sie schon wecken, doch dann hielt sie inne und trat zurück. Im Gesicht ihrer schlafenden Tochter entdeckte sie die Konturen ihrer eigenen Züge – die gleichen vollen Lippen, die gleiche rundliche Nase, das gleiche vorspringende Kinn –, nur waren die Linien bei dem Kind noch klar und scharf, während sie bei ihr mit der Zeit undeutlich geworden waren, gleichsam verwischt. Nach sieben Jahren Ehe war Diti selbst noch kaum mehr als ein Kind, auch wenn sich in ihrem dichten schwarzen Haar schon ein paar weiße Fäden zeigten. Ihre Gesichtshaut, von der Sonne ausgedörrt und gedunkelt, wurde um Mundwinkel und Augen herum bereits schuppig und rissig. Doch bei allen Sorgenfalten und aller Unscheinbarkeit ihres Äußeren hob sie sich doch in einem vom Alltäglichen ab: Sie hatte hellgraue Augen, was in diesem Teil des Landes ungewöhnlich war. Die Farbe – oder die Farblosigkeit – ihrer Augen bewirkte, dass man sie zugleich für eine Blinde und eine Seherin halten konnte. Das verunsicherte die Kinder und verstärkte ihre Vorurteile und abergläubischen Ansichten so sehr, dass sie ihr manchmal Schimpfwörter nachriefen – churail, dāiniyā –, als wäre sie eine Hexe. Doch ein einziger Blick aus ihren Augen genügte, und sie stoben davon. Obwohl Diti durchaus ein wenig stolz darauf war, dass sie diese Macht besaß, war sie um ihrer Tochter willen froh, ihr diesen Aspekt ihres Aussehens nicht vererbt zu haben – sie erfreute sich an Kabutris dunklen Augen, die so schwarz waren wie ihr glänzendes Haar. Als sie so auf das träumende Gesicht ihrer Tochter hinabsah, lächelte Diti und beschloss, sie doch nicht zu wecken: In drei bis vier Jahren würde das Mädchen heiraten und fortgehen; sie würde noch genug arbeiten müssen, wenn sie erst im Haus ihres Mannes lebte; die wenigen Jahre, die sie noch daheim war, konnte sie sich genauso gut ausruhen.
Diti aß rasch einen Bissen rotī und trat dann auf den flachen Vorplatz aus gestampfter Erde hinaus, der ihre Lehmhütte von den Mohnfeldern trennte. Im Licht der Morgensonne sah sie mit großer Erleichterung, dass einige der Blüten endlich begonnen hatten, ihre Blätter abzuwerfen. Auf dem Nachbarfeld war Chandan Singh, der jüngere Bruder ihres Mannes, bereits bei der Arbeit. Mit seinem Opiummesser ritzte er einige der kahlen Kapseln an; trat über Nacht genügend Saft aus, würde er morgen mit seiner Familie das ganze Feld bearbeiten. Der Zeitpunkt musste genau stimmen, denn die kostbare Milch floss nur während einer kurzen Spanne im Lebenszyklus der Pflanze: ein, zwei Tage zu früh oder zu spät, und die Mohnkapseln waren so wertlos wie Unkrautblüten.
Chandan Singh hatte Diti auch gesehen, und er war einer, der niemanden vorbeigehen lassen konnte, ohne ihn anzusprechen. Ein lüstern blickender, weichlicher junger Mann mit einer Brut von fünf Kindern, ließ er keine Gelegenheit aus, Diti ihre geringe Nachkommenschaft vorzuhalten. »Was ist los?«, rief er und leckte einen Tropfen frischen Saft von der Spitze seines Messers. »Wieder allein bei der Arbeit? Wie lange willst du noch so weitermachen? Du brauchst einen Sohn, der dir zur Hand gehen kann. Schließlich bist du nicht unfruchtbar …«
Diti kannte die Art ihres Schwagers zur Genüge, und es fiel ihr nicht schwer, seine anzüglichen Reden zu ignorieren: Sie kehrte ihm den Rücken und ging, einen großen Korb auf der Hüfte, zu ihrem eigenen Feld. Zwischen den Reihen der Mohnblumen war die Erde mit seidigen Blütenblättern bedeckt, und sie scharrte sie mit beiden Händen zusammen und legte sie in ihren Korb. Noch vor ein, zwei Wochen hätte sie sich seitwärts bewegt, um die Blüten nicht zu berühren, doch nun schritt sie munter aus und beachtete es kaum, wenn ihr wehender Sari die Blütenblätter büschelweise von den reifenden Kapseln streifte. Als der Korb voll war, trug sie ihn zurück und entleerte ihn neben dem chūlhā, dem Herd vor dem Haus, auf dem sie meist das Essen kochte. Dieser Teil des Eingangs lag im Schatten eines riesigen Mangobaums, an dem sich gerade erst die Grübchen zeigten, aus denen die ersten Knospen des Frühlings entspringen würden. Froh, der Sonne entronnen zu sein, ging Diti vor dem Herd in die Hocke und warf einen Armvoll Feuerholz in die Asche, unter der noch die Glut vom Abend zuvor glomm.
Kabutri war aufgewacht, und als sie in der Tür erschien, war Ditis nachsichtige Stimmung verflogen. »So spät?«, schalt sie. »Wo bleibst du denn? Denkst du, es gibt nichts zu tun?«
Diti trug ihrer Tochter auf, die Mohnblütenblätter zu einem Häufchen zusammenzufegen, während sie damit beschäftigt war, das Feuer anzufachen und eine schwere eiserne Pfanne zu erhitzen. Als die Pfanne heiß genug war, streute sie eine Handvoll Blütenblätter hinein und drückte sie mit einem Lumpen an. Durch das Rösten verfärbten sie sich dunkel und klebten zusammen, sodass sie schon bald genauso aussahen wie die runden rotīs aus Weizenmehl, die Diti ihrem Mann zum Mittagsmahl mitgegeben hatte. Und »rotī« war auch der Name dieser Mohnblütenhüllen, obwohl sie einem ganz anderen Zweck dienten als ihre Namensvettern: Sie wurden an die Sudder Opium Factory verkauft, die Opiumfabrik in Ghazipur, wo man mit ihnen die irdenen Behälter auskleidete, in denen das Opium verpackt wurde.
Kabutri hatte unterdessen etwas Teig geknetet und ein paar rotīs gerollt, und Diti buk sie noch rasch, bevor sie das Feuer löschte: Die rotīs wurden beiseitegelegt, um später zu den Resten vom Vortag gegessen zu werden – abgestandenem alūposta , in Mohnsamenpaste gegarten Kartoffeln. Nun wandten sich ihre Gedanken wieder ihrem Schrein zu: Da die Stunde der mittäglichen pūjā nahte, wurde es Zeit für ein Bad im Fluss. Nachdem sie in Kabutris und ihr eigenes Haar Mohnsamenöl einmassiert hatte, legte sie sich ihren zweiten Sari über die Schulter und ging mit ihrer Tochter über das Feld zum Wasser hinunter.
Die Mohnpflanzen endeten an einem sandigen Ufer, das sanft zum Ganges hin abfiel; von der Sonne aufgeheizt, war der Sand so heiß, dass er an den Sohlen ihrer nackten Füße brannte. Plötzlich fiel die Last mütterlicher Wohlanständigkeit von Ditis gebeugten Schultern ab, und sie rannte hinter ihrer Tochter her, die ein Stück vorausgelaufen war. Unten am Wasser richteten sie mit lauter Stimme ein Bittgebet an den Fluss – »Jay gangā maiyā kī …«, holten tief Luft und sprangen hinein.
Beide lachten, als sie wieder an die Oberfläche kamen: Es war die Jahreszeit, in der das Wasser sich nach dem ersten Schock schon bald als erfrischend kühl erweist. Obwohl die große Sommerhitze erst in einigen Wochen einsetzen würde, war der Strom schon merklich geschrumpft. Diti wandte sich nach Westen, wo Benares lag, und hob ihre Tochter hoch, sodass sie eine Handvoll Wasser als Tribut an die heilige Stadt verspritzen konnte. Zusammen mit der Opfergabe floss ein Blatt aus den Händen des Kindes. Sie sahen zu, wie es flussabwärts trieb, auf die Ghats von Ghazipur zu.
Die Mauern der Opiumfabrik von Ghazipur waren teilweise hinter Mango- und Jackfruchtbäumen verborgen, aber die britische Flagge auf dem Dach überragte knapp die Wipfel, desgleichen der Turm der Kirche, in der die Aufseher der Fabrik beteten. An dem Ghat der Fabrik hatte ein einmastiger Patela festgemacht, der den Wimpel der britischen Ostindien-Kompanie führte. Er hatte eine Ladung chalān-Opium aus einer der Niederlassungen der Kompanie geholt und wurde gerade von einer langen Reihe von Kulis entladen.
»Ma«, sagte Kabutri und schaute zu ihrer Mutter auf, »wo fährt das Boot hin?«
Diese Frage war es, die Ditis Vision auslöste: Plötzlich stand ihr das Bild eines riesigen Schiffes mit zwei hoch aufragenden Masten vor Augen. An den Masten waren große, blendend weiße Segel angeschlagen. Der Bug des Schiffes verjüngte sich zu einer Galionsfigur mit einem langen Schnabel, wie bei einem Storch oder einem Reiher. Im Hintergrund, nicht weit vom Bug, stand ein Mann, und obwohl sie ihn nicht deutlich sah, hatte sie das Gefühl, dass es sich um einen ganz bestimmten, ihr aber nicht bekannten Menschen handelte.
Diti wusste, dass sie nichts Materielles vor sich sah – wie etwa den vor der Fabrik festgemachten Lastkahn. Sie hatte das Meer noch nie gesehen, war nie über ihren Bezirk hinausgekommen, hatte nie eine andere Sprache als ihr heimatliches Bhojpuri gesprochen, und doch hegte sie nicht den geringsten Zweifel, dass es dieses Schiff tatsächlich irgendwo gab und dass es auf sie zuhielt. Diese Gewissheit machte ihr Angst, denn sie hatte noch nie etwas gesehen, was dieser Erscheinung auch nur entfernt ähnlich gewesen wäre, und konnte sich nicht erklären, was es bedeuten mochte.
Kabutri merkte, dass etwas Ungewöhnliches geschehen war, denn sie wartete eine Weile und fragte erst dann: »Ma? Was schaust du an? Was siehst du?«
Ditis Gesicht war zu einer Maske der Furcht und der Vorahnung erstarrt, als sie mit zitternder Stimme sagte: »Betī, ich habe ein Schiff gesehen.«
»Meinst du das Boot dort drüben?«
»Nein, betī, es war ein Schiff, wie ich noch nie eins gesehen habe. Es war wie ein großer Vogel, mit Segeln wie Flügel und einem langen Schnabel.«
Kabutri schaute flussabwärts und fragte: »Kannst du zeichnen, was du gesehen hast?«
Diti nickte, und sie wateten ans Ufer. Sie zogen sich rasch um und füllten einen Krug mit Wasser aus dem Ganges. Als sie wieder zu Hause waren, zündete Diti eine Lampe an und führt Kabutri in den Schrein. Der dunkle Raum hatte rußgeschwärzte Wände und roch durchdringend nach Öl und Räucherwerk. Drinnen stand ein kleiner Altar mit Statuetten von Shiva und Ganesh und gerahmten Drucken von Durga und Krishna. Doch der Raum war nicht nur ein Schrein für die Götter, sondern auch Ditis persönliches Pantheon der Verehrung, und er enthielt viele Andenken an ihre Familie und ihre Vorfahren – darunter Erinnerungsstücke wie die Holzpantinen ihres verstorbenen Vaters, eine Halskette aus rudrāksha-Perlen, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte, und verblasste Abdrücke von den Füßen ihrer Großeltern, die ihnen auf dem Scheiterhaufen abgenommen worden waren. Die Wände um den Altar waren Bildern vorbehalten, die Diti selbst umrissartig auf papierähnliche Scheiben aus Mohnblütenblättern gezeichnet hatte, darunter die Kohlezeichnungen von zwei Brüdern und einer Schwester, die schon im Kindesalter gestorben waren. Auch einige noch lebende Verwandte waren vertreten, doch nur in Gestalt skizzenhafter Porträts auf Mangoblättern: Diti glaubte, es bringe Unglück, wenn man versuchte, allzu realistische Bildnisse derer anzufertigen, die noch auf dieser Erde weilten. So war ihr geliebter älterer Bruder Kesri Singh nur mit ein paar Strichen angedeutet, die sein Sepoy-Gewehr und seinen aufwärtsgezwirbelten Schnurrbart darstellten. Als sie jetzt ihren Schrein betrat, hob Diti ein grünes Mangoblatt auf, tauchte eine Fingerspitze in ein Schälchen mit zinnoberroter Farbe und zeichnete mit wenigen Strichen zwei flügelähnliche Dreiecke in der Schwebe über einem geschwungenen Gebilde, das in einen hakenförmigen Schnabel auslief. Es hätte ein Vogel im Flug sein können, doch Kabutri erkannte sofort, was es war – ein Bild von einem Zweimaster mit gesetzten Segeln. Sie staunte darüber, dass ihre Mutter das Bild gezeichnet hatte, als stelle es etwas dar, was es wirklich gab.
»Kommt es in den Schrein?«, fragte sie.
»Ja«, sagte Diti.
Kabutri verstand nicht, was ein Schiff im Andachtsraum der Familie zu suchen hatte. »Aber warum?«, fragte sie. »Ich weiß nicht.« Diti fragte sich selbst, woher ihre Gewissheit kam. »Ich weiß einfach, dass es da hingehört; und nicht nur das Schiff selbst, sondern auch viele von denen, die auf dem Schiff sind; auch sie gehören an die Wände des Schreins.« »Aber was sind das für Leute?«, wollte das Kind wissen.
»Ich weiß es noch nicht«, sagte Diti. »Aber ich weiß, dass sie kommen werden und dass ich sie sehen werde.«
Die höchst ungewöhnliche geschnitzte Figur, die das Bugspriet der Ibis trug – der Kopf eines Vogels mit einem langen Schnabel –, genügte denen, die so etwas brauchten, als Beweis dafür, dass dies in der Tat das Schiff war, das Diti sah, als sie bis an die Hüften im Wasser des Ganges stand. Später sollten sogar altgefahrene Seeleute zugeben, dass Ditis Zeichnung ihren Gegenstand geradezu unheimlich genau wiedergab, zumal wenn man bedachte, dass sie von jemandem angefertigt worden war, der noch nie einen Zweimastschoner oder überhaupt irgendein hochseetaugliches Schiff gesehen hatte.
Mit der Zeit setzte sich bei den vielen, die nach und nach in der Ibis ihren Ahnen sahen, die Überzeugung durch, dass es der Fluss selbst gewesen war, der Diti die Vision beschert hatte: dass das Bild der Ibis elektrischem Strom gleich flussaufwärts transportiert worden war, sobald das Schiff mit dem heiligen Gewässer in Berührung kam. Das würde bedeuten, dass es in der zweiten Märzwoche 1838 geschah, denn in dieser Woche ging die Ibis vor der Ganga-Sagar-Insel, wo der heilige Fluss sich in den Golf von Bengalen ergießt, vor Anker. Hier wartete die Ibis auf den Lotsen, der sie nach Kalkutta führen sollte, und von hier aus sah Zachary Reid zum ersten Mal indischen Boden. Was er sah, war ein dichtes Mangrovendickicht und ein schlammiger Küstenstreifen, der unbewohnt schien, bis die Bumboote ausschwärmten – eine kleine Flottille von Dingis und Kanus, deren Besitzer darauf aus waren, den neu eingetroffenen Seeleuten Obst, Fisch und Gemüse zu verkaufen.
Zachary Reid war von mittelgroßer, kräftiger Statur, mit einer Haut von der Farbe alten Elfenbeins und einem gewaltigen Schopf lackschwarzer Locken, die ihm über die Stirn und in die Augen fielen. Seine Augen waren genauso dunkel wie sein Haar, jedoch mit haselnussbraunen Glitzerpünktchen durchsetzt: Als er ein Kind war, sagten die Leute oft, zwei Augensterne wie die seinen könne man einer Herzogin als Diamanten verkaufen. (Später, als es an der Zeit war, ihn in Ditis Schrein aufzunehmen, wurde viel Aufhebens von seinem leuchtenden Blick gemacht.) Weil er oft und gern lachte und sich stets heiter und unbeschwert gab, hielten ihn manche für jünger, als er war, aber Zachary belehrte sie immer rasch eines Besseren: Als Sohn einer freigelassenen Sklavin aus Maryland war er sehr stolz darauf, dass er sein genaues Alter, ja sogar das genaue Datum seiner Geburt kannte: Er sei zwanzig, sagte er denen, die sich geirrt hatten, nicht einen Tag jünger und nur wenige älter.
Zachary hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, jeden Tag an mindestens fünf Dinge zu denken, die er preisen konnte, eine Übung, die seine Mutter ihm verordnet hatte, als notwendiges Korrektiv für eine bisweilen allzu spitze Zunge. Seit seiner Abreise aus Amerika hatte fast täglich die Ibis selbst auf seiner Liste preiswürdiger Dinge gestanden. Nicht, dass sie besonders schnittig oder rassig gewesen wäre, ganz im Gegenteil: Die Ibis war ein Schoner von altmodischem Aussehen, weder so schlank noch mit einem so glatten Deck wie die Klipper, für die Baltimore berühmt war. Sie hatte ein kurzes Achterdeck, eine erhöhte Back mit Backdeck am Bug und ein Deckshaus mittschiffs, das als Kombüse und Kabine für die Bootsleute und Stewards diente. Ihres stark gegliederten Hauptdecks und ihres bauchigen Rumpfes wegen wurde die Ibis von alten Seeleuten manchmal für eine schonergetakelte Bark gehalten: Ob das seine Berechtigung hatte, wusste Zachary nicht zu sagen, aber für ihn war sie nie etwas anderes als der Toppsegelschoner, den er vorfand, als er auf ihr anheuerte. Aus seiner Sicht besaß die jachtähnliche Takelung der Ibis eine ganz ungewöhnliche Anmut, denn ihre Segel standen in Richtung der Längsachse statt quer zum Rumpf. Er konnte sich schon vorstellen, dass sie mit vollen Segeln an einen weißflügeligen Vogel im Flug erinnerte; andere große Schiffe mit ihrer hoch gestaffelten Last rechteckiger Rahsegel wirkten dagegen fast unansehnlich.
Eines wusste Zachary genau: Erbaut worden war die Ibis für den Sklavenhandel. Das war auch der Grund, warum sie den Besitzer gewechselt hatte, denn ihr alter Eigner war zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht schnell genug war, um den Fregatten der Royal Navy zu entkommen, die neuerdings vor der westafrikanischen Küste patrouillierten, seit die Sklaverei vom britischen Parlament geächtet worden war. Wie bei manch anderem Sklavenschiff hatten die neuen Besitzer den Schoner im Hinblick auf einen anderen Wirtschaftszweig erworben: den Opiumhandel. Käufer war in diesem Fall eine Firma namens Burnham Bros., ein Schifffahrts- und Handelsunternehmen mit weitverzweigten Interessen in Indien und China.
Die Repräsentanten der neuen Eigner hatten die Ibis unverzüglich nach Kalkutta beordert, wo der Chef des Unternehmens, Benjamin Brightwell Burnham, seinen Hauptsitz hatte. Nach ihrer Ankunft sollte sie umgebaut werden, und zu diesem Zweck war Zachary angeheuert worden. Er hatte acht Jahre lang als Schiffszimmermann auf der Gardner-Werft in Fell’s Point, Baltimore, gearbeitet und besaß alle erforderlichen Fähigkeiten, um den Umbau des alten Sklavenschiffs zu leiten, doch von der Seefahrt verstand er auch nicht mehr als jeder gewöhnliche Zimmermann – dies war seine erste Seereise. Aber er hatte gerade deshalb angeheuert, weil er die Seemannschaft erlernen wollte, und er ging voll freudiger Erwartung an Bord mit einem Seesack, der kaum mehr enthielt als Kleidung zum Wechseln und eine Blechflöte, die sein Vater ihm geschenkt hatte, als er noch ein Junge war. Auf der Ibis machte er eine kurze, aber denkbar harte Lehrzeit durch: Das Logbuch ihrer Reise war fast vom ersten Tag an eine einzige Litanei von Schwierigkeiten. Mr. Burnham hatte es so eilig, seinen Schoner nach Indien zu bekommen, dass die Ibis in Baltimore unterbemannt in See ging, mit ganzen neunzehn Mann, von denen neun mit »Hautfarbe schwarz« geführt wurden, unter ihnen auch Zachary. Trotz der zu geringen Besatzung ließ der Proviant an Menge und Güte zu wünschen übrig, und das hatte Anlass zu Misshelligkeiten zwischen Offizieren und Mannschaft gegeben. Dann geriet die Ibis in grobe See, und man stellte fest, dass ihre Planken leicht leckten: Zachary entdeckte, dass das Zwischendeck voller Löcher war, die Generationen gefangener Afrikaner in das Holz gekratzt und gebohrt hatten. Die Ibis hatte Baumwolle geladen, von der die Kosten der Überfahrt bestritten werden sollten; nun moderten die Ballen und mussten über Bord geworfen werden.
Vor der Küste Patagoniens erzwangen schwere Stürme eine Änderung des Kurses, der die Ibis über den Pazifik und um Java Head herum hätte führen sollen. Stattdessen wurde nun das Kap der Guten Hoffnung angesteuert mit dem Ergebnis, dass das Schiff abermals in schweres Wetter geriet und später vierzehn Tage lang in den Kalmen vor sich hin dümpelte. Da die Mannschaft auf halbe Ration gesetzt wurde und von Maden wimmelnden Schiffszwieback und verdorbenes Fleisch essen musste, brach an Bord die Ruhr aus: Noch bevor der Wind wieder auffrischte, waren drei Mann tot, und zwei der schwarzen Besatzungsmitglieder wurden in Ketten gelegt, weil sie das Essen verweigert hatten, das ihnen vorgesetzt wurde. Mit so wenig Leuten an Bord musste Zachary sein Zimmermannswerkzeug beiseitelegen und die Aufgaben eines Vortoppmanns übernehmen.
Dann geschah es, dass der Zweite Steuermann, ein Leuteschinder, den alle schwarzen Besatzungsmitglieder hassten, über Bord fiel und ertrank. Jeder wusste, dass es kein Unfall war, doch die Stimmung an Bord war inzwischen so explosiv, dass der Kapitän, ein scharfzüngiger Bostoner Ire, die Sache auf sich beruhen ließ. Zachary gab als Einziger an Bord ein Gebot ab, als die persönliche Habe des Toten versteigert wurde, und gelangte auf diese Weise in den Besitz eines Sextanten und einer vollen Kleiderkiste.
Da er weder aufs Achterdeck noch aufs Vorschiff gehörte, wurde Zachary schon bald zum Vermittler zwischen den beiden Teilen des Schiffes und übernahm die Pflichten des Zweiten Steuermanns. Er war nicht mehr so unbeleckt wie zu Beginn der Überfahrt, aber auch bei Weitem nicht seinen neuen Aufgaben gewachsen. Seine halbherzigen Bemühungen trugen nicht zur Verbesserung der Moral bei, und als der Schoner in Kapstadt einlief, verkrümelte sich die Mannschaft über Nacht und erzählte überall herum, wie unerträglich die Verhältnisse an Bord und wie erbärmlich die Bezahlung gewesen sei. Der Ruf der Ibis wurde dadurch dermaßen beschädigt, dass kein einziger Amerikaner oder Europäer, nicht einmal der übelste Rauf- und Saufbold, sich überreden ließ, auf dem Schoner anzuheuern. Die einzigen Matrosen, die sich an Bord der Ibis wagten, waren Laskaren.
Es war Zacharys erste Begegnung mit dieser Sorte Matrosen. Er hatte die Laskaren immer für ein Volk oder einen Stamm gehalten, wie die Cherokee oder die Sioux; jetzt erfuhr er, dass sie aus weit auseinanderliegenden Weltgegenden stammten und außer dem Indischen Ozean nichts gemeinsam hatten; unter ihnen waren Chinesen und Ostafrikaner, Araber und Malaien, Bengalen und Goaner, Tamilen und Arakanesen. Sie bildeten Gruppen von zehn bis fünfzehn Mann, und jede von ihnen hatte einen Sprecher. Es war unmöglich, diese Trupps auseinanderzureißen – entweder man nahm alle, oder man bekam keinen –, und sie waren zwar billig, hatten aber ihre eigenen Vorstellungen davon, wie viel sie arbeiten würden, was darauf hinauslief, dass man drei bis vier Laskaren für eine Aufgabe brauchte, die ein einziger Vollmatrose gut und gern allein hätte erledigen können. Der Kapitän erklärte sie zur faulsten Bande von Niggern, die er je gesehen habe, aber Zachary fand sie vor allem lächerlich. Schon allein ihre Bekleidung: Ihre Füße waren so nackt wie am Tag ihrer Geburt, und viele besaßen offenbar als einzige Kleidung ein Stück Kambrik, das sie sich um die Körpermitte schlangen. Einige stolzierten in kurzen Hosen mit einer Schnur um den Bauch herum, andere trugen Sarongs, die wie Unterröcke um ihre hageren Beine flatterten, sodass das Deck manchmal dem Salon eines Freudenhauses glich. Wie konnte ein Mann barfuß einen Mast hochklettern, nur mit einem Tuch umwickelt wie ein neugeborenes Kind? Flink und wendig waren sie, das schon, doch Zachary geriet immer von Neuem aus der Fassung, wenn er sie affengleich in den Wanten hängen sah. Und wenn ihre Sarongs im Wind wehten, wandte er vorsichtshalber den Blick ab, aus Angst vor dem, was er womöglich sehen würde, wenn er nach oben schaute.
Nach langem Überlegen entschied sich der Kapitän für einen Laskarentrupp, der von einem gewissen Serang Ali angeführt wurde. Dieser war eine höchst eindrucksvolle Gestalt, mit einem Gesicht, um das ihn ein Dschingis-Khan beneidet hätte: hager, lang und schmal, mit flinken schwarzen Augen über verwegen schräg geschnittenen Backenknochen. Zwei schüttere Schnurrbartsträhnen hingen ihm aufs Kinn herab und umrahmten einen Mund, der ständig in Bewegung und in den Winkeln leuchtend rot gefärbt war: Es war, als schmatzte er ständig, nachdem er wie ein blutdürstiger Tatar aus den geöffneten Adern einer Stute getrunken hatte. Auch die Auskunft, die Substanz in seinem Mund sei pflanzlicher Herkunft, war nicht dazu angetan, Zachary zu beruhigen: Einmal, als der Serang einen Strom blutroten Safts über Bord spie, fiel ihm auf, dass das Wasser unten von Haifischflossen aufgewühlt wurde. Wie harmlos konnte dieses Betel-Zeug sein, wenn sogar ein Hai es mit Blut verwechselte?
Die Aussicht darauf, mit dieser Mannschaft nach Indien zu segeln, war so unerquicklich, dass der Erste Steuermann ebenfalls verschwand; so eilig hatte er es, von Bord zu kommen, dass er einen Sack Kleider zurückließ. Als man dem Kapitän sagte, dass der Steuermann abgehauen sei, knurrte er: »Hat die Leine gekappt, ja? Kann’s ihm nicht mal verdenken. Ich wär auch längst auf und davon, wenn ich mein Geld schon hätte.«
Der nächste Anlaufhafen der Ibis sollte die Insel Mauritius sein, wo sie ihre Getreideladung löschen und Ebenholz und anderes Hartholz an Bord nehmen sollte. Da sich bis zum Auslaufen kein anderer Seeoffizier auftreiben ließ, musste Zachary als Erster Steuermann einspringen. So kam es, dass er infolge von Desertion und Sterbefällen im Lauf einer einzigen Überfahrt vom bloßen Schiffszimmermann zum zweiten Mann an Bord mit eigener Kajüte aufstieg. Das einzig Traurige an seinem Umzug vom Vorschiff nach mittschiffs war, dass dabei seine geliebte Blechflöte verschwand und nicht mehr aufzufinden war.
Bis dahin hatte Zachary auf Weisung des Kapitäns seine Mahlzeiten unter Deck eingenommen – »ich will keine Farbe an meinem Tisch, auch wenn’s bloß ein mattes Gelb ist«. Jetzt aber speiste er nicht mehr allein, sondern bestand darauf, dass Zachary sich zu ihm an den Tisch in seiner kleinen Kajüte setzte, wo sie von einer ansehnlichen Schar Laskaren-Schiffsjungen bedient wurden.
Kaum waren sie unter Segeln, da musste Zachary schon wieder einen Lehrgang absolvieren, diesmal hinsichtlich der Sitten und Gebräuche der neuen Mannschaft. Anstelle der üblichen Karten spielten die Männer jetzt auf aus Leinen improvisierten Brettern pachīsī, die vertrauten fröhlichen Shantys erklangen in ganz neuen, wüsten und disharmonischen Melodien, und allmählich roch es sogar anders an Bord, nach allen möglichen fremdartigen Gewürzen. Da Zachary neuerdings für die Vorräte zuständig war, musste er sich mit neuartigem Proviant vertraut machen, der nichts mehr mit dem gewohnten Schiffszwieback und Pökelfleisch gemein hatte. Und er musste lernen, resum anstelle von Ration zu sagen, und seine Zunge an wildfremde Wörter wie dāl, masālā und achār gewöhnen. Anstelle des normalen englischen Worts für »Steuermann« musste er »Malum« sagen, der Bootsmann hieß nun »Serang«, der Bootsmannsmaat »Tindal« und der Rudergänger »Seacunny«. Eine Unmenge neuer seemännischer Vokabeln musste er sich einprägen, die vage ans Englische erinnerten, aber doch ganz anders klangen: Das »Rigg« hieß nicht mehr rigging, sondern ringīn, aus avast! für »halt!« wurde bas!, und der Ruf der Vormittagswache lautete nicht mehr all’s well, sondern alzbel. Aus dem Deck wurde tūtak, die Masten waren dols, ein Kommando war ein hukam, und anstelle von »Steuerbord« und »Backbord«, »vorn« und »achtern« musste er jamanā und dāvā, āgil und pīchhil sagen.
Unverändert blieb die Einteilung der Mannschaft in zwei Wachen, jede unter der Leitung eines Tindals. Die meisten Aufgaben an Bord oblagen den beiden Tindals, und Serang Ali ließ sich die ersten beiden Tage kaum blicken. Doch als Zachary am dritten im Morgengrauen an Deck kam, schallte ihm ein fröhliches »Chin-chin, Malum Zikri!« entgegen. »Schnappi Ham-ham? Was vor Zeug hab in-drin?«
Im ersten Moment war Zachary verblüfft, doch bald stellte er fest, dass er ungewohnt zwanglos mit dem Serang sprechen konnte: Es war, als würde dessen seltsame Sprache seine eigene Zunge lösen. »Serang Ali, wo kommst du her?«, fragte er.
»Serang Ali Rohingya – aus Arakan.«
»Und wo hast du so reden gelernt?«
»Opiumschiff«, lautete die Antwort. »China-Land Yankee- Gentlem immer so red. Auch Kadetts wie Malum Zikri.«
»Ich bin kein Kadett«, stellte Zachary richtig. »Hab als Schiffszimmermann angeheuert.«
»Machnix«, sagte der Serang in väterlich-nachsichtigem Tonfall. »Machnix: All selb-selb. Malum Zikri fix-fix eins-a Gentlem. Wie is: Schon schnappi Weif?«
»Nein«, lachte Zachary. »Und du? Serang Ali schon schnappi Weif?«
»Serang Ali Weif hab mach sterb«, kam die Antwort. »Geh Himmel auf-auf. Komm Zeit, Serang Ali schnapp ander Stuk Weif …«
Eine Woche später trat Serang Ali erneut an Zachary heran: »Malum Zikri! Kebbin-Mann fix futschi-futsch. Hab ganz viel krank! Muss hab Dokta. Kannix ham-ham. Bloß ka-ka, pi-pi. Riech puh-puh in Kebbin-Kabbin.«
Zachary begab sich in die Kapitänskajüte und erfuhr, es sei alles halb so schlimm: nur ein normaler Dünnpfiff – nicht die Ruhr, denn es sei keine Spur von Blut zu finden, keine dunklen Flecken im Mostrich. »Ich pass schon auf mich auf: Nicht das erste Mal, dass ich Bauchgrimmen und Aftersausen hab.«
Aber bald schon war der Kapitän zu schwach, um seine Kajüte zu verlassen, und Logbuch und Navigationskarten wurden Zachary anvertraut. Da er bis zum zwölften Lebensjahr die Schule besucht hatte, konnte Zachary schreiben – langsam zwar, dafür aber wie gestochen. Es fiel ihm also nicht schwer, das Logbuch zu führen. Anders verhielt es sich mit der Navigation: Er hatte auf der Werft ein wenig Rechnen gelernt, aber Zahlen waren nicht seine Stärke. Doch im Lauf der Überfahrt hatte er so oft wie möglich dem Kapitän und dem Ersten Steuermann bei der Mittagspeilung zugesehen, und manchmal hatte er sogar Fragen gestellt, die ihm, je nach Laune der Vorgesetzten, lakonische Antworten oder einen Fausthieb einbrachten. Jetzt bemühte er sich mithilfe der Uhr des Kapitäns und des von dem toten Steuermann geerbten Sextanten, die Position des Schiffes zu errechnen. Seine ersten Versuche endeten in Panik, denn seine Berechnungen ergaben eine Kursabweichung von mehreren Hundert Meilen. Doch als er eine Kursänderung anordnete, stellte er fest, dass die Steuerung des Schiffes ohnehin nie in seinen Händen gelegen hatte.
»Malum Zikri denk Laskar-Mann nix kann segel Schiff?«, fragte Serang Ali gekränkt. »Laskar-Mann auch weiß viel gut segel Schiff, luk-luk.«
Auf seinen Einwand, sie seien Hunderte von Meilen von ihrem Kurs nach Port Louis abgekommen, erwiderte Serang Ali gereizt: »Vor was Malum Zikri mach so groß Tamtam? Malum Zikri noch muss lern segel. Nix kann segel Schiff. Nix seh Serang Ali auch viel schlau Mann? Bring Schiff Por Lui drei Tag, luk-luk.«
Drei Tage später, genau wie versprochen, tauchten Steuerbord voraus die gewundenen Hügel von Mauritius und darunter Port Louis in seiner Bucht auf.
»Mich laust der Affe!«, sagte Zachary in widerstrebender Bewunderung. »Ist denn das die Möglichkeit? Bist du sicher, dass es Mauritius ist?«
»Hab sag, nein? Eins-a kann segel Schiff.«
Wie Zachary später erfahren sollte, hatte Serang Ali die ganze Zeit seinen eigenen Kurs gesteuert, mittels einer Kombination aus Koppelnavigation und häufigen Sternmessungen.
Der Kapitän war inzwischen so krank, dass er die Ibis nicht verlassen konnte, also fiel es Zachary zu, die Geschäfte der Schiffseigner auf der Insel zu besorgen; unter anderem musste dem Besitzer einer Plantage etwa sechs Meilen von Port Louis entfernt ein Brief überbracht werden. Zachary wollte gerade mit dem Brief an Land gehen, als er von Serang Ali abgefangen wurde.
»Malum Zikri krik Masse Erger, wenn so geh Por Lui.«
»Warum? Was soll denn sein?«
»Malum luk-luk.« Serang Ali trat zurück und musterte Zachary kritisch von Kopf bis Fuß. »Kleid nix gut.«
Zachary trug seine Arbeitskleidung – Segeltuchhosen und den üblichen weiten Matrosenkittel, der in diesem Fall aus Osnabrücker Leinwand war. Nach den vielen Wochen auf See war er unrasiert, und seine schwarzen Locken starrten von Fett, Teer und Salz. Aber nichts davon kam ihm ungebührlich vor, schließlich wollte er nur einen Brief überbringen. Er zuckte die Achseln. »Na und?«
»Malum Zikri geh so Por Lui, komm nix wieder«, sagte Serang Ali. »Zu viel Presspatrull in Por Lui. Zu viel Leut will fang Sklav. Malum schanghai, mach Sklav, immer schlag mit Peitsch. Nix gut.«
Das machte Zachary nachdenklich. Er ging in seine Kabine zurück und sah sich die Besitztümer genauer an, die ihm durch den Tod des einen und die Flucht des anderen Steuermanns zugefallen waren. Einer der beiden war eine Art Dandy gewesen, und in seiner Seekiste waren so viele Kleider, dass Zachary in Entscheidungsnöte geriet: Was passte wozu? Was war das Richtige für welche Tageszeit? Es war gut und schön, andere in solchen Ausgehsachen zu sehen. Aber sie selber tragen?
Auch hier kam ihm Serang Ali wieder zu Hilfe: Es stellte sich heraus, dass es unter den Laskaren viele gab, die neben der Seefahrt auch noch andere Handwerke beherrschten: einen Schlachter, der einmal als Kammerdiener bei einem Schiffseigner gearbeitet hatte, einen Steward, der nebenbei Schneider war und sich mit Nähen und Flicken etwas dazuverdiente, und einen Schiffsjungen, der Friseur gelernt hatte und der Mannschaft als Barbier diente. Unter Serang Alis Anleitung ging das Team an die Arbeit, sichtete Zacharys Kisten und Säcke, suchte Kleider aus, maß, faltete, schnippelte und nähte. Während der Schneider-Steward und seine Handlanger sich mit Hosenbeinen und Manschetten beschäftigten, führte der Barbier Zachary zu den leeseitigen Speigatten und schrubbte ihn mithilfe von zwei Schiffsjungen blitzsauber. Zachary ließ die Prozedur über sich ergehen, bis der Barbier schließlich eine dunkle, parfümierte Flüssigkeit hervorzog und Anstalten machte, sie ihm übers Haar zu schütten. »He! Was’n das für’n Zeug?«
»Schampu«, sagte der Barbier und rieb die Hände aneinander. »Schampu?« Davon hatte Zachary noch nie gehört, doch so unangenehm es ihm auch war, damit in Berührung zu kommen, ließ er es sich doch gefallen, und zu seiner Überraschung bereute er es hinterher nicht, denn sein Kopf hatte sich noch nie so leicht angefühlt, sein Haar noch nie so gut gerochen.
Nach zwei Stunden erkannte sich Zachary im Spiegel kaum wieder: Vor ihm stand ein vornehmer Herr in einem weißen Leinenhemd, Reithosen und einem zweireihigen Sommer-Paletot, mit einem ordentlich gebundenen weißen Tuch um den Hals. Sein Haar war geschnitten, gebürstet und im Nacken mit einem blauen Band zusammengefasst, und darüber trug er einen glänzenden schwarzen Hut. Soweit Zachary sehen konnte, war seine Ausstattung komplett, aber Serang Ali war immer noch nicht zufrieden: »Uhr nix hab? Kling-klang?«
»Was?«
»Uhr.« Der Serang griff in seine Weste, als wollte er an einer Uhrkette ziehen.
Über die Vorstellung, er könne sich eine Uhr leisten, musste Zachary lachen. »Nein«, sagte er. »Ich hab keine Uhr.«
»Machnix. Malum Zikri wart Moment.«
Der Serang schickte die anderen Laskaren aus der Kabine und verschwand für zehn Minuten. Als er wiederkam, hatte er etwas in den Falten seines Sarongs versteckt. Er schloss die Tür hinter sich, löste den Knoten an seiner Taille und überreichte Zachary eine silbern glänzende Uhr.
»Heiliger Bimbam!« Zachary blieb der Mund offen, als er die Taschenuhr betrachtete, die wie eine glitzernde Auster auf seiner Handfläche lag: Ober- und Unterseite waren mit filigranen Mustern verziert, und die Kette bestand aus drei fein ziselierten Silbersträngen. Er klappte den Deckel auf und starrte fasziniert auf die laufenden Zeiger und die klickenden Zahnrädchen.
»Die ist wunderschön.« Auf der Innenseite des Deckels war in kleinen Buchstaben ein Name eingraviert. Er las laut: »›Adam T. Danby‹. Wer war das? Hast du ihn gekannt, Serang Ali?«
Der Serang zögerte einen Moment und schüttelte dann den Kopf: »Nein. Nix weiß. Uhr kauf in Leihe, in Kebtaun. Jetz Malum Zikri.«
»Das kann ich nicht annehmen, Serang Ali.«
»Is gut schon, Malum Zikri«, sagte der Serang und lächelte, was er nur selten tat. »Is gut.«
Zachary war gerührt. »Ich danke dir, Serang Ali. So was Schönes hat mir noch keiner geschenkt.« Er stellte sich vor den Spiegel, die Uhr in der Hand, den Hut auf dem Kopf, und brach in Lachen aus. »He! Die machen mich glatt zum Bürgermeister.«
Serang Ali nickte. »Malum Zikri eins-a pakka Sahib jetz. Fein Pinkel. Wenn Pflanzer-Mann will fang, muss maulhau.«
»Maulhau?«, fragte Zachary. »Was soll das heißen?«
»Muss schrei laut: ›Pflanzer-Mann, geh muschilek Schwester. Ich eins-a pakka Sahib, kannix fang.‹ Stek Pistol in Tasch; wenn Mann will schanghai, peng-peng.«
Zachary steckte eine Pistole ein und ging nervös von Bord – doch kaum hatte er einen Fuß auf den Kai gesetzt, stellte er fest, dass er mit ungewohnter Ehrerbietigkeit behandelt wurde. Er ging zu einem Stall, um ein Pferd zu mieten, und der französische Besitzer verbeugte sich, sprach ihn mit »Milord« an und überschlug sich förmlich vor Diensteifer. Als er hinausritt, lief ein Stallknecht neben ihm her, um ihm den Weg zu zeigen.
Die Stadt war klein, nur ein paar Häuserblocks, die schon bald in ein Gewirr armseliger Hütten ausliefen; weiter vorn wand sich der Weg durch dichte Wäldchen und hohe Zuckerrohrdickichte. Die ringsum ansteigenden Hügel und Felsen hatten seltsam zerklüftete Formen; sie hockten in der Ebene wie ein Bestiarium gargantuesker Tiere, die bei dem Versuch erstarrt waren, sich dem Griff der Erde zu entwinden. Von Zeit zu Zeit stieß Zachary zwischen den Zuckerrohrfeldern auf Gruppen von Männern, die ihre Sicheln sinken ließen und ihn anstierten: Die Aufseher verbeugten sich und tippten sich devot mit der Peitsche an den Hut, während die Arbeiter ihn finster anstarrten, sodass er froh war um die Waffe in seiner Tasche. Das Plantagenhaus war schon aus weiter Ferne zu sehen, am Ende einer Allee von Bäumen mit sich abschälender honigfarbener Rinde. Er hatte ein Herrenhaus erwartet wie die auf den Plantagen in Delaware und Maryland, aber dieses Haus hatte weder Säulen noch Giebelfenster. Es war ein ebenerdiger, aus Holzbalken errichteter Bungalow, rings umgeben von einer breiten Veranda. Dort saß der Besitzer, Monsieur d’Epinay, in Unterhosen und Hosenträgern. Zachary fand nichts dabei und erschrak, als sein Gastgeber sich für seinen Aufzug entschuldigte und in stockendem Englisch erklärte, er habe nicht damit gerechnet, zu dieser Tageszeit Besuch von einem Gentleman zu bekommen. Er ließ seinen Gast in der Obhut einer Dienerin zurück, ging ins Haus und kam eine halbe Stunde später voll angekleidet wieder heraus. Dann ließ er Zachary ein Essen mit vielen Gängen vorsetzen, zu denen beste Weine gereicht wurden.
Mit einigem Widerstreben sah Zachary auf seine Uhr und verkündete, er müsse sich jetzt verabschieden. Auf dem Weg hinaus übergab ihm Monsieur d’Epinay einen Brief an Mr. Benjamin Burnham in Kalkutta.
»Meine Zuckerrohrstauden verfaulen auf dem Feld, Mr. Reid«, sagte der Pflanzer. »Sagen Sie Mr. Burnham, dass ich Männer brauche. Seit wir keine Sklaven mehr auf Mauritius halten dürfen, brauche ich Kulis, sonst bin ich aufgeschmissen. Legen Sie ein gutes Wort für mich ein, bitte, ja?«
Als sie sich zum Abschied die Hand gaben, warnte ihn Monsieur d’Epinay. »Geben Sie acht, Mr. Reid, halten Sie die Augen auf. In den Bergen hier wimmelt es von Desperados und entlaufenen Sklaven. Ein Gentleman, der allein unterwegs ist, muss Vorsicht walten lassen. Halten Sie Ihre Pistole stets griffbereit.«
Zachary saß auf und trottete davon mit einem Grinsen im Gesicht und dem Wort »Gentleman« im Ohr: Dieses Etikett brachte einem offenkundig mancherlei Vorteile – was ihm noch deutlicher vor Augen geführt wurde, als er im Hafenviertel von Port Louis eintraf. Mit Einbruch der Nacht hatten sich die Gässchen rings um den Laskar-Basar mit Frauen bevölkert, die der Anblick von Zachary in Paletot und Hut förmlich elektrisierte. Worauf er flugs Kleider auf seine Liste preiswürdiger Dinge setzte. Dank ihrer magischen Wirkung sah sich Zachary Reid, der bei den Huren von Fell’s Point so oft abgeblitzt war, auf einmal von Frauen umringt und bedrängt: Sie fuhren ihm durchs Haar, pressten ihre Hüften an ihn und nestelten verspielt an den Hornknöpfen seiner aus feinem Wollstoff geschneiderten Hose. Eine von ihnen, die sich »Madagaskar Rose« nannte, war ausnehmend hübsch, mit Blüten hinterm Ohr und rot bemalten Lippen. Nur allzu gern hätte er sich nach zehn Monaten auf See hinter ihre Tür ziehen lassen, um seine Nase zwischen ihre jasminduftenden Brüste zu stecken und mit der Zunge ihre Vanillelippen zu erforschen, doch unversehens vertrat ihm Serang Ali in seinem Sarong den Weg, das Raubvogelgesicht zu einer Miene strenger Missbilligung verzogen. Als sie ihn sah, welkte die Rose von Madagaskar dahin und verschwand auf Nimmerwiedersehen.
»Malum Zikri nix Hirn in Kopf?«, fragte der Serang, die Arme in die Seiten gestemmt. »Bloß Wasser oben drin, in sein Kopf? Zu was brauch Pissnelk? Nich jetz eins-a pakka Sahib?«
Zachary hatte keine Lust auf eine Gardinenpredigt. »Zieh Leine, Serang Ali! Du kannst einem Seemann doch nicht den Puff verbieten.«
»Vor was Malum Zikri will zahl vor fiki-fak?«, fragte der Serang. »Noch nie Ok-toh-puss seh? Is ganz gliklich Fisch.«
Zachary war ratlos? »Ein Krake? Was hat denn der damit zu tun?«
»Nix hab seh?«, fragte Serang Ali. »Mista Ok-to-puss acht Hand hab. Mach immer selb gliklich in-drin. Immer lechel. Warum Malum nix auch mach so? Zehn Finger auch hab, nein?«
Nach einer Weile hob Zachary resigniert die Hände und ließ sich von Serang Ali wegführen. Auf dem Rückweg zum Schiff staubte Serang Ali ständig Zacharys Kleider ab, zupfte sein Halstuch zurecht, strich sein Haar glatt. Es war, als hätte er dadurch, dass er einen Sahib aus ihm gemacht hatte, ein Anrecht auf ihn erworben; Zachary konnte noch so viel fluchen und ihm auf die Finger hauen, er ließ einfach nicht von ihm ab. Es war, als sei Zachary der Inbegriff der Vornehmheit geworden, ausgestattet mit allem, was man braucht, um in dieser Welt Erfolg zu haben. Allmählich dämmerte ihm, dass Serang Ali ihn auch deshalb so resolut daran gehindert hatte, sich mit den Mädchen im Basar einzulassen – auch seine Paarungen mussten von nun an arrangiert und kontrolliert werden. Jedenfalls nahm er das an.
Der Kapitän, der immer noch leidend war, konnte es kaum erwarten, nach Kalkutta zu kommen, und wollte so bald wie möglich Anker lichten. Doch davon wollte Serang Ali nichts wissen: »Kebbin-Mann viel krank«, sagte er. »Wenn nix komm Dokta, er mach sterb. Geh Himmel auf-auf ganz fix.«
Zachary wollte einen Arzt kommen lassen, aber der Kapitän ließ es nicht zu. »Ich lass mir von keinem Kurpfuscher die Heckreling begrapschen. Mir fehlt nichts. Ist bloß der flotte Heinrich. Sobald wir Segel setzen, geht’s mir besser.«
Am nächsten Tag frischte der Wind auf, und die Ibis lief aus. Der Kapitän schleppte sich aufs Achterdeck und erklärte, er sei wieder völlig auf dem Damm, aber Serang Ali war anderer Meinung: »Kebbin schnappi Ruhr. Luk-luk – Zung ferb schwarz. Besser Malum Zikri bleib weg von Kebbin-Mann.« Später brachte er Zachary einen übel riechenden Absud von Wurzeln und Kräutern. »Malum das trink: nix werd krank. Mit Ruhr nix Spaß.« Auf den Rat des Serangs stellte Zachary auch seine Ernährung um, von der üblichen Seemannskost wie Labskaus, Hartbrotpudding und Hartkäse auf Laskaren-Gerichte aus Reis, Linsen und eingelegtem Gemüse, gelegentlich untermischt mit etwas frischem oder gedörrtem Fisch. An die scharfen Gewürze musste Zachary sich erst gewöhnen, aber mit der Zeit merkte er, dass sie ihm gut taten, weil sie seine Innereien durchputzten, und schon bald schmeckte es ihm sogar.
Zwölf Tage später, genau wie Serang prophezeit hatte, war der Kapitän tot. Diesmal wurden die Habseligkeiten des Verstorbenen nicht versteigert: Sie wurden über Bord geworfen, und die Kajüte wurde gewaschen und offen gelassen, damit die Salzluft sie reinigen konnte.
Als der Leichnam ins Meer gekippt wurde, las Zachary aus der Bibel. Er tat es mit so klangvoller Stimme, dass er ein Kompliment von Serang Ali bekam: »Malum Zikri eins-a Heiligmann. Warum nix sing Lied?«
»Kann ich nich«, sagte Zachary. »Hab noch nie singen können.«
»Machnix«, sagte Serang Ali. »Hab eins-a Singmann.« Er winkte einen hochgewachsenen, spindeldürren Schiffsjungen namens Raju heran. »Er mal in Mission. Heiligmann ihm hab lern eins-a Salm.«
»Einen Psalm?«, fragte Zachary überrascht. »Welchen?« Statt einer Antwort begann der Laskare zu singen: »Warum toben die Heiden, und die Leute reden so vergeblich …?«
Für den Fall, dass Zachary das nicht verstanden hatte, übersetzte es ihm der Serang zuvorkommenderweise. »Das mein«, flüsterte er Zachary ins Ohr, »vor was mach Heidenleut so viel Spektakel? Hab kein ander Arbeit?«
Zachary seufzte: »Das trifft ja so ziemlich den Nagel auf den Kopf.«
Als die Ibis an der Mündung des Hooghly vor Anker ging, waren elf Monate vergangen, seit sie in Baltimore ausgelaufen war, und von der ursprünglichen Besatzung des Schoners waren nur noch Zachary und Crabbie, die rötliche Schiffskatze, an Bord.
Da es nur noch zwei, drei Tage bis Kalkutta waren, hätte Zachary nur allzu gern gleich wieder Segel gesetzt, doch sie mussten auf den Lotsen warten, und der ließ sich, sehr zum Verdruss der ungeduldigen Mannschaft, tagelang nicht blicken. Zachary schlief in seiner Kabine, nur mit einem Sarong bekleidet, als Serang Ali hereinkam, um ihm zu sagen, dass das Lotsenboot längsseit gekommen war.
»Mista Dummbak hab komm.«
»Wer?«
»Lotse. Er viel groß Maul«, sagte der Serang. »Horch.«
Zachary legte den Kopf schräg und hörte von oben eine polternde Männerstimme. »Will verdammt sein, wenn ich schon mal einen solchen Haufen rammdösiger Maulaffen gesehen hab. Euch Arschgeigen sollte man die Kimme kalfatern. Denkt ihr vielleicht, ihr könnt hier eure Lumpen lüften und mich in der Sonne schmoren lassen?«
Zachary zog sich ein Unterhemd und Hosen an und trat hinaus. Vor ihm stand ein untersetzter Engländer, der erbost mit seinem Malakkastock auf das Deck trommelte. Er war auf extravagante Art altmodisch gekleidet, mit hohem Hemdkragen, einem Gehrock und einem buntseidenen Tuch um die Hüfte. Mit einer Farbe wie rosa Schinken, Koteletten wie Hammelkoteletts, fleischigen Wangen und Lippen wie Leberschnitten sah sein Gesicht aus wie frisch vom Schlachter. Hinter ihm stand ein Grüppchen Träger und Laskaren mit diversen Kisten, Schrankkoffern und anderem Gepäck.
»Hat denn keiner von euch Hundsfotten einen Funken Verstand?« Die Adern schwollen auf der Stirn des Lotsen, während er die wie gebannt dastehende Mannschaft anbrüllte: »Wo ist der Steuermann? Habt ihr Schafsköpfe ihm nicht gesagt, dass mein Boot längsseit liegt? Steht nicht bloß da und glotzt blöde! Dalli, dalli, oder muss ich euch mit meinem Stock den Steiß bläuen, bis ihr Allah um Hilfe ruft?«
»Bitte sehr um Entschuldigung, Sir«, sagte Zachary und trat vor. »Tut mir leid, dass Sie warten mussten.«
Der Lotse kniff missbilligend die Augen zusammen, als er Zacharys zerknitterte Kleidung und seine nackten Füße sah. »Ich trau meinen Klüsen nicht, Mann!«, sagte er. »Sie lassen sich ja ganz schön gehen. Sollten Sie nicht tun, wenn Sie der einzige Sahib an Bord sind – außer, Sie wollen sich zum Gespött Ihrer Nigger machen.«
»Tut mir leid, Sir … bin nur ein bisschen durcheinander.« Zachary streckte ihm die Hand hin. »Ich bin der Zweite Steuermann, Zachary Reid.«
»Und ich bin James Doughty«, sagte der Neuankömmling und schüttelte Zachary widerstrebend die Hand. »Früher mal Bengal River Pilot Service, zurzeit Lotse und Supercargo in Diensten von Burnham Bros. Der Bara Sahib – will sagen Ben Burnham – hat mich gebeten, das Kommando auf diesem Schiff zu übernehmen.« Er winkte lässig zu dem Mann am Ruder hinüber. »Das da ist mein Rudergänger; weiß genau, was er tut – könnte Sie mit verbundenen Augen den Brahmaputra raufbugsieren. Wie wär’s: Wollen wir das Steuern diesem Halunken überlassen und uns einen Schluck Rotspon genehmigen?«
»Rotspon?« Zachary kratzte sich am Kinn. »Tut mir leid, Mr. Doughty, aber ich weiß nicht, was das ist.«
»Rotwein, mein Junge«, sagte der Lotse aufgeräumt. »Sie haben nicht zufällig einen Schluck Bordeaux an Bord? Wenn nicht, dann tut’s auch ein Gläschen Brandy.«
ZWEITES KAPITEL
Zwei Tage später, als Diti und ihre Tochter gerade zu Mittag aßen, hielt Chandan Singh mit seinem Ochsenkarren vor ihrer Tür. »Kabutri-kī-mā!«, rief er. »Hör zu: Hukam Singh ist in der Fabrik zusammengeklappt. Du sollst ihn dort abholen.«
Damit ließ er die Zügel schnalzen und fuhr eilig davon, voller Ungeduld, zu seinem Essen und seinem Mittagsschlaf zu kommen. Hilfe bot er nicht an – typisch für ihn.
Ein Frösteln kroch Diti den Nacken hinauf. Nicht dass die Nachricht sie allzu sehr überrascht hätte; ihr Mann kränkelte seit Längerem, und sein Zusammenbruch kam nicht ganz unerwartet. Aber sie war sich sicher, dass diese Wendung der Dinge irgendwie mit dem Schiff zusammenhing, das sie gesehen hatte. Es war, als hätte ihr der Wind, der es zu ihr trug, einen kalten Hauch das Rückgrat hinaufgesandt.
»Ma?«, sagte Kabutri. »Was machen wir jetzt? Wie sollen wir ihn denn holen?«
»Wir brauchen Kaluas Ochsenkarren«, antwortete Diti. »Komm, wir gehen.«
Bis zu der Chamaren-Siedlung, in der Kalua lebte, war es nicht weit, und nachmittags um diese Zeit musste er auch zu Hause sein. Nur würde er wahrscheinlich eine Bezahlung erwarten, und Diti wusste beim besten Willen nicht, was sie ihm anbieten sollte. Überschüssiges Getreide oder Obst hatte sie nicht, und an Geld war nicht eine einzige Kaurischnecke im Haus. Nachdem sie alle Möglichkeiten durchgegangen war, musste sie einsehen, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als an die holzgeschnitzte Kassette zu gehen, in der ihr Mann seinen Opiumvorrat aufbewahrte. Sie war verschlossen, aber Diti wusste, wo der Schlüssel lag. Sie öffnete den Deckel und war erleichtert, mehrere Klumpen hartes akbarī-Opium und auch ein größeres Stück weiches chandū-Opium vorzufinden, noch in Mohnblütenblätter verpackt. Sie entschied sich für das harte Opium, schnitt ein daumennagelgroßes Stück davon ab und wickelte es in eine der Hüllen, die sie am Morgen angefertigt hatte. Sie steckte das Päckchen in die Taille ihres Saris und machte sich dann in Richtung Ghazipur auf den Weg. Kabutri lief voraus und hüpfte über die Erdwälle zwischen den Mohnfeldern.
Die Sonne hatte den Zenith inzwischen überschritten, und in der warmen Nachmittagsluft hing flirrender Dunst über den Blüten. Diti zog sich den ihres Saris über das Gesicht; der ausgebleichte dünne Stoff war so zerschlissen, dass sie hindurchschauen konnte. Die Umrisse der Dinge, die sie sah, verschwammen, um die prallen Mohnkapseln erschien ein blassroter Hof. Ihre Schritte wurden länger. Auf einigen Feldern war der Mohn schon ein gutes Stück weiter als ihrer. Die Kapseln waren bereits angeritzt, und um die parallelen Einschnitte herum gerann der ausgetretene weiße Saft. Sein süßer, betäubender Duft hatte Schwärme von Insekten angelockt, und die Luft summte von Bienen, Heuschrecken und Wespen. Viele würden in dem Saft hängen bleiben, und morgen, wenn er sich verfärbt hatte, würde die schwarze Masse sie einschließen – bei der Ernte ein willkommener Zuwachs an Gewicht. Selbst auf die Schmetterlinge schien der Saft eine beruhigende Wirkung auszuüben, denn ihr Flügelschlag wurde seltsam unstet, als hätten sie das Fliegen verlernt. Einer von als sie ihn in die Luft warf.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!