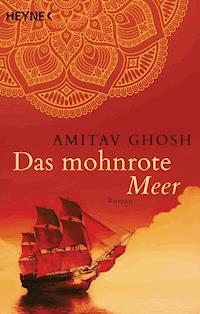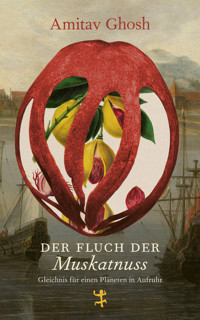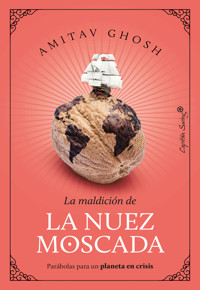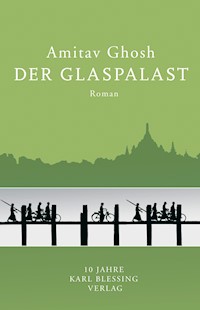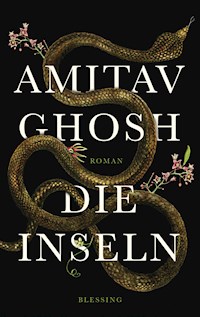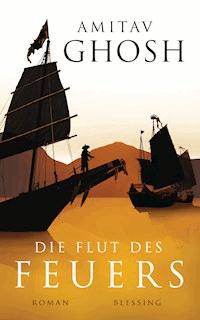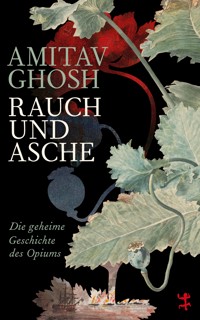
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In einer mitreißenden Mischung aus Reisebericht, Memoir und historischem Essay zeichnet der indische Autor die Anfänge des weltweiten Opiumhandels ab dem 19. Jahrhundert nach und macht deutlich, dass dessen Auswirkungen bis in die heutige Zeit reichen: von den mächtigsten Familien und prestigeträchtigsten Institutionen, deren Reichtum sich den Einnahmen aus dem Opiumgeschäft verdankt, bis hin zur amerikanischen Opioid-Epidemie und dem Oxycontin-Skandal. Während der jahrzehntelangen Archivrecherche für seine Ibis-Romantrilogie stellte Amitav Ghosh mit Erstaunen fest, dass die Lebenswege und Handelsrouten zahlreicher Menschen, auch seiner eigenen Vorfahren, im 19. Jahrhundert mit einer einzigen Pflanze verwoben waren: der Mohnblume. Das Britische Weltreich sicherte sich durch ihren Anbau in den indischen Kolonien die Handelsfähigkeit mit China, indische Bauern wurden über Jahrhunderte hinweg in prekärer Abhängigkeit gehalten, und die chinesische Bevölkerung wurde von einer unaufhaltsamen Drogenepidemie überspült. Währenddessen hofften internationale Handelsleute stets auf Reichtum durch die Beteiligung am Opiumhandel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rauch und Asche
Amitav Ghosh
Rauch und Asche
Die geheime Geschichte des Opiums
Aus dem Englischen von Heide Lutosch
Matthes & Seitz Berlin
INHALT
1 HIER SIND DRACHEN
2 SAMEN
3 »EIN EIGENSTÄNDIGER AKTEUR«
4 FREINDE
5 DIE OPIUMBEHÖRDE
6 BIG BROTHER
7 VISIONEN
8 FAMILIENGESCHICHTE
9 MALWA
10 OST UND WEST
11 DIASPORA
12 DIE BRAHMANEN VON BOSTON
13 AMERIKANISCHE GESCHICHTEN
14 GUANGZHOU
15 DER MEERESBERUHIGUNGSTURM
16 DIE STÜTZE DES EMPIRE
17 PARALLELEN
18 VORZEICHEN
DANK
ANMERKUNGEN
BILDNACHWEISE
Für Rahul Srivastava und Aradhana Seth, zum Lob guter Nachbarschaft
1HIER SIND DRACHEN
Aus heutiger Sicht finde ich es verblüffend, dass China für mich die meiste Zeit meines Lebens nicht mehr war, als die riesige leere Fläche, die auf der Landkarte über Indien schwebte. Es fehlte wirklich nur noch die Inschrift »Hier sind Drachen«.
Wie es der Zufall wollte, wurde ich in Westbengalen geboren, einem indischen Bundesstaat, der an China grenzt. Aufgewachsen bin ich in Kalkutta (heute Kolkata), wo es eine kleine, aber bedeutende chinesische Gemeinde gibt. Dennoch hatte ich keinerlei Interesse an der chinesischen Geschichte, Geografie oder Kultur. Und obwohl ich schon immer gerne gereist bin, wäre es mir lange Zeit nicht in den Sinn gekommen, sagen wir, in die Provinz Yunnan zu fahren – und das, obwohl deren Hauptstadt Kunming per Luftlinie kaum weiter von Kalkutta entfernt ist als Neu-Delhi. Irgendwie schien Kunming einer anderen Welt anzugehören, die von meiner eigenen abgeschnitten war – nicht nur durch eine ganz reale, hoch in den Himmel ragende Gebirgskette, sondern gewissermaßen auch durch einen geistigen Himalaya.
Erst als ich im Jahr 2004 anfing, meinen Roman Das mohnrote Meer zu schreiben, kam ich auf die Idee, nach China zu reisen. Meine beiden Hauptfiguren Diti und Kalua machen sich im Jahr 1838 auf den Weg nach Mauritius, um sich dort als Vertragsarbeiter zu verdingen. Da dies der Hauptbogen der Geschichte werden sollte, war mir klar, dass mich die Recherche für das Buch nach Mauritius führen würde (was sie dann auch tat). Aber ich wurde auch noch in eine andere, völlig unerwartete Richtung gelenkt: Als ich nämlich tiefer in die Recherche einstieg, begriff ich, dass nicht nur Indien und Mauritius den Hintergrund meiner Geschichte bilden würden, sondern auch die Wasserfläche, die diese beiden Länder voneinander trennt (und sie verbindet): der Indische Ozean.
Das Schreiben über das Meer ist völlig anders als über das Land zu schreiben. Der Horizont ist viel weiter, und den Schauplätzen fehlt jene Beständigkeit, die es Romanautoren überhaupt erst ermöglicht, ein »Gefühl für den Ort« zu vermitteln. Wenn der Hauptschauplatz ein Schiff ist, wie der Schoner Ibis in Das mohnrote Meer, dann wird man sich der Strömungen, der Winde und der Verkehrsflüsse extrem bewusst. Und je mehr ich über diese Hintergründe herausfand, desto klarer wurde mir, dass die Seefahrt in der Zeit, über die ich schrieb, nämlich die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, nicht (wie ich gedacht hatte) in erster Linie zwischen Indien und dem Westen stattfand, sondern zwischen Indien und China – oder besser gesagt einem bestimmten Ort in China, einer Stadt namens »Kanton«.
Der Name war mir schon oft begegnet, ohne dass ich genau wusste, wo sich diese Stadt befand. Aber als ich nun anfing, mich in die Schriften über die Seefahrerei des 19. Jahrhunderts zu vertiefen, wurde ich immer neugieriger: Was war so besonders an Kanton, dass allein der Gedanke, dorthin in See zu stechen, Seefahrer und Reisende des 19. Jahrhunderts in Verzückung geraten ließ?
Wäre ich auch nur annähernd über China und die chinesische Geschichte informiert gewesen, hätte ich gewusst, dass »Kanton« ein Wort ist, das die Europäer einst ganz unbefangen der Provinz Guangdong im Allgemeinen und der Stadt Guangzhou im Besonderen übergestülpt hatten.1 Aber damals waren meine Kenntnisse über China und seine Geografie so lückenhaft, dass ich wie gesagt nur eine vage Ahnung davon hatte, wo Guangzhou überhaupt lag.
Wenn ich zurückdenke, war wohl meine Ahnungslosigkeit in Bezug auf China weder ein Mangel an Neugierde oder Gelegenheit noch überhaupt auf äußere Umstände zurückzuführen, sondern vielmehr, so bin ich überzeugt, das Ergebnis einer inneren Schranke, die nicht nur uns Indern, sondern auch Amerikanern, Europäern und vielen anderen Menschen auf der ganzen Welt durch bestimmte wiederkehrende weltgeschichtliche Erzählmuster eingepflanzt wurde. Und während die Jahre vergehen und der Schatten, den China auf die Welt wirft, immer länger wird, werden diese Schranken, insbesondere in Indien und den Vereinigten Staaten, immer unüberwindlicher.
Meines Erachtens kann man aus der genauen Betrachtung dieser Umstände etwas Wichtiges lernen – nicht nur wegen ihrer Bedeutung für China, sondern auch, weil sie uns etwas über die verschiedenen Arten und Weisen sagen, die Welt wahrzunehmen und zu verstehen.
Auf indischer Seite ist es der chinesisch-indische Krieg von 1962, in dem Indien eine vernichtende Niederlage erlitt und der alle mit China verbundenen Erinnerungen dominiert, ja erschlägt.2
Ich war damals erst sechs Jahre alt, aber meine Erinnerungen an diese Zeit sind immer noch lebendig. Ich weiß noch, wie meine Mutter unter Tränen goldene Armreifen heraussuchte, um sie für den Krieg zu spenden; ich erinnere mich, wie mein Vater Decken und Wollsachen sammelte, die er an die Front schicken wollte; ich erinnere mich auch, wie meine Eltern mit Freunden endlos über die Ursachen des Krieges stritten und darüber, wer die Schuld an dem Debakel trug.
Über diese Fragen besteht bis heute keine Einigkeit. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2021 von Avtar Singh Bhasin, dem ehemaligen Leiter der historischen Abteilung des indischen Außenministeriums, legt nahe, dass Missverständnisse sowie Fehler des damaligen Premierministers Jawaharlal Nehru zu den zentralen Auslösern des Krieges gehörten. »Die Freiheiten, die sich Neru an der Westgrenze herausnahm, forderten den Ärger geradezu heraus«, schreibt Bhasin: »Indien wurde zum Opfer seiner eigenen falschen Annahmen.«3 Zwar war Nehru in vielerlei Hinsicht ein bewundernswerter Mensch und visionärer Staatsmann, doch bei der Bewältigung dieser Krise scheint er sich merkwürdig ungeschickt verhalten zu haben.
Die ganze Wahrheit wird man wahrscheinlich ohnehin nie herausfinden, da einige der wichtigsten historischen Materialien noch nicht ans Licht gekommen sind. Sicher ist jedoch, dass der Krieg von 1962 bis zu einem gewissen Grad eine Folge des kulturellen und politischen Schattens war, den der Himalaya warf – Fehlinterpretationen, Missverständnisse und falsche Vorstellungen spielten als Auslöser des Konflikts jedenfalls eine große Rolle.4
Die Probleme, die für den Krieg von 1962 verantwortlich sind, wurden keineswegs gelöst, im Gegenteil: Der Konflikt, der sich nun schon seit Jahrzehnten hinzieht, dauert bis heute an. Entlang der Grenze kommt es regelmäßig zu Zusammenstößen zwischen chinesischen und indischen Truppen, und ein Ende ist nicht in Sicht. Gegenüber seinem zunehmend selbstbewussten und kriegerischen Nachbarn China hat Indien wohl im Moment keine andere Wahl, als sich so gut es geht zu behaupten.5
Zweifellos hat diese anhaltende Konfrontation die Angst, das Ressentiment und die Feindseligkeit der Inder verstärkt, aber den ausgeprägten Hass gegenüber China, der heute in den USA immer deutlicher zutage tritt, gibt es in Indien schon seit ich denken kann.
Aber auch zwischen Indien und Pakistan herrschen extreme Spannungen: Sie haben mehrmals Krieg gegeneinander geführt, und in beiden Ländern gibt es zahlreiche Menschen, die die Bewohner des jeweils anderen Landes erbittert hassen. Dennoch mangelt es auf beiden Seiten der Grenze nicht an Interesse und Neugierde. Ganz im Gegenteil: Indien und Pakistan haben ein obsessives Interesse an der Politik, der Kultur, der Geschichte, den aktuellen Ereignissen, dem Sport und so weiter des jeweils anderen Landes.
Das ist keineswegs ungewöhnlich: Konflikte dieser Art führen oft zu einer Vertiefung des Engagements im kulturellen und ideellen Bereich. So gab es in den Vereinigten Staaten nach den Anschlägen auf das World Trade Center im Jahr 2001 eine Welle von Anmeldungen für Arabischkurse. Die Zahl der Bücher, Artikel und Filme über den Irak und Afghanistan hat seither stetig zugenommen.
Nichts dergleichen geschah in Indien nach 1962. Anstatt, dass das Interesse aneinander sprunghaft anstieg, wich man ruckartig und voller Scham, Misstrauen und Angst voreinander zurück, und nach dem nur wenige Wochen dauernden Krieg begannen die Inder, die chinesischstämmigen Migranten in ihren kleinen verstreuten Gemeinden zu Sündenböcken für die Katastrophe zu machen.
Die chinesischen Gemeinschaften in Indien gehen bis auf das 18. Jahrhundert zurück, als sich die ersten Hakka in der Nähe von Kalkutta niederließen.6 Im Laufe der Zeit florierte die Gemeinde immer mehr; sie betrieb diverse Schulen, Tempel und Zeitungen, und viele ihrer Mitglieder wurden erfolgreiche Fachkräfte oder Unternehmer.7 Viele chinesische Inder waren noch nie in China gewesen und hatten keinerlei Verbindungen zu diesem Land; nicht wenige von ihnen waren Antikommunisten. Doch ein Gesetz, das die indische Regierung erließ, kaum, dass der Krieg von 1962 beendet war, erlaubte von nun an die »Festnahme und Inhaftierung von Personen, die einer feindlichen Herkunft verdächtigt werden«.
Man zwang Tausende von ethnischen Chinesen, Indien zu verlassen; so wurden viele zu staatenlosen Flüchtlingen. Tausende weitere wurden in Indien in Gewahrsam genommen und verblieben jahrelang ohne Gerichtsverfahren in Internierungslagern. Als man sie freiließ, kehrten viele von ihnen zurück und mussten feststellen, dass ihre Häuser und Geschäfte beschlagnahmt oder verkauft worden waren. Noch jahrelang mussten sie sich jeden Monat auf einer Polizeistation melden. Auch die wenigen indischen Wissenschaftler, die über China forschten, hatten unter der Atmosphäre des Misstrauens zu leiden.
In den Nachkriegsjahren halbierte sich die Zahl der ethnischen Chinesen in Kalkutta von 20 000 auf 10 000. Viele der Dagebliebenen waren gezwungen, die alte Chinatown im Zentrum zu verlassen und nach Tangra umzuziehen, eine sumpfige Gegend am Stadtrand. Dass sich dieses Viertel zu einer pulsierenden neuen Chinatown mit Fabriken, Werkstätten, Tempeln und Restaurants entwickeln konnte, zeugt von der Widerstandskraft und dem Unternehmungsgeist der chinesischen Gemeinschaft in Indien.
Dass die chinesisch-indische Gemeinschaft nach 1962 zum Sündenbock gemacht wurde, ist zweifellos ein hässliches Kapitel in der Geschichte des unabhängigen Indien. Aber auch Indien hat einen Preis dafür gezahlt, besonders die Stadt Kalkutta. Die 1960er- und 1970er-Jahre waren genau die Zeit, in der die chinesische Diaspora in vielen Teilen Südostasiens einen wirtschaftlichen Wandel herbeiführte, indem sie ausländisches Kapital in das jeweilige Land fließen ließ und neue Unternehmen und Industrien gründete. Wäre die chinesisch-indische Gemeinschaft nicht durch den Krieg von 1962 zerstört worden, hätte sie vielleicht auch zur Wiederbelebung Kalkuttas beitragen können.
Als meine Frau und ich 2010 einige Tage in Coloane an der südlichsten Spitze der Halbinsel Macau verbrachten, wurde mir das eindringlich ins Gedächtnis gerufen. Unser ruhiges, sonniges Hotel lag oberhalb eines Sandstrandes und bot einen atemberaubenden Ausblick über das Meer, und die Küche des Hotels war in dieser Stadt der Genießer dafür bekannt, einige der besten Gerichte Macaus zu servieren. Eines Morgens erfuhr ich zu meiner Überraschung, dass die Hotelbesitzerin, eine Mittfünfzigerin, in Kalkutta aufgewachsen war: Sie sprach fließend Englisch, Bengali und Kantonesisch (aber kein Mandarin). Ihre Familie habe in Kalkutta Restaurants besessen, erzählte sie mir, und sie selbst habe auch immer ein Hotel führen wollen. Aber nach 1962 seien sie gezwungen gewesen, das Land zu verlassen. Sie hatten viele Jahre kämpfen müssen, bis sie endlich ihren Traum verwirklichen konnten – nur, dass ihr Hotel nun in Macau und nicht in Kalkutta stand.
Inwiefern wurde meine Sicht auf China also durch den Krieg von 1962 geprägt? Zweifellos spielte er eine gewisse Rolle – aber das eigentlich Seltsame war ja, dass China für mich kaum existierte – und das lag meiner Ansicht nach nicht nur daran, wie ich China, sondern vor allem auch den Rest der Welt wahrnahm: In dieser Sichtweise ist nämlich der Westen so groß, dass er alles andere überdeckt.
Auf dem indischen Subkontinent ist die Präsenz des Westens unübersehbar, ganz gleich, ob es sich um Sprache, Kleidung, Sport, Gebrauchsgegenstände oder Kunst handelt. Unter Indern, aber auch unter vielen Westlern war man sich lange Zeit einig, dass die Transformation des sozialen, kulturellen und materiellen Lebens, die in der Region während der Kolonialzeit stattfand, größtenteils auf einen Prozess zurückzuführen war, den man »Verwestlichung« nannte.8 Dahinter stand die Annahme, dass die Moderne ausschließlich ein Phänomen der westlichen Welt war und erst durch Kontakt mit ihr auf Indien und den Rest der Welt übertragen wurde, wie »ein Virus, der sich von einem Ort zum anderen ausbreitet«.9
Eine andere Gegend der Welt, die seit Langem auf dem indischen Subkontinent präsent ist, ist der Nahe Osten. Überall in der Region sind diese Einflüsse zu erkennen – in der Kunst, der Architektur, dem Essen, der Kleidung und der Sprache. Die Vokabeln der wichtigsten Sprachen des Subkontinents bedienen sich massiv aus dem Persischen und Arabischen. Schon als Teenager wusste ich, dass ich, wenn ich Bengali, Hindi oder Englisch sprach, Dutzende von Wörtern mit arabischem oder persischem Ursprung benutzte. Aber ich wäre nicht in der Lage gewesen, auch nur ein einziges Wort chinesischen Ursprungs in einer dieser Sprachen zu nennen; allein die Vorstellung, dass ich in meinem Alltag Wörter chinesischer Herkunft verwenden könnte, wäre mir bizarr vorgekommen. Das Gleiche gilt auch für Alltagsgegenstände und Alltagspraktiken: Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass irgendetwas in meiner materiellen oder kulturellen Welt eher auf China als auf den Nahen Osten oder Europa verweisen könnte.
Erst als ich China im September 2005 zum ersten Mal besuchte, wurde mir klar, wie falsch ich damit lag.
Obwohl ich nur wenige Wochen in China verbrachte, und die meiste Zeit davon in Guangzhou, war dieser erste Besuch für mich in vielerlei Hinsicht eine Offenbarung – auch wenn ich die eigentlichen Erkenntnisse gar nicht direkt während meines Aufenthalts in China hatte, sondern erst nach meiner Rückkehr nach Indien.
Eines Tages, kurz nach meiner Reise nach Guangzhou, saß ich in meinem Elternhaus in Kalkutta im Arbeitszimmer und trank eine Tasse Tee. Dieses Ritual war eine tägliche Routine wie das Aufstehen aus dem Bett; tausende Male hatte ich an genau diesem Schreibtisch gesessen, auf genau diesem Stuhl, mit einem Teetablett vor mir auf dem Tisch.
Aber dieser Tag war irgendwie anders. Als ich mich über meine Teetasse beugte – »cha«, wie sie auf Bengali heißt –, erinnerte ich mich plötzlich an ein Wort, das ich kürzlich in Guangzhou benutzt hatte: »chah«. Ich betrachtete die Tasse erneut und sah, dass sie aus Porzellan war – »china« auf Englisch, oder »chinémati« (chinesischer Ton) auf Bengali. In diesem Moment wurde mir klar, dass solche Dinge erst durch die Reise nach Guangzhou in meinen Horizont gelangt waren – von hier aus wurden nämlich jahrhundertelang riesige Mengen von Porzellan (englisch »chinaware«) in die ganze Welt exportiert.10
Auf dem Teetablett stand neben der Tasse und der Untertasse eine Schale mit weißem Zucker, dem von Indern wohl am meisten geliebten Aromastoff. Und wie wird er genannt? In Bengalen und auch in den meisten anderen Teilen Indiens nennt man ihn »Cheeni«, was nichts anderes ist als ein gebräuchliches Wort für »chinesisch«.11 Ich hatte dieses Wort mein ganzes Leben lang benutzt, aber es war mir nie in den Sinn gekommen, nach seinem Ursprung zu fragen. Und dann war da noch das Teetablett, billige Lackware, wie man sie in Indien häufig sieht. Auch dieser Gegenstand passte so gut zu meiner Umgebung, dass er nie auffiel oder Fragen aufwarf. Aber an diesem Tag rief es visuelle Erinnerungen an die Lackwaren-Sammlungen hervor, die ich kürzlich in Guangzhou gesehen hatte: Da wurde mir klar, dass auch das Tablett chinesische Vorläufer haben könnte.
Ich schaute mich im Raum um und sah plötzlich überall China: in einem Glas mit Erdnüssen (die auf Bengali »chinébadam« heißen: »chinesische Nüsse«); in den Chrysanthemen in ihrer Vase; im Goldfischglas; in den Briefumschlägen und Räucherstäbchen. Es war, als würde eine unsichtbare Hand in diesem Raum auf eine Reihe von Gegenständen zeigen, die in ihrer Vertrautheit so tief in mein Bewusstsein eingezogen waren, dass sie sich meiner bewussten Wahrnehmung entzogen. All diese Dinge – Tee, Zucker, Porzellan – hatten mir an sich nie etwas bedeutet. Sie waren einfach nur Gegenstände: leblos, stumm und ohne die Fähigkeit, zu kommunizieren.
Einige Wochen später, als ich wieder bei mir zu Hause in Brooklyn war, machte ich in meinem dortigen Arbeitszimmer die gleiche Erfahrung. Neben einer ähnlichen Ansammlung von Dingen, die mit Tee zu tun hatten, gab es einen alten Teppich, einen Briefbeschwerer und natürlich eine Fülle von elektronischen und digitalen Geräten »Made in China«. Ob alt oder neu: wo ich auch hinsah, gemahnte etwas an China.
Damals dämmerte mir, dass bestimmte Gegenstände gewissermaßen das stumme, material gewordene Äquivalent der Wörter sind, die von jenen unsichtbaren, geisterhaften Kräften gesprochen werden, die unser Leben beeinflussen, ohne dass wir uns dessen bewusst werden. In einer seltsamen Umkehrung wurden die leblosen Gegenstände um mich herum plötzlich zu Lehrern, die mir zeigten, dass meine physische Existenz von einer Vergangenheit zeugte, die eine völlig andere war als die, die ich aus Büchern und Quellen kannte. Während China in meinem geistigen Kosmos so gut wie gar nicht vorkam, war China in meiner materiellen Welt überall.
In den darauffolgenden Jahren sollte sich Das mohnrote Meer zum Anfang einer umfangreichen, nach dem Schoner Ibis benannten Romantrilogie entpuppen. Viele Kapitel in den anderen beiden Bänden der Ibis-Trilogie (Der rauchblaue Fluss, Die Flut des Feuers) spielen in Guangzhou und seiner unmittelbaren Umgebung sowie am Perlflussdelta. Als ich mich in die Recherchen für die Romane vertiefte, wurde mir bewusst, dass ein Großteil der Menschheit eine ähnliche Haltung zu China pflegt wie ich selbst: In unserem materiellen und kulturellen Leben spielt das Land eine nicht zu unterschätzende Rolle, die aber seltsamerweise oft unbemerkt bleibt.
Warum ist das so?
Als ich um Antworten auf diese Frage rang, kam ich schließlich zu der Einsicht, dass Chinas historische Präsenz in meiner Welt leicht übersehen wurde, weil sie größtenteils nonverbal war: also mit den diskursiven Konzepten von »Entwicklung« und »Fortschritt«, die in der modernen Geschichtsschreibung eine so große Rolle spielen, einfach nicht in Verbindung gebracht wurde.
Anders ausgedrückt: Während der Westen meine eigene Welt beinahe ausschließlich und in obsessiver Weise über Worte und Konzepte beeinflusste, war der Einfluss Chinas subtiler, fast unsichtbar, und wurde vor allem über die Verbreitung von Alltagspraktiken und über genau solche Gegenstände ausgeübt, die sich auf meinen Schreibtischen in Kalkutta und Brooklyn reihten. Da Gegenstände stumm sind und die Erklärung für ihre Existenz nicht in sich tragen, bedarf es eines grundsätzlichen Umdenkens, um sich bewusst zu machen, was sie tatsächlich – ja – kommunizieren. Diese Umstellung ist besonders für diejenigen unter uns anstrengend, die durch Bildung und Erziehung daran gewöhnt sind, die Welt auf eine Weise zu betrachten, die sich fast ausschließlich auf Sprache verlässt. Und da die menschliche Sprache per definitionem ein Attribut der Spezies Homo sapiens ist, gilt in der Konsequenz alles Nicht-Menschliche prinzipiell als stumm, in dem Sinne, dass es nicht sprechen kann.
Natürlich »sprachen« die Gegenstände, die meine Epiphanie auslösten, nicht wirklich. Dennoch teilten sie mir im Stillen etwas mit, etwas, das auf historische und kulturelle Zusammenhänge verwies, die einen vollkommen anderen Charakter hatten als die, die durch abstrakte Begriffe wie »Verwestlichung«, »Modernität«, »Kolonialismus« und so weiter suggeriert wurden. Aber auch hier gab es ein Problem, denn die Dinge, die vor mir aufgereiht waren, konnten gar nicht alle als Objekte definiert werden: Die Teetasse, das Tablett und die Zuckerdose waren sicherlich Objekte, aber was war mit dem Tee selbst? Die blassbraune Flüssigkeit in meiner Teetasse war etwas viel Komplizierteres als ein Gegenstand: Tee existiert auch in Form von getrockneten Blättern, als lebende Pflanze und als eine biologische Art, die einen nicht ganz unbedeutenden Teil der Erdoberfläche bedeckt. »Tee« ist also eher so etwas wie ein riesiger Komplex pflanzlicher Materie, der in vielen Formen vorkommt. Ohne dieses Formengeflecht hätten die Objekte, die ich an diesem Tag vor mir hatte – die Tasse, das Tablett, die Zuckerdose –, keinen Zusammenhang. Diese Dinge in Analogie zu Wörtern zu denken, würde also bedeuten, dass es eine Grammatik oder Syntax gibt, die sie miteinander verbindet: Und was könnte diese Grammatik anderes sein als »Tee« selbst, ein Ding, das kein einzelnes Objekt ist, sondern eine lebendige Einheit, die sich ständig weiterentwickelt und neue Artikulationsformen findet? Das wiederum würde bedeuten, dass die Sache, die ich immer so leicht und problemlos als »Tee« identifiziert hatte, eine bestimmte Art von Vitalität besaß, ein Leben, das sich auf unzählige Arten manifestierte, sichtbar und unsichtbar.
Wenn wir uns die botanische Materie auf diese Weise vorstellen, erkennen wir an, dass die Beziehung zwischen Menschen und bestimmten Pflanzen nicht nur in eine Richtung funktioniert, sondern dass auch die Menschen durch diese Verbindung verändert werden. Dies gibt uns eine Ahnung davon, warum einige Kulturen bestimmte Pflanzen als Geister oder Gottheiten betrachten, die auf geheimnisvolle Weise, manchmal freundlich und manchmal voller Rachsucht, mit den Menschen interagieren. Mit den Worten der Botanikerin Robin Wall Kimmerer vom Stamm der Potawatomi:
Im Weltbild der Indigenen stehen die Menschen in der Demokratie der Arten nicht an der Spitze. Wir werden die jüngeren Brüder der Schöpfung genannt und müssen wie jüngere Brüder von den älteren lernen. Die Pflanzen waren zuerst da und hatten lange Zeit, sich in der Welt zurechtzufinden. Sie leben sowohl über- wie unterirdisch und halten die Erde an ihrem Platz fest.12
Diese Sichtweise auf das Verhältnis zwischen China und Indien zu übertragen, mag zunächst abwegig erscheinen, kann aber sehr erhellend sein. Denn in der Beziehung zwischen diesen beiden Ländern hat pflanzliche Materie immer eine herausragende Rolle gespielt. Bestimmte Pflanzen waren dabei so allgegenwärtig, dass sie nicht nur in Asien, sondern auch in Großbritannien und Amerika bestimmte Muster schufen, die auf unsichtbare Weise Kultur und Geschichte mit geformt haben. Der Einfluss, den Pflanzen auf die Beziehungen haben, die China zum Rest der Welt unterhält, ist so groß, dass hier letztlich genau die Art von Demut gegenüber den biologischen Arten gefragt ist, zu der Kimmerer aufruft: nämlich anzuerkennen, dass es auf diesem Planeten Wesen und Entitäten gibt, die die Kraft haben, menschliche Absichten zu verstärken und in die Beziehungen zwischen Menschen einzugreifen.
Damit soll keinesfalls die Bedeutung des historischen Handelns von Menschen kleingeredet werden. Ganz im Gegenteil. Es geht darum zu betonen, dass Menschen in ihren Beziehungen zueinander immer wieder unterschiedlichste Arten nicht-menschlicher Wesenheiten in Dienst genommen haben. Es ist paradox, aber die wahre Natur der menschlichen Absichten in Bezug auf so etwas wie die Teepflanze können wir erst erkennen, wenn wir einen Blick auf die Geschichte etablieren, der darauf verzichtet, den Menschen an oberste Stelle zu setzen, und es dadurch ermöglicht, die historische Handlungsmacht von pflanzlicher Materie anzuerkennen. Umgekehrt dient das Ableugnen der Wirkmacht bestimmter nicht-menschlicher Kräfte nicht selten dazu, die Absichten ausgerechnet jener Menschen im Dunklen zu belassen, die im Rückgriff auf Pflanzen und andere nicht-menschliche Wesenheiten einen Krieg gegen ihre Rivalen und Feinde anzetteln.
2SAMEN
Diese Geschichte beginnt mit dem Samen des Teestrauchs (Camellia sinensis). Ein Großteil des Tees, den die Menschen auf der ganzen Welt trinken, wird aus ihm gewonnen. Die ältesten Teeblätter, gefunden im Grab des chinesischen Kaisers Jing Di, sind 2150 Jahre alt. Anfangs nur von einer Elite praktiziert, war das Trinken von Tee schon im frühen Mittelalter in China weit verbreitet.1
Nach England soll der chinesische Tee durch Katharina von Braganza, die Ehefrau König Karls II., gekommen sein.2 Portugal, wo sie geboren wurde, war das erste europäische Land, das den Indischen Ozean befuhr; zu seinem Netz von Stützpunkten und Kolonien gehörte auch das südchinesische Macau, das 1557 von der herrschenden Ming-Dynastie an die Portugiesen verpachtet worden war. 1662, in jenem Jahr, in dem Katharina von Braganza heiratete, stand die Ming-Dynastie kurz vor dem Sturz durch die Qing-Dynastie, doch der Status von Macau blieb unverändert. Das bedeutet auch, dass man in Portugal zum Zeitpunkt der Hochzeit bereits seit über hundert Jahren chinesische Produkte konsumierte: Das Trinken von Tee war in der Oberschicht des Landes fest etabliert. Katharinas Mitgift sollte sich als weltgeschichtlich bedeutsam erweisen: Sie brachte eine Schatulle mit Tee in die Ehe ein – sowie sechs kleine Inseln, aus denen später Bombay (das heutige Mumbai) werden sollte.
Das Teetrinken setzte sich in England schnell durch, und zu Beginn des 18. Jahrhunderts, noch bevor Großbritannien seine Herrschaft in Indien errichtete, war Tee aus China für die britische Wirtschaft bereits eine wichtige Handelsware3, deren Wert in den folgenden Jahrzehnten rasant zunahm. Im gesamten 18. Jahrhundert, als die Briten riesige Gebiete in Nordamerika und auf dem indischen Subkontinent eroberten, blieb der chinesische Tee die Haupteinnahmequelle der British East India Company, die zum Großteil zur Finanzierung der britischen Kolonialexpansion verwendet wurde: »Im 18. Jahrhundert«, schreibt die Historikerin Erika Rappaport, »wurde mit dem Tee der Krieg bezahlt, aber auch mit dem Krieg der Tee.«4 Im späten 18. Jahrhundert war Tee »so sehr zum Nationalgetränk geworden, dass die Ostindien-Kompanie durch ein Parlamentsgesetz verpflichtet wurde, stets ein Jahreskontingent vorrätig zu halten«.5
Wie umfassend das Schicksal des britischen Weltreichs vom Tee abhing, erscheint aus der heutigen postindustriellen Perspektive erstaunlich. Ist es wirklich vorstellbar, dass ausgerechnet das Land, in dem die industrielle Revolution ihren Anfang nahm, während seiner eigenen Industrialisierung finanziell von einer Pflanze abhing, die im fernen Osten von einfachen Bauern angebaut wurde? Aber genau so war es. »Als das Britische Empire in Europa und Nordamerika seine Schlachten kämpfte«, schreibt der Historiker Andrew Liu, »verließ sich der Staat zur Finanzierung der Kriege zunehmend auf die Erhebung von Teezöllen.«6
Jahrhundertelang war die Einfuhr von Tee ein Monopol der Ostindien-Kompanie gewesen, und die Teezölle waren lange Zeit eine der wichtigsten Einnahmequellen Großbritanniens. Der Zoll lag zwischen 75 und 125 Prozent des geschätzten Wertes, was bedeutete, dass er Großbritannien höhere Einnahmen bescherte als China, das einen Ausfuhrzoll von nur zehn Prozent erhob.7
Vor allem wegen des Tees rangierte China stets unter den vier wichtigsten Ländern, aus denen Großbritannien seine Importe bezog. Der Wert der Waren, die Großbritannien aus China bezog, überstieg bei weitem den Wert, den es aus den meisten anderen Kolonien zog: »Im Jahr 1857 beispielsweise war der berechnete reale Wert der Einfuhren aus China in das Vereinigte Königreich 1,8 Mal so hoch wie der Wert der Einfuhren aus Britisch-Nordamerika, doppelt so hoch wie der Wert der Einfuhren aus Australien, 2,2 Mal so hoch wie der Wert der Einfuhren aus Britisch-Westindien, 6,4 Mal so hoch wie der Wert der Einfuhren aus den britischen Besitztümern in Südafrika und 72,2 Mal so hoch wie der Wert der Einfuhren aus Neuseeland.«8
Über weite Strecken des 18. und 19. Jahrhunderts machte die Teesteuer fast ein Zehntel der britischen Einnahmen aus.9 Sie brachte der britischen Regierung so viel ein wie alle Grund-, Vermögens- und Einkommenssteuern zusammen: Diese Summe war so groß, dass sie für die Gehälter aller Staatsbediensteten, für alle öffentlichen Arbeiten und Gebäude, für alle Ausgaben im Zusammenhang mit Recht, Justiz, Bildung, Kunst und Wissenschaft und für die kolonialen, konsularischen und ausländischen Einrichtungen Ihrer Majestät – zusammengenommen – verwendet werden konnte.10 Dies war nicht der einzige Vorteil, den der Tee der britischen Wirtschaft brachte. Ein großer Teil der britischen Handelsmarine war mit dem Transport von Tee beschäftigt, und zwar nicht nur von China nach Großbritannien, sondern auch von Großbritannien in seine Kolonien.11 Kurz gesagt, während eines Großteils der industriellen Revolution waren die Finanzen der britischen Regierung stark vom Tee abhängig – und dieser Tee stammte hauptsächlich aus China.
Das Problem war, dass Großbritannien China im Gegenzug nicht viel zu verkaufen hatte: An den meisten westlichen Waren hatten die Chinesen wenig Interesse oder schlicht keinen Bedarf.12 Dies machte Chinas Kaiser Qianlong schon im Jahr 1793 in einem Brief an Georg III. deutlich: »Auf irgendwelche raffinierten Gebrauchsgüter legen wir keinen Wert und wir haben nicht den geringsten Bedarf an den Erzeugnissen Ihres Landes.«13
Chinas mangelndes Interesse an ausländischen Waren war für die Briten aus unterschiedlichen Gründen ärgerlich – nicht nur aus finanziellen. (Ein Wissenschaftler hat die verblüffende Vermutung geäußert, dass die chinesische Autarkie für die Briten deshalb so beunruhigend war, weil sie darin die Möglichkeit einer rivalisierenden »Herrenrasse« erkannten.14) Ein unmittelbareres Problem für die Westler bestand jedoch darin, dass chinesische Waren im Allgemeinen mit Silber bezahlt werden mussten. Aufgrund des Handelsungleichgewichts kam es zu einem enormen Abfluss von Silberbarren aus dem Westen nach China. Dennoch war der Handel immer noch profitabel, da die mit Silber gekauften chinesischen Waren in Europa für das Zwei- oder Dreifache ihres Preises verkauft werden konnten.
Edelmetalltransfers dieses Ausmaßes waren nur möglich, weil das weltweite Angebot an Edelmetallen durch die amerikanischen Minen enorm gestiegen war.15 Es war also letztendlich die europäische Eroberung Amerikas, die den Handel mit China finanziell möglich machte, indem Massen von versklavten indigenen und afrikanischen Arbeitern die dafür benötigten riesigen Mengen an Edelmetallen abbauten. Aber nach und nach schwanden diese Vorräte, und ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde es für die Ostindien-Kompanie immer schwieriger, die Silbermengen zu beschaffen, die für die Aufrechterhaltung des Chinahandels benötigt wurden: Man suchte nun immer dringlicher, ja fast verzweifelt nach einer Möglichkeit, den Abfluss von Edelmetallen auszugleichen.16
Eine einfache Lösung des Problems hätte darin bestanden, Tee in Indien anzubauen. Dies war tatsächlich ein Traum, den die Ostindien-Kompanie seit dem späten 18. Jahrhundert zu verwirklichen versuchte, indem sie erfahrene Botaniker und Pflanzensammler nach China schickte, die die entsprechenden Pflanzen und das mit dem Teeanbau verbundene Know-how stehlen sollten.17 Doch dieses Ziel erwies sich als unerreichbar. Die Chinesen waren sich des Wertes ihrer Teepflanzen sehr wohl bewusst, und es war streng verboten, Samen oder Setzlinge des Teestrauchs außer Landes zu bringen. Für Ausländer war es ohnehin unmöglich, in China umherzustreifen und sich an irgendwelchen beliebigen Pflanzen zu bedienen, weil ihre dortige Bewegungsfreiheit zahlreichen Auflagen unterlag. Briten und andere Europäer, die es gewohnt waren, sich, wo immer sie hinkamen, völlig frei an der heimischen Pflanzenwelt zu bedienen, empfanden das immer wieder als enorme Frustration. Selbst als sich die Zahlungsprobleme verschlimmerten, wurden sämtliche Versuche vereitelt, die Teepflanze und die entsprechende Technologie zu entwenden.
Um ihr Handelsbilanzproblem mit China in den Griff zu bekommen, blieb der Kompanie nur noch eine Möglichkeit: die Steigerung der Exporte aus ihren indischen Kolonien. Für Baumwolle aus Indien hatte sich in China bereits ein beträchtlicher Markt etabliert. Auch mit Opium, das aus der Mohnsorte Papaver somniferum gewonnen wurde, trieb man bereits einen kleinen, aber regen Handel. Mithilfe dieser Pflanze sollte schließlich das Problem mit Camellia sinensis gelöst werden.
So kam es, dass eine Pflanze, die in der Geschichte bereits eine wichtige Rolle spielte, der Verbreitung einer anderen, noch geheimnisvolleren und mächtigeren Pflanze den Weg ebnete.
Chai aus Indien, den heute viele als ursprünglich indisch betrachten, war in dieser jahrhundertealten Geschichte eigentlich ein Nachzügler. Der Gedanke daran lässt einen demütig werden – auch auf einer persönlichen Ebene.
Für mich, wie für viele Inder, ist Tee heutzutage wesentlich, unverzichtbar, eine verfassungsmäßige Notwendigkeit: Ich kann buchstäblich nicht ohne ihn leben. Das galt auch für meine Mutter und fast alle anderen Menschen aus meiner Kindheit. Tee war nicht nur unverzichtbar für unser Wohlbefinden, sondern wurde auch als ein wichtiger Bestandteil der indischen Identität betrachtet. Diese Sichtweise hat sich die ganze Welt zu eigen gemacht: Jeder Inder gilt als Teetrinker, und Chai ist für die Inder heute das, was Apple Pie für die Amerikaner ist.
Tatsächlich aber hat das Chai-Trinken in Indien eine eher kurze Geschichte, die eben nicht in der Erde des Subkontinents, sondern in den Beziehungen Großbritanniens zu China wurzelt. Die Inder wurden gewissermaßen erst nachträglich mit dem Teetrinken vertraut gemacht, und selbst das nur mit großem Aufwand.
Vor dem 20. Jahrhundert standen die meisten Inder dem Teetrinken voller Abneigung, ja manchmal sogar mit Misstrauen gegenüber. Es bedurfte mehrerer ausgeklügelter, von den unterschiedlichen Branchen der Teeindustrie massiv lancierter Werbekampagnen, damit sich die Meinung der Menschen änderte. Regelrecht populär wurde Tee auf dem Subkontinent erst in den 1940er-Jahren, und selbst das war das Ergebnis der wahrscheinlich brillantesten Werbekampagne, die das moderne Indien bisher gesehen hat und an der einige der bedeutendsten Künstler und Designer der damaligen Zeit beteiligt waren, unter anderem der Regisseur Satyajit Ray und Annada Munshi, ein Pionier des Werbedesigns in Indien.18
Das eigentliche Rätsel in der Geschichte des indischen Tees ist also, warum das Getränk auf dem Subkontinent so langsam angenommen wurde. Schon im 17. Jahrhundert wurde in Surat mit Tee gehandelt, und es ist bekannt, dass er dort auch konsumiert wurde.19 Dennoch scheint sich die Vorliebe für Tee nicht über diese Stadt hinaus ausgebreitet zu haben, was rätselhaft ist, da der indische Subkontinent von teetrinkenden Kulturen umgeben ist. In Tibet wurde Tee bereits im siebten Jahrhundert eingeführt, und von dort aus verbreitete er sich auch in den angrenzenden Regionen Nordnepal, Sikkim, Bhutan, Ladakh und Kaschmir. Davon abgesehen war in bestimmten Regionen Nordostindiens die Teepflanze sogar heimisch, und bei einigen dortigen indigenen Gemeinschaften trank man einen aus ihren Blättern zubereiteten Aufguss.20
Dass tatsächlich eine Sorte der Camellia sinensis im Nordosten Indiens heimisch war, erfuhren die britischen Beamten jedoch erst in den 1820er-Jahren.21 Als der Fund ein Jahrzehnt später bestätigt wurde, war die Freude in der East India Company groß: Der alte Traum, mit Rückgriff auf Indien die finanzielle Abhängigkeit Großbritanniens vom chinesischen Tee zu verringern, war endlich in greifbare Nähe gerückt!22
Entgegen des erbitterten Widerstands der indigenen Bevölkerung wurden innerhalb weniger Jahre die ersten indischen Teeplantagen in Assam angelegt, aber seltsamerweise nicht mit einheimischem Saatgut.23 Die britischen Pflanzer hatten kein Vertrauen in die einheimische Sorte und verwendeten daher Saatgut und Lagerbestände, die aus China eingeschmuggelt worden waren.24 Ebenso wenig vertrauten sie den indischen Arbeitern, die nach der vorherrschenden Meinung der Briten »nicht die Fähigkeiten und den Unternehmergeist der Chinesen« hatten.25 Aus diesem Grund wurden neben den Pflanzen auch chinesische Teebauern ins Land geholt, damit sie ihr Wissen über den Anbau und die Verarbeitung von Tee weitergaben.26
Die Aneignung von chinesischem Know-how wurde wesentlich einfacher, nachdem die Briten dem Qing-Staat im Ersten Opiumkrieg (1839–1842) eine vernichtende Niederlage beigebracht hatten. Nun genossen die Europäer in China deutlich mehr Freiheiten: Die Auflagen zu umgehen, die ihnen zuvor den Diebstahl von Technologie und ausgebildeten Arbeitskräften fast unmöglich gemacht hatten, war nun wesentlich einfacher. (Natürlich wird dieser Fall von Wissensdiebstahl durch den Westen heute gern unter den Teppich gekehrt.)
Daraus wird ersichtlich, dass die koloniale Teeindustrie in Indien von Anfang an von chinesischem Fachwissen, Arbeitskräften und – in den Worten eines britischen Generalgouverneurs – »chinesischer Handlungsmacht« abhängig war.27 Und so kam es, dass kleine chinesische Gemeinschaften im ländlichen Assam Wurzeln schlugen: Auch sie wurden während des Krieges von 1962 gewaltsam umgesiedelt (eine Geschichte, die von der assamesischen Schriftstellerin Rita Chowdhury in ihrem Roman Chinatown Days großartig erzählt wird).28
Das Einzige, was die Briten nicht von China übernommen hatten, war das Pachtmodell, unter dem Tee dort hauptsächlich angebaut wurde, nämlich von Bauern und ihren Familien in Kleinstbetrieben.29 In Indien wurde Tee dagegen von halbfreien Vertragsarbeitern angebaut, die sich auf riesigen, hauptsächlich im Besitz weißer Pflanzer befindlichen Plantagen abrackern mussten.30
Nach dem langsamen Beginn machte die indische Teeindustrie schnelle Fortschritte, bis ihre Exporte die von China in den Schatten stellten. »Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten die indischen Teeausfuhren die ihrer chinesischen Konkurrenten übertroffen, und Indien wurde in dieser Branche zum Weltmarktführer.«31 Dieser enorme Produktivitätssprung kam nicht etwa durch die Effizienz des Kapitalismus britischer Manier zustande, wie oft behauptet wird, sondern dadurch, dass der Kolonialstaat eine stark rassifizierte Produktionsweise durchsetzte, bei der die Plantagenbesitzer Steuervergünstigungen, kostenloses Land und unter Vertragsknechtschaft stehende Arbeiter erhielten, die unter ihnen vollständig aufgezwungenen Bedingungen arbeiten mussten.32 Derselbe Kolonialstaat, der im Namen des Kapitalismus und des Freihandels Krieg gegen China führte, hatte keine Bedenken, innerhalb seiner eigenen Grenzen ein System unfreier Arbeit einzuführen.33 Dieses entsetzliche Erbe verfolgt die indische Teeindustrie bis heute, und viele Plantagen sind noch immer hierarchisch nach Kasten beziehungsweise ethnischen Zugehörigkeiten strukturiert. (Wobei jedoch anzumerken ist, dass einige kleine und auch größere Erzeuger mit den kolonialen Produktionspraktiken gebrochen und sozialere und umweltfreundlichere Methoden eingeführt haben.)34
Indien war auch nicht die einzige Kolonie, in der Tee auf diese Weise angebaut wurde: Das gleiche System wurde in den von den Briten beherrschten Ländern Ceylon (Sri Lanka), Kenia und Malaysia angewandt, mit ähnlichen Ergebnissen in Bezug auf die Produktivität. Entscheidend für den Aufstieg der Tees des britischen Empires war die verbreitete Vorstellung, dass chinesischer Tee schmutzig und unhygienisch sei, kolonialer Tee dagegen irgendwie »modern« und »rein«.35 Mit der Zeit wurde Tee so sehr mit Indien und anderen britischen Kolonien identifiziert, dass man zu fragen begann: »Gibt es in China überhaupt Tee?«36
Und tatsächlich ist diese Säule der chinesischen Exportwirtschaft durch den vom britischen Empire initiierten Prozess des Technologiediebstahls zerstört worden. Dass es sich dabei um einen Krieg mit anderen Mitteln handelte, wurde von beiden Seiten ausdrücklich anerkannt. Wie Andrew Liu in seiner ausgezeichneten vergleichenden Studie zur chinesischen und indischen Teeindustrie feststellt: »Britische Beamte in Indien setzten sich mit der gleichen Rhetorik für den Teeanbau im nordöstlichen Brahmaputra-Tal ein, die auch die Kriegsbefürworter während des Opiumkriegs benutzten, indem sie beispielsweise behaupteten, dass indischer Tee das chinesische Monopol ›zerstören‹ beziehungsweise ›unschädlich machen‹ würde.«37 Auch auf chinesischer Seite wurde der Angriff auf die wichtigste Exportindustrie des Landes als »Handelskrieg« verstanden38, was auch der Grund dafür ist, dass Lius Buch den Titel Tea War trägt.
Mit anderen Worten: Dass der Tee nach Indien kam, ist eine Folge des anhaltenden wirtschaftlichen, sozialen und militärischen Konkurrenzkampfes zwischen dem Westen und China. Dieser Kampf hat sich über mehrere Jahrhunderte hinweg entwickelt und ist längst nicht abgeschlossen; er hat die moderne Welt in vielerlei Hinsicht geprägt und wird dies in den kommenden Jahren weiterhin tun. Dennoch hat sich dieser strukturelle Langzeitkonflikt nur selten zu einem tatsächlichen, von Soldaten geführten Krieg zugespitzt. In anderen Phasen wurde der Konflikt über nicht-menschliche Akteure ausgetragen, insbesondere über Tee und Opium. Dies legt einen Vergleich mit den Verwüstungen nahe, die die Europäer vorher bei den Indigenen Amerikas und Australiens angerichtet hatten: zum Großteil verursacht durch nicht-menschliche Kräfte wie Krankheiten oder Krankheitserreger, durch die Zurichtung des Landes für kapitalistische Interessen (Terraforming) sowie durch die Einführung nicht-einheimischer Flora und Fauna. Es handelte sich hier um strukturelle, biopolitische Kämpfe, bei denen echte Kriegsausbrüche eher die Ausnahme als die Regel darstellten; über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg machten sich stattdessen die tödlichen Auswirkungen von Prozessen wie Terraforming und der Verbreitung von Krankheitserregern bemerkbar.
Durch die Eroberung und Kolonisierung Amerikas waren die Europäer mit dieser Form der Konfliktführung bereits bestens vertraut. Insbesondere die Engländer hatten es darin zu großem Geschick gebracht, und sie konnten sich gleichzeitig einreden, dass ihre Methoden weniger gewalttätig waren als die des spanischen Imperiums, weil sie sich bei der Ausrottung der Indigenen eher auf strukturelle als auf physische Gewalt stützten. Dieses erstaunlich widersprüchliche Kunststück wurde dadurch ermöglicht, dass die Europäer die »Natur« als einen von den Menschen völlig getrennten Bereich betrachteten. So entlasteten sie sich beispielsweise von jeglicher Verantwortung für die Ausbreitung von Krankheiten, indem sie behaupteten, dies sei ein »natürlicher« Prozess, auf den sie keinen Einfluss hätten, obwohl sie die Ausbreitung von Krankheitserregern oft aktiv förderten, indem sie sich weigerten, Maßnahmen zu ergreifen, die Epidemien oder Umweltveränderungen hätten aufhalten können. Die Zerstörung durch Untätigkeit wurde so zu einem wesentlichen Merkmal dieses biopolitischen Kampfes.39
Solche Kämpfe verhinderten jedoch nicht die Aneignung von Ideen und Technologien. Zahlreiche Aspekte der Kultur der Native Americans wurden von den europäischen Siedlern bewundert und sogar angeeignet, wie David Graeber und David Wengrow in ihrem bahnbrechenden Buch Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit gezeigt haben. Sie übernahmen zum Teil die indigene Kritik an der westlichen Zivilisation, die sogar vor den angeblich rein westlichen Ideen der »Freiheit« und »Gleichheit« nicht haltmachten: Weil die Quellen oft unterschlagen worden seien, sehe es häufig so aus, als wären diese Ideen im Westen erfunden worden.40 In ähnlicher Manier gab es viele Europäer, die die chinesische Zivilisation in höchstem Maße schätzten – und gleichzeitig jede ihrer Schwächen ausnutzten.
Ebenfalls typisch für die europäischen Kolonisatoren war, dass sie eine Vielzahl von Allianzen mit Nicht-Europäern eingingen, die zum Teil von diesen Bündnissen profitierten. Für das Verständnis der biopolitischen Konflikte, die im Asien des 19. Jahrhunderts über Pflanzen ausgetragen wurden, ist auch dies ein wichtiger Aspekt. So hatten die Briten in China zahlreiche Verbündete, die aus den gegenseitigen Geschäften enormen Nutzen zogen. Ihre wichtigsten Bündnispartner jedoch kamen vom indischen Subkontinent, darunter Händler der Parsen und der Marwari, Söldner (»Sepoys«) und Matrosen (»Lascars«), sowie unzählige Behördenmitarbeiter und Angestellte von Zuliefererbetrieben. Die tiefgreifende und doch unsichtbare Weise, in der der Konkurrenzkampf zwischen Großbritannien und China das Wirtschaftsleben und den Alltag auf dem indischen Subkontinent veränderte, ist vor allem auf diese ausgedehnten Netzwerke und Verbindungen zurückzuführen.
3»EIN EIGENSTÄNDIGER AKTEUR«
Schlafmohn (Papaver somniferum) kommt wahrscheinlich ursprünglich aus Mittel- oder Osteuropa, möglicherweise vom Balkan oder von der Schwarzmeerküste.1Seine Blüte scheint schon sehr früh in einer ganz besonderen Beziehung zum Menschen gestanden zu haben: Es ist sogar möglich, dass die Pflanze ihre spezifische chemische Struktur genau dafür ausgebildet hat, dass der Mensch anfängt, sie zu vermehren.2Dies könnte auch der Grund dafür sein, dass es keine wirklich wilden Sorten des Schlafmohns gibt; es handelt sich durchweg um Züchtungen, die sich im Wechselspiel mit dem Menschen entwickelt haben – immer mit dem Ziel, die medizinischen und psychoaktiven Eigenschaften der Pflanze zu verbessern.3
Opium wurde in einer 6000 Jahre alten archäologischen Fundstätte in der Schweiz und in einem ägyptischen Grab aus dem zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung gefunden.4 Die Substanz war in der griechischen und römischen Welt bestens bekannt und wird bei Homer, Vergil, Livius, Plinius und Ovid erwähnt.5 Möglicherweise gibt es auch in der Bibel entsprechende Hinweise.6 Im 11. Jahrhundert beschrieb Avicenna Opium als das »mächtigste aller Betäubungsmittel«, eine Substanz, die nicht nur als Schmerzmittel außergewöhnlich wirksam war, sondern auch als Gift.7
Tatsächlich war das Wissen um die Wirkung des Schlafmohns jedoch mit ziemlicher Sicherheit noch mehrere Jahrhunderte älter. Lange vor den Anfängen der aufgezeichneten Geschichte scheinen unterschiedliche Gruppen von Menschen unabhängig voneinander entdeckt zu haben, dass Schlafmohn eine einzigartig wirksame medizinische Substanz produziert, die zur Behandlung von Husten, Magenbeschwerden und vielen anderen Leiden eingesetzt werden kann.8 Es genügt ein Blick auf die Liste der Chemikalien in verschiedenen häufig verwendeten Medikamenten, um zu erkennen, dass Opium bis heute pharmakologisch unverzichtbar ist. Einfach ausgedrückt: Opium ist das wohl älteste und wirksamste Medikament, das der Menschheit bekannt ist. Wie Thomas Sydenham, ein englischer Apotheker aus dem 17. Jahrhundert, feststellte: »Unter den Heilmitteln, die Gott, der Allmächtige, den Menschen zur Linderung seiner Leiden gegeben hat, ist keines so universell anwendbar und so wirksam wie Opium.«9
Heute kommt so gut wie jeder, der moderne Medikamente einnimmt, mit Opium in Berührung. Bei Lesungen aus meinem Roman Das mohnrote Meer wurde ich häufig gefragt, ob ich selbst einmal Kontakt mit Opium gehabt habe. Ich erklärte dann jedes Mal, dass es für mich nie infrage gekommen sei, Opioide als Freizeitdrogen zu konsumieren. (Während ich an meinem Roman arbeitete, hatte ich sogar so viel Respekt vor dem Schlafmohn bekommen, dass ich mich, selbst als ich gerade einen chirurgischen Eingriff hinter mir hatte, nicht dazu durchringen konnte, Schmerzmittel zu nehmen, die Opioide enthielten.) Dennoch habe ich, ob nun wissentlich oder nicht, im Laufe der Jahre über Medikamente wie Imodium sowie Corex und andere Hustenmittel auf Codeinbasis eine beträchtliche Menge Opium zu mir genommen. Opium hat derart viele medizinische Anwendungsmöglichkeiten, dass es für die moderne Arzneimittelindustrie vollkommen unverzichtbar ist – eben genau wie für die Apotheker des Mittelalters.
So unentbehrlich Opium als Medikament ist, so wertvoll ist es als Narkosemittel: Seine außergewöhnliche Wirksamkeit bei der Linderung von Schmerzen ist wie gesagt schon seit der Antike bekannt, aber es wird auch bereits seit sehr langer Zeit für chirurgische und zahnärztliche Eingriffe verwendet. Auch heute noch sind viele, wenn nicht sogar die meisten Narkosemittel von Opioiden abgeleitet. Es geschieht nicht selten, dass Anästhetika auf Opioidbasis ein unerwartetes Hochgefühl hervorrufen, weshalb selbst eine so unangenehme Erfahrung wie eine Darmspiegelung mit einer seltsamen Euphorie enden kann. Ich erinnere mich, wie ich als Teenager nach einem kleinen chirurgischen Eingriff aufwachte und ein so starkes Hochgefühl verspürte, dass ich vom Bett aufspringen und meine Arme um die Krankenschwester schlingen wollte. Dieses Gefühl war so eigenartig, dass ich es nie vergessen habe. Es dauerte Jahrzehnte, bis ich herausfand, dass mir ein Anästhetikum auf Opioidbasis verabreicht worden war – denn die Rolle des Opiums im modernen Leben ist inzwischen so gründlich verdrängt worden, dass es durchaus üblich ist, zu sagen: »Na ja, es mag ja toll gewesen sein, im Mittelalter zu leben, aber was war, wenn man sich einen Zahn ziehen oder ein Körperteil amputieren lassen musste?« Die Antwort ist natürlich, dass man damals eine hohe Dosis eines Opioids bekommen hätte – genau wie heute auch.
Als Narkosemittel war Opium so wichtig, dass es während beider Weltkriege als zentrale strategische Ressource behandelt wurde. Aus dieser Wichtigkeit in der Neuzeit kann man schließen, wie wertvoll Opium in früheren Epochen gewesen sein muss, als es allgemein noch weit weniger Medikamente gab. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich sowohl in Europa als auch in Asien und Afrika bereits sehr früh ein reger Handel mit medizinischem Opium entwickelt hat.
Dass Opium Bewusstseinsveränderungen hervorrufen kann, ist natürlich ebenfalls seit der Antike bekannt. Doch scheint dies nicht immer ein zentraler Grund für die Verbreitung der Substanz gewesen zu sein. In diesem Punkt unterscheidet sich Opium vollkommen von anderen, der Menschheit bekannten bewusstseinserweiternden Substanzen wie Wein, Palmwein, Marihuana, Koca, Rauschpfeffer, Peyote, Ayahuasca, Meskalin, psilocybinhaltigen Pilzen oder Pituri. Bekanntlich hat es historisch betrachtet keine einzige menschliche Gesellschaft gegeben, die nicht irgendeine bewusstseinsverändernde Substanz verwendet oder Techniken wie Meditation, Fasten oder Geißelungen entwickelt hat, um in andere Bewusstseinszustände zu gelangen.10 Wie David Courtwright hervorgehoben hat, ist der Drang, das normale Bewusstsein zu verändern, bei Menschen so stark, dass sich sogar »Kinder beim Spielen absichtlich in einen Schwindel hineinwirbeln«.11 Tatsächlich ist schwer vorstellbar, wie es wäre, fortwährend auf einem immer gleichen Nüchternheitslevel zu leben: Wahrscheinlich wäre ein solcher Zustand kaum von einer klinischen Depression zu unterscheiden.
Auch verschiedene andere Tierarten sind dafür bekannt, dass sie bewusstseinsverändernde Pflanzen nutzen, weshalb es durchaus möglich ist, dass Menschen – vielleicht sogar schon vor der Entstehung des Homo sapiens – den Umgang mit psychoaktiven Substanzen von anderen Arten gelernt haben.12 Da viele der Pflanzen mit psychoaktiven Eigenschaften wild in Wäldern und auf Wiesen wuchsen, waren sie für Sammler, Nomaden, Waldbewohner und überhaupt jeden, der sich mit Pflanzen auskannte, leicht zugänglich. Einige dieser Pflanzen wachsen so schnell und sind so robust, dass sie kaum auszurotten sind: Cannabis sativa zum Beispiel gehört zu den am schnellsten wachsenden Pflanzen der Welt. Als ich 2012 durch Südchina reiste, sah ich nicht nur in den Wäldern, sondern auch in der Umgebung von Städten und Dörfern, wie üppig Cannabis wachsen kann.
Weil sie in ihren angestammten Lebensräumen so weit verbreitet sind, könnte man Substanzen wie Palmwein, Cannabis, Koka, Betelnuss, Kava, Peyote, Tabak, Pituri, Psilocybin-Pilze, Ayahuasca und Meskalin vielleicht als »psychoaktive Grundsubstanzen« bezeichnen.13 Eine Besonderheit dieser Substanzen besteht darin, dass sie in erster Linie wegen ihrer bewusstseinsverändernden Wirkung verwendet wurden (und nicht – wie Opium – wegen ihrer medizinischen Eigenschaften). Die Tatsache, dass die Wirkungen dieser Substanzen in ihren Heimatregionen gut bekannt waren, führte dazu, dass die örtliche Bevölkerung bestimmte Regeln und Rituale für ihren Konsum entwickeln konnte und dadurch Missbrauchsmöglichkeiten massiv minimierte. Die entsprechenden traditionellen Konsumgewohnheiten haben sich in der Regel über sehr lange Zeiträume hinweg entwickelt – sicherlich über Jahrhunderte, wenn nicht gar über Jahrtausende.
Von den psychoaktiven Grundsubstanzen unterscheidet sich Opium in vielen verschiedenen Hinsichten, aber nicht zuletzt durch die große Zeitspanne, die es brauchte, bis es zu einer Substanz wurde, die Menschen gezielt konsumierten, um ihren Bewusstseinszustand zu verändern. Dies geschah nämlich erst vor wenigen hundert Jahren, was insofern von Bedeutung ist, als es darauf hindeutet, dass sich für Opium im Vergleich zu den psychoaktiven Grundsubstanzen erst vor relativ kurzer Zeit klassische Nutzungsarten herausgebildet haben. Der Zeitrahmen, innerhalb dessen sich der Konsum einer Droge in einer Gesellschaft entwickelt, ist in der Tat entscheidend dafür, welche generellen Auswirkungen er auf diese Gesellschaft hat.
Auch räumlich betrachtet gibt es wichtige Unterschiede in der Art und Weise, wie bewusstseinsverändernde Substanzen in Umlauf gebracht wurden. Die jeweilige Verwendung bestimmter psychoaktiver Grundsubstanzen war in der Regel lokal begrenzt und spezifisch für bestimmte Kulturen und Regionen. Das Kauen von Kokablättern zum Beispiel ist bis zum heutigen Tag nur in bestimmten Gesellschaften Südamerikas üblich. Diese Praxis breitete sich auch dann nicht über den Kontinent hinaus aus, als man begann, das aus Kokablättern gewonnene Kokain als Freizeitdroge zu verkaufen. So bauten die Niederländer auf Java jahrhundertelang in großem Stil Koka an, doch die dortigen Bauern haben nie die Praxis des Kauens der Blätter übernommen, obwohl andere psychoaktive Substanzen (wie auch das Opium) zu dieser Zeit auf der Insel weit verbreitet waren.14 Im Gegensatz zu Koka war Cannabis eine Pflanze der »Alten Welt«, die ein großes geografisches Verbreitungsgebiet über die Kontinente hinweg hatte und darüber hinaus außerordentlich robust und schnellwüchsig war. Dennoch wurde Cannabis nicht überall, wo es wuchs, als psychoaktive Substanz verwendet: An vielen Orten, wie zum Beispiel in Italien, wurde es wegen seiner Fasern (Hanf) angebaut.15 Während damals also die Europäer Wein und Spirituosen vorzogen, wurden auf dem indischen Subkontinent die stimmungsaufhellenden Eigenschaften von Cannabis so früh und so eifrig genutzt, dass man »Indien als die erste cannabisorientierte Kultur der Welt bezeichnet hat«.16
Ein weiterer Aspekt, in dem sich die psychoaktiven Grundsubstanzen von den Opioiden unterscheiden, ist, dass sie in der Regel kaum verarbeitet werden müssen. Die meisten von ihnen können direkt nach der Ernte gekaut, geraucht oder anderweitig konsumiert werden; einige müssen vor der Verwendung getrocknet werden, andere, wie zum Beispiel Palmwein, werden direkt aus der Pflanze gewonnen. Dagegen muss der Saft in den Kapselfrüchten der Mohnpflanze stark verarbeitet werden, bis er zu Opium wird. Noch im 18. und 19. Jahrhundert dauerte es fast ein ganzes Jahr, um den Mohnsaft in konsumierbares Opium zu verarbeiten; dieser Saft kann nicht wie Marihuana, Qat oder Kokablätter frisch von der Pflanze verwendet werden. Dies ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass der vormoderne Opiumhandel fast ausschließlich medizinischer Natur war: Die Verarbeitung, die das Rohopium erforderte, setzte wohl der Menge an Opium, die gleichzeitig in Umlauf sein konnte, eine natürliche Grenze.
Die Tatsache, dass Opium verarbeitet werden musste, bedeutete auch, dass es teuer war, und so ist es kein Zufall, dass die frühen Konsumenten oft Mitglieder der kulturellen Eliten und Literaten waren.17 Dies ist tatsächlich ein konstantes Merkmal des Opioidkonsums, von den mittelalterlichen Höfen bis in die Gegenwart.18 Auch im heutigen Westen waren häufig Musiker, Künstler und Schriftsteller diejenigen, die als erste Opioide ausprobierten: »Es hatte einfach einen gewissen Glamour.«19 Die frühe Verbindung der Eliten mit dem Opium ist ein weiterer Faktor, der es von den psychoaktiven Grundsubstanzen unterscheidet. Palmwein, Marihuana und Mahua zum Beispiel wurden schon deshalb von den Eliten verschmäht, weil die entsprechenden Pflanzen in der »Wildnis« wuchsen und von armen Bauern oder von Jägern und Sammlern konsumiert wurden.20 Ihre eigenen Vorlieben galten dagegen eher hochentwickelten bewusstseinsverändernden Substanzen wie Wein, Spirituosen und vor allem Aphrodisiaka (wofür Opium fälschlicherweise gehalten wurde). Es ist daher nicht verwunderlich, dass Opium, welches ebenfalls veredelt werden musste, eine besondere Anziehungskraft auf Kenner und Literaten ausübte, von Schriftstellern wie Thomas De Quinceyin England, Jean Cocteau in Frankreich und William S. Burroughs in den Vereinigten Staaten bis hin zu Zhang Changjia in China.21 Diese Anziehungskraft ließ im Laufe der Zeit nicht nach, sondern wurde sogar noch stärker. Beth Macy meint: »Der Begriff ›Hipster‹ geht auf den chinesischen Opiumraucher des 19. Jahrhunderts zurück, der einen Großteil seiner Zeit – auf eine Hüfte gestützt – mit dem Rauchen verbrachte. Im Westen ließ sich die Hipster-Gegenkultur von heroinabhängigen Jazz-Größen wie Charlie Parker und John Coltrane inspirieren.«22
Die Pflanze, deren Profil dem des Schlafmohns am meisten ähnelt, ist der Kokastrauch (Erythroxylum coca), dessen Blätter zu der süchtig machenden Droge Kokain verarbeitet werden können. Die meiste Zeit seiner langen Geschichte war Koka jedoch eine psychoaktive Grundsubstanz, die von der indigenen Bevölkerung in Südamerika auf die gleiche Weise konsumiert wurde, wie es dort noch heute zahlreiche Menschen tun. Allerdings waren es nicht die Koka-Kauer, die die Blätter des Strauchs zum ersten Mal in Kokain verwandelten, sondern ein deutscher Chemiker, der 1855 das Kokainalkaloid isolierte. Erst später im 19. Jahrhundert (und etwa 300 Jahre nach dem Opium) sollte dann auch Kokain zu einer Handelsware werden. Kokain trat also in die Fußstapfen des Opiums, dessen seit Langem etablierte Muster sich, wie der Historiker Alfred McCoy bemerkt, »Jahre oder sogar Jahrzehnte später in der Kokazone der Anden wiederholten«.23
Die Sozialgeschichte des Opiums ist daher ziemlich besonders. Opioide mit anderen psychoaktiven Substanzen in einen Topf zu werfen und als »Droge« zu bezeichnen, ist nicht nur irreführend; es hat auch zu grundlegend falschen Ansätzen im Bereich der öffentlichen Gesundheit geführt, wo Menschen einige Substanzen wie Cannabis und Peyote vorenthalten wurden, von denen inzwischen bekannt ist, dass sie zahlreiche positive Eigenschaften haben. Tatsächlich könnte das einzig wirksame Mittel zur Bekämpfung der anhaltenden Verbreitung von Opioiden darin bestehen, sich mit anderen psychoaktiven Pflanzen zu verbünden, das heißt, psychoaktive Grundsubstanzen wie Cannabis und Peyote leichter zugänglich zu machen.
Natürlich hat Opium auch zahllose nützliche Anwendungsmöglichkeiten, vielleicht mehr als jede andere psychoaktive Substanz. Aber gerade wegen dieser außergewöhnlichen Eigenschaften kann Opium auch immer süchtiger machende Formen annehmen, vom Ma‘jûn des Mittelalters über Chandu und Morphin bis hin zu Heroin und Oxycodon.
Dass aus Opium immer neuere und stärkere Varianten seiner selbst produziert werden können – sogar synthetische Analoga wie Fentanyl –, hat neben anderen Gründen dazu geführt, dass der Geist nun aus der Flasche ist. Einmal draußen, breitet er sich schnell über die Klassengrenzen hinweg aus und greift von den Eliten auf jene Menschen über, die sich am unteren Ende der sozialen Leiter befinden. Auch dies ein Muster, das sich im Laufe der Geschichte oft wiederholt hat.24
Durch seine besonderen Eigenschaften konnte Opium immer wieder in ein Wechselverhältnis mit bestimmten gesellschaftlichen Konstellationen treten, die dann Geschichte gemacht haben. »Vielleicht ist es tatsächlich angebracht«, schreibt William B. McAllister, ein US-amerikanischer Diplomat und Historiker, »Opium als einen eigenständigen Akteur zu betrachten. Wenn man aufhört, Opium einfach nur als eine passive Substanz zu sehen, kann man es viel besser als das unabhängige, biologisch-imperiale Mittel erkennen, das es in den letzten 300 bis 400 Jahren gewesen ist. Die vergangenen Jahrzehnte, in denen sich [Opium] weltweit ausgebreitet hat, kann man jedenfalls nur als eine Bestätigung dieser Handlungsmacht sehen; die Substanz scheint alle ihre menschlichen Herausforderer besiegt zu haben.«25
Weil Opium ebendiese eigenständige historische Kraft darstellt, muss die Art und Weise, in der diese Substanz zu unterschiedlichen Zeiten mit den Menschen in ein Wechselverhältnis getreten ist, besonders aufmerksam betrachtet werden. Dieses Wechselverhältnis ist jedoch begrifflich sehr schwer zu fassen, was sicher vor allem daran liegt, dass es stark von Klassen- und Machtunterschieden geprägt ist. Verschärft wird diese Schwierigkeit aber dadurch, dass bisher nicht das Vokabular existiert, das notwendig wäre, um über Geschichte in einer Weise nachzudenken, die die Handlungsfähigkeit nichtmenschlicher Entitäten einbezieht.
Während der längsten Phasen der Menschheitsgeschichte war Opium nur in äußerst geringen Mengen im Umlauf und wurde hauptsächlich als Medikament verwendet. Als Nutzpflanze baute man Mohn wahrscheinlich zum ersten Mal in der Region Anatolien an – wahrscheinlich hat sich diese Praxis von dort aus in andere Länder verbreitet. Opium kam wahrscheinlich durch die Armeen Alexanders des Großen in den Iran, daher die Ableitung des persischen und arabischen Wortes für Opium, »afyun«, vom griechischen »opion«.26 Aus den persisch-arabischen Begriffen wiederum ging das Wort »afeem« hervor, das auf dem indischen Subkontinent viel benutzt wird – genau wie die chinesischen Begriffe »afyon« und »yapian«.27 Aber auch nach seiner Einführung im Nahen Osten wurde Opium weiterhin fast nur zu medizinischen Zwecken verwendet.
Auf dem indischen Subkontinent begann der Mohnanbau wahrscheinlich gegen Ende des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung. Die ersten Hinweise auf Opium im Sanskrit stammen aus dem 8. Jahrhundert, in etwa aus der Zeit der arabischen Eroberung der Region Sindh. Dies und die persisch-arabischen Ableitungen vieler indischer Wörter für Opium deuten darauf hin, dass der kommerzielle Mohnanbau vom Iran und der arabischen Welt aus in die Region eingeführt wurde.28
Eine hilfreiche Analogie für die Sozialgeschichte des Opiums ist die eines opportunistischen Krankheitserregers, der sich über lange Phasen ruhig verhält und nur sehr wenige Menschen befällt.29 Wenn jedoch soziale Prozesse und historische Ereignisse dem Erreger eine gute Gelegenheit bieten, bricht er aus und verbreitet sich rasch. Häufig kommt es bei diesen Ausbrüchen zu einer Mutation des Erregers, die es ihm ermöglicht, sich dem menschlichen Immunsystem zu entziehen. Auch bei Opioidausbrüchen mutiert die Droge und wird in immer neueren, stärker süchtig machenden Formen konsumiert.
Eine der frühesten Möglichkeiten, sich zu verbreiten, wurde dem Opium um das 14. Jahrhundert herum von den Mongolen geboten, deren zusammenhängende Gebiete sich damals von China über Nordindien und den Iran bis in die Levante und nach Anatolien erstreckten. Der orale Konsum von Opium in verschiedenen Formen war unter den mongolischen Herrschern und an ihren Höfen sehr beliebt, die Praxis wurde dann an ihre Nachfolger, die Osmanen, Safawiden und Moguln, weitergegeben. Die Herrscherdynastien dieser Reiche waren entweder schiitische oder sunnitische Muslime, aber ihre jeweiligen Territorien blieben ungeteilt – sie erstreckten sich über einen großen Teil Eurasiens und Nordafrikas – und standen stets in engem Austausch miteinander.
Im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts erlebte der Opiumkonsum in diesen Herrschaftsbereichen eine zweite Hochphase. Damals änderte sich auch die Form, in der Opium typischerweise konsumiert wurde. Man begann nun, seine Wirksamkeit durch das Mischen mit anderen psychoaktiven Substanzen wie Cannabis zu verstärken, und konsumierte die entsprechenden Mischungen entweder als Getränk oder in Form von Nahrungsmitteln.30
Da die Menschen in diesen Teilen Asiens zu einer Zeit mit Opium in Berührung kamen, in der die entsprechenden Vorräte begrenzt waren, konnten sie sich langsam und allmählich damit vertraut machen. Sie hatten genügend Zeit, soziale Sitten und Gebräuche zu entwickeln, die den Opiumkonsum auf bestimmte gesellschaftliche Bereiche beschränkten, ähnlich, wie es die Europäer mit dem Alkohol getan hatten.31 Auch dieser Prozess ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie Bevölkerungen Immunitäten gegen Krankheitserreger entwickeln, nur dass in diesem Fall die Resistenzen sozial und nicht biologisch bedingt sind. Die Tatsache, dass andere psychoaktive Substanzen wie Cannabis und Betelnuss auf dem indischen Subkontinent weit verbreitet waren, trug wahrscheinlich ebenfalls dazu bei, die Verbreitung von Opium lokal einzuschränken. Darüber hinaus war Opium zwar ein wichtiger Bestandteil des höfischen Lebens im Mogulreich Indien, doch die Droge war weder ein Instrument der Staatspolitik noch eine wichtige Einnahmequelle. Daher hatte das Mogulreich keinen finanziellen Anreiz, den Opiumkonsum zu fördern oder den gesamten Wirtschaftsbereich auszubauen.32
Nach und nach entwickelte sich auf dem indischen Subkontinent und in Persien eine gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber Opium – jedenfalls, solange es oral, in Form von Pillen und Stärkungsmitteln konsumiert wurde. Das Rauchen von Opium, das viel süchtiger macht, war dagegen stark tabuisiert. Wenn es aber getrunken oder gegessen wurde, erzeugte Opium in den minimal verarbeiteten Formen, in denen es in Indien im Umlauf war, in der Regel keinen »Rausch«: Es wirkte eher wie ein Schlaf- oder Schmerzmittel. Daher wurde das Schlucken von Opium mit der Einnahme von Medikamenten gleichgesetzt, während das Rauchen der Droge als Freizeitbeschäftigung und somit als »Perversion« angesehen wurde.33 Ein ähnliches Muster des Opioidkonsums zeigte sich auch in Europa und Amerika. Obwohl verschiedene Tinkturen und Tonika auf Opioidbasis im Westen weit verbreitet waren, war das Rauchen von Opium zum bloßen Vergnügen über die längste Zeit des 19. Jahrhunderts stark verpönt: Es galt als »verabscheuungswürdig« und man meinte, es sei typisch für »degenerierte Rassen«.34
Kurz gesagt, gesellschaftliche Konventionen, die sich durch den jahrhundertelangen Umgang mit Opium entwickelt hatten, könnten dazu beigetragen haben, einige Teile Eurasiens vor hochgradig süchtig machenden Formen des Opioidkonsums zu schützen. Es ist jedoch anzumerken, dass die gesellschaftliche Resistenz gegen Suchtmittel nicht ewig anhält und vor allem dann recht schnell bröckeln kann, wenn die jeweilige Droge zu noch suchterzeugenderen Formen synthetisiert wird. Im Iran beispielsweise entwickelte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein heftiges Heroinproblem, ebenso wie in Indien, wo man begann, Kokain in die Paste zu mischen, die auf Betelblätter aufgetragen wird, um Paan herzustellen.35 Und auch heute sind Teile Indiens, Pakistans und Afghanistans erneut von sich rasch ausbreitenden Opioidepidemien betroffen.
Aus vielen europäischen Reiseberichten geht hervor, dass Opium im 16. Jahrhundert unter den höfischen Eliten Nordindiens, Afghanistans und Zentralasiens weit verbreitet war. In dieser Zeit wurde es in der Regel in einer Form konsumiert, die als ma‘jûn bekannt ist, eine Mischung aus Opiumpaste und diversen anderen Substanzen. Ma‘jûn wurde in der Regel zu Kügelchen gerollt und gegessen oder in Getränke gemischt und getrunken.36 Der erste Mogulkaiser von Indien, Babur, bezieht sich in seiner Autobiografie häufig auf Ma’jûn.37 Sein Sohn, Kaiser Humayun, war ein noch passionierterer Fan der Droge.38 Humayuns Sohn, Kaiser Akbar