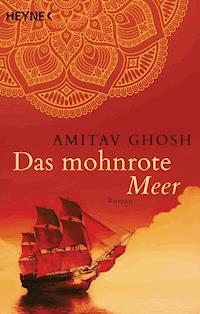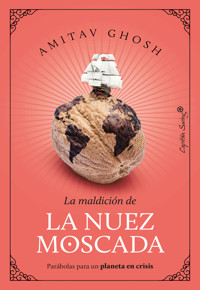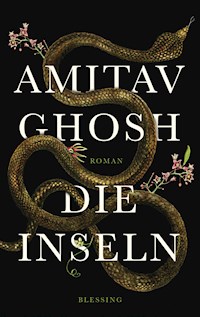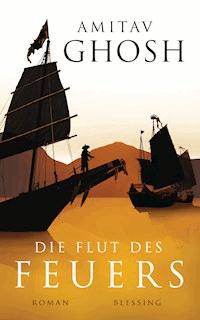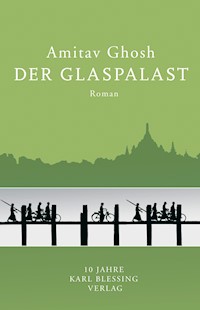
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine faszinierende Familiensaga - und zugleich eine dramatische Liebesgeschichte
"Der Doktor Schiwago des Fernen Osten" (INDEPENDENT ON SUNDAY) fand mit seinem farbenprächtigen Epos über Liebe und Krieg in einem exotischen Land auf der ganzen Welt begeisterte Leser und war auch bei den Kritikern ein Riesenerfolg. Dieser erste große Roman über das geheimnisumwitterte Birma erzählt die Geschichte des jungen Rajkumar, der in einer Imbissbude auf dem Markt von Mandalay 1885 Zeuge des Einmarsches der britischen Truppen wird. Entsetzt beobachtet er die Plünderung des Glaspalastes und muss mit ansehen, wie die Königsfamilie ins Exil gejagt wird. Im Gefolge sieht er die Dienerin Dolly und ist von ihrer Schönheit so bezaubert, dass er ihr Gesicht nie mehr vergisst ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Amitav Ghosh
Der Glaspalast
Roman
Aus dem Englischen
1
In Ma Chos Suppenküche war nur einer, der zu wissen schien, was für ein Geräusch da über die Ebene heranrollte, die silberne Biegung des Irawadi entlang, bis hin zur westlichen Mauer der Festung von Mandalay. Sein Name war Rajkumar, und er war Inder, ein Junge von zwölf Jahren – nicht gerade eine Quelle der Zuverlässigkeit.
Es war ein fremdartiges, beunruhigendes Geräusch, ein fernes Dröhnen, gefolgt von leisem, stotterndem Grollen. Ab und zu klang es wie das Knacken trockener Zweige, jäh und unvermutet. Und dann, mit einem Mal, ging es in lauten Donner über, der die wackeligen Bänke der Garküche erzittern ließ und den Topf mit der dampfenden Brühe heftig durchrüttelte.
In der Imbissstube gab es nur zwei Bänke, und auf beiden drängten sich die Menschen dicht an dicht. Es war kalt, der Beginn des kurzen, aber eisigen Winters in Mittelbirma, und die Sonne war noch nicht hoch genug hinaufgestiegen, um den klammen Nebel zu vertreiben, der im Morgengrauen vom Fluss heraufgekrochen war. Als die ersten Geräusche in den Imbiss drangen, herrschte augenblicklich Schweigen, das sich alsbald in einem Gewirr von Fragen und geflüsterten Vermutungen verlor. Bestürzt sahen die Leute sich um. Was ist das? Ba le? Was mag das sein?
Und dann durchschnitt Rajkumars helle, aufgeregte Stimme das Gewirr von Mutmaßungen. »Englische Kanonen«, sagte er in fließendem, wenn auch stark gefärbtem Birmanisch. »Irgendwo flussaufwärts wird geschossen. Sie sind auf dem Weg hierher.«
Manche Gäste machten finstere Gesichter, als sie sahen, dass die Worte von dem Küchenjungen kamen, und dass er ein kala von jenseits des Meeres war – ein Inder, mit Zähnen, so weiß wie seine Augäpfel und einer Haut mit der Farbe von poliertem Hartholz. Er stand mitten in der Garküche, einen Stapel angeschlagener irdener Schalen in den Händen, und grinste ein wenig einfältig, als mache es ihn verlegen, mit seinem kostbaren Wissen zu prahlen.
Sein Name bedeutete Prinz, doch seine Erscheinung war alles andere als majestätisch, mit seinem ölbespritzten Wams, seinem unordentlich geknoteten longyi und den nackten Füßen mit der dicken schwieligen Haut. Wurde er gefragt, wie alt er sei, dann sagte er fünfzehn, manchmal auch achtzehn oder neunzehn; denn es bescherte ihm ein Gefühl von Stärke und Macht, so schamlos zu übertreiben, sich als stark und erwachsen auszugeben, was Geist und Körper anbelangte, wo er doch in Wirklichkeit fast noch ein Kind war. Hätte er sich für zwanzig ausgegeben, so hätte man ihm auch das geglaubt, denn er war groß und stämmig, und seine Schultern waren kräftiger und breiter als die vieler Männer. Und weil er sehr dunkelhäutig war, ließ sich schwer erkennen, dass sein Kinn ebenso glatt war wie seine hohle Hand.
Allein dem Zufall war es zu verdanken, dass Rajkumar an diesem Novembermorgen in Mandalay zugegen war. Der Sampan, das Hausboot, auf dem er sich als Helfer und Botenjunge verdingte, bedurfte einiger Reparaturarbeiten, nachdem es vom Golf von Bengalen kommend den Irawadi hinaufgesegelt war. Der Bootsbesitzer hatte einen gehörigen Schrecken bekommen, als man ihm sagte, die Arbeiten könnten sich gut einen ganzen Monat oder länger hinziehen. Es war ihm unmöglich, seine Mannschaft die ganze Zeit über durchzufüttern, und so fasste er einen Entschluss: Einige von ihnen würden sich andere Arbeit suchen müssen. Er empfahl Rajkumar, in die Stadt zu laufen, ein paar Meilen landeinwärts. In dem Basar gegenüber der westlichen Festungsmauer solle er nach einer Frau mit Namen Ma Cho fragen. Sie sei zur Hälfte Inderin und betreibe eine kleine Garküche. Mochte sein, dass sie Arbeit für ihn habe.
Und so kam es, dass sich Rajkumar im Alter von zwölf Jahren auf den Weg in die Stadt Mandalay machte und zum ersten Mal in seinem Leben eine gerade Straße erblickte. Die Lehmdecke war durchzogen von parallelen Furchen, in den Boden gegraben von den harten, massiven Teakholzrädern der Ochsenkarren. Bambusbaracken und mit Palmwedeln gedeckte Hütten säumten die Straßen zu beiden Seiten. Daneben türmten sich Kuhfladen und Berge von Unrat. Doch der schnurgerade Weg, den die Straße nahm, blieb unbesudelt von dem Durcheinander, das ihn säumte. Die Straße war wie ein Damm über unruhiger See. Ihr Verlauf geleitete das Auge geradewegs durch die Stadt, vorbei an den leuchtend roten Mauern der Festung bis hin zu den fernen Pagoden auf dem Hügel von Mandalay, die auf der Anhöhe leuchteten wie eine Kette weißer Glocken.
Rajkumar war weit gereist für sein Alter. Das Schiff, auf dem er arbeitete, war ein Küstenboot, das sich gewöhnlich nicht auf das offene Meer begab; es verkehrte an dem lang gestreckten Küstenstreifen, der Birma mit Bengalen verband. Rajkumar war schon in Chittagong und in Bassein gewesen und in zahlreichen Städten und Dörfern dazwischen. Doch auf seiner Wanderung vom Fluss nach Mandalay musste er sich eingestehen, dass er noch niemals zuvor eine Verkehrsader wie diese gesehen hatte. Er war an Pfade und Gassen gewöhnt, die sich unaufhörlich um sich selbst wanden, sodass man nie über die nächste Biegung hinaussehen konnte. Dies war etwas Neues: Eine Straße, die den Horizont mitten in bewohnte Gebiete holte.
Als sich ihm die Festung in ihrer gesamten Unermesslichkeit offenbarte, blieb Rajkumar mitten auf der Straße stehen: Der Anblick der Zitadelle war prächtig, die meilenlangen Mauern und der gewaltige Graben. Die roten, mit Zinnen bewehrten Schutzwälle waren beinahe drei Stockwerke hoch und dennoch von beschwingter Leichtigkeit. Sie wurden überschattet von reich verzierten Torbauten mit siebenstufigen Dächern. Lange, schnurgerade Wege führten strahlenförmig von den Mauern fort und bildeten ein gleichmäßiges Netz. Das geordnete Muster dieser Straßen und Wege war so verlockend, dass Rajkumar sich einfach treiben ließ, auf Erkundungsreise ging. Als er sich darauf besann, warum man ihn in die Stadt geschickt hatte, war es beinahe dunkel. Schließlich fand er die westliche Mauer der Festung und fragte nach Ma Cho.
»Ma Cho?«
»Sie hat eine Garküche. Sie verkauft baya-gyaw. Sie ist zur Hälfte Inderin.«
»Ach, Ma Cho.« Es lag auf der Hand, dass dieser zerlumpte indische Junge auf der Suche nach Ma Cho war: Sie beschäftigte oft indische Vagabunden in ihrer Garküche. »Das da ist sie, die Dünne da.«
Ma Cho war klein und hager, und über die Stirn hingen ihr wirre Locken ins Gesicht wie ein Fransenbaldachin. Sie war Mitte dreißig und sah eher birmanisch als indisch aus. Sie war gerade damit beschäftigt, Gemüse zu braten, und blinzelte im Schutz ihres erhobenen Armes auf das rauchende Öl. Misstrauisch sah sie Rajkumar an: »Was willst du?«
Er hatte kaum angefangen, von dem Boot und den Reparaturen zu erzählen und zu erklären, dass er auf der Suche nach Arbeit war, als sie ihm ins Wort fiel. Mit schriller Stimme und geschlossenen Augen schrie sie ihn an: »Was glaubst du denn? Dass ich Arbeit unter meinem Rocksaum verstecke, die ich nur hervorholen und dir geben muss? Letzte Woche erst ist mir ein Junge mit zwei von meinen Töpfen davongelaufen. Wer sagt mir denn, dass du es nicht genauso machst?« Und so ging es weiter.
Rajkumar verstand, dass dieser Ausbruch nicht gegen ihn persönlich gerichtet war; dass er viel mehr mit dem Küchendampf zu tun hatte, dem spritzenden Öl und den Gemüsepreisen als mit seiner Anwesenheit oder mit dem, was er gesagt hatte. Er schlug die Augen nieder und stand gleichmütig da, scharrte im Staub, bis sie fertig war.
Keuchend hielt sie inne und musterte ihn. »Wer sind deine Eltern?«, fragte sie schließlich und wischte sich mit dem Ärmel ihres verschwitzten aingyi über die feuchte Stirn.
»Ich habe keine. Sie sind gestorben.«
Sie überlegte, biss sich auf die Lippe. »Also gut. An die Arbeit, aber merk dir, viel mehr als drei Mahlzeiten am Tag und einen Platz zum Schlafen wirst du hier nicht bekommen.«
Er lächelte. »Mehr brauche ich nicht.«
Ma Chos Garküche bestand aus ein paar Bänken, die sich zwischen die Pfähle einer Bambushütte drängten. Auf einem kleinen Hocker thronend kochte Ma Cho über dem offenen Feuer. Außer gebratenen baya-gyaw gab es bei ihr Nudeln und Suppe. Rajkumar oblag die Aufgabe, die gefüllten Schalen zu den Gästen zu tragen. Dazwischen räumte er die Kochgeräte auf, schürte das Feuer und schnitt Gemüse für die Suppe klein. Fisch oder Fleisch vertraute Ma Cho ihm nicht an. Diese Arbeit erledigte sie selbst, mit ihrem kurzstieligen gebogenen da. Abends schleppte Rajkumar die Gerätschaften kübelweise zum Festungsgraben und besorgte dort den Abwasch.
Eine breite, staubige Straße trennte Ma Chos Garküche von dem Graben. Ein riesiges Rechteck beschreibend führte diese Straße um die gesamte Festung herum. Um an den Graben zu gelangen, musste Rajkumar also lediglich diese Straße überqueren. Der Garküche gegenüber befand sich eine Brücke, die zu einem der kleineren Eingänge der Festung führte, dem Begräbnistor. Rajkumar hatte die Lotosblätter entfernt, die auf dem Wasser schwammen und sich so unter der Brücke ein kleines Bassin geschaffen. Dies war sein Platz geworden: Hier spülte er ab, und hier wusch er sich – direkt unterhalb der Schutz gewährenden hölzernen Planken der Brücke.
Am anderen Ende der Brücke lagen die Mauern der Festung. Alles, was man vom Inneren der Festung erspähen konnte, war eine bemalte Turmspitze, die in einem glitzernden Schirm aus Gold endete: Der große, neundachige hti der Könige von Birma. Rajkumar wusste, dass sich an jener Stelle der Thronsaal des Glaspalastes befand, wo Thebaw, König von Birma, zusammen mit seiner Ersten Gemahlin, der Königin Supayalat, Hof hielt. Und er wusste ebenso, dass die Festung für einen wie ihn verboten war.
»Bist du schon mal drinnen gewesen?«, fragte er Mo Cho eines Tages. »In der Festung, meine ich.«
»Aber ja«, sagte Mo Cho und nickte wichtigtuerisch. »Dreimal, wenn nicht öfter.«
»Wie ist es dort?«
»Es ist riesig, viel größer als es scheint. Es ist eine Stadt für sich, mit langen Straßen und Kanälen und Gärten. Zuerst kommen die Häuser der Beamten und der Edelleute. Und dann stehst du vor einer Palisade aus riesigen Teakholzpfählen. Dahinter verborgen liegen die Wohnräume der königlichen Familie und ihrer Dienerschaft – hunderte und aberhunderte Zimmer, mit goldenen Säulen und blank glänzenden Böden. Und genau in der Mitte befindet sich ein riesiger Saal, wie ein großer funkelnder Lichtstrahl. Die Wände sind mit Kristall verziert und die Decke mit Spiegeln behangen.«
»Verlässt der König die Festung jemals?«
»Die letzten sieben Jahre hat er es nicht getan. Aber die Königin und ihre Dienerinnen gehen manchmal an den Mauern spazieren. Wer sie gesehen hat, sagt, dass ihre Dienerinnen die schönsten Frauen im ganzen Land sind.«
»Wer sind diese Dienerinnen?«
»Junge Mädchen, Waisen, viele von ihnen noch Kinder. Man sagt, die Mädchen werden von den fernen Bergen in den Palast gebracht. Die Königin nimmt sie in ihre Obhut und zieht sie auf, und die Mädchen dienen ihr als Zofen. Man sagt, dass sie niemand anderem traut, ihr und ihren Kindern aufzuwarten.«
»Wann kommen diese Mädchen zu den Mauern?«, fragte Rajkumar. »Wie kann man sie sehen?«
Rajkumar hatte leuchtende Augen und ein eifriges Gesicht. Ma Cho lachte ihn aus. »Warum? Willst du etwa versuchen, dort hineinzukommen, du indischer Narr, du kohlrabenschwarzer kala? Man wird dich schon von ferne entdecken und dir den Kopf abhacken.«
Als er in jener Nacht ausgestreckt auf seiner Matte lag und durch die Lücke zwischen seinen Füßen spähte, erhaschte Rajkumar einen Blick auf den vergoldeten hti, der den Glaspalast bezeichnete: Er glühte im Mondlicht wie ein Leuchtfeuer. Einerlei, was Ma Cho sagte, ehe er Mandalay verließ, würde er den Graben überqueren – und sei es nur ein einziges Mal.
Ma Chos Garküche bestand aus dem Raum zwischen den Pfählen, die ihre Hütte aus Bambuswänden stützten. Ma Cho selbst wohnte in der kleinen Kammer über der Imbissstube. Wie ein Käfer krabbelte sie abends über eine wackelige Leiter durch eine enge Luke hinauf. Rajkumar verbrachte seine Nächte unter Ma Chos Kammer zwischen den Pfählen, dort, wo am Tage die Gäste saßen. Ma Cho schlief direkt über ihm auf einer Matte. Der Boden bestand aus roh zusammengezimmerten Brettern. Wenn Ma Cho ihre Lampe anzündete, um sich umzukleiden, dann konnte Rajkumar sie durch die Ritzen in der Holzdecke deutlich sehen. Er lag auf dem Rücken, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, und sah ohne zu blinzeln hinauf, während sie den aingyi löste, der locker um ihre Brüste geknotet war.
Am Tage war Ma Cho ein hagerer, rasender Drachen, der unentwegt von einer Verrichtung zur nächsten eilte und dabei jeden, der ihm in die Quere kam, mit schriller Stimme beschimpfte. Am Abend aber, wenn des Tages Arbeit getan war, schlich sich eine gewisse Trägheit in ihre Bewegungen. Sie umfasste sanft ihre Brüste und fächelte ihnen mit den Händen Luft zu; sie ließ ihre Finger gemächlich durch die Spalte zwischen ihren Brüsten gleiten, über den Hügel ihres Bauches hinab zu den Schenkeln. Langsam schlängelte sich Rajkumars Hand dann an dem Knoten seines longyi vorbei zu seinen Leisten.
Eines Nachts wurde er von Geräuschen geweckt, einem gleichmäßigen Quietschen der Bretter über seinem Kopf, begleitet von Stöhnen und Wispern und heftigem Keuchen. Wer mochte nur da oben bei ihr sein? Er hatte niemanden hinaufgehen sehen.
Als er am nächsten Morgen erwachte, sah Rajkumar einen kleinen, bebrillten, eulengleichen Mann die Leiter hinunterklettern, die in Ma Chos Kammer führte. Er trug europäische Kleidung: ein Hemd, eine Hose und einen Strohhut. Er unterzog Rajkumar einer ernsten, eingehenden Betrachtung und lüftete förmlich den Hut. »Wie geht es dir?«, fragte er. »Kaisa hai? Sab kuchh thik-thak?«
Rajkumar hatte die Worte sehr wohl verstanden – aus dem Munde eines Inders hätte er nichts anderes erwartet – doch ihm blieb vor Staunen der Mund offen stehen. Seit er nach Mandalay gekommen war, hatte er vielerlei fremdländische Menschen gesehen, doch dieser Mann sah vollkommen anders aus als die anderen. Er trug europäische Kleidung und sprach Hindustani – und doch waren seine Züge weder die eines Weißen noch die eines Inders. Er schien eindeutig Chinese zu sein.
Der Mann lächelte über Rajkumars Staunen, zog abermals den Hut und verschwand hinaus in den Basar.
»Wer war das?«, fragte Rajkumar, als Ma Cho die Leiter herunterstieg.
Sie war über die Frage offensichtlich verärgert und funkelte ihn böse an, um deutlich zu machen, dass sie nicht gedachte, ihm zu antworten. Doch Rajkumars Neugierde war geweckt, und er blieb hartnäckig: »Wer war das, Ma Cho? Sag es mir.«
»Das ist…« Ma Chos Antwort kam in kurzen Stößen, als würde ein Schluckauf die Worte aus ihrem Bauch heraufzwingen. »Das ist… mein Lehrmeister… mein sayagyi.«
»Dein Lehrmeister?«
»Ja… er lehrt mich… Er weiß viele Dinge.«
»Was für Dinge?«
»Das geht dich nichts an.«
»Wo hat er gelernt, Hindustani zu sprechen?«
»Im Ausland, aber nicht in Indien. Er kommt irgendwo aus Malaya. Aus Malakka, glaube ich. Das solltest du besser ihn fragen.«
»Wie heißt er?«
»Das tut nichts zur Sache… Du wirst ihn Saya nennen, genau wie ich.«
»Nur Saya?«
»Saya John.« Sie war wütend. »So nennt ihn jeder hier. Wenn du noch mehr wissen willst, musst du ihn selbst fragen.«
Sie griff in die erkaltete Kochstelle und warf mit einer Hand voll Asche nach ihm. »Wer hat gesagt, du kannst hier rumsitzen und den ganzen Morgen plappern, du schwachköpfiger kala? An die Arbeit.«
An diesem und am nächsten Abend war von Saya John nichts zu sehen. Eines Abends konnte Rajkumar der Versuchung nicht länger widerstehen. »Ma Cho?«, fragte er, »was ist mit deinem Lehrmeister geschehen? Warum ist er nicht wiedergekommen?«
Ma Cho saß an ihrem Feuer und briet baya-gyaw. Sie starrte in das heiße Öl und sagte einsilbig: »Er ist fort.«
»Wo ist er?«
»Im Dschungel…«
»Im Dschungel? Wieso?«
»Er ist Händler. Er beliefert die Teaklager. Er ist meistens unterwegs.« Auf einmal entglitt ihr die Schöpfkelle, und Ma Cho vergrub das Gesicht in den Händen.
Rajkumar eilte zu ihr. »Warum weinst du, Ma Cho? Wein doch nicht.« Mit einer ungeschickten Geste des Mitgefühls strich er ihr über den Kopf. »Willst du ihn heiraten?«
Sie griff nach den Falten seines abgetragenen longyi und wischte sich mit dem Stoff die Tränen ab. »Seine Frau ist letztes Jahr gestorben. Er hat einen Sohn, einen kleinen Jungen. Er sagt, er wird nie wieder heiraten.«
»Vielleicht überlegt er es sich noch anders.«
In einem ihrer plötzlichen Wutausbrüche stieß sie ihn weg. »Das verstehst du nicht, du dummköpfiger kala. Er ist Christ. Jedes Mal, wenn er mich besuchen kommt, muss er am nächsten Morgen in seine Kirche gehen, beten und um Vergebung bitten. Denkst du vielleicht, mit so einem Mann will ich verheiratet sein?« Sie hob die Kelle auf und drohte ihm damit. »Und jetzt zurück an die Arbeit, oder ich brate dein schwarzes Gesicht in heißem Öl…«
Ein paar Tage später war Saya John wieder da. Aufs Neue begrüßte er Rajkumar in seinem gebrochenen Hindustani: »Kaisa hai?
Sab kuchh thik-thak?«
Rajkumar brachte ihm eine Schale Nudeln. Er blieb stehen und sah Saya John beim Essen zu. »Saya«, fragte er schließlich auf Birmanisch, »wo hast du Hindustani gelernt?«
Saya John blickte zu ihm auf und lächelte. »Schon als Kind«, sagte er, »denn ich bin eine Waise gewesen, ein Findelkind. Katholische Priester haben mich aufgezogen, in einer Stadt namens Malakka. Diese Männer kamen von überall her – aus Portugal, aus Macao, aus Goa. Sie haben mir auch meinen Namen gegeben – John Martins, was auch nicht ganz richtig ist – sie nannten mich Joao, doch später habe ich dann John daraus gemacht. Diese Priester haben viele verschiedene Sprachen gesprochen, und von jenen, die aus Goa stammten, habe ich ein paar indische Wörter aufgeschnappt.
Als ich alt genug war, um Geld zu verdienen, bin ich nach Singapur gegangen. Dort habe ich eine Weile als Sanitäter in einem Militärhospital gearbeitet. Die meisten der Soldaten dort waren Inder, und sie haben mir immer wieder diese eine Frage gestellt: Wie kommt es, dass einer, der aussieht wie ein Chinese und noch dazu einen christlichen Namen trägt, unsere Sprache spricht? Als ich ihnen erzählte, wie es dazu kam, pflegten sie zu lachen, und dann sagten sie, ich sei ein dhobi ka kutta – der Hund eines Wäschers, na ghar ka na ghat ka – einer, der nirgends hingehört, nicht ins Wasser und nicht an Land, und ich sagte, ja, genau, das bin ich.« Saya John lachte so sehr, dass Rajkumar in sein Gelächter einfiel.
Eines Tages brachte Saya John seinen Sohn mit in die Garküche. Der Junge hieß Matthew und war sieben Jahre alt, ein hübsches Kind mit leuchtenden Augen, dem eine etwas altkluge, selbstgefällige Art zu Eigen war. Er war soeben aus Singapur gekommen, wo er bei der Familie seiner Mutter lebte und eine bekannte Missionsschule besuchte. Mehrmals in jedem Jahr richtete Saya John es so ein, dass die Verwandten den Jungen in den Ferien nach Birma brachten.
Es war früher Abend, und zu dieser Zeit war in der Garküche gewöhnlich viel Betrieb. Doch zu Ehren ihrer Besucher beschloss Ma Cho, den Imbiss für diesen Tag zu schließen. Sie zog Rajkumar beiseite und befahl ihm, mit Matthew spazieren zu gehen, nur für etwa eine Stunde. Auf der anderen Seite der Festung sei ein pwe, und der Junge würde an dem Jahrmarktrummel sicher Gefallen finden.
»Und denke daran«, sie drohte ihm mit grimmigen, fahrigen Gesten, »nicht ein Wort über…«
»Keine Bange.« Rajkumar lächelte sie unschuldig an. »Ich sage nichts von deinem Unterricht.«
»Schwachköpfiger kala.« Mit geballten Fäusten trommelte sie auf seinen Rücken ein. »Raus jetzt – sieh zu, dass du rauskommst.«
Rajkumar wickelte seinen einzigen guten longyi um und zog eine zerfranste Weste über, die Ma Cho ihm geschenkt hatte. Saya John drückte ihm ein paar Münzen in die Hand. »Kaufe etwas davon – für euch beide, geht euch vergnügen.«
Auf dem Weg zu dem pwe erregte ein Erdnussverkäufer ihre Aufmerksamkeit. Matthew hatte Hunger, und er bestand darauf, dass Rajkumar Unmengen von Erdnüssen für sie kaufte. Sie setzten sich an den Graben, ließen die Füße ins Wasser baumeln und breiteten die in getrocknete Blätter gewickelten Erdnüsse rund um sich aus.
Matthew zog ein Blatt Papier aus der Tasche, ein Bild. Es zeigte ein Gefährt mit drei Speichenrädern, zwei großen am hinteren Teil und einem kleinen ganz vorne. Rajkumar studierte es mit gerunzelter Stirn. Es sah aus wie ein Einspänner, aber es gab keine Deichsel für ein Pferd oder einen Ochsen.
»Was ist das?«
»Ein Motorwagen.« Matthew zeigte ihm die Einzelheiten – den eingebauten Verbrennungsmotor, die senkrechte Kurbelwelle, das waagerechte Schwungrad. Er erklärte, dass diese Maschine beinahe so viel Kraft erzeugen konnte wie ein Pferd und es auf eine Geschwindigkeit von acht Meilen in der Stunde brachte. Es war erst dieses Jahr, 1885, in Deutschland von einem Mann namens Carl Benz präsentiert worden.
»Eines Tages«, sagte Matthew ganz leise, »werde ich auch so eins haben.«
Dabei klang er keineswegs aufschneiderisch, und Rajkumar zweifelte nicht einen Augenblick an seinen Worten. Er war tief davon beeindruckt, dass ein Kind in diesem Alter sich mit einem solch seltsamen Ding so genau auskannte.
Dann fragte Matthew: »Wie bist du hierher gekommen, nach Mandalay?«
»Ich habe auf einem Boot gearbeitet, auf einem Sampan, so einem wie die auf dem Fluss dort.«
»Und wo sind deine Eltern? Deine Familie?«
»Ich habe keine.« Rajkumar hielt inne. »Ich habe sie verloren.« Matthew knackte eine Nuss mit den Zähnen. »Wie?«
»In Akyab, unserer Stadt, gab es ein Fieber, eine Seuche. Viele Menschen sind daran gestorben.«
»Und du hast überlebt?«
»Ja. Ich war krank, aber ich bin am Leben geblieben. In meiner Familie war ich der Einzige. Ich hatte einen Vater, eine Schwester, einen Bruder…«
»Und eine Mutter?«
»Und eine Mutter.«
Rajkumars Mutter war auf einem Sampan gestorben, der in einer von Mangroven gesäumten Flussmündung vertäut gewesen war. Er erinnerte sich an die tunnelartige Kabine des Bootes und an das Dach aus gebogenem Bambusrohr und Stroh; neben dem Kopf seiner Mutter hatte eine Öllampe gestanden, auf einer der Querplanken des Rumpfes, ihr flackernder gelber Schein gedämpft von einem Lichthof aus zahllosen Insekten. Die Nacht war still und stickig gewesen, denn die Mangroven mit ihren Hängewurzeln hatten jede Brise abgehalten und das Boot sanft zwischen tiefen Schlammbänken gewiegt. Und doch hatte in der dunklen Feuchtigkeit um das Boot herum etwas Rastloses gelegen. Von Zeit zu Zeit war das Platschen von Samenschoten zu hören gewesen, die ins Wasser fielen, und das geschmeidige Gleiten der Fische, die sich durch den Schlamm wühlten. In der engen, dunklen Kabine des Sampans war es heiß gewesen, doch seine Mutter hatte gezittert. Rajkumar hatte das Boot durchstöbert und sie mit jedem Stückchen Kleidung zugedeckt, das er finden konnte
Zu dem Zeitpunkt war das Fieber Rajkumar schon wohlvertraut: Sein Vater, der Tag für Tag in einem Lagerhaus am Hafen arbeitete, hatte es in ihr Haus gebracht. Er war ein stiller Mann, der sein Auskommen als dubash und als munshi – als Dolmetscher und als Schreiber – verdiente. Er arbeitete für eine Reihe Kaufleute entlang der Ostküste des Golfs von Bengalen. Ursprünglich stammte seine Familie aus dem Hafen von Chittagong, doch Rajkumars Vater hatte sich mit den Verwandten überworfen und war mit den Seinen fortgezogen. Allmählich war er so die Küste hinunter gewandert, hatte seine Kenntnis von Zahlen und Sprachen feilgeboten und sich schließlich in Akyab niedergelassen, dem Haupthafen der Arakanküste – jenem Küstenstreifen, an dem es zwischen Birma und Indien immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt. Dort war er ein gutes Dutzend Jahre geblieben und hatte drei Kinder gezeugt, von denen Rajkumar das älteste war. Ihr Haus stand an einer Bucht, die nach getrocknetem Fisch roch. Ihr Familienname lautete Raha, und als die Nachbarn wissen wollten, wer sie waren und woher sie kamen, sagten sie, sie seien Hindus aus Chittagong. Das war alles, was Rajkumar über die Vergangenheit seiner Familie wusste.
Nach seinem Vater wurde Rajkumar krank. Als er das Bewusstsein wiedererlangte, war er auf dem Weg der Besserung. Er fand sich wieder auf dem Meer, zusammen mit seiner Mutter. Sie seien auf dem Weg zurück in ihre Heimatstadt Chittagong, so sagte sie ihm, und es gebe nur noch sie beide – alle anderen waren gestorben.
Sie hatten die Strömung gegen sich und kamen nur langsam voran. Der Rahsegler und die khalasi-Mannschaft hatten sich dicht ans Ufer gedrängt die Küste entlanggekämpft. Rajkumar hatte sich geschwind erholt, doch dann war seine Mutter krank geworden. Als sie nur noch einige Tage von Chittagong entfernt waren, hatte sie zu zittern begonnen. Das Ufer war dicht mit Mangrovenwäldern bewachsen. Eines Abends hatte der Bootsbesitzer den Sampan in eine Flussmündung gezogen, und dort hatten sie gewartet.
Rajkumar hatte seine Mutter mit sämtlichen Saris aus ihrem Kleiderbündel zugedeckt, mit geliehenen longyis der Bootsmänner, sogar mit einem gefalteten Segel. Doch kaum war er fertig, da begannen ihre Zähne wieder zu klappern, ganz leise, wie kleine Würfel. Mit einem Wink ihres Zeigefingers rief sie ihn an ihre Seite. Als er sein Ohr an ihren Mund legte, fühlte er an seiner Wange, dass ihr Körper heiß war wie glühende Kohlen.
Sie zeigte ihm einen Knoten an der Rückseite ihres Saris. Darin eingewickelt war ein goldener Armreifen. Sie zog ihn heraus und reichte ihn Rajkumar. Er sollte ihn in dem Taillenknoten seines longyi verbergen. Der nakhoda, der Bootsbesitzer, sei ein vertrauenswürdiger alter Mann, so sagte sie ihm. Bei ihrer Ankunft in Chittagong – aber erst dann, keinesfalls vorher – sollte Rajkumar ihm den Armreif geben.
Sie schloss seine Finger um den Reif. Von der Glut ihres Körpers erhitzt schien das Metall sich in seine Hand zu brennen. »Bleib am Leben«, flüsterte sie. »Beche thako Rajkumar. Lebe, mein Prinz; halte dein Leben fest.«
Ihre Stimme erstarb, und Rajkumar wurde sich plötzlich des schwachen Platschens der Katzenfische bewusst, die sich in den Schlamm gruben. Er blickte auf und sah den nakhoda. Er hockte im Bug des Sampan, paffte seine aus Kokosschale geschnitzte Wasserpfeife und befingerte seinen dünnen, weißen Bart. Seine khalasi-Mannschaft war um ihn herum versammelt. Sie hielten ihre von einem longyi umhüllten Knie umfasst und beobachteten Rajkumar. Der Junge vermochte nicht zu sagen, ob ihre starren Blicke von Mitleid zeugten oder von Ungeduld.
Jetzt besaß er nur noch den Armreif. Seine Mutter hatte gewollt, dass er damit seine Passage nach Chittagong bezahlte. Doch nun war seine Mutter tot, und welchem Zweck sollte es dienen, an einen Ort zurückzukehren, von dem sein Vater einst geflohen war? Nein. Besser, er traf eine Abmachung mit dem nakhoda. Rajkumar nahm den alten Mann beiseite und bat darum, in die Mannschaft aufgenommen zu werden. Statt des üblichen Lehrgeldes bot er ihm den Armreif an.
Der Alte musterte ihn von Kopf bis Fuß. Der Junge war kräftig und willig, und er hatte überdies das tödliche Fieber überlebt, das so viele Städte und Dörfer entlang der Küste leer gefegt hatte. Das allein sprach für gewisse nützliche Qualitäten von Körper und Geist. Er nickte dem Jungen zu und nahm den Armreif – ja, du kannst bleiben.
Bei Tagesanbruch machte der Sampan an einer Sandbank fest, und die Männer halfen Rajkumar, einen Holzstoß für die Verbrennung seiner Mutter aufzuschichten. Rajkumar weinte, als er ihr das Feuer in den Mund legte. Nun war er, der er so reich an Angehörigen gewesen war, allein, sein ganzes Erbe eine khalasi-Lehre. Doch er hatte keine Angst, nicht einen einzigen Augenblick; seine Traurigkeit war von Bedauern geprägt – dass sie so zeitig, so früh von ihm gegangen waren, ohne jemals in den Genuss des Reichtums oder gerechten Lohns zu kommen, der ihm, dessen war er sich gewiss, einst gehören würde.
Es war lange her, seit Rajkumar zuletzt über seine Familie gesprochen hatte. Unter den Kameraden auf dem Sampan wurden diese Dinge nur selten erwähnt. Viele von ihnen kamen aus Familien, die all jenen Katastrophen und Unglücksfällen zum Opfer gefallen waren, die diesen Küstenstreifen so häufig heimsuchten. Sie zogen es vor, nicht über diese Dinge zu sprechen.
Es war seltsam, dass gerade Matthew, dieses Kind mit seiner gebildeten Redeweise und seinen vollendeten Manieren, es geschafft hatte, ihn auszuhorchen. Rajkumar konnte nicht anders, er war gerührt. Auf dem Rückweg zu Ma Cho legte er dem Jungen einen Arm um die Schultern. »Und wie lange wirst du hier bleiben?«
»Ich fahre morgen zurück.«
»Morgen? Aber du bist doch gerade erst gekommen.«
»Ich weiß. Eigentlich sollte ich zwei Wochen bleiben, aber Vater glaubt, dass sich Schwierigkeiten anbahnen.«
»Schwierigkeiten!« Rajkumar sah ihn an. »Was für Schwierigkeiten?«
»Die Engländer treffen Vorbereitungen, um eine Flotte den Irawadi hinaufzuschicken. Es wird Krieg geben. Vater sagt, die Briten erheben Anspruch auf das gesamte Vorkommen an Teakholz in Birma. Der König wird es ihnen nicht geben, also werden sie den König beseitigen.«
Rajkumar brach in schallendes Gelächter aus. »Ein Krieg um Holz? Hat man so was schon gehört?« Ungläubig versetzte er Matthew einen sanften Schlag auf den Kopf. Er war trotz allem nichts weiter als ein Kind, auch wenn seine Art so erwachsen war. Er hatte wohl schlecht geträumt letzte Nacht.
Doch dies sollte nur der erste von vielen Anlässen sein, bei denen sich Matthew als weiser und vorausschauender erwies als Rajkumar. Zwei Tage später wimmelte es überall in der Stadt von Kriegsgerüchten. Ein großer Trupp Soldaten marschierte aus den Toren der Festung und machte sich flussabwärts auf den Weg, in Richtung der Festung von Myingyan. Der Basar war in Aufruhr. Fischweiber leerten eilig ihre Waren auf den Abfallhaufen und hasteten davon. Völlig aufgelöst kam Saya John zu Ma Chos Garküche gerannt. Er hielt ein Blatt Papier in der Hand. »Eine königliche Proklamation«, verkündete er, »versehen mit der Signatur des Königs.«
Alle verstummten, als er zu lesen begann: »An alle königlichen Untertanen und Bewohner des Königreichs: Diese Ketzer, diese barbarischen englischen kalas, welche auf äußerst ungehörige Weise Forderungen stellten, die darauf abzielen, unsere Religion zu entweihen, ja, zu zerstören, unsere nationalen Sitten und Gebräuche zu schänden und unser Volk zu erniedrigen, treffen nun offensichtlich Vorkehrungen, um Krieg zu führen gegen unseren Staat. Wir haben ihnen geantwortet, wie es unter großen Nationen Brauch ist, in gerechten, wohl bedachten Worten. Sollten diese ketzerischen kalas des ungeachtet kommen und in irgendeiner Weise den Versuch unternehmen, unsere Souveränität zu bedrängen oder gar zu zerstören, werden Seine Majestät, Wächter über die Interessen unserer Religion und Hüter unseres Landes, höchstselbst voranmarschieren, mitsamt seinen Generälen, Hauptleuten und Leutnants und mit starken Verbänden, als da sind Infanterie, Artillerie, Elefanterie und Kavallerie; mit seiner mächtigen Streitmacht wird er diesen Ketzern zu Lande und zu Wasser entgegentreten, sie vernichten, ihr Land erobern und es annektieren. Die Religion zu wahren, die nationale Ehre zu wahren, die Interessen unseres Landes zu wahren wird dreifaches Heil bringen – das Heil unserer Religion, das Heil unseres Gebieters sowie das Heil von uns allen, und unser wird der größte Lohn von allem sein – ein Stück des Weges auf dem Pfad zu den himmlischen Gefilden und zum Nirwana.«
Saya John verzog das Gesicht. »Große Worte«, sagte er. »Wir werden sehen, was weiter geschieht.«
Nach der anfänglichen Aufregung kehrte auf den Straßen wieder Ruhe ein. Der Basar öffnete seine Pforten aufs Neue, die Fischweiber kamen zurück und durchwühlten auf der Suche nach ihren Waren die Abfallhaufen. In den folgenden Tagen gingen die Menschen ihren Geschäften nach wie gewohnt.
Die einzige merkliche Veränderung war, dass auf den Straßen keinerlei fremdländische Gesichter mehr zu sehen waren. In Mandalay lebte eine nicht unerhebliche Anzahl Fremder – da waren Gesandte und Missionare aus Europa, Händler und Kaufleute griechischer, armenischer, chinesischer und indischer Herkunft, Arbeiter und Seeleute aus Bengalen, Malaya und von der Koromandelküste; weiß gewandete Sterndeuter aus Manipur; Geschäftsleute aus Gujarat – eine Vielfalt von Menschen, wie sie Rajkumar niemals zuvor erblickt hatte. Doch nun waren die Fremden mit einem Mal verschwunden. Es gingen Gerüchte, die Europäer hätten die Stadt verlassen und sich flussabwärts auf den Weg gemacht, und die anderen hätten sich in ihren Häusern verschanzt.
Einige Tage später veröffentlichte der Palast eine weitere Proklamation, und diesmal war es eine freudige: Man verkündete, die königlichen Truppen hätten den Eindringlingen in der Nähe der Festung Minhla eine deutliche Niederlage erteilt. Die englischen Truppen seien geschlagen worden und über die Grenze geflohen. Die königliche Barke solle flussabwärts entsandt werden, um den Truppen und ihren Befehlshabern Auszeichnungen zu überbringen; im Glaspalast solle eine Dankeszeremonie abgehalten werden.
Freudenrufe hallten durch die Straßen, und der Nebel aus Angst, der in den vergangenen Tagen über der Stadt gehangen hatte, verzog sich geschwind. Zur Erleichterung aller nahmen die Dinge schnell wieder ihren gewohnten Gang: Käufer und Händler kamen in Scharen zurück, und der Betrieb in Ma Chos Garküche war reger denn je.
Eines Abends dann, als Rajkumar durch den Basar eilte, um Ma Chos Fischvorräte aufzufüllen, traf er zufällig auf das vertraute weißbärtige Gesicht seines nakhoda.
»Fährt unser Boot nun bald los?«, fragte Rajkumar. »Wo der Krieg doch aus ist?«
Der alte Mann lächelte ihn bekümmert an. »Der Krieg ist nicht vorüber. Noch nicht.«
»Aber wir haben gehört…«
»Was man sich unten am Ufer erzählt, unterscheidet sich sehr von dem, was man hier in der Stadt zu hören bekommt.«
»Was hast du gehört?«, wollte Rajkumar wissen.
Der nakhoda senkte die Stimme, obwohl sie sich in ihrer bengalischen Chittagong-Mundart unterhielten.
»Die Engländer werden in ein oder zwei Tagen hier sein«, sagte er. »Viele unserer khalasis haben sie schon gesehen. Sie reisen mit der größten Flotte, die je auf einem Fluss gesichtet wurde. Sie haben Kanonen, die die Steinmauern einer Festung hinwegfegen können. Sie haben Schiffe, die so schnell sind, dass sie eine Flutwelle überholen können. Ihre Gewehre schießen schneller, als du zu reden vermagst. Sie kommen wie die Flut: Nichts kann sie aufhalten. Heute haben wir gehört, dass ihre Schiffe um Myingyan herum in Stellung gehen. Morgen schon wirst du den Donner der Geschütze hören können…«
Und wirklich – am nächsten Morgen kam ein fernes, dröhnendes Geräusch über die Ebene herangerollt, bis hin zu Ma Chos Garküche an der westlichen Festungsmauer. Der Basar wimmelte bereits von Menschen, als die ersten Kanonensalven erklangen. Bauersfrauen aus der Umgebung waren frühmorgens in die Stadt gekommen und hatten in langen Reihen ihre Matten ausgebreitet, um ihr Gemüse in hübschen kleinen Büscheln feilzubieten. Auch die Fischer waren schon da, mit den Fängen der vergangenen Nacht, frisch vom Fluss. Schon in ein oder zwei Stunden würde das Gemüse welken und die Fischaugen würden sich trüben. Im Augenblick aber war noch alles knackig und frisch.
Die ersten Schüsse waren nicht mehr als eine kurze Störung in der frühmorgendlichen Geschäftigkeit. Die Menschen sahen verwirrt hinauf in den strahlend blauen Himmel, und die Händler lehnten sich über ihre Waren und bestürmten sich gegenseitig mit Fragen. Ma Cho und Rajkumar waren schon seit Sonnenaufgang sehr beschäftigt. Wie stets, wenn der Morgen kalt war, hatten viele Leute auf dem Nachhauseweg bei ihnen Halt gemacht, um eine Kleinigkeit zu essen. Und nun wurde das Schweigen der mit ihrer Mahlzeit beschäftigten Gäste von plötzlicher Aufregung unterbrochen: Die Leute sahen sich aufgeschreckt an. Was war das?
Und hier kam Rajkumar zum Einsatz: »Englische Kanonen«, sagte er. »Sie sind hierher unterwegs.«
Ma Cho entfuhr ein Schrei des Unmuts. »Englische Geschütze?«, rief sie. »Woher willst du das wissen, du Dummkopf?«
»Bootsleute haben sie gesehen«, antwortete Rajkumar. »Eine ganze englische Flotte ist auf dem Weg hierher.«
Ma Chos Garküche war voller Menschen, die bewirtet sein wollten, und sie war nicht bereit, ihrem einzigen Helfer zu gestatten, sich von weit entferntem Lärm ablenken zu lassen.
»Genug damit«, sagte sie. »Geh wieder an die Arbeit.«
Die entfernten Salven wurden stärker und ließen die Schüsseln auf den Bänken erzittern. Die Gäste wurden allmählich unruhig. Sie verdrehten die Hälse, um einen Blick auf den angrenzenden Marktplatz zu werfen. Ein Kuli hatte am Eingang zum Basar einen Sack Reis fallen lassen; wie ein weißer Fleck verteilten sich die verschütteten Körner über den staubigen Weg, als die Menschen sich aneinander vorbeidrängten, um fortzukommen. Die Ladenbesitzer räumten ihre Stände ab und stopften die Waren in Säcke und Taschen; die Bauersfrauen kippten den Inhalt ihrer Körbe auf den Abfallhaufen.
Ma Chos Gäste sprangen plötzlich auf, verschütteten, was in ihren Schüsseln war und warfen die Bänke um. Bestürzt wandte sich Ma Cho an Rajkumar: »Habe ich dir nicht gesagt, du sollst den Mund halten, du dummköpfiger kala? Sieh doch, jetzt hast du mir die Gäste vertrieben!«
»Das ist nicht meine Schuld…«
»Wessen dann? Was soll ich mit dem ganzen Essen machen? Was soll jetzt aus dem Fisch werden, den ich gestern gekauft habe?« Mit einem Seufzer sank Ma Cho auf ihren Schemel.
Im Basar, der menschenleer hinter ihnen lag, balgten sich die Hunde um herumliegende Fleischbrocken. In Rudeln umkreisten sie mit gefletschten Zähnen die Abfallberge.
2
Im Glaspalast, weniger als eine Meile entfernt von Ma Chos Garküche, eilte Königin Supayalat, die Erste Gemahlin des Königs, eine steile Treppenflucht nach oben, um den Hall der Geschütze besser hören zu können.
Der Palast bildete den Mittelpunkt von Mandalay. Er lag tief im Herzen der ummauerten Stadt – eine weit ausladende Anlage aus Pavillons, Gärten und Wandelgängen, die sich allesamt um den neundachigen hti der Könige von Birma scharten. Eine Palisade aus hohen Teakholzpfählen schirmte die Anlage von den sie umgebenden Straßen und Behausungen ab. An allen vier Ecken dieser Palisade befand sich ein Wachturm, bemannt mit Soldaten der königlichen Leibgarde. Einen dieser Wachtürme hatte Königin Supayalat zu besteigen beschlossen.
Die Königin war eine kleine, zartgliedrige Frau mit einer Haut wie Porzellan und winzigen Händen und Füßen. Ihr Gesicht war klein und mit klaren Zügen, und nur ein winziger Makel in der Form ihres rechten Auges störte das vollkommene Ebenmaß ihrer Züge. Die Taille der Königin, berühmt wegen ihrer wespengleichen Schlankheit, war unförmig geworden. Supalayat trug seit acht Monaten ihr drittes Kind.
Die Königin war nicht allein. Dicht hinter ihr folgte etwa ein halbes Dutzend Dienerinnen. Sie trugen ihre zwei kleinen Töchter, die Erste und die Zweite Prinzessin, Ashin Hteik Su Myat Phaya Gyi und Ashin Hteik Su Myat Phaya Lat. Das fortgeschrittene Stadium ihrer Schwangerschaft hatte die Königin ängstlich werden lassen über den Verbleib ihrer Kinder: In den letzten Tagen hatte sie nicht einmal für kurze Augenblicke erlaubt, dass ihre zwei Töchter nicht in ihrem Blickfeld waren.
Die Erste Prinzessin war drei Jahre alt und hatte bemerkenswerte Ähnlichkeit mit ihrem Vater Thebaw, dem König von Birma. Sie war ein gutmütiges, folgsames Mädchen mit rundem Gesicht und einem Lächeln, das nie erlosch. Die Zweite Prinzessin war zwei Jahre jünger, beinahe ein Jahr alt, und von ihrer Schwester gänzlich verschieden. Sie war vielmehr das Kind ihrer Mutter. Von Geburt an litt sie unter heftigen Krämpfen, und oft schrie sie Stunde um Stunde. Mehrmals am Tage steigerte sie sich in wahre Wutanfälle hinein. Ihr Körper wurde ganz starr, und sie ballte die kleinen Hände zu Fäustchen; ihr Brustkorb begann anzuschwellen, der Mund war weit aufgerissen, doch ihrer Kehle entfuhr kein Laut. Die Anfälle der kleinen Prinzessin ließen selbst die erfahrensten Ammen erzittern. Die Königin bestand darauf, dass sich ihre verlässlichsten Zofen stets zur Verfügung hielten, um sich um das Kind zu kümmern – Evelyn, Hemau, Augusta, Nan Pau. Diese Mädchen waren noch sehr jung, alle etwa zehn Jahre alt, und sie waren beinahe ausnahmslos Waisenkinder. Gesandte der Königin hatten sie einst in kleinen Dörfern entlang der nördlichen Grenze des Königreiches gekauft. Einige der Mädchen stammten aus christlichen Familien, andere aus buddhistischen – nach ihrer Ankunft in Mandalay war das nicht länger von Belang. Sie wurden unter der Vormundschaft des Palastgefolges aufgezogen, in der persönlichen Obhut der Königin.
Die jüngste dieser Dienerinnen bewies im Umgang mit der Zweiten Prinzessin das größte Geschick. Sie war ein schlankes Mädchen von zehn Jahren mit Namen Dolly, ein scheues, zurückhaltendes Kind mit riesigen Augen, dem biegsamen Körper einer Tänzerin und geschmeidigen Gliedmaßen. Dolly war noch sehr klein gewesen, als man sie aus der Grenzstadt Lashio nach Mandalay gebracht hatte. Sie besaß keinerlei Erinnerung an ihre Eltern oder ihre Familie. Man glaubte, dass sie von Shan abstammte, doch dies war nichts weiter als eine vage Vermutung, die sich auf ihre schlanke zartknochige Gestalt und ihren blassen, elfenbeinfarbenen Teint gründete.
An diesem Morgen jedoch war auch Dolly mit der Zweiten Prinzessin kein Glück beschieden. Der Lärm der Geschütze hatte das kleine Mädchen aus dem Schlaf gerissen und seitdem schrie es unentwegt. Dolly, die selbst von sehr schreckhafter Natur war, hatte fürchterliche Angst bekommen, als die Kanonen erklangen. Sie hatte sich die Hände auf die Ohren gepresst, sich mit klappernden Zähnen in eine Ecke gekauert und unentwegt den Kopf geschüttelt. Doch dann hatte die Königin nach ihr geschickt, und seitdem war Dolly so sehr damit beschäftigt gewesen, die kleine Prinzessin abzulenken, dass ihr keine Zeit mehr geblieben war, sich zu fürchten.
Dolly besaß noch nicht genügend Kraft, um die Prinzessin die steilen Stufen zur Palisade hinaufzutragen. Und so fiel Evelyn, die schon sechzehn und sehr kräftig für ihr Alter war, die Aufgabe zu, das Kind zu tragen. Dolly ging hinter den anderen her und betrat als Letzte den Wachturm – eine hölzerne Plattform, die von schweren Holzbalken umzäunt war.
In einer Ecke standen vier uniformierte Soldaten. Die Königin überschüttete sie mit Fragen, doch keiner von ihnen gab ihr Antwort oder wagte es, ihr in die Augen zu sehen. Sie ließen die Köpfe hängen und nestelten verlegen an den Läufen ihrer Steinschlossgewehre herum.
»Wie weit sind die Gefechte entfernt?«, fragte die Königin. »Und mit welcher Art Kanonen wird geschossen?«
Die Soldaten schüttelten die Köpfe. Sie wussten genauso wenig wie die Königin. Als der Lärm angehoben hatte, hatten sie aufgeregt über seinen Ursprung gerätselt. Zuerst hatten sie sich geweigert zu glauben, dass dieses Grollen von Menschenhand stammte. Weder waren in diesem Teil von Birma jemals zuvor derartig mächtige Geschütze vernommen worden, noch lag es im Bereich ihres Vorstellungsvermögens, dass etwas existieren sollte, das in der Lage wäre, derart schnelle Salven abzufeuern, die nötig wären, um ein solches Geräusch zu verursachen.
Die Königin erkannte, dass sie von diesen Unglückseligen nichts zu erwarten hatte. Sie wandte sich ab und lehnte ihr Gewicht gegen das hölzerne Geländer des Wachturmes. Wenn nur ihr Körper nicht so schwer wäre, wenn sie nur nicht so müde wäre und so langsam.
Seltsam war nur, dass sie in den vergangenen zehn Tagen, seit die Briten die Grenze überschritten hatten, nichts als gute Nachrichten zu hören bekommen hatte. Vor einer Woche hatte einer der Garnisonskommandanten ein Telegramm gesandt, in dem er mitteilte, dass man die britischen Truppen in Minhla, zweihundert Meilen flussabwärts, aufgehalten habe. Der Palast hatte den Sieg gefeiert, und der König hatte dem Kommandanten eine Auszeichnung geschickt. Wie konnten die Eindringlinge mit einem Male derart nahe sein, dass der Lärm ihrer Kanonen sogar in der Hauptstadt zu hören war?
Alles war so schnell gegangen: Vor einigen Monaten war es zum Streit mit einer britischen Holzhandelsgesellschaft gekommen – eine Auseinandersetzung um einige Stämme Teakholz. Es lag auf der Hand, dass die Gesellschaft im Unrecht war. Man hatte die Zollbestimmungen des Königreiches umgangen. Um den Zollzahlungen zu entgehen, waren Stämme zersägt worden. Die königlichen Zollbeamten hatten die Gesellschaft mit einer Strafe belegt und sie aufgefordert, die ausstehenden Zahlungen für etwa fünfzigtausend Stämme zu begleichen. Die Engländer hatten jedoch protestiert und die Zahlung verweigert. Stattdessen legten sie beim britischen Gouverneur in Rangun Beschwerde ein. Dem waren diverse Aufforderungen gefolgt. Einer der älteren Minister, der Kinwun Mingyi, hatte vorsichtig zu bedenken gegeben, es sei wohl das Beste, die Bedingungen zu akzeptieren: Die Briten würden der königlichen Familie gestatten, im Palast von Mandalay zu bleiben, zu Konditionen, die jenen glichen, denen die indischen Prinzen unterworfen waren – wie Mastschweine mit anderen Worten, gefüttert und gemästet von ihren Herren; Vieh, in Koben gehalten, die mit etwas Tand herausgeputzt waren. Die Könige von Birma seien keine Prinzen, hatte sie dem Kinwun Mingyi geantwortet. Sie seien immer Könige gewesen, Herrscher. Sie hatten den Kaiser nach China zurückgeschlagen, Siam besiegt, Assam und Manipur. Und auch Supayalat selbst hatte stets alles gewagt, um den Thron für Thebaw, ihren Mann und Halbbruder, zu bewahren. War es auch nur im Entferntesten vorstellbar, dies alles nun aufzugeben? Und was, wenn das Kind in ihrem Leib – und diesmal war sie sich dessen sicher – ein Knabe war? Wie sollte sie ihm je erklären, dass sie wegen eines Streits um ein paar Stämme Holz sein Erbe verraten hatte? Die Königin hatte sich durchgesetzt: Der Hof von Birma weigerte sich, den britischen Drohungen nachzugeben.
Nun klammerte Supayalat sich an das Geländer des Wachturmes und lauschte angestrengt auf den entfernten Gefechtslärm. Zuerst hatte sie gehofft, das Geschützfeuer rühre von einer Art Übung her. Der verlässlichste General der Streitmächte, der Hlethin Atwinwun, war mit achttausend Mann in der Festung von Myingyan stationiert, die sich nur dreißig Meilen entfernt befand.
Erst gestern hatte der König, ganz beiläufig, gefragt, was sich an der Kriegsfront tat. Die Art, wie er über die Dinge sprach, sagte ihr, dass dieser Krieg für ihn weit weg war, eine ferne Angelegenheit, wie die Expeditionen, die in den vergangenen Jahren in das Hochgebirge der Shan entsandt worden waren, um sich mit Räubern und Banditen zu befassen.
Alles verlaufe bestens, hatte sie ihm berichtet. Es gebe keinen Grund zur Sorge. Und soweit sie wusste, war das die Wahrheit. Jeden Tag war sie mit den leitenden Beamten zusammengekommen, mit dem Kinwun Mingyi, dem Taingda Mingyi, selbst mit den wungyis und wundauks und myowuns. Keiner von ihnen hatte auch nur die leiseste Andeutung gemacht, dass Anlass zur Besorgnis bestünde. Doch der Klang dieser Geschütze konnte nicht mehr falsch gedeutet werden. Was sollte sie nun dem König sagen?
Plötzlich erfüllten laute Stimmen den Innenhof unter dem Wachturm.
Dolly warf einen verstohlenen Blick die steile Treppe hinab. Unten liefen Soldaten umher. Es waren dutzende. Sie trugen die Farben der Palastwache. Einer von ihnen entdeckte sie und rief ihr zu: »Die Königin? Ist die Königin dort oben?«
Dolly wich eilig zurück und entzog sich seinen Blicken. Wer waren diese Männer? Was wollten sie? Sie konnte die Schritte der Soldaten auf den Stufen hören. Ganz in ihrer Nähe begann die Prinzessin zu weinen, es war ein kurzes, atemloses Keuchen. Evelyn drückte ihr ungestüm das Kind in die Arme. »Hier, Dolly, hier, nimm sie, sie hört nicht auf.«
Das Kind schrie und schlug um sich. Dolly musste ihr Gesicht abwenden, um nicht getroffen zu werden.
Ein Offizier hatte den Wachturm betreten. In seinen ausgestreckten Händen hielt er sein Schwert in der Scheide vor sich hin, wie ein Zepter. Er sagte etwas zu der Königin, bat sie, den Wachposten zu verlassen und sich in den Palast zu begeben.
»Heißt das, wir sind nun Gefangene?« Das Gesicht der Königin war wutentbrannt. »Wer hat euch geschickt?«
»Unsere Befehle kommen vom Taingda Mingyi«, sagte der Offizier. »Zu Eurer Sicherheit, Mebya.«
»Zu unserer Sicherheit?«
Der Wachturm war inzwischen voll von Soldaten. Sie trieben die Mädchen auf die Treppe zu. Dolly spähte hinab: Die Stufen waren sehr steil. Ihr Kopf begann sich zu drehen.
»Ich kann nicht«, jammerte sie. »Ich kann nicht.« Sie würde stürzen, das wusste sie. Die Prinzessin war zu schwer für sie. Die Stufen waren zu hoch. Sie brauchte eine freie Hand, um sich festzuhalten, um das Gleichgewicht zu wahren.
»Beweg dich.«
»Ich kann nicht.« Sie konnte kaum ihre Stimme hören, so sehr schrie das Kind. Sie blieb still stehen, reglos.
»Schnell. Schnell.« Hinter ihr stand ein Soldat. Mit dem kalten Heft seines Schwertes versetzte er Dolly einen Stoß. Ihre Augen liefen über, und die Tränen strömten über ihre Wangen. Konnten die Männer nicht sehen, dass sie stürzen und die Prinzessin fallen lassen würde? Warum kam ihr niemand zu Hilfe?
»Schnell.«
Sie drehte sich um und schaute in das grimmige Gesicht des Soldaten. »Ich kann nicht. Ich trage die Prinzessin, und sie ist zu schwer für mich. Siehst du das nicht?«
Doch über das Geheul der Prinzessin hinweg schien niemand sie zu hören.
»Was ist los mit dir, Mädchen? Warum stehst du da herum? Beweg dich!«
Sie schloss die Augen und machte einen Schritt auf die erste Stufe zu. Und dann, gerade als ihre Beine nachgeben wollten, hörte sie die Stimme der Königin: »Dolly! Halt!«
»Es ist nicht meine Schuld.« Sie fing an zu schluchzen und hielt ihre Augen fest geschlossen. Jemand riss ihr das Kind aus den Armen. »Es ist nicht meine Schuld. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie haben nicht auf mich gehört.«
»Schon gut.« Der Tonfall der Königin war bestimmt, aber nicht unfreundlich. »Jetzt komm herunter. Sei vorsichtig.«
Dolly weinte Tränen der Erleichterung, während sie die Stufen hinabstieg und über den Innenhof lief.
Sie spürte auf ihrer Schulter die Hand eines anderen Mädchens, das sie so einen Gang entlangführte.
Die meisten Gebäude im Inneren der Palastanlage waren niedrige Holzbauten, durch lange Gänge miteinander verbunden. Der Palast war vergleichsweise junger Bauart, erst dreißig Jahre alt. In seiner Architektur orientierte er sich stark an den königlichen Residenzen in den ehemaligen birmanischen Hauptstädten Ava und Amarapura. Nach der Gründung von Mandalay im Jahre 1856 waren Teile der königlichen Wohngebäude vollständig hierher versetzt worden, doch viele der kleineren Gebäude in den äußeren Bezirken waren noch immer nicht vollendet und selbst den Bewohnern des Palastes unbekannt. Den Raum, in den man sie nun führte, hatte Dolly noch niemals zuvor betreten. Er war dunkel, mit feuchten, rau verputzten Wänden und schweren Türen.
»Führt den Taingda Mingyi zu mir«, schrie die Königin die Wachen an. »Ich lasse mich nicht gefangen nehmen. Bringt ihn zu mir. Sofort!«
Langsam verstrichen ein oder zwei Stunden. Die Richtung der Schatten, die unter der Tür hereinkrochen, verriet den Mädchen, dass der Morgen gegangen und der Nachmittag bereits gekommen war. Die kleine Prinzessin hatte sich auf Dollys gekreuzten Beinen in den Schlaf geschrien.
Die Türen wurden aufgestoßen, und der Taingda Mingyi rauschte herein.
»Wo ist der König?«
»In Sicherheit, Mebya.«
Der Taingda Mingyi war ein beleibter Mann mit fettig glänzender Haut. In der Vergangenheit war er nie um Ratschläge verlegen gewesen, doch nun konnte die Königin ihm nicht eine einzige deutliche Antwort entlocken.
»Der König ist in Sicherheit. Macht Euch keine Sorgen.« Die langen Haare, die aus seinen Muttermalen hervorsprossen, bewegten sich leicht, als er die Königin breit angrinste.
Er zog ein Telegramm hervor. »Der Hlethin Atwinwun hat bei Myingyan einen glorreichen Sieg errungen.«
»Es waren aber nicht unsere Geschütze, die ich heute Morgen gehört habe.«
»Die Eindringlinge wurden aufgehalten. Der König hat einen Orden und Auszeichnungen für die Männer entsandt.« Er reichte ihr ein Blatt Papier.
Sie verschwendete keinen Blick darauf. Sie hatte in den letzten zehn Tagen so viele Telegramme gelesen, alle voll der Kunde von großartigen Siegen. Doch die Geschütze, die sie an diesem Morgen gehört hatte, waren keine birmanischen. Daran hegte sie nicht den geringsten Zweifel. »Es waren britische Kanonen«, sagte sie. »Ich weiß es. Lüg mich nicht an. Wie nahe sind sie? Wann werden sie deiner Meinung nach Mandalay erreicht haben?«
Er wagte nicht, sie anzusehen. »Mebya befinden sich in einem bedenklichen Zustand. Ihr solltet nun ausruhen. Ich werde später zurückkehren.«
»Ausruhen?« Die Königin deutete auf ihre Dienerinnen, die auf dem Boden saßen. »Die Mädchen sind erschöpft. Sieh her.« Sie zeigte auf Dollys gerötete Augen und ihr von Tränen fleckiges Gesicht. »Wo sind meine anderen Zofen? Schick sie zu mir. Ich brauche sie.«
Der Taingda Mingyi zögerte und verbeugte sich dann: »Mebya, Sie werden hier sein.«
Eine Stunde später kamen die anderen Zofen zu ihnen. Sie hatten betrübte Gesichter. Die Königin blieb stumm, bis die Wachen die Türen hinter sich geschlossen hatten. Sobald sie fort waren, scharten sich alle um die Neuankömmlinge. Dolly musste ihren Hals verdrehen, um zu hören, was die Mädchen zu berichten hatten.
Die Engländer hatten mit ihren Kanonen die Festung von Myingyan mit makelloser Präzision zerstört, ohne dabei einen einzigen ihrer Soldaten zu verlieren. Der Hlethin Atwinwun hatte kapituliert. Die Truppen hatten sich aufgelöst. Die Soldaten waren mitsamt ihren Gewehren in die Berge geflohen. Der Kinwun Mingyi und der Taingda Mingyi hatten Unterhändler zu den Engländern entsandt. Nun rangen sie miteinander um die Gewalt über die königliche Familie. Sie wussten, dass sich die Briten gegenüber demjenigen, der ihnen das Königspaar auslieferte, dankbar erweisen würden. Es winkten stattliche Belohnungen.
Die Fremden wurden sehr bald schon in Mandalay erwartet, um den König und die Königin gefangen zu nehmen.
Die Invasion ging so glatt vonstatten, dass sie selbst diejenigen in Erstaunen versetzte, die sie vorbereitet hatten. Am 14. November 1885 überquerte die Flotte des Britischen Empire die Grenze zu Birma. Zwei Tage später, nach einigen Stunden Beschuss, besetzten britische Soldaten die birmanischen Vorposten Nyaungbinmaw und Singbaungwe. Am nächsten Tag wurde die Flotte bei Minhla unter heftigen Beschuss genommen. Die Garnison bei Minhla war klein, doch sie setzte sich mit unerwarteter Standhaftigkeit zur Wehr. Nach mehrstündigen Gefechten wurde die britische Infanterie an Land geschickt.
Die Truppen der Briten zählten beinahe zehntausend Mann, wobei es sich bei der großen Mehrheit der Soldaten – es waren beinahe zwei Drittel – um indische sepoys handelte. Unter den Einheiten, die in Minhla aufmarschierten, waren drei Bataillone, die vollständig aus sepoys bestanden. Sie stammten vom Hazara-Regiment sowie von den Ersten Madras-Pionieren. Die Inder galten als erfahrene, kampferprobte Truppe. Die Hazaras, einst von der afghanischen Grenze rekrutiert, hatten ihren Wert für die Briten in jahrzehntelanger Kriegführung in und außerhalb Indiens unter Beweis gestellt. Die Ersten Madras-Pioniere galten als die loyalsten innerhalb der britischen Infanterie. Selbst bei dem Aufstand von 1857, als sich der größte Teil Nordindiens gegen die Briten erhoben hatte, hatten sie ihren Herren unbeirrt zur Seite gestanden. Die birmanischen Verteidiger von Minhla hatten gegen diese sepoys mit ihren neuzeitlichen britischen Waffen und ihrer ungeheuren Truppenstärke nur verschwindend geringe Möglichkeiten. Als die Festung unter Beschuss genommen wurde, lösten sich die hartnäckigen kleinen Verteidigungskräfte in nichts auf. Das Entsetzen über den Fall Minhlas schlug noch weit flussaufwärts seine Wellen. Die Garnison bei Pakkoku flüchtete; in Nyaungu, unweit der großen, pagodenbedeckten Ebene von Pagan, vernagelten die Kanoniere ihr Geschütz, nachdem sie nur ein paar Schüsse abgefeuert hatten. In Myingyan, das unter dem Kommando des Hlethin Atwinwun stand, sahen sich die Verteidiger nach mehrstündigem Bombardement gezwungen, ihre Stellungen aufzugeben. Einige Tage später kapitulierte die gesamte birmanische Armee, ohne König Thebaw davon in Kenntnis zu setzen.
Die britische Infanterie war mit den neuesten Gewehren ausgestattet. Die Artillerie besaß siebenundzwanzig Schnellfeuergeschütze, mehr, als jemals zuvor auf dem gesamten asiatischen Kontinent versammelt gewesen waren. Darunter viele Vierundsechzig-Pfund-Geschütze, die den neckischen Beinamen »Sturmschwalben« trugen, benannt nach der Erfindung eines altgedienten Offiziers der Artillerie. Geschütze dieses Kalibers hatte man in dieser Gegend noch niemals zuvor zu Gesicht bekommen.
Die britischen Invasionskräfte waren so fortschrittlich, dass ihnen nebenbei die Ehre für eine großartige militärische Erfindung gebührte. Ein Offizier hatte den Einfall, sechzehn schwere Maschinengeschütze auf mit Dampf betriebene Schiffe zu montieren. Diese schnellen, bewaffneten Boote wurden als Vorhut entsandt, um die Stärke der birmanischen Verteidigungskräfte auf die Probe zu stellen. Bis zu diesem Zeitpunkt sah die vorherrschende militärische Lehre in diesen Waffen in erster Linie Instrumente zur Verteidigung, die in fest fixierten Positionen am besten zum Einsatz kamen. Und so wurde dieser Einsatz zu einem der ersten Beispiele für die offensive Nutzung von Maschinengeschützen.
Die birmanischen Generäle hatten dieser mächtigen, hoch entwickelten Invasionsstreitmacht nur sehr wenig entgegenzusetzen. Doch sie waren gerissene, altgediente Soldaten, und ihr eigenes Terrain war ihnen wohl vertraut. Sie wussten genau, welche Schritte nötig waren, um die Invasion aufzuhalten. Der britische Angriffsplan basierte auf der uneingeschränkten Nutzung des Irawadi. Der Fluss war der Schlüssel zum Königreich Birma. Das Vorrücken der Briten konnte einfach dadurch verhindert werden, dass man die Navigationsrinnen des Flussbettes blockierte. Die Invasoren hatten keine nennenswerte Kavallerie und waren nicht auf einen langen Marsch vorbereitet. Wenn es gelänge, ihnen den Zutritt zum Irawadi zu verwehren, sähen sich die Briten mit der Zermürbung konfrontiert, die der gewaltsame Vorstoß in gegnerisches Terrain üblicherweise mit sich brachte. Wenn erst die heißen Tage kämen, würde ihre Begeisterung für die Unternehmung schnell dahin sein.
Der Hlethin Atwinwun ersann einen ausgeklügelten Schlachtplan. Zu seinem engsten Beraterstab zählten zwei italienische Baumeister, Commoto und Molinari. Sie hatten die neuesten Festungsanlagen des Königreiches entworfen. Der Hlethin Atwinwun entschied, die Italiener mit einer Kette flacher Kähne flussabwärts zu schicken. Die Boote sollten, drei Meter lange Pfähle auf ihre Kajütendächer montiert, versenkt werden – die scharfen Pfahlspitzen würden die Bäuche der nahenden britischen Schiffe aufschlitzen, und der Fluss wäre versiegelt.
Der Plan wäre um ein Haar gelungen.
Molinari und Commoto hatten ihren Auftrag beinahe ausgeführt, als eine britische Barkasse sie entdeckte. Die Italiener sprangen über Bord und hinterließen ausführliche Karten mit den Stellungen der birmanischen Streitkräfte.
Doch war das Fehlschlagen des Planes von Atwinwun wirklich reiner Zufall? Ohne dass er es ahnte, hatten die Italiener, denen er sein Vertrauen geschenkt hatte, schon seit geraumer Zeit als britische Spione fungiert. Bereits während der Bauzeit hatten sie den Briten Pläne der birmanischen Festungsanlagen zukommen lassen.
Der Krieg währte vierzehn Tage.
3
Vier Tage nach dem Angriff auf Myingyan herrschte in Mandalay eine seltsame, geradezu gespenstische Ruhe. Dann nahmen die Gerüchte ihren Lauf. Eines Morgens rannte ein Mann durch den Basar und kam auch an Ma Chos Garküche vorbei. Er schrie aus vollem Halse. Fremde Schiffe hätten am Ufer festgemacht; englische Soldaten seien auf dem Weg in die Stadt.
Der Basar befand sich in Aufruhr. Die Leute verstopften die Gänge. Rajkumar bahnte sich seinen Weg durch die Menge, hinaus auf die Straße. Er konnte nicht weit sehen: Eine dichte Staubwolke hing in der Luft, aufgewirbelt von hunderten rennenden Füßen. Die Menschen liefen durcheinander wie aufgescheuchte Hühner. Sie rempelten sich an und stießen blindlings alles fort, was ihnen in den Weg kam. Rajkumar wurde in Richtung des Flusses mitgerissen. Während er rannte, bemerkte er, dass der Boden unter seinen Füßen zitterte, als würde in der Erde eine riesige Trommel geschlagen, ein gleichmäßiges Beben, das durch seine Fußsohlen hindurch- und sein Rückgrat hinaufkroch.
Die Menschen vor ihm stoben auseinander und drängten sich an die Straßenränder. Mit einem Male fand er sich in vorderster Reihe, vor sich zwei englische Soldaten hoch zu Ross. Mit gezogenen Schwertern jagten die Reiter die Menschen beiseite und machten so die Straße frei. Der Staub hatte ein Muster auf ihre blank gewichsten Stiefel gemalt. Hinter ihnen wogte ein Meer aus Uniformen, das auf Rajkumar zugerollt kam wie eine Welle.
Er hechtete zur Seite und presste sich gegen eine Mauer. Als der erste Trupp Soldaten mit geschulterten Gewehren vorübermarschiert war, beruhigten sich die Menschen ein wenig: Auf den Gesichtern der Soldaten lag keinerlei Hass, sie zeigten überhaupt keine Regung. Keiner von ihnen verschwendete auch nur einen Blick an die Menge.
»Die Engländer!«, sagte jemand, und in Windeseile flogen die Worte von Mund zu Mund. Dabei wurden sie lauter und lauter, bis sie sich anhörten wie leise gemurmelter Beifall. Doch als die Vorhut vorübergezogen war und der nächste Trupp in Sicht kam, senkte sich erstauntes Schweigen über die Schaulustigen: Diese Soldaten waren keine Engländer – es waren Inder! Die Menschen um ihn starrten Rajkumar an, als hätte der Anblick eines Inders in ihrer Mitte ihre Neugierde entfacht.
»Wer sind diese Soldaten?«, fragte jemand.
»Ich weiß es nicht.«
Mit einem Mal kam Rajkumar zu Bewusstsein, dass ihm den ganzen Tag über im Basar kein einziges der vertrauten indischen Gesichter begegnet war, keiner der Kulis und Flickschuster und Händler, die Tag für Tag auf den Markt kamen. Einen Moment lang erschien ihm das seltsam, doch dann vergaß er es wieder und überließ sich aufs Neue dem Spektakel der marschierenden sepoys.
Die Menschen bestürmten Rajkumar mit Fragen: »Was wollen diese Soldaten hier?«