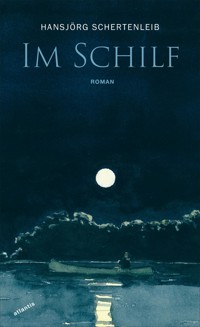Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Red Eye
- Sprache: Deutsch
»Es gibt Menschen, die mich für einen Son- derling halten«, weiß Arthur Dold, und das liegt nicht nur an seinem aus der Mode gekommenen Beruf: Der Siebzigjährige handelt mit Landkarten, Atlanten und Globen, allesamt Dinge, die in unserer digitalen Zeit verstaubt wirken. In der Schule war er Einzelgänger, bis er einen Bruder im Geiste fand: Christian Aplanalp, aus dem später ein weltberühmter Maler werden sollte. Zum sechzigsten Geburtstag lädt Christian seinen Jugendfreund ein. Es ist ein seltsames Fest: in einem einsamen Landhaus im irischen County Donegal, wie am Ende der Welt, und Arthur ist der einzige Gast. Unerklärliche Dinge ereigneten sich - etwas verschwindet, taucht anderswo wieder auf, mit der Haushälterin Bernadette verbringt Arthur eine Nacht, die ihm später wie ein Traum vorkommt. Arthur zweifelt mehr und mehr an seiner Wahrnehmung, an seinem Verstand. Bis zu dem Abend, an dem die Jugendfreunde beim Absinth zusammensitzen und die »grüne Fee« die Grenze zwischen Wirklichkeit und Traum, Gegenwart und Vergangenheit vollkommen verwischt. Ein Abend, der nicht nur Arthur für immer verändert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hansjörg Schertenleib
Die grüne Fee
Eine Gespenstergeschichte
Kampa
Für Brigitte.
Love, life, wife
»Die größte Gnade auf dieser Welt ist, so scheint es mir,
das Nichtvermögen des menschlichen Geistes,
all ihre inneren Geschehnisse miteinander
in Verbindung zu bringen.
Wir leben auf einem friedlichen Eiland des Unwissens
inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit,
und es ist uns nicht bestimmt,
diese weit zu bereisen.«
H.P. Lovecraft, Cthulhus Ruf
Prolog
Die Ereignisse, von denen ich erzählen werde, haben sich vor zehn Jahren abgespielt, und ich würde gewiss lügen, behauptete ich, jede Kleinigkeit wahrheitsgetreu vor mir zu sehen. Ich bin in einem Alter, in dem Erinnerungen undeutlich werden. Ich vergesse Namen, Daten und Gesichter und neige dazu, Geschichten entweder abzukürzen oder mit Zierrat auszuschmücken, der unnötig erscheinen mag. Ich darf jedoch mit Fug und Recht behaupten, Herr meiner Sinne und nicht etwa verrückt zu sein. Den Hinweis auf meinen Geisteszustand wird verstehen, wer es wagt, sich auf das einzulassen, was ich zu berichten weiß.
Weshalb ich die Ereignisse, die mich zehn Jahre lang bis in mein Innerstes erschütterten und noch immer verunsichern wie nichts anderes, das ich erlebt habe, erst jetzt erzähle, ist ganz einfach zu beantworten: Das Päckchen, das ich heute, wir schreiben Montag, den 25. Mai 2020, aus Irland erhalten habe, lässt mir keine andere Wahl, als so wahrheitsgetreu wie möglich zu berichten, was sich damals zugetragen hat.
Eine Geschichte ereignet sich auch ohne Erzähler, aber damit einer an ihr teilhaben kann, der sie nicht miterlebt hat, braucht es einen, der sie erzählt oder gegebenenfalls nacherzählt. In diese Rolle will ich im Gedenken an meinen Freund Christian Aplanalp schlüpfen.
Mein Name ist übrigens Arthur Dold, und ich bin siebzig Jahre alt.
I.
Es gibt Menschen, die mich für einen Sonderling halten, was zweifelsohne auch an meinem aus der Mode geratenen Beruf liegen wird. Ich treibe Handel mit Landkarten, Atlanten, Globen sowie Stichen, die sich der Kunst der Kartographie widmen. Dinge allesamt, die in unserer Zeit elektronischer Stadtpläne, Karten und Reiseführer für die meisten Menschen verstaubt wirken und den Ruch eines altmodischen Spleens an sich haben.
Ein Einzelgänger bin ich gewiss, ich war niemals verheiratet, habe keine Kinder und auch keine Angehörigen mehr, sind doch sowohl meine Eltern als auch meine Schwester Ines verstorben. Die Zahl meiner Bekannten ist klein, die meiner Freunde naturgemäß noch kleiner. Ich bin, das trifft zu, allein auf dieser Welt. Dass ich diese Tatsache nicht beklage, sondern im Gegenteil schätze, trägt natürlich dazu bei, als sonderlich zu gelten. Schon als Kind war die Einsamkeit für mich kein Schreckgespenst, nein, ich war gern für mich. Weder war ich bei den Pfadfindern noch in einem Verein, Orchester oder Chor. Meine Mitschüler und die Kinder unserer Nachbarn hielten mich für komisch, aber sie ließen mich in Frieden. Für Gelächter sorgten meine Aufsätze, die von den Lehrern regelmäßig laut vorgelesen und für ihren altertümlichen und verschnörkelten Ton entweder gelobt oder getadelt wurden. Den Satz des einen Lehrers, ›Unser Arthur schreibt wie ein alter Mann aus dem letzten Jahrhundert‹, nahm ich als Lob mit auf meinen Lebensweg, obwohl er selbstverständlich als spöttische Kritik gedacht gewesen war. Für eine Weile machte ich mir gar einen Spaß daraus, mich anzuziehen, als käme ich aus dem 19. Jahrhundert. Lehrer und Mitschüler schüttelten zwar den Kopf, ließen mich jedoch gewähren und nahmen es als Marotte, die sich legen würde. Und so war es. Bald trug ich wieder wie alle anderen Jeans, T-Shirts, Hemden und Pullover aus synthetischen Fasern, in denen ich nicht nur schwitzte, sondern auch unweigerlich nach Schweiß roch.
Einen Bruder im Geiste fand ich erst in der vorletzten Klasse der Oberstufe. Christian Aplanalp war aus disziplinarischen Gründen von einer anderen Schule strafversetzt worden. An dem Tag, an dem er von unserem Lehrer ins Klassenzimmer geführt wurde, goss es seit dem Morgengrauen wie aus Eimern. Dunkle Regenwolken hielten das Licht zurück, ein kühler Wind erinnerte unbarmherzig daran, dass der Sommer bald zu Ende sein und dem Herbst Platz machen würde. Christian stand vor der Wandtafel und drehte sich, nass bis auf die Knochen wie er war, gemächlich vor uns im Kreis, als wollte er uns zeigen, wie ein Schüler aussieht, der an eine andere Schule versetzt worden ist. Wie Fäden aus Tang klebten ihm die Haare im ungerührten Gesicht, seine Jeansjacke war wie seine Bluejeans schwarz vor Nässe. Bis Christian in der hintersten Bankreihe neben mir Platz nehmen durfte, hatte sich zu seinen Füßen eine Lache gebildet, die die Wandtafel spiegelte.
Um wahre Freunde fürs Leben zu finden, sind die meisten von uns auf die Hilfe des Schicksals angewiesen, das habe ich an jenem Morgen vor mehr als fünfzig Jahren verstanden. Christian und ich wussten vom ersten Augenblick an, wir waren dafür bestimmt, Freunde zu werden und Freunde zu bleiben, geschehe, was da wolle. Jede freie Minute verbrachten wir zusammen, und es gab wenig, was wir nicht teilten, was wir nicht besprachen. Er war der Mensch, dem ich mich öffnete und anvertraute, und ich darf annehmen, dass dies auch im umgekehrten Fall gilt. Nach der Schule besuchte Christian die Kunstgewerbeschule, während ich eine vierjährige Berufslehre absolvierte und mich zum Buchbinder ausbilden ließ. Damals lebten wir uns zwar auseinander, gleichwohl war uns aber immer bewusst, welch großes Geschenk unsere Freundschaft bedeutete. Es kam häufig vor, dass wir uns lange nicht sahen und regelrecht aus den Augen verloren. Diese Pausen fügten unserer Vertrautheit keinen Schaden zu, sie sorgten im Gegenteil für noch mehr Nähe. Christian wurde bildender Künstler, Maler, um genau zu sein. Als er im August 1993 Susanne heiratete, war ich sein Trauzeuge, als er und seine Frau zweieinhalb Jahre später mit Hab und Gut nach Frankreich in die Ardèche auswanderten, saßen wir abwechselnd am Steuer des gemieteten Lieferwagens, und als er sich im August 2004 scheiden ließ, da Susanne dem Wahnsinn verfallen und in eine Anstalt eingeliefert worden war, stand ich ihm bei und half ihm wieder auf die Beine, indem ich ihm für drei Monate das Gästezimmer meiner Wohnung über dem Antiquariat überließ.
Erst als Christian 2006 aus Frankreich in die USA übersiedelte, wo er es in kürzester Zeit zum weltberühmten und wohlhabenden Künstler brachte, trennten sich unsere Lebenswege für eine Weile.
II.
Mit Christians Umsiedlung an Amerikas Ostküste verloren wir uns für beinahe vier Jahre aus den Augen. Wenn ich etwas von ihm erfuhr, dann aus den Medien; erst war er nur in Kunstzeitschriften präsent, bald aber auch in den Klatschspalten der Boulevardpresse, wie es nur Menschen sind, die es in Amerika zu Reichtum und Erfolg gebracht haben, Menschen, die sich an einer Hand abzählen lassen.
Besseren Einblick in Christians neues Leben erhielt ich durch einen Dokumentarfilm, den das Schweizer Fernsehen über ihn gedreht hatte. Gezeigt wurde mein berühmter Freund unter anderem in seinem Sommeranwesen in Marblehead an der Küste von Massachusetts, in den Räumen der Galerie in New York, die ihn vertrat, sowie in seinem loftartigen Atelier in Boston, der Stadt, in der er lebte. Während er Fragen der Filmemacherin beantwortete, stand er vor einem bodentiefen Fenster, durch das man auf den Atlantik und den Flughafen Logan hinaussah; als er von seiner Schulzeit erzählte und den Wert von Freundschaften pries, ohne mich auch nur mit einer Silbe zu erwähnen, schwebte hinter ihm eine Maschine der Aer Lingus im Landeanflug von links nach rechts vorbei. Dass dieses Bild einer Boeing der irischen Fluglinie Symbolcharakter hatte, sollte ich aus bestimmten Gründen erst später begreifen. Christian hatte abgenommen, er wirkte abgehärtet und erkaltet, als hätte er sich mit einem Schutzpanzer gegen alle Widrigkeiten des Lebens gewappnet. Ein Asket in schwarzem Jeanshemd und schwarzen Hosen. Das Grundstück seines mit Schindeln verkleideten Hauses senkte sich in mehreren Terrassen zum Meer und einem Strand hin ab. Die Kamera begleitete meinen Freund auf dem Spaziergang zu diesem Strand, wo er sich auf eine Holzbank setzte und einen Satz äußerte, der mich offen gestanden bis heute beschäftigt: ›Die Kunst der Kunst besteht einzig darin, den Künstler zum Verschwinden zu bringen.‹ Während er Auskunft über sein Leben und seine Arbeit gab, strahlte er Würde und Gelassenheit aus, gleichzeitig aber auch eine Kälte, in der Verachtung lag. Christian Aplanalp war Moralist, Kunst verstand er als Waffe im Kampf für eine bessere Welt mit besseren Menschen, als Werkzeug der Anklage gegen den Irrsinn dieser Welt. Er verstand sich als Kombattant und hatte, wie wohl jeder Moralist, nicht die Größe zu erkennen, dass Dinge auch anders sein können, als er sie sieht.
Nach dem Gespräch mit der Filmemacherin, unergiebig bis auf den erwähnten Satz, ging der Film auf Christians Arbeit ein, wobei die zwei Serien in den Mittelpunkt gerückt wurden, die seinen Ruhm, Marktwert und damit Reichtum begründen. Eine Reihe großer Ölbilder im Querformat zeigt immer wieder das Labyrinth, das seine frühere Frau Susanne im Garten ihres Hauses in Frankreich grabend, mauernd und pflanzend angelegt hatte, jenes Labyrinth, das letztlich wohl daran beteiligt war, dass sie den Verstand verlor. Der Gegenstand der anderen Serie, die aus dreißig Arbeiten besteht, erschließt sich den meisten Betrachtern wohl erst auf den zweiten oder gar dritten Blick, verwandelt die schiere Größe der Aquarelle in Quer- und Hochformat diesen doch in ein sinnentleertes Objekt ohne Erkennungswert. Dass es sich bei dem Gegenstand um Christians Malerhosen handelt, die er einen Monat lang Nacht für Nacht aquarellierte, nachdem er vor dem zu Bett gehen aus ihnen gestiegen war und sie achtlos zu Boden hatte fallen lassen, war eine so verblüffende wie erheiternde Erkenntnis. Ich selbst habe amüsante wie lehrreiche Stunden damit zugebracht, Christians Hosenaquarelle zu studieren und Dinge, ja Aussagen in die eigenartigen Formen hineinzulesen.
Auf dem Fernsehbildschirm wirkten die Gemälde und Aquarelle, die in Originalgröße eine machtvolle Faszination besitzen, der man sich nur schwer entziehen kann, harmlos und sogar dekorativ. In der letzten Einstellung des Dokumentarfilmes stand Christian am Strand seines Sommerhauses in Marblehead, die nackten Füße im verhaltenen und doch deutlich hörbar zischelnden Atlantik, den Blick in die Ferne gerichtet, als halte er bereits nach einem neuen, einem anderen Lebensmittelpunkt Ausschau. Während das Bild schwarz wurde, erschien noch einmal der Titel des Dokumentarfilmes: Der Maler im kalten Wind.
Vierzehn Monate nachdem der Dokumentarfilm gesendet worden war, erbte Christian das irische Manor House seines Großonkels Christoph Aplanalp, verließ die USA und zog im September 2009 ins County Donegal in der Republik Irland, was ich nicht etwa von ihm selbst, sondern aus den Medien erfuhr. Am 28. Dezember 2009 erhielt ich einen Brief von ihm, den ersten seit Langem, in dem er mich einlud, ohne sich zu erkundigen, wie es mir ergangen sei, am 7. Januar 2010 seinen sechzigsten Geburtstag mit ihm in seinem neuen Haus in Irland zu begehen.
III.
Am 4. Januar 2010 flog ich nach Dublin, nahm am Flughafen ein Taxi zur Connolly Station und erwischte tatsächlich den Mittagszug nach Sligo, wie ich es Christian in einer knappen Mail angekündigt hatte. Die vierstündige Zugfahrt führte zunächst durch einen Stadtteil mit bescheidenen Häusern aus Ziegelsteinen, die erstaunlich nahe an die Gleise heranrückten, später durch eine Landschaft, die zusehends karger, leerer und gleichzeitig grüner wurde, überwölbt von einem Himmel, der zwar grau war, aber dennoch kein Ende zu kennen schien. Die Reise verging wie im Flug, was nicht zuletzt an den Fahrgästen lag, die an den Bahnhöfen zu- oder ausstiegen. Frauen mit Nasen wie Vogelschnäbel, Männer mit einem verbliebenen Zahn, den sie stolz herzeigten, Schulkinder so dünn wie Stricke, blass wie Gespenster. Eine fröhliche Gesellschaft, die den Kontakt nicht scheute, wie ich es von meinen Landsleuten in der Schweiz gewohnt bin, sondern suchte, sich neben mich setzte und trotz meiner bescheidenen Englischkenntnisse nicht aufhörte, mir allerlei Fragen zu stellen und Geschichten zu erzählen, von denen ich vielleicht die Hälfte verstand. Man bot mir Sandwiches an, Chips, trockenen Kuchen, Tee aus Thermoskannen, Bier.
In Collooney, der, wie sich herausstellte, letzten Station vor dem Endbahnhof Sligo, fing es plötzlich an zu regnen. Das dürre alte Männchen, das auf dem Bahnsteig stand, offensichtlich aber weder auf unseren Zug noch auf einen anreisenden Passagier wartete, ließ sich davon nicht stören. Mit frischer Gesichtsfarbe stand es, seelenruhig und wie bestellt und nicht abgeholt, im Regen. Als wir schließlich weiterfuhren, war der Regen in Hagel übergegangen und klang, als würfe jemand Münzen auf das Dach unseres Waggons, und schon bald bedeckten Teppiche aus weißen Hagelkörner Wiesen, Felder, Straßen, Dächer. Kühe und Kälber standen reglos an blechernen Tränken, ihrem Schicksal demütig ergeben, Schafe zogen in Herden über Hügel. Kurz darauf erschien der Tafelberg Ben Bulben vor den beschlagenen Fenstern, der als Amboss aus der Erde brach und mit leuchtenden Kalksteinflanken majestätisch in die Höhe wuchs, unverrückbar wie eine Gottheit. Schwarz-Weiß-Fotos des Berges hatte ich in einem Reiseführer aus dem Jahr 1949 ausgiebig studiert und dabei nicht nur seine genaue Höhe erfahren, sondern auch, dass er zu großen Teilen aus Kalkstein bestand und laut keltischer