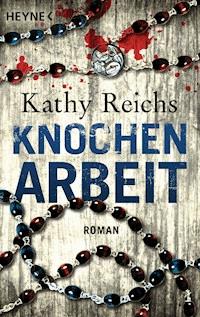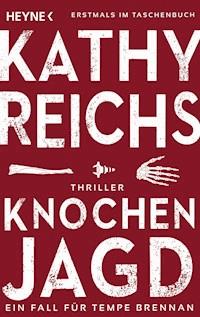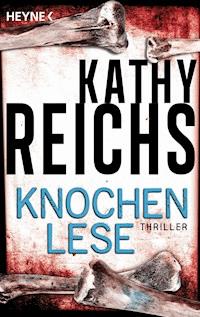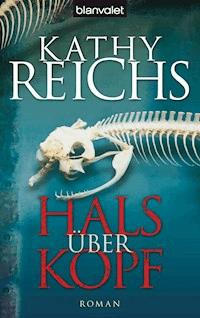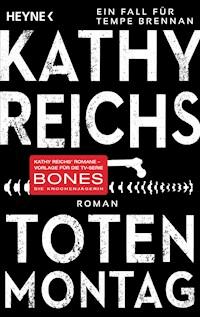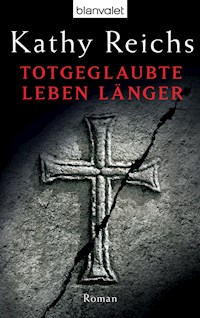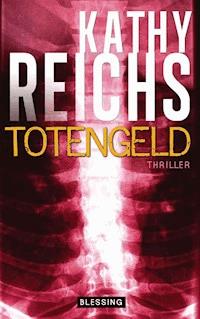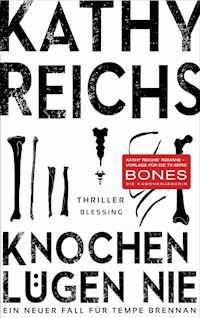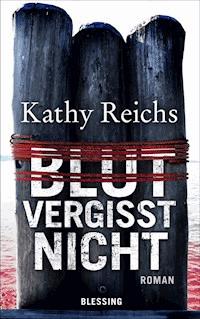10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Tempe-Brennan-Romane
- Sprache: Deutsch
Eine Reihe bizarrer Mordfälle führt die forensische Anthropologin Tempe Brennan auf die karibischen Turks- und Caicos-Inseln. Stehen die grausam verstümmelten Leichen junger amerikanischer Touristen in Zusammenhang mit Bandenkriminalität? Je tiefer Tempe recherchiert, desto beunruhigendere Dimensionen nimmt der Fall an. Und plötzlich findet sie sich im Mittelpunkt einer Verschwörung wieder, die viele Hunderte Menschenleben kosten könnte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Die forensische Anthropologin Tempe Brennan wird gerufen, um die Überreste einer vom Blitz getroffenen Leiche zu untersuchen. Es handelt sich um einen jungen Mann, der ein auffälliges Tattoo am Körper trägt. Tempe folgt der Spur der ungewöhnlichen Tätowierung, die sie schließlich auf die Turks and Caicos Islands führt. Tatsächlich verschwinden dort seit Jahren junge Männer – allesamt Touristen. Verblüffenderweise scheinen die Opfer sonst nichts gemeinsam zu haben. Haben diese Angriffe etwas mit der sich entwickelnden Kultur der Bandengewalt auf den Inseln zu tun? Tempe ist sich da nicht so sicher. Dann stößt sie auf beunruhigende Hinweise darauf, dass sie es mit einem noch viel größeren Fall zu tun haben könnte. Plötzlich sind Hunderte von Menschen bedroht. Wenn Tempe nicht schnell die richtigen Schlüsse zieht, kommt es zur Katastrophe.
Die Autorin
Kathy Reichs, geboren in Chicago, lebt in Charlotte und Montreal. Sie ist Professorin für Soziologie und Anthropologie, eine von nur knapp einhundert vom American Board of Forensics Anthropology zertifizierten forensischen Anthropolog:innen und unter anderem für gerichtsmedizinische Institute in Quebec und North Carolina tätig. Ihre Romane erreichen regelmäßig Spitzenplätze auf internationalen und deutschen Bestsellerlisten und wurden in dreißig Sprachen übersetzt. Die darauf basierende Serie BONES – Die Knochenjägerin wurde von Kathy Reichs mitkreiert und -produziert.
KATHY REICHS
DIE HAND DES TODES
THRILLER
AUS DEM AMERIKANISCHEN VON KLAUS BERR
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel THEBONEHACKER bei Scribner, an imprint of Simon & Schuster, Inc., New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Temperance Brennan, L.P.
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by arrangement with the original publisher, Scribner, a Division of Simon & Schuster, Inc.
Redaktion: Tamara Rapp
Umschlaggestaltung und Motiv:
Nele Schütz Design unter Verwendung von © Shutterstock/BEMPhoto31, Nikolayev Alexey; © AdobeStock/kichigin19
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31753-9V002
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
DANKSAGUNG
Sie wollen gleich weiterlesen? Unsere Empfehlungen für Sie…
Newsletter-Anmeldung
Für mein unfehlbar kluges und immer standhaftes Ensemble, die Grandes Dames der forensischen Anthropologie: Leslie Eisenberg Diane France Madeleine Hinkes Elizabeth Murray Marcella Sorg
»Yes, to dance beneath a diamond sky with one hand waving free.«
Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, 1965
PROLOG
Der Mann war tot, bevor er von der Brücke taumelte.
Bevor sein Körper ins Wasser fiel.
Bevor Schiffsschrauben seine Leiche zerstückelten wie eine Aufschnittmaschine.
Hätte ich das vorher gewusst, wäre vielleicht manches anders gelaufen. Oder auch nicht.
Ich werde es nie erfahren.
1
SAMSTAG, 29. JUNI
Das Monster raste unangekündigt heran, ein fettes schwarzes Raubtier, das den ahnungslosen Sommerabend verschlang. Unbarmherzig. Feuer atmend. Fest entschlossen, alles in seinem Weg zu zerstören.
Ich kauerte in seinem Weg.
Ich würde sterben.
Dröhnen.
Krachen.
Donner toste. Blitze zerrissen den Himmel und zuckten auf einen schwankenden Horizont zu, tauchten schmale Himmelsschneisen in kränkliches Gelbgrün.
Dröhnen.
Krachen.
Wieder und wieder.
Die Luft roch nach Ozon, wütendem Wasser, Öl und Schlamm.
Ich hockte geduckt auf dem Deck eines Boston Whaler, der Wind riss an meiner Jacke und meinen Haaren, Regen prasselte mir auf die hochgezogenen Schultern und den Rücken. Mit all meiner Kraft klammerte ich mich an einen Stahlpfosten und hoffte inständig, nicht über Bord geschleudert oder vom Blitz geröstet zu werden.
Das Boot gehörte Ryans Kumpel, Xavier Rabeau, den ich nicht sonderlich mochte. Ryan war im Heck. Rabeau gut geschützt im Steuerhaus. Natürlich war er das.
Rabeaus etwa zwanzigjährige Begleitung, eine Blondine, Antoinette Damico, lag zusammengerollt neben mir. Noch nicht ganz hysterisch, aber kurz davor.
Wir schlingerten und stampften inmitten eines tosenden St. Lawrence dahin. Der Außenbordmotor war tot, überwältigt vom unaufhörlichen Hämmern der Wellen auf dem Strom.
Später sollten Meteorologen fast ehrfürchtig von dem Wetterphänomen sprechen. Sie redeten von Microbursts, also lokalen, sehr kräftigen Fallböen, und Tornados. La microrafale et la tornade. Sie sollten den Sturm Clémence nennen, entweder aus Anerkennung oder weil sie die Ironie ihrer Namenswahl nicht erkannten. In zwei Sprachen erklärten sie, warum an diesem Abend in Montreal das Unmögliche geschehen war.
Die Obduktion lag da natürlich noch in der Zukunft.
In diesem Augenblick konnte ich mich bloß mit aller Kraft festhalten, während mir das Herz in Brust, Ohren und Kehle pochte. Wichtig war lediglich, an Bord zu bleiben. Und am Leben.
Ich hatte nur wenig Ahnung von Booten und noch weniger vom Neustarten eines uralten Evinrude-Außenborders, dessen einhundertfünfzig Pferde alle aus dem Stall geflohen waren. Ich wollte unbedingt helfen, war aber hilflos. Und so kauerte ich zwischen den hinteren Sitzen, hatte die Füße eingestemmt und klammerte mich so fest an den Pfosten, dass meine Knöchel weiß wurden.
Innerlich verfluchte ich Rabeau, der so auf das Einladen von Säcken voller Supermarktsnacks und einer Kühlbox mit geeistem Bier – ausschließlich Bier – fixiert gewesen war, dass er sämtliche Schwimmwesten im Kofferraum seines Autos vergessen hatte. Vollidiot.
Ich verfluchte auch mich selbst, weil ich vergessen hatte, nach Sicherheitswesten zu fragen, bevor ich den Pier verließ. Zu meiner Entschuldigung – nicht seiner, schließlich gehörte ihm das verdammte Boot, und er hätte sich seiner Verantwortung bewusst sein müssen – kann ich sagen, dass die Luft kühl und trocken gewesen war, als wir an Bord gingen, und die leichte Brise so sanft über meine Haut strich wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. Unzählige Sterne funkelten in einem makellosen Himmel.
Wir würden einen unglaublichen Blick auf das Feuerwerk bekommen, hatte Ryan gesagt, so aufgeregt, wie es für einen gut fünfzigjährigen Ex-Polizisten kaum angemessen war.
Was soll schon schiefgehen?, hatte Rabeau gefragt.
Alles.
Als ich den Kopf hob, liefen mir Tropfen übers Gesicht, Pfeile aus Wasser trübten meinen Blick und stachen mir in die Wangen. Ohne die Hände vom Pfosten zu nehmen, richtete ich mich ein wenig auf und drehte mich auf den Zehenspitzen um.
Ryan machte sich achtern von mir an dem rebellischen Motor zu schaffen. Auch wenn der Wolkenbruch viele Details verwischte, konnte ich erkennen, dass seine Haare an einigen Stellen platt gedrückt und an anderen vom Wind aufgestellt und verwirbelt waren. Sein langärmeliges T-Shirt klebte ihm am Rücken wie die Haut eines Delfins.
Krachen.
Dröhnen.
Das Boot schlingerte heftig. Die Kühlbox rutschte, torkelte, schoss dann plötzlich hoch und segelte über die Steuerbordreling. Während ich mich wieder auf meinen Hintern setzte, sah ich, wie die leuchtend blaue Box verschwand, ein kantiger Schatten, der auf der schwarzen Brandung tanzte.
Um uns herum versuchten auch andere Boote, ans Ufer zu kommen, und ihre vielfarbigen Lichter blinzelten erratisch durch den Regenschleier. Etwa zwanzig Meter von unserer Backbordseite entfernt wippte wild ein gekenterter Katamaran. Hilflos. Wie ich.
Ich schloss die Augen und wünschte den Passagieren des Katamarans eine sichere Landung. Hoffte, dass ihr Kapitän die Vorschriften beachtet und Schwimmwesten bereitgelegt hatte.
Damico neben mir weinte und kotzte, und auf beeindruckende Art schaffte sie es, beides gleichzeitig zu tun. Sie hatte die erste der Provigo-Plastiktüten, in denen man die Snacks und Getränke an Bord gebracht hatte, weggeworfen und machte sich jetzt daran, die zweite zu füllen. Wenn das Deck hin und wieder scharf die Neigung veränderte, schrie sie auf und verlangte, an Land gebracht zu werden.
Rabeau schwankte mit gespreizten Beinen vor seinem Kapitänssessel und wartete auf Nachricht von achtern. Sooft Ryan etwas rief, versuchte Rabeau es mit der Zündung. Immer und immer wieder die gleiche Abfolge. Immer mit demselben Ergebnis.
Nichts.
Dann waren Quebecer Flüche zu hören.
Hostie!
Tabarnak!
Câlice!
Durch die Kakofonie aus Wind, Wellen und männlicher Verdrossenheit nahmen meine Ohren ein fast unhörbares Geräusch wahr. Ein hohes, moskitoartiges Sirren. Entfernte Sirenen? Eine Tornadowarnung?
Ich schickte ein Bittgebet an jede Wassergottheit, die zuhören mochte. Clíodhna, die keltische Meeresgöttin … Verdammt, wo hatte ich das denn her? Natürlich von meiner Grandma. Himmel, ich verlor offenbar den Verstand.
Der Bug schoss himmelwärts und sackte dann vom hohen Wellenkamm ins Tal.
Rumms!
Aus Damicos Kehle drang ein Geräusch, ein Wimmern voll silbrig-grüner Galle.
Ich streckte den Arm aus und legte ihr die Hand auf die Schulter. Sie ließ die Tüte sinken und drehte sich zu mir um, mit einem Mund wie ein umgedrehtes U, aus dessen Winkeln Sabberfäden hingen. Ein Blitz zuckte und erhellte den Skelettbogen der Jacques-Cartier-Brücke hinter und über ihr.
Mit einem Mal spürte ich selbst ein Rumoren im Bauch. Ich schluckte. Und schwor mir, der Übelkeit nicht nachzugeben.
Nicht zu sterben. Nicht so.
Der Tod ist für uns alle unausweichlich. Hin und wieder denken wir über unser Sterben nach. Stellen uns die Augenblicke vor dem letzten Vorhang vor. Vielleicht weil ich mich beruflich mit gewaltsamen Toden beschäftige, neigen meine Vorstellungen eher zum Dramatischen. Ein tiefer Sturz und gebrochene Knochen. Züngelnde Flammen und beißender Rauch. Zerquetschter Stahl und gesplittertes Glas. Kugeln. Schlingen. Giftpflanzen. Tödliche Bisse. Ich bin von Natur aus nicht morbide. Viel wahrscheinlicher ist, dass die finale Zuspitzung in einer Umgebung aus pingenden Monitoren und aseptisch sauberen Laken stattfinden wird.
Ja, ich gebe es zu. Ich bin jede Möglichkeit meiner persönlichen Schlussszene durchgegangen. Jede bis auf eine.
Die eine, die ich am meisten fürchte.
Ich habe schon unzählige Leichen gesehen, die man mit Händen, Haken und Netzen aus ihren wässrigen Gräbern gefischt hat. Habe viele selbst geborgen. Jedes Mal empfinde ich das Grauen nach, das die Opfer durchlitten haben. Der anfängliche Kampf, um über Wasser zu bleiben, das verzweifelte Schnappen nach Luft. Das befürchtete Untertauchen und das Atemanhalten. Das unausweichliche Nachgeben und das Einatmen von Wasser. Und schließlich der gnädige Bewusstseinsverlust, der Herz- und Atemstillstand, der Tod.
Kein leichter Weg zu sterben.
Zur Information: Ich habe eine robuste Angst vor dem Ertrinken. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, ich fürchte mich nicht vor Flüssen, Seen und Pools. Ganz im Gegenteil. Ich betreibe Bodysurfing und fahre Wasserski. Zum Training schwimme ich Bahnen. Ich habe also keine Angst, ins Wasser zu gehen.
Ich habe Angst, nicht mehr rauszukommen.
Irrational, ich weiß. Aber so ist es.
Warum war ich dann hier, in einem offenen Boot, in Lebensgefahr inmitten der Mütter aller Stürme?
Feuerwerk.
Und Liebe.
Der Sommer hatte sich in diesem Jahr viel Zeit gelassen, um nach Quebec zu kommen.
Der April neckte uns mit warmen Tagen, die am schwarz verkrusteten Schnee nagten. Und dann tat der April, was der April eben so tut. Das launische Quecksilber tauchte ab und überzog Gärten, Einfahrten, Straßen und Bürgersteige mit einer schlammfarbenen Schlotze aus gefrorenem Schmelzwasser.
Der Mai bot unaufhörlichen Regen, und das auf vielfältige Weise. Dunst aus samtigem Nebel. Niesel aus bräsig grauem Himmel. Große, fette Tropfen, die aus tief hängenden Wolken prasselten. Feine Tröpfchen, getrieben von Winden, die verächtlich auf wackelige Carports, Vordächer und Regenschirme herabschauten.
Als dann der erste offizielle Sommertag näher rückte, lächelten endlich auch die Wettergötter. Die Sonne tauchte auf, und die Tagestemperaturen knackten die 20-Grad-Marke. Gerade rechtzeitig.
L’International des Feux Loto-Québec, eine Montrealer Tradition, ist eins der größten Feuerwerksfeste der Welt. Damit prahlen zumindest die Organisatoren. Ich habe es nie nachgeprüft. Das Spektakel findet jedes Jahr Ende Juni statt.
Wieder einmal zur Information: Meine bessere Hälfte ist Lieutenant-détective Andrew Ryan, ehemaliger Mordermittler bei der Sûreté du Québec. Oder ein mehr oder weniger Ehemaliger. Mehr dazu später. Ryan hat eine Schwäche für Pyrotechnik. Auf jedem Niveau. Black Cats. Ladykracher. Bengalische Feuer. Römische Kerzen. Flaschenraketen. Wenn etwas knallt oder Feuerräder verschießt, gerät der Mann völlig aus dem Häuschen. Das muss man sich mal vorstellen!
L’International des Feux ist natürlich eine ganz andere Welt als die Kracher und Leuchtraketen, die Ryan kauft, um sie auf Parkplätzen oder auf freiem Feld abzuschießen. Die Darbietungen eines jeden Landes sind professionell choreografierte Kompositionen aus Musik und der Kunst, die hoch am Himmel explodiert. Die pyromusikalischen Präsentationen sind an sechs aufeinanderfolgenden Samstagen überall in der Stadt zu sehen und zu hören. Ryan liebt sie und lässt kaum eine Aufführung aus.
Ich bin eine staatlich geprüfte forensische Anthropologin und praktiziere schon länger, als ich mir eingestehen will. Meine Karriere habe ich an Tatorten und in Autopsiesälen aufgebaut. Mit eigenen Augen habe ich die unzähligen Varianten gesehen, wie Menschen anderen Menschen und sich selbst Schaden zufügen. Die Verrücktheiten, auf die Leute sich einlassen, um schließlich dabei ums Leben zu kommen. Eine dieser Verrücktheiten ist der unsachgemäße Umgang mit Sprengstoffen. In Sachen Pyrotechnik bin ich deshalb weniger begeistert als mein Liebhaber.
Mit vor jungenhafter Begeisterung leuchtendem Gesicht hatte Ryan vorgeschlagen, sich die Eröffnungsveranstaltung dieses Jahres vom Fluss aus anzusehen. Da das Feuerwerk im La-Ronde-Erlebnispark steigt, der auf der Île Sainte-Hélène gegenüber dem historischen Hafen von Montreal liegt, würde die ganze wunderbare Darbietung direkt über unseren Köpfen explodieren. Magnifique!
Und bevor ich mich’s versah – voilà! –, waren wir auf Rabeaus Boot eingeladen.
Ich muss zugeben, es war schon ein bewegendes Erlebnis, wie zu den Klängen des »Walkürenritts« und der »Ode an die Freude« hoch über uns Päonien, Crossettes und Kamuros explodierten. Ryan benannte und erläuterte jeden einzelnen Feuerwerkskörper.
Bis Clémence auftauchte, um Chaos zu stiften.
Und hier waren wir nun. Ohne Motor. Ohne Schwimmwesten. Triefnass. Schlingernd und stampfend und verzweifelt bemüht, an Bord eines Boots zu bleiben, das für die momentanen Bedingungen viel zu klein war.
Dann registrierten meine Ohren durch den Wind und die Wellen und das wütende Prasseln von Tropfen auf Fiberglas ein Geräusch, das ich unbedingt hören wollte. Anfangs schluckend und unbeständig, verwandelte sich das wässerige Glucksen in ein stetiges Knattern.
Das Boot schien sich anzuspannen, als spürte es neue Entschlossenheit in dem alten Evinrude.
Das Knattern gewann an Kraft.
Den Launen des turbulenten Flusses nicht länger ausgeliefert, bewegte sich das Boot nun zielgerichtet.
Das Knattern wurde stärker und höher.
Der Bug hob sich, und das kleine Whaler schoss vorwärts, eine schaumige, weiße Heckwelle hinter sich herziehend, während es durch den Strom pflügte.
Ryan kroch nach vorne, um während der schwankenden Rückkehr zum Ufer bei mir zu sein. Er legte mir den Arm um die Schultern und drückte mich an sich.
Zum ersten Mal seit Einsetzen des Sturms atmete ich tief durch. Clémence machte seinem Namen alle Ehre. Er zeigte sich gnädig mit uns.
Unsere kleine Party würde überleben.
Andere sollten nicht so viel Glück haben.
2
DONNERSTAG, 4. JULI
Ich wachte früh auf und fühlte mich ein wenig melancholisch, ohne so recht zu wissen, wieso.
Independence Day, der Unabhängigkeitstag, ist mein liebster amerikanischer Feiertag. Kein Festessen ist zu kochen, um sich daran zu überfressen. Keine Körbe sind zu füllen und zu verstecken. Keine Geschenke einzupacken, kein Schmuck aufzuhängen oder Plätzchen zu backen. Nennen Sie mich ruhig eine Spaßverderberin. Aber andererseits: Kaufen Sie mir einen Eimer Chicken Wings und zünden Sie ein paar Wunderkerzen an, und ich bin so glücklich wie ein Kind im Karneval. Wobei an diesem Morgen meine Begeisterung für alles Pyrotechnische noch immer ziemlich am Boden war.
Fünf Tage nach seinem dramatischen Auftritt war Clémence weiterhin Gesprächsthema. In dieser kurzen Zeit hatte ich mehr über Microbursts und den Unterschied zu Tornados gelernt, als ich wissen musste. Les microrafales et les tornades.
Ein Microburst ist ein örtlich eng begrenzter Fallwind innerhalb eines Gewitters. Das ist der Burst-, der Ausbruchs-Aspekt. Der sich dabei bildende Trichter beträgt normalerweise nicht mehr als vier Kilometer im Durchmesser. Das ist der Micro-Aspekt. Was die Geschwindigkeit dieser Monster angeht, so habe ich zwar keine Ahnung von Clémence’ persönlicher Bestleistung, aber ich weiß, dass die von Microbursts produzierten Winde bis zu einhundertsechzig Stundenkilometer erreichen können, was einem Tornado der Stufe EF-1 entspricht.
Und nun raten Sie mal, wo Clémence auf festen Boden traf. Genau. Direkt dort, wo sich Rabeaus kleines Boot befand.
Doch dieses Debakel hatte auch etwas Gutes. Ryan war einverstanden, den Kontakt zu Xavier Rabeau und der brechgereizten Mademoiselle Damico einzustellen.
Um halb neun beendete ich eben meine dritte Runde durch ein Netzwerk kleiner Straßen in Hochelaga-Maisonneuve, einem Arbeiterviertel knapp östlich von Centreville. In langsamer Fahrt und mit wachem Blick kam ich vorbei an einer Schule, einem kleinen Park, mehreren, in Quebec depanneurs genannten Minimärkten und Reihen zwei- und dreistöckiger Mehrfamilienhäuser mit schmiedeeisernen Treppenaufgängen. Fand keinen Millimeter freien Bordstein.
Zum vierten Mal durch die Rue Defresne zockelnd, erspähte ich auf halber Höhe des Blocks das rote Flackern von Bremslichtern, schoss vorwärts und wartete, bis ein etwa schuhgroßer Ford Fiesta sich aus der Parklücke manövriert hatte. Mit viel Kurbeln und Fluchen schaffte ich es, mein Auto in die frei gewordene Lücke zu quetschen.
Zufrieden mit meinem kleinen Sieg und ein wenig verschwitzt, schnappte ich mir Laptop und Aktentasche und ging auf das Édifice Wilfrid-Derome zu, ein dreizehnstöckiges Glas- und Stahlgebäude, das vor Jahren nach dem berühmten Kriminalpionier Quebecs umbenannt worden war.
Nicht ohne Grund und vielleicht aus Sturheit nennen viele Einheimische diese Konstruktion noch immer das SQ-Gebäude. Das Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, die kombinierten rechtsmedizinischen und kriminaltechnischen Institute, belegen die oberen beiden Stockwerke. Das Bureau du coroner liegt im elften. Die Leichenhalle und die Autopsiesäle sind im Untergeschoss. Die gesamte andere Fläche gehört der Sûreté du Québec, der Provinzpolizei. Der SQ oder der QPP, je nachdem, ob man frankofon oder anglofon ist. Französisch oder englisch.
Während ich über den Bürgersteig hastete, sah ich den T-förmigen Koloss über dem Viertel aufragen. Irgendwie wirkte der düstere Klotz unpassend vor dem fröhlich blauen Himmel. Und fröhlich war der wirklich.
Der Sommer hatte jetzt das Sagen, die Tage waren heiß und schwül, die Nächte sternenhell und sinnlich. Nach dem langen, trüben Winter und dem herzlosen Frühling dieses Jahres genossen les Montréalais die laue Wiedergeburt ihrer Stadt.
Frauen mit nackten Schultern und Männer mit teigig bleichen Beinen in Bermudas tranken endlos Eiskaffees oder Krüge mit Molson an Tischen, die all die bar proprietaires und restaurateurs auf Bürgersteige und Innenhöfe gestellt hatten. Radfahrer und Rollerblader füllten die Radwege, die parallel zu den Durchfahrtsstraßen und Wasserwegen der Stadt verliefen. Frauen mit Kinderwagen, Jogger, Studenten und Menschen mit Hunden bildeten farbenfrohe Ströme in beiden Richtungen entlang der Rues Ste-Catherine, St-Denise, St-Laurent und der nahen Boulevards.
Großereignisse reihten sich derzeit in schneller Folge aneinander. Les Francofolies de Montréal. Der Große Preis von Kanada in der Formel Eins. Das International Jazz Festival. Das Festival International Nuits d’Afrique. Just for Laughs – die Lachattacke. Montréal Complètement Cirque.
Diese Jahreszeit hatte lange auf sich warten lassen. Weil sie wusste, dass sie nicht lange bleiben würde, nutzte die Bevölkerung sie mit einer Begeisterung, die es in meiner Heimat North Carolina nicht gab.
Doch für mich würde es heute kein entspanntes Herumschlendern, Limonadetrinken oder Picknicken geben. Ich war unterwegs zu einem Autopsiesaal, um tote Babys zu untersuchen.
Mit Melancholie im Herzen. Am Vierten Juli.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe den Canada Day und Saint-Jean-Baptiste – La Fête nationale du Québec genossen. Immer ein großer Spaß. Aber keiner von beiden war eine sternenübersäte Geburtstagsparty wie der Vierte Juli.
Komm runter, Brennan.
Nach Betreten der Lobby zog ich meinen Sicherheitsausweis durch, zog ihn noch einmal am Aufzug durch, dann am Eingang zum zwölften Stock und ein letztes Mal an den Glastüren, die den rechtsmedizinischen Flügel vom Rest des Gebäudes trennten. Straffe Sicherheit? Darauf können Sie Gift nehmen.
Der Korridor war so früh an einem Donnerstagmorgen sehr ruhig. Während ich an den Fenstern zu den Laboren für Mikrobiologie, Histologie und Pathologie vorbeimarschierte, sah ich Männer und Frauen in weißen Mänteln an Mikrotomen, Schreibtischen und Spülbecken arbeiten. Mehrere winkten oder grüßten stumme Wörter formend durch das Glas. Marcel, einer der neuen Techniker, hätte vielleicht gesagt: »Joyeux quatre juillet.« Fröhlichen Vierten Juli.
Mich für die bevorstehende Aufgabe wappnend und alle Gedanken an meine Tochter Katy als Baby verdrängend, arrangierte ich, was von dem ersten winzigen Skelett übrig war. Es gab nur wenig zu arrangieren. Anschließend machte ich mich an das nächste.
Nach beinahe zwei Stunden des Sortierens und Aneinanderreihens spürte ich mehr, als ich sie hörte, in meinem Rücken eine Anwesenheit. Eine Fähigkeit, die ich in den langen Jahren der Interaktion gelernt hatte, vielleicht durch das Erfassen olfaktorischer Hinweise, wie jetzt des schwachen Geruchs nach Pfeifentabak. Ich drehte mich um.
»Bonjour, Temperance«, begrüßte mich LaManche in seinem präzisen Pariser Französisch. Von all meinen Bekannten ist er der Einzige, der darauf besteht, die formelle Version meines Namens zu benutzen. Für ihn gibt es keine Verkürzung zu Tempe.
»Bonjour«, erwiderte ich. »Comment ça va?«
»Ça va.«
Nach seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, liefen die Dinge allerdings nicht so gut, wie er behauptete. Vielleicht. Das Hundegesicht des alten Mannes mit seinen tief eingegrabenen Falten war nur schwer zu enträtseln.
Ein Wort über meinen Chef.
Dr. Pierre LaManche ist Pathologe, seit Gott den Dreck erfand, und le directeur der gerichtsmedizinischen Abteilung des LSJML, seit ich hier arbeite. Schon als wir uns kennenlernten, konnte ich sein Alter nicht schätzen. Jetzt ist er offensichtlich älter und ein bisschen gebeugter, aber immer noch ein Mann von eindrucksvoller Statur. Und Verstohlenheit.
Entweder mit Absicht oder aus Gewohnheit, oder weil das eine aus dem anderen erwachsen war, bewegt LaManche sich mit einer Geräuschlosigkeit, die es ihm erlaubt, völlig unbemerkt aufzutauchen. Er trägt Kreppsohlen und hält seine Taschen frei von Schlüsseln oder Münzen. Kein Knarren. Kein Klimpern. Einige finden dieses Fehlen jeglicher akustischen Vorwarnung verstörend.
»Ich fange eben mit den Babys aus Sainte-Agathe an«, sagte ich, weil ich annahm, dass LaManche einen vorläufigen Bericht über meine Aktivitäten der letzten beiden Tage haben wollte. Aufgrund eines telefonischen Hinweises hatte er mich mit einem Team des Service de l’identité judiciaire, Division des scènes de crime – Quebecs Version von CSI – losgeschickt, um den Keller eines Farmhauses in einer ländlichen Gegend in den Laurentinischen Bergen zu durchsuchen.
»Es sind insgesamt vier, nicht?«, fragte LaManche bedrückt, die Arme vor der Brust verschränkt.
Ich nickte. »Jedes war in einem kleinen Behältnis vergraben. Einem Schuhkarton vielleicht. Ich konnte einige Fetzen eines Materials sicherstellen, das Karton zu sein scheint.«
»Haben Sie schon eine ungefähre Einschätzung, wann diese armen Babys ums Leben kamen?«
»Mein erster Eindruck ist, dass sich die Todesfälle über eine gewisse Zeitspanne erstreckten, doch keiner davon ist neueren Datums.« Ich zögerte. »Aber …«
»Natürlich.« Da LaManche wusste, dass ich nicht gerne nach meiner Meinung gefragt werde, bevor ich eine Untersuchung abgeschlossen habe, hob er nur seine knotigen Hände und streckte mir die Innenflächen entgegen. »Entschuldigen Sie. Lassen Sie sich Zeit. Ich will Sie nicht drängen.«
»Ich sehe keine Hinweise auf Verletzungen. Kann sein, dass ich die Todesursache nicht bestimmen kann.«
»So eine traurige Geschichte. Trotzdem, das ist nicht der Grund, warum ich hier bin.«
Ich wartete.
»Zeugen haben gemeldet, sie hätten ein Mann beobachtet, der von einem Blitz getroffen wurde, als er Samstagnacht beim Feuerwerk zuschaute. Sie erinnern sich vielleicht, dass es einen heftigen Sturm gab?«
»O ja.«
»Der Mann verfolgte es von der Jacques-Cartier-Brücke aus. Als er getroffen wurde, stürzte er vom seitlichen Stahlfachwerk, auf das er geklettert war, in den Fluss. Obwohl die Menge sich schnell zerstreute, gab es viele Zeugen, die den Vorfall sahen.«
»Weiß irgendjemand, wer er war?«
»Nein. Offensichtlich war er alleine. Die Versuche, seine Leiche zu bergen, begannen am Sonntag. Bis heute haben sie sich als erfolglos erwiesen.«
Merde.
Ich wusste genau, was jetzt kam.
»Heute Morgen rief mich Jean-Claude Hubert an.« LaManche meinte den Chief Coroner von Quebec. »Monsieur Hubert sagte, sein Büro wäre von einem SPVM-Beamten namens Roland Plante kontaktiert worden. Constable Plante gab an, er hätte heute um 7:30 Uhr auf die Meldung einer Leiche im Bickerdike Basin reagiert. Kennen Sie es?«
»Ist das ein Fähranleger im alten Hafen?«
»Eine Art Anleger. Constable Plante fuhr zum Basin und traf sich dort mit einem Bootsfahrer namens Ernest Legalt. Da Plante sich ziemlich sicher war, dass Legalt recht hatte und vor Ort menschliche Überreste vorhanden waren, rief Plante den Coroner an.«
Wieder mal. Leichen aus dem Wasser fischen ist eine der Aufgaben, die ich am wenigsten mag.
»Ich hasse es, Sie zweimal pro Woche an einen Fundort zu schicken, aber …«
LaManche senkte das Kinn und hob die Brauen, die buschigen grauen Raupen über seinen Augenhöhlen ähnelten, ließ die Bitte aber unausgesprochen zwischen uns hängen.
»Natürlich«, sagte ich.
»Überprüfen Sie die Situation, s’il vous plaȋt. Wenn die Überreste menschlich sind und Sie vermuten, dass möglicherweise noch mehr zu finden ist, werde ich ein Boot und Taucher anfordern.«
»Ich mache mich sofort auf den Weg.«
»Brauchen Sie ein Fahrzeug?«
»Nein danke. Ich fahre selbst.«
Zwanzig Minuten später saß ich wieder in meinem Auto. Als ich unter dem Pont Jacques-Cartier hindurchfuhr, dachte ich an den Mann, der vom Blitz getroffen wurde, während er auf dem Stahlfachwerk stand. Ich fragte mich, wie er es geschafft hatte, auf das Metallskelett zu klettern und von dort ins Wasser zu fallen.
Auf der Viger unterwegs nach Westen, kam ich an der Molson-Brauerei vorbei, die sich links von mir entlang des Flusses ausbreitete, beschleunigte dann um den Rundturm des Radio-Canada-Gebäudes herum und folgte den Schildern zum Boulevard Robert Bourassa und der Champlain- und der Victoria-Brücke. Montreal ist eine Insel, deshalb diese Fülle an Brücken.
Ich bog in den Chemin des Moulins ein und fuhr nach einer Art Kehre die Avenue Pierre-Dupuy entlang, einen schmalen Asphaltstreifen, der eine spitze Landzunge mit dem Dieppe-Park am Ende zerteilt. Rechts vor mir ragten mehrere Komplexe mit Eigentumswohnungen der Luxusklasse auf, Nutznießer der ausgedehnten Grünflächen auf dieser Landzunge. Ich erkannte Tropiques Nord und Habitat 67, eine Adresse, die Ryan früher sein Zuhause genannt hatte.
Links vor mir lag nun das Bickerdike Basin, ein menschengemachtes Rechteck aus Wasser, das zwischen der grünen Landspitze und dem massiven Betonpier aus dem St. Lawrence herausgeschnitten wurde. Hinter dem Pier war ein weiteres Becken und dahinter der untere Teil des alten Hafens.
Die Straße endete in einem ausgedehnten Parkplatz mit Maschendrahtumzäunung. Hier und dort standen Neunachser und kleinere Lastwagen, einige mit Frachtcontainern, andere ohne. Vor mir am näheren Ende des Beckens erhob sich ein Containerkran hoch in den Himmel, eine kolossale und außergewöhnliche Ansammlung von Kabeln und Stahlträgern, die ich unmöglich benennen konnte.
Rechts des Krans führte eine Öffnung im Zaun zu einem Asphaltstreifen, der sich leicht abwärts neigte und in eine einspurige Fahrbahn entlang des rechten Beckenrands überging. Ein Schild warnte: Defensed’entre sans autorisation. Kein Zutritt ohne Genehmigung.
Die Botschaft des Schildes wurde noch verstärkt durch einen Streifenwagen der SPVM, der mit rot und blau blinkenden Signallichtern die Zufahrt versperrte. Ein Uniformierter stand neben seinem Fahrzeug und signalisierte mir mit beiden Armen, zu wenden und nicht weiterzufahren. Ich ließ den Wagen ausrollen, stieg aus und ging auf ihn zu.
Der Beamte spreizte die Beine und stemmte die Hände in die Hüften. Er lächelte nicht. Wahrscheinlich wäre er überall lieber gewesen als hier zwischen den kreischenden Möwen, in der Hitze, dem Gestank nach Öl, totem Fisch und Algen. Na ja, ich auch.
»Sie dürfen nicht näher kommen, Madame. Sie müssen weitergehen.« Ein kleines Messingschild über seiner Brusttasche identifizierte ihn als Const. Plante.
»Ich bin Dr. Brennan«, sagte ich und zog meinen Ausweis aus der Tasche. »LSJML.«
»Sie arbeiten für den Coroner?« Plantes Ton und Gesichtsausdruck argwöhnisch zu nennen, hätte bei Weitem nicht ausgereicht.
Ich gab ihm meinen Ausweis. »Ich bin die anthropologue judicaire.«
Plante musterte die Plastikkarte so lange, dass ich schon dachte, er wolle den Inhalt auswendig lernen. Er schaute vom Foto zu meinem Gesicht, dann wieder aufs Foto. Dann reichte er mir die Karte zurück und nickte, noch immer ohne Lächeln.
»Haben Sie die Leiche gesehen?«, fragte ich.
»Soweit vorhanden.«
»Ist Monsieur Legalt noch hier?«
»Ja. Aber erwarten Sie sich nicht zu viel.«
Mit diesen verwirrenden Bemerkungen drehte Plante sich um und ging mir voraus die Rampe hinunter.
3
Wie in vielen Regionen kann auch in Montreal die Antwort auf die Frage nach der Zuständigkeit ziemlich verzwickt ausfallen. Die Stadt liegt auf einem schmalen Landstreifen mitten im Fluss St. Lawrence. Der Service de Police de la Ville de Montréal, der SPVM, erledigt die Polizeiarbeit auf der Insel selbst. Außerhalb der Insel ist das die Aufgabe der örtlichen Polizeireviere oder der Provinzpolizei, der Sûreté du Québec, kurz SQ. Auch wenn die Koordination nicht immer perfekt läuft, funktioniert das System.
Bickerdike Basin lag mitten auf der Insel. Deshalb der SPVM und der nicht gerade herzliche Constable Plante.
Plante schritt mit einem Tempo und einer Entschlossenheit aus, die seinem Bestreben Ausdruck verlieh, die Sache so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Ich folgte, beladen mit meinem unhandlichen Bergungskoffer. Das zusätzliche Gewicht bedeutete, dass ich Schwierigkeiten hatte, bei seinem Tempo mitzuhalten. Die Hitze – inzwischen lag die Temperatur bei 30 Grad – half auch nicht gerade.
Rechts von uns erstreckte sich eine hohe Betonmauer mit einem Radweg sowie der Avenue Pierre-Dupuy obendrauf. In Abständen türmten sich Reifenstapel am Sockel der Mauer. Zwischen den Stapeln parkten hier und dort Autos im schmalen Streifen mittäglichen Schattens.
Linker Hand lag das Becken. Wir kamen an einem offenbar schwimmenden Bootsanleger, einigen Lastkähnen und einem Schlepper vorbei. Vielleicht einem Schlepper. Wie bereits zugegeben, bin ich nicht gerade Expertin für nautische Begrifflichkeiten.
Ein Stückchen vor uns ging ein Mann rauchend neben einem rot-weißen Kajütboot mit zwei großen Außenbordmotoren im Heck auf und ab. Sogar aus dieser Entfernung konnte ich erkennen, dass el capitan nicht gerade ein Muskelprotz war.
Ich nahm an, dass dieser Mann Ernest Legalt war. Legalts Körpersprache deutete an, dass er, wie der Constable und ich, lieber woanders gewesen wäre.
Wir waren etwa hundert Meter weit gegangen, als Plante die Hand zum Mund hob und einmal kurz und scharf pfiff. Legalt drehte sich in unsere Richtung, und auf seiner Pilotenbrille blitzte blau das Sonnenlicht.
Plante erreichte Legalt deutlich vor mir und sagte etwas, das ich aus diesem Abstand nicht verstand. Legalt nahm einen letzten, langen Zug aus seiner Zigarette, schnippte den Stummel ins Becken und atmete langsam aus.
Kurz darauf erreichte ich die beiden, zwar nicht keuchend, aber doch schwerer atmend, als mir lieb war. Nachdem ich den lästigen Koffer abgestellt hatte, wischte ich mir feuchte Strähnen aus der Stirn.
Legalt musterte mich volle drei Sekunden lang. Vielleicht weil er mein Auftreten irgendwie beunruhigend fand oder weil er verbergen wollte, dass er verdammt nervös war, senkte er den Blick zu seinen Flip-Flops, die früher wohl einmal lila gewesen waren.
Ich konnte es dem Mann nicht verdenken, dass er mein Äußeres unzulänglich fand. Da ich mich für einen Tag mit exhumierten Babyknochen angezogen hatte, trug ich Jeans und ein T-Shirt mit der Aufschrift Der Wissenschaft ist es egal, an was du glaubst. Die Haare hatte ich zu einem strukturell instabilen Knoten zusammengefasst. Der Sprint in Plantes Schlepptau hatte mein bereits schlampiges Aussehen auch nicht gerade verbessert.
Aber Legalt hätte ebenfalls keinen Schönheitspreis gewonnen. Meinem ersten Eindruck nach sah der Kerl aus wie einer Fritteuse entsprungen. Seine Haut war ziegelrot, die Haare hatten die Farbe von alten Fritten, und sein Körper war muskulös auf eine hagere, sehnige Art. Sein Outfit – ein schmuddeliges Unterhemd über einer ausgefransten Jeans, die so kurz abgeschnitten war, dass das Taschenfutter unten hervorlugte – entsprach durchaus dem niedrigen Modestandard, den ich gesetzt hatte.
Bevor ich etwas sagen konnte, deutete Legalt mit dem Daumen auf das neben uns an einer Klampe vertäute Boot. Oder mit dem halben Daumen. Alles nach dem Mittelgelenk fehlte.
»Bonjour, comment ça va?« Hi. Wie geht es Ihnen?
Legalt erwiderte meinen Gruß nicht und erkundigte sich auch nicht nach meinem Befinden. »Es ist achtern.«
»Sie sind Monsieur Legalt?« Ich setzte ein deutliches Fragezeichen dahinter.
Knappes Nicken. Die Pilotenbrille blitzte blau.
»Ich bin Dr. Temperance Brennan.« Ich streckte die Hand aus. Legalt ignorierte sie.
»Meine Motoren sind wahrscheinlich hinüber.«
»La Madame kommt vom Bureau du coroner.«
Ich ließ Plante den Fehler durchgehen. Seine Vorstellung war nahe genug an der Wahrheit. Und für einen Laien wahrscheinlich verständlicher.
Legalt sagte nichts.
»Die Grésillent gehört Ihnen, Sir?« Aus der Nähe erkannte ich den Namen in schnörkeligen Buchstaben auf dem algenverkrusteten Rumpf. Die Brutzelnde.
Legalt nickte noch einmal.
»Darf ich Sie fragen, warum Sie gerade im Bickerdike Basin festgemacht haben?«
»Ich hab das doch alles schon dem Polizisten erzählt.« Er nickte hinüber zu Plante, der sich entfernt hatte, um mit dem Handy zu telefonieren. »Er hat es notiert.«
»Ich würde mir gerne ein komplettes Bild der Lage machen«, sagte ich.
Legalt hob die verstümmelte Hand, um sich einen Tabakkrümel von der Unterlippe zu wischen. Dann schnippte er ihn weg. Presste die Lippen zusammen.
Über uns knatterte ein Motorrad auf der Pierre-Dupuy vorbei. Eine Autotür knallte, ein Motor sprang an.
»Sir?«, hakte ich nach.
Die blauen Gläser richteten sich auf mich. Widerwillig. »Ich war mit einem Angelfreund verabredet. Der Mistkerl hat erst in letzter Minute abgesagt.«
Legalts Französisch hatte einen starken Akzent, und er verschluckte die Endsilben, wie die flussaufwärtigen Quebecer es taten. Ich musste genau hinhören.
»Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben?«
Legalt wandte den Kopf ab und verdrehte wahrscheinlich die Augen. Bei der Pilotenbrille war das schwer zu sagen.
»Sir?«
Zu meiner Erleichterung wechselte Legalt ins Englische. Zumindest vorwiegend. »Ich lag zwanzig, vielleicht dreißig Minuten am Steg vertäut, als sich eine Riesenhorde Möwen über meine Außenborder hermachte. Vierzig, fünfzig, vielleicht noch mehr. Eine Weile hab ich sie ignoriert. Ich meine, was soll’s? Möwen sind Möwen. Aber diese elenden Viecher kreischten und flatterten und kämpften, als hätte ihnen jemand die Eier angezündet. Weil ich keine Lust mehr hatte, auf Guillaume, dieses connard, zu warten, bin ich ins Heck, um nachzusehen, pourquoi le fou.«
Über uns schrie eine Möwe, vielleicht, weil sie mit Legalts Beschreibung des Verhaltens ihrer Artgenossen nicht einverstanden war. Vielleicht wegen seiner Bezeichnung seines Freundes als »Arschloch«. Oder der Erwähnung ihrer Genitalien.
»Und?«, fragte ich nach.
»Ein Haufen Dreck hatte sich in den Schraubenblättern verfangen. Weil ich dachte, das ist die übliche Flussscheiße, habe ich drin rumgestochert, um das Zeug loszuschneiden. Doch dann bin ich auf was gestoßen, irgendwie lourd.«
Lourd. Schwer. Das klang nicht gut.
Legalt kramte eine Packung Player’s aus der Tasche seiner Jeans, schüttelte sie, zog eine Zigarette mit den Lippen heraus. Mit einem Streichholzbriefchen, das er in der Zellophantüte stecken hatte, zündete er sie an, inhalierte und blies den Rauch mit verzogenen Lippen seitlich wieder aus.
Im Augenwinkel bemerkte ich, dass Plante auf die Uhr schaute. »Fahren Sie fort«, ermutigte ich Legalt.
»Na ja, ich stochere eben noch ein bisschen mehr.« Legalt hielt inne, um den nächsten Zug zu nehmen. Einen langen.
»Ja?«
Legalt zuckte die Achseln. »Ich dachte mir, ist vielleicht mein Glückstag. Bergungsgut aus dem Meer, Sie wissen schon.«
Ich wusste es nicht. »Und dann?«
»Nach einer Weile merke ich, dass das Ding da drinnen schleimig und weiß ist. Und es stinkt abscheulich. Ich weiß, wie ein verfaulender Kadaver aussieht, deshalb denke ich mir, ist vielleicht ein totes Tier oder ein Fisch. Ich versuche, es umzudrehen, und plötzlich ist da ein verdammter Fuß.«
»Von dem Sie dachten, er sei menschlich.«
»Tabarnak! Les orteils haben direkt auf mich gezeigt.« Vielleicht weil er das Bild noch einmal vor Augen hatte, vielleicht weil er sich göttlichen Beistand erhoffte, bekreuzigte sich Legalt schnell, die Zigarette noch immer zwischen den Fingern.
»Was haben Sie dann getan?«
»Was glauben Sie denn? Ich bin von dem verdammten Boot runter.«
»Und dann haben Sie den SPVM angerufen?«
Legalt nickte, und seine Wangen wölbten sich nach innen, während er sich einen weiteren Schwall Karzinogene in die Lunge saugte.
»Haben Sie die Überreste berührt oder irgendwie manipuliert?«
»Êtes vous fou?«
Ich nahm sein »Sind Sie verrückt?« als entschiedenes »Nein«.
»Können Sie mir zeigen, was Sie gefunden haben?«
Legalt sah aus, als hätte ich ihm vorgeschlagen, sich selbst Polonium-210 zu spritzen.
»Erlauben Sie mir, an Bord zu gehen?«
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können.«
Anscheinend hatte Plante zugehört. Als ich mich umdrehte, war er bereits in Bewegung.
»Monsieur Legalt zieht es vor, an Land zu bleiben.«
»Reste ici!«, befahl Plante Legalt nicht gerade sanft. Bleiben Sie hier.
Plante stellte sich neben den Bug der Grésillent und streckte den Arm aus. Der Wellengang war mäßig, aber doch in einem Maß voller Elan, dass das Boot schwankte, deshalb griff ich nach seiner Hand. Das Letzte, was ich wollte, war, vor diesen beiden zu stolpern.
Mich über die Lücke beugend, die von zwei Gummi-Fendern gebildet wurde, stützte ich mich auf der Reling ab, schwang die Beine darüber und sprang an Deck. Mit einer Hand an der Reling deutete ich mit der anderen auf meinen Koffer. Nachdem Plante ihn mir gegeben hatte, ging ich nach achtern, eine Hand immer an der Kabinenwand.
Der langstielige Haken lag noch dort, wo Legalt ihn hingeworfen hatte, bevor er davongestürzt war, ein Knäuel maritimer Flora noch am gekrümmten Ende. Fliegen umschwirrten das Knäuel, sie sausten sirrend umher, und ihre blau-grünen Körper schimmerten irisierend im Sonnenlicht.
Der Geruch, den das Objekt ihres Interesses verströmte, war zwar schwach, aber unmissverständlich. In die salzige Mischung aus Meerwasser und faulender Vegetation mischte sich der süßliche Gestank verwesenden Fleisches.
Ich klappte eben die Verschlüsse meines Koffers hoch, als Plante zu mir trat. Er sah mir zu, wie ich Fotos schoss. Eine Maske anlegte. Gummihandschuhe überstreifte.
Als ich mich hinkauerte, schwirrten die Fliegen in einer laut protestierenden Wolke auf. Ich ignorierte sie, wie auch die Wasserwanzen, Schnecken und gelegentlichen Krebse, die sich an das Knäuel klammerten oder von ihm davonstoben, und schaute mir die Sache genauer an. Und verstand, warum es so stank.
Gefangen in den schleimigen Strängen aus Tang und Algen, waren aufgeweichte Brocken in verschiedenen Größen und Formen zu erahnen. Bleich und aufgequollen standen sie in starkem Kontrast zur meeresdunklen Vegetation. Ich erkannte sie als Fragmente verwesenden Fleisches.
Der Magen zog sich mir zusammen, und ich stand auf. »Ist vielleicht ein Netz an Bord?«, fragte ich, während ich weitere Fotos schoss.
»Un instant.«
Plante stieg in die Kabine hinunter. Ich hörte Klappern, einen dumpfen Knall, dann kehrte er mit etwas zurück, das mir als zu klein für die Aufgabe erschien, die ich im Sinn hatte. Ich betrachtete es skeptisch, sagte aber nichts.
Nachdem ich den Bootshaken von allen Vegetationsresten befreit hatte, packte ich den Stiel mit beiden Händen und ging nach achtern. Plante folgte. Zusammen spähten wir über das Heck nach unten.
Legalts Beschreibung war präzise gewesen. »Ein Haufen Dreck«, eingeklemmt zwischen den beiden Außenbordern, der sich mit den Bewegungen des Wassers hob und senkte.
Ich senkte die lange Stange, brachte den Haken in Position und riss und zerrte daran so fest, wie ich konnte. Die Möwen, denen das offensichtlich missfiel, schrien und kreischten knapp über unseren Köpfen.
Nach viel Manövrieren und reichlich Schweiß und unausgesprochenen Flüchen gab das Gewirr aus Algen, Tang und Zweigen widerwillig nach und löste sich.
Im Becken herrschte kaum Strömung. Dennoch wollte ich nicht, dass sich das Knäuel vom Haken löste und davongetrieben wurde. Oder, schlimmer noch, dass es sank. Ich griff nach unten und packte einen kräftig aussehenden Stängel.
Das Bündel drehte sich.
Vier Zehen deuteten himmelwärts.
Das Fleisch war grün und weiß gesprenkelt, und wo sich Aasfresser zu schaffen gemacht hatten, waren Knochen zu erkennen. Dennoch hatte Legalt recht. Les orteils waren eindeutig menschlich.
Wortlos drückte Plante einen Knopf auf dem Kescher in seinen Händen. Der Teleskopstiel fuhr zu voller Länge aus.
Sehr gut, Constable.
Während ich das Tanggewirr so ruhig wie möglich hielt, versuchte Plante, es ins Netz zu bekommen.
Das klingt so einfach. Aber wir brauchten mindestens ein Dutzend Versuche, bis wir es an Bord hatten.
Plante und ich sahen schlammiges Wasser aus unserem Fang triefen und das Deck verdunkeln. Obwohl wir an der frischen Luft waren, war der Verwesungsgestank überwältigend.
Über unseren Köpfen gerieten die Möwen außer sich. Direkt vor uns rasteten die Fliegen aus.
Wieder stieg Plante in die Kabine hinunter. Diesmal kehrte er mit einer Plane zurück.
Ich sah zu, wie er die provisorische Abdeckung auseinanderfaltete und über unserer Beute ausbreitete, und wusste, dass das vielleicht die Möwen abschrecken würde, aber nicht die Fliegen. Ich hatte keinen Zweifel, dass die beharrlichen Weibchen einen Weg unter das Plastik finden und vergnügt ihr Eier ablegen würden. Dass diese Eier meine bevorstehende Aufgabe noch unangenehmer machen würden.
Ich zog mein Handy aus der Tasche und drückte eine eingespeicherte Nummer.
LaManche antwortete sofort. »Qui, Temperance. Läuft alles gut?«
»Absolut brutzelnd.«
»Pardon?«
»Egal. Schicken Sie einen Transporter.«
»Alors. Sind die Überreste menschlich?«
»Sind Sie.«
»Ist es der Mann von der Brücke?«
»Kann man noch nicht sagen.«
»Ist die Leiche intakt?«
»Weit davon entfernt.«
»Soll ich das marine Suchteam hinschicken?«
»Unverzüglich.«
4
Ich blieb, um die Verlagerung des Algenknäuels samt seinem abstoßenden Inhalt vom Boot in einen Transporter des Coroners zu überwachen. Während ich mich darum kümmerte, dass alles korrekt ablief, beobachtete ich nebenher ein Team von Tauchern, die das Bickerdike Basin absuchten.
LaManche rief um zwei und erneut um drei an. Jedes Mal berichtete ich ihm, dass nichts weiter gefunden worden war. Beim zweiten Anruf ermutigte er mich, ins LSJML zurückzukehren, ließ sich aber von meinem Vorschlag überzeugen, noch zu bleiben, falls sich irgendwelche Fragen ergeben sollten.
Gute Entscheidung. In den nächsten fünf Stunden lieferte das Becken sieben zusätzliche Brocken algenbedeckten Fleisches. Drei waren menschlich. Vier waren es nicht, doch die Frage der Gattungszugehörigkeit blieb vorerst zweifelhaft. Möglicherweise die partiellen Vorder- und Hinterläufe eines Schweins.
Ryan rief um fünf an. Ich sagte ihm, ich hätte vor, so lange auszuharren, wie die Taucher arbeiteten. Ich versprach, ihm zu texten, sobald ich den Hafen verließ. Er seinerseits versprach ein selbst gekochtes Abendessen. Und andere Dienste viel persönlicherer Natur.
Um acht stoppte der Teamleiter, ein großer, dünner Kerl namens Pen Olsen, die Suche bis zum nächsten Morgen. Ich war enttäuscht, dass wir nur so wenig gefunden hatten. Trotzdem, ich war verschwitzt, müde und schmutzig – und eigentlich nicht unglücklich über den Feierabend.
In der hereinbrechenden Dämmerung fuhr ich nach Hause. Ein Hauch von Sommer am 45. nördlichen Breitengrad. Die Sonne steht hier lange am Himmel und verabschiedet sich dann mit der sensationellen Leuchtkraft eines Rothko.
Vor meiner Windschutzscheibe ergab sich die Stadt der Nacht.
Gelb quoll aus den Fenstern der Zwei- und Dreizimmerwohnungen von Griffintown, von den Hochhäusern Centrevilles in gespenstisches Blau getaucht. Neonlicht blinkte einladend von vorspringenden Schildern und Röhren um die Kneipentüren und -fenster an der Straße.
Als ich nach links auf den Boulevard René-Lévesque einbog, spürte ich, wie die gewohnten Gedanken und Gefühle meine Stimmung einzufärben begannen. Trauer um die Person, die Stück für Stück aus dem Fluss aufgetaucht war. Aber auch Hoffnung, dass der neue Tag sich erfolgreicher erweisen würde.
Eine Reihe von Bildern blitzte am Rand meines Bewusstseins auf. Eine Gestalt. Eine Brücke. Zerfasernde Blitznetze am Himmel und sprühende Tentakel, die zur Erde schossen.
Die Leichenteile, die ich in Säcke gepackt und beschriftet hatte – der Fuß, die Fragmente eines Arms und eines Beins –, deuteten auf einen Erwachsenen hin. Die Knochen, die in dem aufgequollenen und verstümmelten Fleisch sichtbar waren, wirkten robust, aber nicht allzu sehr. Ich war mir nicht sicher, ob wir einen Mann oder eine Frau aus dem Wasser zogen. War es der Mann, der mitten im Clémence vom Blitz getroffen worden war? Oder lieferte uns der Fluss einen anderen Unglücklichen, der aus einem Boot, von einem Ufer oder einer Brücke gestürzt war?
Ich empfand auch Mitleid mit jenen, deren Leben sich durch die Nachricht vom Tod dieses Menschen für immer verändern würde. Ich wusste, wie das lief. Ich hatte herzzerreißende Szenen erlebt, wenn die Leute es erfuhren. Hatte die Bestürzung, die Weigerung, die Ungläubigkeit in ihrem Blick gesehen. Und schließlich die weit aufgerissenen Augen. Das stoische Schweigen, die Tränen oder den körperlichen Zusammenbruch, wenn die Erkenntnis erst einmal durchdrang. Es gibt keine angemessene oder vorhersagbare Reaktion. Der Umgang mit einem Verlust ist so vielfältig wie die Wirbel und Bogen auf einem menschlichen Daumen.
Schließlich empfand ich die Entschlossenheit, die sich mit jedem neuen Fall einstellt. Ich kannte dieses Opfer nicht. Hatte keine Ahnung, wie er oder sie ausgesehen hatte. Keine Ahnung von seinen oder ihren Hoffnungen und Träumen, den Errungenschaften oder Misserfolgen. Aber schon jetzt fühlte ich mich verpflichtet, das Geheimnis dieses Todes zu entschlüsseln.
Als ich in die Tiefgarage meines Gebäudes einfuhr, knurrte mein Magen so laut, dass man es wahrscheinlich bis in die Carolinas hörte. Und meine Gedanken schweiften von Leichen zu Leckereien.
Sylvain begrüßte mich in Epauletten, die weit über seine knochigen Schultern hinausragten.
»Bon soir, Dr. Brennan. Langer Tag, was?« Wie Legalt und viele andere frankofone Montrealer, spricht Sylvain mit Anglofonen in einer Mischung aus Französisch und Englisch. Frenglisch.
»Ein sehr langer Tag«, pflichtete ich ihm bei.
Sylvain ging zu einer Reihe Aufzüge und drückte einen Knopf. Wartete die Millisekunde, bis die Kabine ankam. Geleitete mich lächelnd durch die makellos verspiegelten Türen.
Ich fuhr hoch in den fünfzehnten Stock und ging zu unserer Eigentumswohnung.
Der letzte Halbsatz – eine ganz schlichte Aussage – enthält gleich eine doppelte Ladung zu den großen Veränderungen in meinem Leben. Im Detail.
Erste Ladung: Fünfzehnter Stock. Jahrzehntelang bewohnte ich eine kleine Erdgeschosswohnung mit Küchenzeile und Flügeltüren zu einem Innenhof auf der einen Seite und einem winzigen Rasen auf der anderen. Jetzt bin ich Mitbesitzerin einer Wohnung mit drei Schlafzimmern in einem schicken neuen Hochhaus samt Marmorböden in der Lobby und einem uniformierten Portier.
Zweite Ladung: Unsere. Bis auf meinen Kater Birdie und meine gelegentlich hier campierende Tochter Katy habe ich alleine gelebt, seit ich mich irgendwann im Neolithikum von meinem Ex trennte. Jetzt habe ich einen Zimmergenossen an beiden Enden meines geografisch komplizierten Lebens. Dieser Zimmergenosse ist Andrew Ryan.
Sie fragen sich, wie das passieren konnte?
Nachdem ich mich jahrelang gegen Ryans Druck nach größerer persönlicher Nähe gestemmt hatte – darunter auch wiederholte Heiratsanträge –, gab ich schließlich nach und fand mich bereit zum Zusammenleben.
Als Beweis meiner Verpflichtung zu dieser neuen Lebensgestaltung kündigte ich beim Vermieter meiner geliebten kleinen Wohnung. Ryan verkaufte seine Bude im Habitat 67. Ich beauftragte die Errichtung eines Anbaus an den Annex in Charlotte, und le monsieur und ich machten uns auf die Suche nach Eigentumswohnungen in Montreal.
Endlose Eigentumswohnungen.