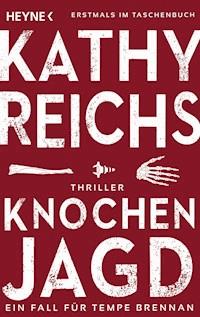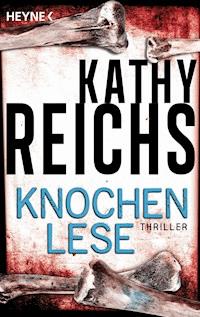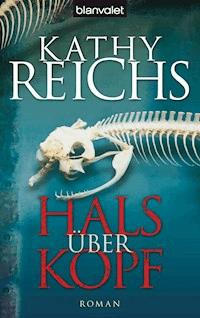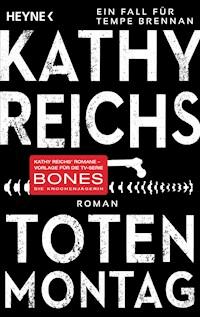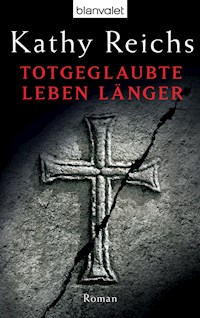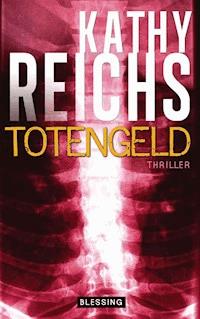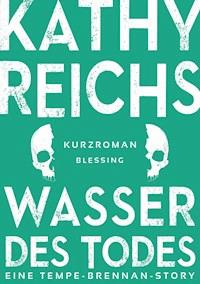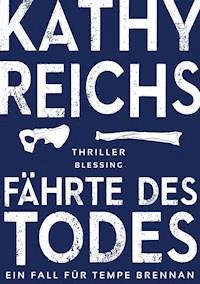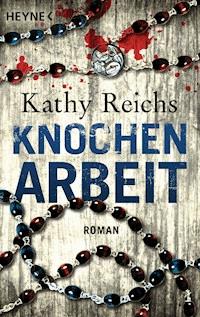
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Tempe-Brennan-Romane
- Sprache: Deutsch
Die Wahrheit der Knochen
Grauenvolles erwartet die forensische Anthropologin Tempe Brennan, als sie in den kleinen Ort St. Jovice gerufen wird: ein niedergebranntes Haus mit sieben Leichen, zwei davon Babys, denen das Herz fehlt. Nur zu gern widmet sie sich deshalb ihrem anderen Auftrag – der Exhumierung der Ordensschwester Elisabeth Nicolet zwecks posthumer Heiligsprechung. Doch erst liegt die Nonne in einem falschen Grab, und dann entdeckt Tempe gemeinsam mit Detective Ryan eine entsetzliche Parallele zu dem Fall von St. Jovice.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für alle, die den großen Schneesturm 1998 in Quebec überlebt haben.
Nous nous souvenons
ANMERKUNG DER AUTORIN
Die Figuren und Ereignisse in diesem Buch sind frei erfunden und entstammen der Fantasie der Autorin. Die Geschichte spielt in Montreal, Kanada, in Charlotte, North Carolina, und an einigen anderen Schauplätzen. Gewisse reale Orte und Institutionen werden erwähnt, aber die dargestellten Figuren und Ereignisse sind rein fiktiv.
1
Wenn die Leichen an dieser Stelle waren, konnte ich sie nicht finden.
Draußen heulte der Wind. Im Inneren der alten Kirche waren nur das Scharren meiner Kelle und das Brummen eines tragbaren Generators mit Heizlüfter zu hören. Hoch über uns kratzten Zweige an vernagelten Fenstern wie knotige Finger auf Sperrholztafeln.
Die Gruppe stand hinter mir, dicht beieinander, aber ohne sich zu berühren, die Hände fest geballt in den Taschen. Ich hörte, wie sie von einem Fuß auf den anderen traten. Stiefel knirschten auf gefrorener Erde. Niemand sagte etwas. Die Kälte hatte uns zum Schweigen gebracht.
Langsam sickerte ein Erdhäufchen durch das grobe Netz meines Siebes. Der körnige Untergrund war eine angenehme Überraschung gewesen. Eigentlich hatte ich angesichts der gefrorenen Oberfläche mit Dauerfrostboden für die gesamte Tiefe der Ausgrabung gerechnet. Doch in den letzten beiden Wochen war es in Quebec für die Jahreszeit ungewöhnlich warm gewesen, der Schnee war geschmolzen und die Erde getaut. Wieder mal Glück gehabt, Tempe. Obwohl diese Vorahnung des Frühlings kürzlich von einem arktischen Wind davongeblasen worden war, hatte das milde Intermezzo die Erde weich gemacht und das Graben erleichtert. Gut. Letzte Nacht war das Thermometer wieder auf unter minus zehn Grad Celsius gefallen. Nicht gut. Die Erde war zwar nicht wieder gefroren, aber die Luft war eisig. Meine Finger waren so kalt, dass ich sie kaum bewegen konnte.
Es war bereits unser zweiter Graben, aber im Sieb fand sich noch immer nichts außer Kieseln und Steinsplittern. Bei dieser Tiefe hatte ich zwar noch nicht viel erwartet, aber man konnte nie wissen. Eine Exhumierung, bei der alles so lief wie geplant, hatte ich bis jetzt noch nicht erlebt.
Ich drehte mich zu einem Mann in schwarzem Parka und Zipfelmütze um. Er trug lederne, bis unter die Knie geschnürte Stiefel, aus denen zwei Paar über die Schäfte gekrempelte Strümpfe herauslugten. Sein Gesicht hatte die Farbe von Tomatensuppe.
»Nur noch ein paar Zentimeter.« Ich machte eine beschwichtigende Bewegung mit der Hand, als würde ich eine Katze streicheln. Langsam. Ganz langsam arbeiten.
Der Mann nickte und stieß seinen langstieligen Spaten in den flachen Graben. Dabei grunzte er wie die Seles beim Aufschlag.
»Par pouces!«, schrie ich und packte die Schaufel. Zentimeter für Zentimeter! Ich wiederholte die flach schneidende Bewegung, die ich ihm schon den ganzen Vormittag gezeigt hatte. »Wir wollen das Erdreich in dünnen Schichten abtragen.« Ich sagte es noch einmal, in langsamem, bemühtem Französisch.
Der Mann war allem Anschein nach nicht meiner Meinung. Vielleicht war es die mühselige Eintönigkeit der Arbeit, vielleicht der Gedanke,Tote auszugraben. Jedenfalls wollte Tomatensuppe es hinter sich haben.
»Bitte, Guy, wollen Sie es nicht noch einmal probieren?«, fragte eine männliche Stimme hinter mir.
»Ja, Hochwürden.« Ein Murmeln.
Kopfschüttelnd nahm Guy die Arbeit wieder auf, doch diesmal trug er die Erde in flachen Schichten ab, wie ich es ihm gezeigt hatte, und warf sie gegen das Sieb. Immer auf der Suche nach Hinweisen, dass wir uns endlich einem Grab näherten, wanderte mein Blick vom Sieb zu der Grube.
Wir arbeiteten schon seit Stunden, und hinter mir konnte ich die Anspannung spüren. Ich drehte mich um und warf der Gruppe einen, wie ich hoffte, ermutigenden Blick zu. Meine Lippen waren so steif, dass ich nicht wusste, ob er mir gelang.
Sechs Gesichter starrten mich an, verkniffen vor Kälte und banger Erwartung. Eine kleine Dampfwolke stieg vor jedem hoch und löste sich auf. Sechs Münder lächelten in meine Richtung. Ich spürte, dass heftig gebetet wurde.
Neunzig Minuten später waren wir einen Meter fünfzig tief. Wie schon aus der ersten hatten wir auch aus dieser Grube nur Erde herausgeholt. Ich war mir sicher, dass ich Frostbeulen an jedem Zeh hatte, und Guy hätte wahrscheinlich am liebsten mit einem Schaufelbagger weitergemacht. Zeit für eine Neubesinnung.
»Hochwürden, ich glaube, wir müssen uns die Bestattungsunterlagen noch einmal ansehen.«
Er zögerte einen Augenblick. Dann: »Ja, natürlich. Natürlich. Und ich glaube, Kaffee und Sandwiches könnten wir jetzt alle gut gebrauchen.«
Der Priester ging auf die Flügeltür am anderen Ende der Kirche zu, und die Nonnen folgten ihm, mit gesenktem Kopf vorsichtig über den unebenen Boden trippelnd. Ihre weißen Schleier breiteten sich in genau gleichen Fächern auf den Rücken ihrer schwarzen Wollmäntel aus. Pinguine. Wer hatte das gesagt? Die Blues Brothers.
Ich schaltete die Flutlichtstrahler aus und folgte ihnen. Den Blick ebenfalls gesenkt, staunte ich über die Knochenfragmente, die hier überall in dem Lehmboden eingebettet waren. Klasse. Wir hatten an der einzigen Stelle in der ganzen Kirche gegraben, an der es keine Gräber gab.
Father Ménard stieß einen Flügel auf, und wir traten im Gänsemarsch ans Tageslicht. Man brauchte einen Moment, um sich an die Helligkeit zu gewöhnen. Der Himmel war bleigrau und lag schwer auf den Giebeln und Türmen des Klosters. Ein beißender Wind blies von den Laurentian Mountains herunter und fuhr in Kragen und Schleier.
Unsere kleine Gruppe stemmte sich gegen den Wind und marschierte zu einem Nachbargebäude, aus grauem Stein wie die Kirche, nur etwas kleiner. Wir stiegen die Stufen hoch zu einem reich mit Schnitzwerk verzierten hölzernen Portal und traten durch eine Seitentür ein.
Drinnen war es warm und trocken, angenehm nach der bitteren Kälte. Ich roch Tee und Mottenkugeln und den Bratgeruch von Jahren.
Wortlos zogen die Frauen ihre Stiefel aus, lächelten mich eine nach der anderen an und verschwanden durch eine Tür auf der rechten Seite, während eine winzige Nonne in einem riesigen Skipullover ins Foyer schlurfte. Flauschige braune Rentiere trabten über ihre Brust und verschwanden unter ihrem Schleier. Sie blinzelte mich durch dicke Brillengläser an und streckte die Hand nach meinem Parka aus. Ich zögerte, denn ich befürchtete, sein Gewicht würde sie aus dem Gleichgewicht bringen und sie auf den Fliesenboden schleudern. Doch sie nickte und wedelte beinahe ungeduldig mit den Fingern, und so zog ich die Jacke aus, legte sie ihr über die Arme und fügte Mütze und Handschuhe hinzu. Sie war die älteste Frau, die ich je lebend gesehen hatte.
Ich folgte Father Ménard über einen langen, düsteren Gang in ein kleines Arbeitszimmer. Hier roch es nach altem Papier und Schulkleister. Über einem Schreibtisch hing ein Kruzifix, das so riesig war, dass ich mich fragte, wie man es durch die Tür gebracht hatte. Dunkle Eichentäfelung reichte fast bis zur Decke, von wo aus Statuen auf uns herabstarrten, mit Gesichtern so düster wie das des Mannes auf dem Kruzifix.
Father Ménard setzte sich auf einen der Holzstühle vor dem Schreibtisch und bedeutete mir, auf dem anderen Platz zu nehmen. Das Rascheln seiner Kutte. Das Klimpern seiner Rosenkranzperlen. Einen Augenblick lang war ich wieder in St. Barnabas. Im Büro des Ehrwürdigen Vaters. Wieder mal in Schwierigkeiten. Lass das, Brennan. Du bist über vierzig und Akademikerin. Forensische Anthropologin. Man hat dich hierhergerufen, weil dein Fachwissen gefragt ist.
Der Priester nahm einen ledergebundenen Folianten vom Schreibtisch, schlug ihn bei der mit einem grünen Lesebändchen markierten Seite auf und schob ihn zwischen uns. Er holte tief Luft, spitzte die Lippen und atmete durch die Nase wieder aus.
Der Lageplan war mir inzwischen vertraut. Ein Gitternetz mit regelmäßigen Reihen rechteckiger Felder, einige mit Nummern, andere mit Namen. Stundenlang hatten wir die Zeichnung tags zuvor angestarrt und die Daten und Beschreibung der Gräber mit ihrer Lage auf dem Gitternetz verglichen. Dann waren wir das Gelände abgeschritten und hatten die genaue Stelle markiert.
Élisabeth sollte eigentlich, von der Nordwand aus gerechnet, in der dritten Reihe liegen, im dritten Grab vom westlichen Ende her. Genau neben Mère Aurelie. Aber dort lag sie nicht. Und auch Aurelie war nicht dort, wo sie sein sollte.
Ich deutete auf ein Grab im selben Quadranten, aber einige Reihen weiter unten und ein Stückchen weiter rechts. »Okay, Raphaël scheint hier zu liegen.« Dann weiter die Reihe entlang. »Und Agathe, Véronique, Clément, Marthe und Éléonore. Das sind die Grabstellen aus den 1840ern, richtig?«
»C’est ça.«
Ich schob den Zeigefinger zu dem Teil der Zeichnung, der dem südwestlichen Winkel der Kirche entsprach. »Und das sind die jüngsten Gräber. Die Indizien, die wir gefunden haben, passen zu Ihren Aufzeichnungen.«
»Ja. Das waren die letzten, kurz bevor die Kirche aufgegeben wurde.«
»Sie wurde 1914 geschlossen.«
»1914. Ja. 1914.« Er hatte eine merkwürdige Art, Namen und Begriffe zu wiederholen.
»Élisabeth starb 1888?«
»C’est ça. 1888. Mère Aurelie 1894.«
Es ergab keinen Sinn. Wir hätten an dieser Stelle Hinweise auf die beiden Gräber finden müssen. Von den Gräbern aus den 1840er Jahren waren noch Artefakte vorhanden. Eine Testgrabung in diesem Teil hatte Holz- und Metallteile von Särgen zutage gefördert. In der geschützten Umgebung im Inneren der Kirche und in dieser Art von Erdreich erwartete ich eigentlich relativ gut erhaltene Skelette. Wo waren also Élisabeth und Aurelie?
Die alte Nonne kam mit einem Tablett mit Kaffee und Sandwiches ins Zimmer geschlurft. Dampf aus den Tassen hatte ihr die Brille beschlagen, und so ging sie mit kurzen, schleifenden Schritten, ohne die Füße je richtig vom Boden zu heben.
Father Ménard stand auf, um ihr das Tablett abzunehmen. »Merci, Schwester Bernard. Das ist sehr freundlich. Sehr freundlich.«
Die Nonne nickte und schlurfte davon, ohne sich die Brille abzuwischen. Ich nahm mir eine Tasse und sah der Ordensfrau nach. Ihre Schultern schienen so schmal wie mein Handgelenk.
»Wie alt ist Schwester Bernard?«, fragte ich, während ich nach einem belegten Hörnchen griff. Marinierter Lachs und welke Salatblätter.
»Wir sind nicht ganz sicher. Sie war schon hier, als ich als Junge zum ersten Mal hierherkam, vor dem Krieg. Vor dem Zweiten Weltkrieg, meine ich. Dann ging sie als Lehrerin in Missionen in Übersee. Sie war lange in Japan und dann in Kamerun, glaube ich. Erst seit ein paar Wochen ist sie wieder da. Wir glauben, dass sie in den Neunzigern ist.« Er trank einen Schluck Kaffee. Schlürfend. »Sie wurde in einem kleinen Dorf am Saguenay geboren und sagt, dass sie zwölf war, als sie in den Orden eintrat.« Schlürfen. »Zwölf. Die Aufzeichnungen im ländlichen Quebec waren zu der Zeit nicht so gut. Nicht so gut.«
Ich biss in mein Croissant und legte die Finger dann wieder um die Kaffeetasse. Die Wärme tat gut.
»Hochwürden, gibt es noch irgendwelche anderen Aufzeichnungen? Alte Briefe, Dokumente, irgendetwas, das wir uns noch nicht angesehen haben?« Ich wackelte mit den Zehen. Kein Gefühl.
Er deutete auf die Unterlagen auf dem Schreibtisch und zuckte mit den Achseln. »Das ist alles, was Schwester Julienne mir gegeben hat. Sie ist die Archivarin des Konvents, wie Sie wissen.«
»Ja.«
Schwester Julienne und ich hatten ausführlich miteinander gesprochen und korrespondiert. Sie war es gewesen, die sich wegen des Projekts mit mir in Verbindung gesetzt hatte. Der Fall hatte mich von Anfang an fasziniert. Er war ganz anders als meine übliche forensische Arbeit mit Verstorbenen, die in der Gerichtsmedizin landen. Die Erzdiözese wollte, dass ich die Überreste einer Heiligen exhumierte und untersuchte. Nun ja, eigentlich war sie noch keine richtige Heilige. Aber darauf lief es hinaus. Élisabeth Nicolet war für die Seligsprechung vorgeschlagen worden. Ich sollte ihr Grab finden und nachprüfen, ob die Knochen wirklich die ihren waren. Der Rest war dann Sache des Vatikans.
Schwester Julienne hatte mir versichert, dass zuverlässige Aufzeichnungen vorhanden seien. Alle Gräber in der alten Kirche waren katalogisiert und kartografiert. Das letzte Begräbnis hatte 1911 stattgefunden. 1914 war die Kirche nach einem Feuer aufgegeben und geschlossen worden. Als Ersatz wurde eine größere erbaut, und das alte Gebäude wurde nie mehr benutzt. Geschlossene Grabungsstätte. Gute Dokumentation. Eigentlich ein Kinderspiel.
Aber wo war Élisabeth Nicolet?
»Fragen kann nicht schaden. Vielleicht findet sich ja noch etwas, das Schwester Julienne Ihnen nicht gegeben hat, weil sie es für unwichtig hielt.«
Er wollte etwas erwidern, schien es sich dann aber anders zu überlegen. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir alles gegeben hat, aber ich werde sie trotzdem fragen. Schwester Julienne hat viel Zeit mit der Recherche in dieser Angelegenheit verbracht. Sehr viel Zeit.«
Ich sah ihm nach, wie er durch die Tür verschwand, aß mein erstes Hörnchen auf und dann ein zweites. Gut. Das Gefühl in meinen Zehen kehrte zurück. Während ich an meinem Kaffee nippte, nahm ich einen Brief vom Schreibtisch.
Ich hatte ihn schon einmal gelesen.Vom 4. August 1885. Damals wüteten in Montreal die Pocken. Élisabeth Nicolet hatte an Bischof Edouard Fabre geschrieben und ihn gebeten, für alle Gemeindemitglieder, die nicht infiziert waren, eine Impfung anzuordnen und die Infizierten ins städtische Krankenhaus einzuweisen. Die Handschrift war präzise, das Französisch drollig und altmodisch.
Im Konvent Notre Dame de L’Immaculée Conception war es absolut still. Meine Gedanken schweiften ab. Ich dachte an andere Exhumierungen. Der Polizist in Saint-Gabriel zum Beispiel.Auf jenem Friedhof waren die Särge dreifach übereinandergestapelt gewesen; schließlich hatten wir Monsieur Beaupré vier Gräber von der in den Unterlagen verzeichneten Stelle entfernt gefunden, in unterster, nicht in oberster Position. Und dann der Mann in Winston-Salem, der nicht in seinem eigenen Sarg lag. In dem befand sich eine Frau in einem langen, blumengemusterten Kleid. Worauf der Friedhof ein doppeltes Problem gehabt hatte. Wo war der Verstorbene? Und wer die Leiche in dem Sarg? Die Familie war nie in der Lage gewesen, ihrem Großvater in Polen eine letzte Ruhestätte zu schenken, und die Anwälte hatten sich für einen Kampf gerüstet, als ich den Schauplatz verließ.
Weit weg hörte ich eine Glocke läuten und dann, im Korridor, ein Schlurfen. Die alte Nonne kam wieder ins Zimmer.
»Serviettes«, kreischte sie. Ich schrak hoch und schüttete mir Kaffee auf den Ärmel. Wie konnte eine so zierliche Person eine solche Lautstärke produzieren?
»Merci.« Ich griff nach den Servietten.
Sie ignorierte mich, kam näher und fing an, an meinem Ärmel zu reiben. Ein winziges Hörgerät ragte hinter ihrem rechten Ohr hervor. Ich spürte ihren Atem und sah feine weiße Haare auf ihrem Kinn. Sie roch nach Wolle und Rosenwasser.
»Eh voilà. Waschen Sie es, wenn Sie nach Hause kommen. Mit kaltem Wasser.«
»Ja, Schwester.« Ein Reflex.
Ihr Blick fiel auf den Brief in meiner Hand. Zum Glück war kein Kaffee darauf. Sie beugte sich über das Schreiben.
»Élisabeth Nicolet war eine großartige Frau. Eine Frau Gottes. Eine solche Reinheit. Ein solcher Ernst.« Pureté. Austérité. Ihr Französisch klang, wie ich mir Élisabeths Briefe gesprochen vorstellte.
»Ja, Schwester.« Ich war wieder neun Jahre alt.
»Sie wird eine Heilige.«
»Ja, Schwester. Deswegen versuchen wir ja, ihre Knochen zu finden. Damit sie eine angemessene Behandlung erfahren können.« Ich wusste nicht so recht, was eine angemessene Behandlung für eine Heilige war, aber es klang irgendwie richtig.
Ich zog den Lageplan hervor und zeigte ihn ihr. »Das ist die alte Kirche.« Ich fuhr die Reihe an der Nordwand nach und deutete auf ein Rechteck. »Das ist ihr Grab.«
Die alte Nonne musterte, die Brille nur Millimeter von dem Blatt entfernt, die Zeichnung.
»Dort liegt sie nicht.«
»Wie bitte?«
»Sie liegt nicht dort.« Ein knotiger Finger tippte auf das Rechteck. »Das ist die falsche Stelle.«
In diesem Augenblick kehrte Father Ménard zurück. Eine Erklärung war nicht nötig. Offensichtlich hatte er schon im Korridor gehört, was die alte Frau gesagt hatte. Wahrscheinlich hatte man sie bis Ottawa gehört.
»Das ist die falsche Stelle. Sie suchen an der falschen Stelle.«
»Was meinen Sie damit, Schwester Bernard?«
»Sie suchen an der falschen Stelle«, wiederholte sie. »Sie liegt nicht dort.«
Father Ménard und ich warfen uns einen Blick zu.
»Wo ist sie dann, Schwester?«, fragte ich.
Sie beugte sich noch einmal über den Lageplan und tippte dann auf den südöstlichsten Winkel der Kirche. »Da ist sie. Zusammen mit Mère Aurelie.«
»Aber Schwes…«
»Man hat sie verlegt. Hat ihnen neue Särge gegeben und sie unter einem speziellen Altar vergraben. Dort.«
Wieder deutete sie auf die südöstliche Ecke.
»Wann?«, fragten wir gleichzeitig.
Schwester Bernard schloss die Augen. Die runzligen Lippen bewegten sich in stummer Berechnung.
»1911. Das Jahr, in dem ich als Novizin hierherkam. Ich erinnere mich noch daran, weil ein paar Jahre später die Kirche niederbrannte und geschlossen wurde. Und ich hatte die Aufgabe, den Altar mit Blumen zu schmücken. Ich mochte das gar nicht. Es war unheimlich ganz allein da drin. Aber ich habe es für Gott getan.«
»Was ist mit dem Altar passiert?«
»Wurde irgendwann in den Dreißigern ausgebaut. Er ist jetzt in der Kapelle zum Jesuskind in der neuen Kirche.« Sie faltete die Serviette zusammen und sammelte das Geschirr ein. »Früher war da eine Tafel, die die Gräber kennzeichnete, aber jetzt nicht mehr. Es geht ja niemand mehr da rein. Die Tafel ist seit Jahren verschwunden.«
Father Ménard und ich sahen uns an. Er zuckte leicht mit den Achseln.
»Schwester«, sagte ich, »glauben Sie, Sie könnten uns zeigen, wo Élisabeths Grab ist?«
»Bien sûr.«
»Jetzt gleich?«
»Warum nicht?« Porzellan klapperte.
»Kümmern Sie sich nicht um das Geschirr«, sagte Father Ménard. »Bitte ziehen Sie Mantel und Stiefel an, Schwester, und dann gehen wir hinüber.«
Zehn Minuten später waren wir alle wieder in der alten Kirche versammelt. Das Wetter hatte sich nicht gebessert, es war höchstens noch kälter und feuchter als am Vormittag. Der Wind heulte noch immer. Die Zweige kratzten wie zuvor.
Von Father Ménard und mir gestützt, tapste Schwester Bernard durch die Kirche. Durch die vielen Kleiderschichten hindurch fühlte sie sich zerbrechlich und federleicht an.
Die Schwestern folgten uns, aufgeregt schnatternd in ihrer Rolle als Zaungäste, Schwester Julienne mit gezücktem Stenoblock und Stift. Guy bildete das Schlusslicht.
Vor einer Nische in der südöstlichen Ecke blieb Schwester Bernard stehen. Sie hatte sich eine hellgrüne, unter dem Kinn geknüpfte Strickhaube über den Schleier gezogen. Wir sahen zu, wie sie den Kopf hin und her drehte, sich orientierte, nach Hinweisen suchte. Alle Augen waren auf den einen Klecks Farbe in dem düsteren Kircheninneren gerichtet.
Ich bedeutete Guy, einen Strahler neu auszurichten. Schwester Bernard achtete nicht darauf. Nach einer Weile trat sie ein Stück von der Wand zurück. Kopf nach links, Kopf nach rechts, Kopf nach links. Nach oben. Nach unten. Sie kontrollierte noch einmal ihre Position und zog dann mit dem Absatz eine Linie in die Erde. Oder versuchte es zumindest.
»Hier ist sie.« Die schrille Stimme hallte von den Wänden wider.
»Sind Sie sicher?«
»Hier ist sie.« An Selbstvertrauen mangelte es Schwester Bernard nicht.
Wir alle starrten die Markierung an, die sie gezogen hatte.
»Sie liegen in kleinen Särgen. Keine normalen. Es waren ja nur noch Knochen, deshalb hat alles in kleine Särge gepasst.« Sie streckte die Arme aus, um die Größe eines Kindersargs anzudeuten. Ihre Hände zitterten. Guy richtete den Strahler auf die Stelle zu ihren Füßen.
Father Ménard dankte der uralten Ordensfrau und bat zwei der Nonnen, sie in den Konvent zurückzubringen. Ich sah ihnen nach. Schwester Bernard wirkte wie ein Kind zwischen den beiden, so klein, dass der Saum ihres Mantels durch den Staub schleifte.
Ich bat Guy, den zweiten Strahler an die neue Stelle zu bringen. Dann holte ich meine Sonde von unserer ersten Ausgrabungsstätte, platzierte die Spitze an der Stelle, die Schwester Bernard markiert hatte, und drückte auf den T-förmigen Griff. Nichts bewegte sich. Diese Stelle war offenbar weniger aufgetaut. Ich benutzte eine Rohrsonde, um im Untergrund nichts zu beschädigen, und die abgerundete Spitze konnte die teilweise gefrorene obere Schicht kaum durchdringen. Ich versuchte es noch einmal, diesmal mit mehr Kraft.
Immer mit der Ruhe, Brennan. Es gefällt ihnen bestimmt nicht, wenn du eine Namenstafel auf dem Sarg zertrümmerst. Oder der guten Schwester ein Loch in den Schädel bohrst.
Ich zog meine Handschuhe aus, legte die Finger fest um den Griff und drückte noch einmal. Diesmal durchbrach ich die Oberfläche und spürte, wie die Sonde durch das Erdreich drang. Ich musste mich beherrschen, um nicht in Hast zu verfallen. Mit geschlossenen Augen sondierte ich das Erdreich, tastete nach Unterschieden in der Dichte. Weniger Widerstand konnte einen Hohlraum bedeuten, wo etwas verfault war. Mehr Widerstand konnte bedeuten, dass sich ein Knochen oder ein Artefakt im Erdreich befand. Nichts. Ich zog die Sonde heraus und wiederholte den Vorgang an anderer Stelle.
Beim dritten Versuch spürte ich Widerstand. Ich zog den Stab heraus und stieß ihn fünfzehn Zentimeter daneben wieder in die Erde. Dasselbe. Knapp unter der Oberfläche war etwas Festes.
Ich zeigte dem Priester und den Nonnen den erhobenen Daumen und bat Guy, das Sieb zu bringen. Dann legte ich die Sonde weg, nahm einen Spaten und begann, dünne Schichten Erde abzutragen. Ich schälte das Erdreich Zentimeter um Zentimeter ab und warf es durch das Sieb, wobei mein Blick zwischen Schaufelfüllung und Grube hin- und herwanderte. Nach dreißig Minuten sah ich, wonach ich gesucht hatte. Die letzten Häufchen auf dem Spaten waren dunkel, schwarz im Gegensatz zur rötlichbraunen Erde unter dem Sieb.
Ich wechselte vom Spaten zur Kelle, bückte mich in die Grube, schabte behutsam über den Boden und entfernte lose Partikel, um die Oberfläche zu glätten. Fast sofort wurde ein dunkles Oval sichtbar. Der Fleck schien etwa einen Meter lang zu sein. Die Breite konnte ich nur schätzen, da er noch halb unter Erde verborgen war.
»Hier ist etwas«, sagte ich und richtete mich auf.
Priester und Nonnen rückten näher und spähten in die Grube. Ich markierte den Umriss des Ovals mit der Kelle. In diesem Augenblick kehrten Schwester Bernards Begleiterinnen zurück.
»Es könnte ein Grab sein, obwohl es ziemlich klein aussieht. Ich habe ein Stückchen links davon gegraben, also muss ich jetzt hier weitermachen.« Ich deutete auf die Stelle, über der ich kauerte. »Ich werde mich neben dem eigentlichen Grab in die Tiefe arbeiten. So bekommen wir eine Profilansicht der Grabstätte. Es ist auch besser für den Rücken, wenn man auf diese Art gräbt. Außerdem können wir so, wenn nötig, den Sarg auch seitlich herausziehen.«
»Was ist das für ein Fleck?«, fragte eine junge Nonne mit einem Gesicht wie eine Pfadfinderin.
»Wenn etwas mit hohem organischem Gehalt zerfällt, färbt es die Erde dunkler. Ein solcher Fleck ist fast immer der erste Hinweis auf eine Grabstätte.«
Zwei Nonnen bekreuzigten sich.
»Ist es Élisabeth oder Mère Aurelie?«, fragte eine ältere Nonne. Eins ihrer Unterlider zuckte ein wenig.
Ich hob die Hände – keine Ahnung. Dann zog ich die Handschuhe wieder an und entfernte mit der Kelle die Erde über der rechten Hälfte des Flecks. Ich vergrößerte die Grube, so dass das ganze Oval und ein etwa sechzig Zentimeter breiter Streifen rechts davon freigelegt wurden.
Wieder waren nur Scharren und das Rieseln von Erde durch das Sieb zu hören.
Dann: »Ist das etwas?« Die größte Nonne deutete auf das Sieb.
Ich stand auf, um nachzusehen, dankbar für diese Gelegenheit, mich strecken zu können.
Die Nonne zeigte mir ein kleines, rötlich braunes Fragment.
»Himmel, Ar… Ja, Schwester. Sieht aus wie Sargholz.«
Ich holte einen Stapel Papiertüten aus meinem Ausrüstungskoffer, beschriftete eine mit Datum, Ort und anderen wichtigen Informationen, stellte sie auf das Sieb und legte die anderen auf den Boden. Meine Finger waren inzwischen völlig taub.
»An die Arbeit, Ladys. Schwester Julienne, Sie registrieren alles, was wir finden. Schreiben Sie es auf die Tüte und tragen Sie es in das Buch ein, wie wir es besprochen haben. Wir sind bei …« Ich sah in die Grube. »… etwa sechzig Zentimeter Tiefe. Schwester Marguerite, machen Sie ein paar Fotos?«
Schwester Marguerite nickte und hielt den Apparat in die Höhe.
Froh, nach den langen Stunden des Zusehens endlich etwas zu tun zu haben, machten sich alle eifrig an die Arbeit. Ich schaufelte, Schwester Lid und Schwester Pfadfinderin siebten. Immer mehr Fragmente tauchten auf, und bald konnten wir in der verfärbten Erde einen Umriss erkennen. Holz. Stark verfallen. Nicht gut.
Mit Kelle und bloßen Händen legte ich nun frei, was, wie ich hoffte, ein Sarg war. Aber zu wem gehörte er? Nach den Aufzeichnungen war in diesem Teil der Kirche niemand begraben. Obwohl die Temperatur unter dem Gefrierpunkt lag und meine Finger und Zehen völlig gefühllos waren, schwitzte ich in meinem Parka. Bitte, lass das Élisabeth sein. Und wer betete jetzt?
Während ich die Grube Stück für Stück nach Norden vergrößerte, wurde immer mehr Holz sichtbar, das Objekt verbreiterte sich. Langsam wurde die Form erkennbar: sechseckig. Eine Sargform. Am liebsten hätte ich laut »Halleluja!« gerufen. Würde zwar in den Rahmen passen, war aber unprofessionell, sagte ich mir.
Handvoll um Handvoll entfernte ich vorsichtig Erde, bis der Deckel des Objekts ganz freilag. Es war ein kleiner Sarg, und ich bewegte mich vom Fußende zum Kopf. Ich legte die Kelle weg und griff nach einem Pinsel. Dabei kreuzte ich den Blick mit einer der siebenden Schwestern. Ich lächelte. Sie lächelte. Ihr rechtes Lid tanzte einen Jitterbug.
Immer und immer wieder bürstete ich über das Holz, bis alle anhaftenden Erdpartikel entfernt waren. Jeder hielt inne, um mir zuzusehen. Allmählich wurde auf dem Sargdeckel ein erhabenes Objekt erkennbar. Knapp oberhalb der breitesten Stelle. Genau dort, wo man die Namenstafel erwarten würde. Mein Herz fing ebenfalls an zu tanzen.
Ich bürstete Erde von dem Objekt, bis es wirklich als Tafel erkennbar wurde. Sie war oval, aus Metall, mit einem filigran verzierten Rand. Mit einer Zahnbürste säuberte ich behutsam die Oberfläche. Buchstaben wurden sichtbar.
»Schwester, könnten Sie mir meine Taschenlampe geben? Aus meinem Koffer?«
Alle beugten sich über die Grube. Pinguine an einem Wasserloch. Ich richtete den Strahl auf die Tafel. »Élisabeth Nicolet. 1846–1888. Femme contemplative.«
»Wir haben sie«, rief ich in die kalte Kirche.
»Halleluja!«, rief Schwester Pfadfinderin. So viel zu kirchlicher Etikette.
In den nächsten zwei Stunden exhumierten wir Élisabeths Überreste. Die Nonnen und sogar Father Ménard stürzten sich in die Arbeit wie Anfangssemester bei ihrer ersten Ausgrabung. Schwesterntracht und die Soutane raschelten und wehten, während Erde durchgesiebt, Tüten gefüllt, beschriftet und gestapelt und die einzelnen Arbeitsschritte auf Film festgehalten wurden. Auch Guy half, wenn auch noch immer etwas widerwillig. Es war die merkwürdigste Crew, die ich je gehabt hatte.
Den Sarg herauszuheben war nicht einfach. Obwohl er nur klein war, war das Holz stark beschädigt, so dass Erde ins Innere gerieselt war, was das Gewicht auf fast eine Tonne erhöhte. Der seitliche Graben war eine gute Idee gewesen, obwohl ich den Platz unterschätzt hatte, den wir brauchen würden. Wir mussten den Graben noch um etwa sechzig Zentimeter verbreitern, um Sperrholz unter den Sarg schieben zu können. Schließlich konnten wir das Ganze mit Hilfe eines Polypropylenseils herausheben.
Um halb sechs Uhr abends tranken wir Kaffee in der Küche des Konvents, erschöpft, mit langsam wieder auftauenden Fingern, Zehen und Gesichtern. Élisabeth Nicolet und ihr Sarg ruhten zusammen mit meiner Ausrüstung auf der Ladefläche des klostereigenen Transporters. Tags darauf würde Guy sie ins Laboratoire de Médecine Légale in Montreal bringen, wo ich als forensische Anthropologin für die Provinz Quebec arbeite. Da historische Tote nicht als forensische Fälle gelten, war vom Bureau du Coroner eine spezielle Genehmigung eingeholt worden, die Untersuchung dort durchzuführen.
Ich stellte meine Tasse auf den Tisch und verabschiedete mich. Die Schwestern dankten mir noch einmal und lächelten mit angespannten Gesichtern, denen die Nervosität wegen meiner bevorstehenden Befunde anzumerken war. Sie waren große Lächler.
Father Ménard brachte mich zum Auto. Es war dunkel geworden und schneite leicht. Die Flocken fühlten sich auf meinen Wangen merkwürdig warm an.
Der Priester fragte mich noch einmal, ob ich nicht lieber im Konvent übernachten wolle. Der Schnee funkelte im Lichtkegel der Portalbeleuchtung. Und ich lehnte wieder ab. Noch eine kurze Wegbeschreibung, und ich war unterwegs.
Nach zwanzig Minuten auf der zweispurigen Straße begann ich meine Entscheidung zu bedauern. Die Flocken, die anfangs träge im Licht meiner Scheinwerfer getanzt hatten, fielen jetzt in dichten, diagonalen Schwaden. Die Straße und die Bäume zu beiden Seiten waren bedeckt von einer weißen Membran, die immer undurchsichtiger wurde.
Ich packte das Lenkrad mit beiden Händen, und meine Handflächen waren feuchtkalt in den Handschuhen. Ich bremste ab auf fünfundsechzig Stundenkilometer. Fünfundfünfzig. Alle paar Minuten testete ich die Bremsen. Obwohl ich schon seit Jahren immer wieder in Quebec lebe, habe ich mich ans Autofahren im Winter nie gewöhnt. Ich halte mich zwar selber für hart im Nehmen, aber auf verschneiter Straße bin ich ein Hasenfuß. Ich zeige noch immer die typisch südliche Reaktion auf Winterstürme. Oh, Schnee – dann gehen wir natürlich nicht aus! Les Québecois schauen mich bloß an und lachen.
Angst hat etwas Erlösendes. Sie vertreibt die Erschöpfung. Müde wie ich war, blieb ich doch wachsam, hielt die Zähne zusammengebissen, den Hals gereckt, die Muskeln angespannt. Die Eastern-Townships-Autoroute war in einem etwas besseren Zustand als die Nebenstraßen, aber auch nicht sehr. Von Memphrémagog bis Montreal dauert es normalerweise zwei Stunden. Ich brauchte fast vier.
Kurz nach zehn stand ich in meiner dunklen Wohnung und war froh, zu Hause zu sein. In meinem Quebecer Zuhause. Bienvenue. Mein Denken hatte bereits auf Französisch umgeschaltet.
Ich drehte die Heizung auf und schaute in den Kühlschrank. Trübe Aussichten. Ich wärmte mir ein tiefgefrorenes Burrito in der Mikrowelle auf und spülte es mit zimmerwarmer Kräuterlimonade hinunter. Keine haute cuisine, aber nahrhaft.
Das Gepäck, das ich am Dienstagabend hier abgestellt hatte, lag noch ungeöffnet im Schlafzimmer. Ich dachte nicht einmal ans Auspacken. Morgen. Mit dem festen Wunsch, mindestens neun Stunden zu schlafen, fiel ich ins Bett. Das Telefon weckte mich nach weniger als vier.
»Oui, ja«, murmelte ich.
»Temperance, Pierre LaManche hier. Es tut mir sehr leid, Sie um diese Zeit stören zu müssen.«
Ich wartete. In den sieben Jahren, seit ich für den Direktor des Gerichtsmedizinischen Instituts arbeitete, hatte er mich noch nie um drei Uhr morgens angerufen.
»Ich hoffe, in Memphrémagog ging alles gut.« Er räusperte sich. »Ich habe eben einen Anruf aus dem Büro des Leichenbeschauers erhalten. In St. Jovite hat es in einem Privathaus einen Brand gegeben. Die Feuerwehr versucht noch immer, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Brandstiftungsspezialisten werden gleich morgen früh die Ermittlungen aufnehmen, und der Leichenbeschauer will uns ebenfalls an Ort und Stelle haben.« Wieder ein Räuspern. »Ein Nachbar sagt, dass die Bewohner zu Hause waren. Ihre Autos stehen noch in der Auffahrt.«
»Wozu brauchen Sie mich?«, fragte ich.
»Offensichtlich ist es ein ziemlich starkes Feuer. Wenn es Leichen gibt, dürften die stark verbrannt sein. Vielleicht nur noch kalzinierte Knochen und Zähne. Es könnte eine schwierige Bergung werden.«
Verdammt. Nicht morgen.
»Wann?«
»Kann ich Sie um sechs abholen?«
»Okay.«
»Temperance. Das könnte ziemlich übel werden. In dem Haus haben Kinder gewohnt.«
Ich stellte den Wecker auf halb sechs.
Bienvenue.
2
Ich habe mein ganzes Leben im Süden verbracht. Mir kann es gar nicht warm genug sein. Ich liebe den Strand im August, Sommerkleider, Deckenventilatoren, den Geruch schweißfeuchter Kinderhaare, das Geräusch von Insekten an Fliegengittern. Und doch verbringe ich den Sommer und die Semesterferien in Quebec. In den meisten Monaten während des akademischen Jahres pendele ich zwischen Charlotte, North Carolina, wo ich an der Anthropologischen Fakultät der Universität unterrichte, und Montreal, wo ich im gerichtsmedizinischen Institut arbeite, hin und her. Das ist eine Entfernung von fast zweitausend Kilometern.
Wenn es tiefer Winter ist, muss ich mir oft selbst gut zureden, bevor ich aus dem Flugzeug steige. Es ist kalt, schärfe ich mir ein. Es ist sehr kalt. Aber du brauchst dich nur entsprechend anzuziehen und dich darauf einzustellen. Ja. Ich stelle mich darauf ein. Darauf vorbereitet bin ich dennoch nicht. Es ist immer ein Schock, wenn ich den Terminal verlasse und zum ersten Mal die kalte Luft einatme.
Um sechs Uhr morgens am zehnten Tag des März zeigte das Thermometer auf meiner Terrasse zwei Grad Fahrenheit. Minus siebzehn Grad Celsius. Ich hatte mir angezogen, so viel ich nur konnte. Lange Unterwäsche, Jeans, zwei Pullover, Wanderstiefel und Wollsocken. In den Socken trug ich funkelnde Isolier-Innenstrümpfe, die eigentlich Astronauten auf dem Pluto die Füße wärmen sollten. Dieselbe sexy Kombination wie am Tag zuvor. Die mich vermutlich genauso wenig warm halten würde.
Als LaManche hupte, zog ich den Reißverschluss meines Parkas zu und rannte aus der Lobby. So wenig Begeisterung ich für diesen Ausflug aufbringen konnte, wollte ich Pierre doch nicht warten lassen.
Ich hatte eine dunkle Limousine erwartet, doch das Fahrzeug, aus dem er mir zuwinkte, war eine Art sportiver Geländewagen. Vierradantrieb, knallrot, Rennstreifen.
»Nettes Auto«, sagte ich beim Einsteigen.
»Merci.« Er deutete auf ein Haltegestell auf der Mittelkonsole. Es enthielt zwei Styroporbecher und eine Tüte mit Dunkin’ Donuts. Sehr aufmerksam. Ich nahm mir einen mit Apfelfüllung.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!