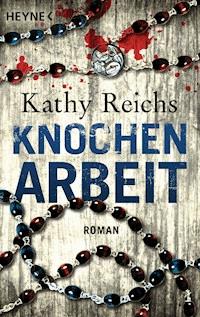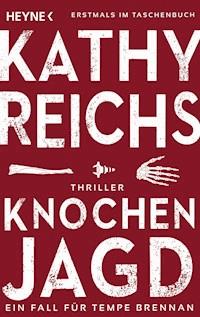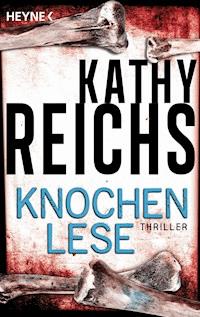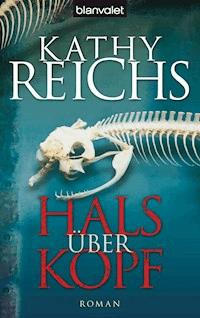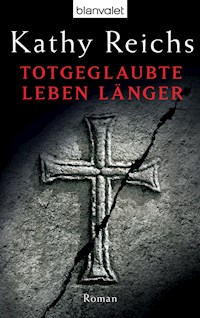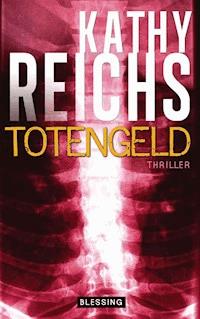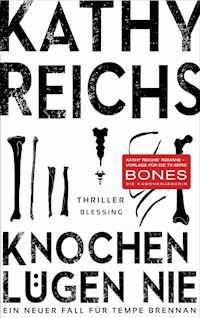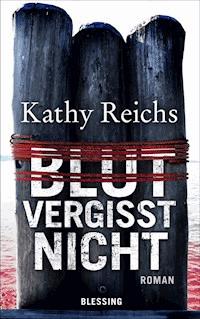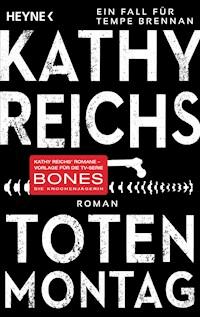
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Tempe-Brennan-Romane
- Sprache: Deutsch
Was könnte frostiger sein als ein kanadischer Wintersturm? Tempe Brennan, Forensikerin in Montreal, wird an einem tristen Montagmorgen zu einem Fundort gerufen, der ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt. Verscharrt in einem Kellergewölbe liegen die Leichen dreier junger Frauen. Nicht eine Gewebefaser gibt Aufschluss darüber, warum diese Mädchen sterben mussten. Dank akribischer Ermittlungen und weiblicher Intuition kommt Tempe einem Verdächtigen auf die Spur. Doch sie muss auf alles gefasst sein, denn ihr Gegner ist an Kaltblütigkeit nicht zu übertreffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
»Monday, Monday, can’t trust that day…« Mit dieser Melodie im Ohr steigt Tempe Brennan in den Keller einer schmierigen Pizzeria hinab, und mit jedem Schritt sinkt ihre Laune weiter auf das Niveau der subarktischen Temperaturen. Unten angekommen verfliegt ihr morgendlicher Missmut jedoch schlagartig und weicht Entsetzen. Denn hier liegen, von einer dünnen Erdschicht bedeckt, die Skelette dreier Mädchen. Außer ein paar antiken Schmuckstücken finden sich keinerlei Hinweise. Ihr Gespür sagt Tempe jedoch, dass es sich hier nicht um eine Aufgabe für Archäologen handelt. Leider hält Luc Claudel, zuständiger Beamter der Mordkommission, weder viel von weiblicher Intuition noch von Brennans Untersuchungen und legt den Fall zu den Akten. Wider die männliche Ignoranz stellt Tempe ihre eigenen Nachforschungen an. Zusammen mit Detective Ryan, auf den zumindest in beruflicher Hinsicht Verlass ist, und dank neuester Messverfahren gelingt der Kriminologin der Durchbruch: Die drei Frauen wurden nicht etwa vor ewigen Zeiten beerdigt, sondern erst vor ein paar Jahren ermordet. Wenig später wird Brennans Wohnung verwüstet, und ihre beste Freundin Anne, auf Besuch aus den USA, verschwindet spurlos. Soll sie selbst das nächste Opfer des Unbekannten werden?
Was Kälte wirklich bedeutet, erfährt Tempe, als sie ihren Gegner in einem düsteren Haus abseits des weihnachtlichen Glanzes der Stadt stellt. Was sie dort erwartet, lässt ihr das Blut in den Adern gefrieren, und sie muss all ihren Mut aufbringen, damit ihr verflixter siebter Fall nicht ihr letzter bleibt.
Autorin
Kathy Reichs, 1950 in Chicago geboren, arbeitet als forensische Anthropologin an den gerichtsmedizinischen Instituten in Montreal und Charlotte, North Carolina, als Gutachterin für die Vereinten Nationen und das US-Verteidungsministerium und unterrichtet an der FBI-Akademie in Quantico,Virginia. Bereits ihr erster Roman »Tote lügen nicht« wurde in 15 Sprachen übersetzt – ein großer internationaler Erfolg, den sie zuletzt mit dem Roman »Knochenlese« sogar noch steigern konnte. Soeben erschien Tempe Brennans neunter Fall »Hals über Kopf« und steht seitdem wochenlang auf den Spitzenplätzen der Spiegel-Bestsellerliste.
Inhaltsverzeichnis
Für Deborah Miner, meine kleine Schwester. Meine Harry.
Danke, dass du immer für mich da bist.
Oh Monday mornin’ you gave me no warnin’of what was to be …
John Phillips, The Mamas and the Papas
1
Monday, Monday …Can’t trust that day …
Diese Melodie spielte eben in meinem Kopf, als in dem engen unterirdischen Raum, in dem ich mich befand, ein Schuss knallte.
Mit weit aufgerissenen Augen sah ich, wie nur einen Meter von mir entfernt Muskeln, Knochen und Eingeweide gegen Fels klatschten.
Einen Augenblick lang wirkte der verstümmelte Körper wie festgeklebt und glitt dann, eine Spur aus Blut und Haaren hinter sich her ziehend, nach unten.
Obwohl ich noch immer kauerte, wirbelte ich herum.
»Assez!« Das reicht!
Sergeant-détective Luc Claudels Brauen zogen sich zu einem V zusammen. Er senkte seine Neun-Millimeter, steckte sie aber nicht in den Halfter.
»Ratten. Diese Teufelsbrut.« Claudels Französisch war abgehackt und nasal, was seine Herkunft aus einem Ort ein Stückchen flussaufwärts verriet.
»Werfen Sie Steine«, blaffte ich.
»Dieser Mistkerl war groß genug, um sie zurückzuwerfen.«
Das stundenlange Kauern in Kälte und Feuchtigkeit an einem Dezembermontag in Montreal forderte jetztseinen Tribut. Meine Knie protestierten, als ich mich aufrichtete.
»Wo ist Charbonneau?«, fragte ich, während ich zuerst einen gestiefelten Fuß drehte und dann den anderen.
»Befragt den Besitzer. Ich wünsche ihm viel Glück. Der Trottel hat den IQ von Erbsensuppe.«
»Der Besitzer hat das hier entdeckt?« Ich deutete auf den Boden hinter mir.
»Non. Le plombier.«
»Was hatte der Klempner denn im Keller zu tun?«
»Das Genie hat neben der Kloschüssel eine Falltür entdeckt und beschlossen, eine Expedition in den Untergrund zu starten, um sich mit den Abwasserrohren vertraut zu machen.«
Ich dachte an meinen eigenen Abstieg über die wackelige Treppe und fragte mich, warum jemand dieses Risiko auf sich nehmen sollte.
»Die Knochen lagen auf der Erde?«
»Er sagte, er sei über etwas gestolpert, das aus dem Boden ragte. Dort.«
Claudel deutete mit dem Kinn auf eine flache Senke direkt vor der Südwand. »Hat es rausgezogen. Und dem Besitzer gezeigt. Und gemeinsam waren sie dann in der örtlichen Bücherei, um in der Anatomiesammlung nachzuschauen, ob der Knochen von einem Menschen stammen könnte. Haben sich ein Buch mit schönen bunten Bildern geholt, vermutlich weil sie nicht lesen können.«
Ich wollte eben weiter nachfragen, als über uns etwas klickte. Claudel und ich schauten hoch, weil wir seinen Partner erwarteten.
Anstelle von Charbonneau sahen wir eine Vogelscheuche von einem Mann in einem knielangen Pullover, ausgebeulten Jeans und schmutzig blauen Nikes. Ringelschwänzchen quollen unter einem roten Kopftuch hervor.
Der Mann kauerte in der Tür und zielte mit einer Wegwerf-Kodak auf mich.
Claudels V wurde noch tiefer und seine Papageiennase noch dunkelroter. »Tabernac!«
Es klickte noch zweimal, dann krabbelte der Mann mit dem Kopftuch zur Seite.
Claudel steckte seine Halbautomatik in den Halfter und legte die Hand auf das hölzerne Geländer. »Bis die SIJ kommt, werfen Sie Steine.«
SIJ – Section d’Identité Judiciaire. So nennt man in Quebec die Spurensicherung.
Ich sah zu, wie Claudels perfekt gewandeter Hintern durch die kleine rechteckige Öffnung verschwand. Obwohl es mich reizte, warf ich keinen einzigen Stein.
Oben gedämpfte Stimmen, das Poltern von Stiefeln. Hier unten nur das Summen des Generators für die Scheinwerfer.
Mit angehaltenem Atem lauschte ich den Schatten um mich herum.
Kein Quieken. Kein Scharren. Kein Pfotengetrippel.
Ich schaute mich schnell um.
Keine Knopfaugen. Keine nackten, schuppigen Schwänze.
Die kleinen Mistkerle formierten sich wahrscheinlich gerade für eine weitere Offensive.
Auch wenn ich Claudels Problemlösungsstrategie nicht guthieß, in einer Sache stimmte ich mit ihm überein. Ich konnte gut ohne die Nager auskommen.
Froh, dass ich für den Augenblick allein war, konzentrierte ich mich wieder auf die modrige Kiste zu meinen Füßen. Dr. Energy’s Power Tonic.Todmüde? Dr. Energy’s bringt deine Knochen zum Tanzen.
Diese Knochen nicht mehr, Doc.
Ich starrte den grausigen Inhalt der Kiste an.
Der Großteil des Skeletts war zwar noch mit Dreck verkrustet, doch einige Knochen waren bereits sauber gebürstet. Ihre Oberfläche wirkte im harten Licht der Strahler kastanienbraun. Ein Schlüsselbein. Rippen. Ein Becken.
Ein menschlicher Schädel.
Verdammt.
Auch wenn ich es schon ein halbes Dutzend Mal gesagt hatte, konnte eine Wiederholung nicht schaden. Ich war einen Tag früher von Charlotte nach Montreal gekommen, um mich auf eine Gerichtsverhandlung am Dienstag vorzubereiten. Ein Mann war angeklagt, seine Frau ermordet und zerstückelt zu haben. Ich sollte die Sägespurenanalyse erläutern, die ich an ihrem Skelett vorgenommen hatte. Die Materie war kompliziert, und ich hatte meine Unterlagen noch einmal durchgehen wollen. Stattdessen fror ich mir hier im Keller einer Pizzabäckerei den Arsch ab.
Schon früh an diesem Morgen hatte Pierre LaManche mich in meinem Büro besucht. Ich kannte diese Miene und wusste daher sofort, was auf mich zukam.
Im Keller eines Pizza-Straßenverkaufs habe man Knochen gefunden, sagte mein Chef. Der Besitzer habe die Polizei gerufen. Die Polizei habe den Coroner gerufen, den Leichenbeschauer also. Der Coroner habe das Gerichtsmedizinische Institut angerufen.
LaManche wollte, dass ich der Sache nachging.
»Heute?«
»S’il vous plaît.«
»Ich muss morgen in den Zeugenstand.«
»Der Pétit-Prozess?«
Ich nickte.
»Die Überreste sind wahrscheinlich die eines Tiers«, sagte LaManche in seinem präzisen Pariser Französisch. »Es sollte nicht lange dauern.«
»Wo?« Ich griff nach einem Notizblock.
LaManche las die Adresse von dem Zettel in seiner Hand ab. Rue Ste. Catherine, einige Blocks östlich des Centre-ville.
CUM-Revier.
Claudel.
Der Gedanke, mit Claudel arbeiten zu müssen, war der Grund für das erste »Verdammt« dieses Vormittags gewesen.
Es gibt einige kleinstädtische Dienststellen in der Umgebung der Inselstadt Montreal, aber die beiden Hauptakteure bei der Strafverfolgung sind die SQ und die CUM. La Sûreté du Québec ist die Provinzbehörde. Die SQ hat auf dem flachen Land das Sagen und in Orten, die keine eigene städtische Dienststelle haben. Die Police de la Communauté Urbaine de Montreal, oder CUM, ist die Großstadtpolizei. Die Insel gehört der CUM.
Luc Claudel und Michel Charbonneau sind Detectives bei der Abteilung Schwerverbrechen der CUM. Als forensische Anthropologin für die Provinz Quebec habe ich im Lauf der Jahre mit beiden gearbeitet. Mit Charbonneau war es immer ein Vergnügen. Luc Claudel ist zwar ein guter Polizist, hat aber die Geduld eines Knallfrosches, das Einfühlungsvermögen von Vlad dem Pfähler und eine beharrliche Skepsis, was den Wert der forensischen Anthropologie angeht.
Schicke Garderobe, zugegeben.
Dr. Energy’s Kiste war bereits voller Knochen gewesen, als ich zwei Stunden zuvor hier im Keller angekommen war. Obwohl Claudel mir viele Details erst noch liefern musste, nahm ich an, dass der Besitzer der Knochensammler gewesen war, vielleicht mit der Unterstützung des glücklosen Klempners. Meine Aufgabe war es gewesen, zu bestimmen, ob die Überreste menschlichen Ursprungs waren.
Sie waren es.
Diese Feststellung hatte zum zweiten »Verdammt« dieses Morgens geführt.
Meine nächste Aufgabe war es gewesen, herauszufinden, ob in der Ruhestätte unter dem Kellerboden sonst noch jemand lag. Dazu hatte ich drei Erkundungstechniken benutzt.
Ein schräges Ableuchten des Kellerbodens mit einer Taschenlampe hatte Vertiefungen im Erdreich gezeigt. Behutsames Stochern mit einer Sonde hatte Widerstände unter jeder Vertiefung ergeben, was auf Objekte unter der Oberfläche hindeutete. Versuchsgrabungen hatten menschliche Knochen an den Tag gebracht.
Das hatte die Aussichten auf ein entspanntes Durchsehen der Pétit-Akten dramatisch verschlechtert.
Claudel und Charbonneau hatten mit »Verdammt« Nummer drei bis fünf reagiert, als sie meine Einschätzung hörten. Zur Verstärkung hatten sie noch ein paar Quebecer Flüche hinzugefügt.
Wir hatten die SIJ gerufen. Die Spurensicherungsroutine lief an. Scheinwerfer wurden aufgestellt. Fotos wurden geschossen. Während Claudel und Charbonneau den Besitzer und seinen Gehilfen befragten, wurde ein Bodendurchdringungsradar durch den Keller gezogen. Das BDR zeigte Störungen, die in etwa zehn Zentimeter Tiefe in jeder der beiden Senken begannen. Ansonsten war der Keller sauber.
Während Claudel mit seiner Halbautomatik den Rattenfänger spielte, machten die SIJ-Techniker Pause, und ich baute zwei simple, quadratische Gitternetze. Ich band eben die letzte Schnur an den letzten Pflock, als Claudel seine Rambo-Nummer mit den Ratten abzog.
Und jetzt? Warten, bis die Spurensicherung zurückkommt?
Bestimmt.
Mit der Foto- und Videoausrüstung der SIJ fotografierte und filmte ich. Dann rieb ich mir Durchblutung in die Hände, zog meine Handschuhe wieder an und begann, im Planquadrat 1-A mit einer Kelle Erde abzutragen.
Beim Graben überkam mich die gewohnte Tatortanspannung. Die geschärften Sinne. Die intensive Neugier. Was, wenn es nichts ist? Was, wenn es doch etwas ist?
Die Ängstlichkeit.
Was, wenn ich grundlegend wichtiges Material zu Krümeln trete?
Ich dachte an andere Ausgrabungen. Andere Tote. Ein Möchtegern-Heiliger in einer ausgebrannten Kirche. Ein kopfloser Teenager in einer Biker-Bude. Von Kugeln durchsiebte Junkies in einem Grab an einem Bachufer.
Ich weiß nicht, wie lange ich schon grub, als das Spurensicherungsteam zurückkehrte. Der Größere der beiden hatte einen Styroporbecher in der Hand. Ich versuchte, mich an seinen Namen zu erinnern.
Wurzel. Racine. Lang und dünn wie eine Wurzel. Meine Eselsbrücken funktionierten.
René Racine. Netter Kerl. Wir hatten schon eine Hand voll Tatorte miteinander bearbeitet. Sein kleinerer Partner war Pierre Gilbert. Ich kannte ihn schon ein Jahrzehnt.
Während ich an lauwarmem Kaffee nippte, erläuterte ich, was ich in ihrer Abwesenheit getan hatte. Dann bat ich Gilbert, zu filmen und den Abraum in Eimern wegzutragen, und Racine, zu sieben.
Zurück zum Gitternetz.
Nachdem ich in 1-A gut sieben Zentimeter abgetragen hatte, wandte ich mich 1-B zu. Dann 1-C und 1-D.
Nichts als Erde.
Okay. Das BDR zeigte eine Abweichung, die in zehn Zentimeter Tiefe begann.
Ich grub weiter.
Meine Finger und Zehen wurden taub. Ich fror bis ins Mark. Ich verlor jedes Zeitgefühl.
Gilbert trug Eimer mit Erde von meinem Gitternetz zum Sieb. Racine warf die Erde durch die Maschen. Hin und wieder machte Gilbert ein Foto. Als ich das gesamte erste Gitternetz etwa sieben Zentimeter tief abgetragen hatte, fing ich wieder bei Planquadrat 1-A an. Bei einer Tiefe von fünfzehn Zentimetern wechselte ich zum nächsten Planquadrat.
Ich hatte gerade zweimal in Planquadrat 1-B gekratzt, als mir eine farbliche Veränderung des Erdreichs auffiel. Ich bat Gilbert, einen Scheinwerfer neu auszurichten.
Ein Blick, und mein Blutdruck schnellte in die Höhe.
»Bingo.«
Gilbert kauerte sich neben mich. Racine kam ebenfalls dazu.
»Quoi?«, fragte Gilbert. Was?
Ich fuhr mit der Spitze meiner Kelle um den Klecks, der in 1-B einsickerte.
»Die Erde ist dunkler«, bemerkte Racine.
»Verfärbung deutet auf Zersetzung hin«, erläuterte ich.
Beide Techniker starrten mich an.
Ich zeigte auf die Planquadrate 1-C und 1-D. »Irgendjemand oder irgendetwas geht dort unten den Weg alles Irdischen.«
»Soll ich Claudel Bescheid sagen?«, fragte Gilbert.
»Der freut sich bestimmt.«
Vier Stunden später waren meine Hände und Füße steif gefroren. Obwohl ich eine Zipfelmütze auf dem Kopf und einen Schal um den Hals hatte, zitterte ich in meinem superabsorbierenden, isolierbeschichteten Mikrofaser-Parka, für den Kanuk eigentlich Schutz bis zu einer Temperatur von minus vierzig Grad garantierte.
Gilbert ging im Keller herum und fotografierte und filmte aus verschiedenen Blickwinkeln. Racine schaute zu, die behandschuhten Hände unter die Achseln geklemmt. Beide schienen sich in ihren arktistauglichen Overalls ziemlich behaglich zu fühlen.
Die beiden Detectives, Claudel und Charbonneau, standen nebeneinander, die Füße gespreizt, die Hände vor den Genitalien gefaltet. Beide trugen schwarze Wollmäntel und schwarze Lederhandschuhe. Aber keiner machte ein fröhliches Gesicht.
Acht tote Ratten zierten die Wände.
Die Grube des Klempners und die beiden Vertiefungen waren bis zu einer Tiefe von sechzig Zentimetern abgegraben. Erstere hatte noch einige verstreute Knochen preisgegeben, die der Klempner und der Besitzer übersehen hatten. Die beiden anderen Löcher erzählten eine ganz andere Geschichte.
Das Skelett unter Gitternetz eins lag in Fötalhaltung da. Es war unbekleidet, im Sieb war kein einziges Artefakt aufgetaucht.
Die Person unter Gitternetz zwei war vor dem Vergraben eingewickelt und verschnürt worden. Die Teile, die wir sehen konnten, wirkten ebenfalls völlig skelettiert.
Nachdem ich die letzten Erdpartikel von dem Bündel gebürstet hatte, legte ich meinen Pinsel weg, stand auf und stampfte mit den Füßen, um sie aufzutauen.
»Ist das eine Decke?« Charbonneaus Stimme klang heiser vor Kälte.
»Sieht eher aus wie Leder«, sagte ich.
Er deutete mit dem Daumen auf Dr. Energy’s Patienten.
»Ist das der Rest von dem Kerl in der Kiste?«
Sergeant-détective Michel Charbonneau stammte aus Chicoutimi, einer Stadt sechs Stunden den St. Lawrence flussaufwärts in einer Region, die als Saguenay bekannt war. Bevor er zur CUM kam, hatte er mehrere Jahre auf den Ölfeldern im westlichen Texas gearbeitet. Stolz auf seine Cowboy-Jugend, sprach Charbonneau mit mir immer in meiner Muttersprache. Sein Englisch war gut, auch wenn er manchmal die falschen Silben betonte und seine Formulierungen so mit Slang durchsetzt waren, dass man einen Zehn-Gallonen-Stetson damit hätte füllen können.
»Wollen wir’s hoffen.«
»Sie hoffen es?« Eine kleine Atemwolke wehte aus Claudels Mund.
»Ja, Monsieur Claudel. Ich hoffe es.«
Claudel kniff die Lippen zusammen, blieb aber stumm.
Als Gilbert genügend Fotos von den verpackten Überresten geschossen hatte, kniete ich mich hin und zupfte an einer Ecke des Leders. Es riss.
Ich ersetzte meine warmen Wollfäustlinge durch Gummihandschuhe, beugte mich wieder über das Bündel und machte mich daran, eine Ecke abzulösen, dann behutsam die Schichten zu trennen, anzuheben und aufzurollen.
Nachdem ich die obere Schicht komplett nach links abgewickelt hatte, machte ich mich an die untere. An einigen Stellen hafteten Fasern am Knochen. Vor Kälte und Nervosität zitternd, löste ich mit dem Skalpell verfaultes Leder vom darunter liegenden Knochen.
»Was ist das weiße Zeug?«, fragte Racine.
»Adipocire.«
»Adipocire?«, wiederholte er.
»Leichenwachs«, antwortete ich, obwohl ich nicht in der Stimmung für eine Chemiestunde war. »Fettsäuren und Kalziumseifen aus Muskel- oder Fettgewebe, die eine chemische Veränderung durchmachen, normalerweise nach einer langen Verweildauer in der Erde oder im Wasser.«
»Warum ist das nicht auch auf dem anderen Skelett?«
»Weiß ich nicht.«
Ich hörte, wie Claudel Luft durch die Lippen blies. Ich ignorierte ihn.
Fünfzehn Minuten später hatte ich die untere Schicht vollständig abgelöst und ausgebreitet, und das Skelett lag nun frei vor uns.
Der Schädel war zwar beschädigt, aber unübersehbar vorhanden.
»Drei Köpfe, drei Personen.« Charbonneau stellte das Offensichtliche fest.
»Tabernouche«, sagte Claudel.
»Verdammt«, sagte ich.
Gilbert und Racine blieben stumm.
»Irgendeine Idee, was wir hier haben, Doc?«, fragte Charbonneau.
Ich richtete mich ächzend auf. Acht Augen folgten mir zu Dr. Energy’s Kiste.
Nacheinander holte ich die beiden Beckenhälften und den Schädel heraus und untersuchte sie.
Dann ging ich zum ersten Loch, kniete mich hin und entnahm und untersuchte dieselben Skelettteile.
O Gott.
Ich legte diese Knochen wieder zurück, kroch zum zweiten Loch, kniete mich darüber und betrachtete die Schädelfragmente.
Nein. Nicht schon wieder. Die universellen Opfer.
Behutsam löste ich die rechte Beckenhälfte.
Atemwolken blähten sich vor fünf Gesichtern.
Ich ging in die Hocke und bürstete Erde von der Schambeinfuge.
Und spürte, wie es kalt wurde in meiner Brust.
Drei Frauen. Fast noch Mädchen.
2
Als ich am Dienstagmorgen zum Wetterbericht aufwachte, wusste ich, dass mich eine mörderische Kälte erwartete. Nicht die feucht-kühlen zehn Grad plus, über die wir in North Carolina im Januar gelegentlich jammern. Ich meine arktische Kälte im zweistelligen Minusbereich. Kälte nach dem Motto: Hör auf, dich zu bewegen, und du stirbst und wirst von Wölfen gefressen.
Ich liebe Montreal. Ich liebe den gut zweihundertfünfzig Meter hohen Berg, den alten Hafen, Little Italy, Chinatown, das Schwulenviertel, die Stahl- und Glaswolkenkratzer des Centre-ville, die verwinkelten Viertel mit ihren Gassen und Steinhäusern und unmöglichen Treppen.
Montreal ist ein schizoider Raufbold, der beständig mit sich selbst über Kreuz ist. Anglophon gegen frankophon. Separatistisch gegen föderalistisch. Katholisch gegen protestantisch. Alt gegen neu. Ich genieße den kulinarischen Multikulturalismus der Stadt: Empanada, Falafel, Poutin, Kong Pao. Hurley’s Irish Pub, Katsura, L’Express, Fairmont Bagel, Trattoria Trastevere.
Ich nehme teil an der endlosen Reihe von Festivals in dieser Stadt, Le Festival International de Jazz, Les Fêtes Gourmandes Internationales, Le Festival des Films du Monde, das Käferkosten-Festival im Insektarium. Ich kaufe ein in den Läden an der Ste. Catherine, auf den Freiluftmärkten an der Jean-Talon und der Atwater, in den Antiquitätenläden an der Notre-Dame. Ich besuche Museen, mache Picknicks in den Parks, fahre auf den Wegen am Canal Lachine Fahrrad. Ich genieße das alles.
Was ich nicht genieße, ist das Klima von November bis Mai.
Eins muss ich zugeben. Ich habe zu lange im Süden gelebt. Ich friere nicht gern. Ich habe keine Geduld mit Eis und Schnee. Behaltet eure Stiefel und euer Labello und die Eishotels. Was ich brauche, sind Shorts und Sandalen und Lichtschutzfaktor dreißig.
Mein Kater, Birdie, teilt diese Meinung. Als ich mich aufsetzte, stand auch er auf, machte einen Buckel und vergrub sich dann wieder unter der Decke. Mit einem Lächeln sah ich, wie sein Körper sich zu einer dichten, runden Masse zusammenrollte. Birdie, mein einziger und treuer Zimmergenosse.
»Ich kann dich gut verstehen, Bird«, sagte ich und schaltete den Radiowecker aus.
Der Kater rollte sich noch enger zusammen.
Ich schaute mir die Ziffern an. Halb sechs.
Ich schaute zum Fenster. Pechschwarz.
Ich rannte ins Bad.
Zwanzig Minuten später saß ich am Küchentisch, die Kaffeetasse am Ellbogen, die Pétit-Akte vor mir.
Marie-Reine Pétit war eine zweiundvierzig Jahre alte Mutter von drei Kindern, die in einer boulangerie als Brotverkäuferin arbeitete. Vor zwei Jahren war sie verschwunden. Vier Monate später fand man Marie-Reines verwesten Torso in einer Eishockey-Tasche in einem Lagerschuppen hinter dem Haus der Pétits. Marie-Reines Gliedmaßen und der Kopf waren in dazu passenden Gepäckstücken verstaut.
Bei einer Durchsuchung wurden in Pétits Keller eine Laub-, eine Bügelsäge und ein Fuchsschwanz gefunden. Ich hatte die Sägespuren auf Marie-Reines Knochen untersucht, um festzustellen, ob eine Säge ähnlich einer der des Gatten diese Spuren verursacht hatte. Volltreffer bei der Bügelsäge. Rejean Pétit stand jetzt vor Gericht wegen des Mordes an seiner Gattin.
Zwei Stunden und drei Kaffees später schob ich meine Fotos zusammen und las mir noch einmal die Vorladung durch.
De comparaître personnellement devant la Cour du Québec,chambre criminelle et pénale, au Palais de Justice de Montréal,à 09:00 heures, le 3 décembre …
O Mann. Ich werde persönlich zur Aussage vorgeladen. Das ist ungefähr so persönlich wie eine Vorladung zur Steuerprüfung. U.A.w.g. erübrigt sich.
Ich notierte mir den Gerichtssaal.
Dann zog ich Stiefel und Parka an, nahm Handschuhe, Mütze und Schal, schaltete die Alarmanlage ein und fuhr in die Garage hinunter. Birdie musste sich erst noch entrollen. Offensichtlich hatte meine Katze schon vor Morgengrauen ein Frühstück genossen.
Mein alter Mazda sprang gleich beim ersten Mal an. Ein gutes Omen.
Oben auf der Rampe der Tiefgarage bremste ich zu heftig und schlitterte quer auf die Straße wie ein Kind auf einer Wasserrutsche. Schlechtes Omen.
Stoßzeit. Die Straßen waren verstopft, jedes Fahrzeug schleuderte Schneematsch hoch. Die frühmorgendliche Sonne machte Milchglas aus meiner mit Salz verkrusteten Windschutzscheibe. Obwohl ich immerzu spritzte und die Wischer betätigte, fuhr ich streckenweise blind. Schon nach wenigen Blocks bereute ich, dass ich kein Taxi genommen hatte.
Im späten sechzehnten Jahrhundert lebte eine Gruppe Lawrence-Irokesen in einem Dorf, das sie Hochelaga nannten und das zwischen einem kleinen Berg und einem großen Strom, knapp unterhalb einer Reihe mächtiger Wasserfälle, lag. 1642 kamen dort französische Missionare und Abenteurer an und blieben auch. Die Franzosen nannten ihren Außenposten Ville-Marie.
Im Lauf der Jahre kamen die Bewohner von Ville-Marie zu Wohlstand, sie bauten und pflasterten. Das Dorf nahm den Namen des Berges hinter ihm an, Mont Réal. Der Fluss wurde St. Laurent getauft.
Hallo, Europäer. Tschüs, einheimische Völker.
Heute ist die Gegend des ehemaligen Hochelaga-Ville-Marie als Vieux-Montréal bekannt. Touristen lieben das Viertel.
Das alte Montreal, das sich vom Fluss aus den Hügel hoch erstreckt, verströmt Heimeligkeit. Gaslaternen. Pferdekutschen. Straßenverkäufer und -cafés. Die soliden Steinhäuser, in denen einst die Kolonisten wohnten, die Pferdeställe, Werkstätten und Lagerhäuser sind heute Museen, Boutiquen, Galerien und Restaurants. Die Straßen sind schmal und gepflastert.
Und bieten einem keine Möglichkeit zum Parken.
Ich verfluchte mich noch einmal, weil ich kein Taxi genommen hatte, stellte mein Auto auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz ab und ging den Boulevard St. Laurent zum Palais de Justice hoch. Der Justizpalast, mit der Adresse 1 Rue Notre-Dame est, liegt am nördlichen Rand des historischen Viertels. Salz knirschte unter meinen Sohlen. Der Atem gefror auf meinem Schal. Tauben blieben eng zusammengedrängt sitzen, wenn ich vorbeiging, die kollektive Körperwärme war ihnen wichtiger als die Sicherheit einer Flucht.
Unterwegs dachte ich an die Skelette im Pizzakeller. Würden sich die Knochen wirklich als die von toten Mädchen erweisen? Ich hoffte nicht, aber tief drinnen wusste ich bereits Bescheid.
Ich dachte auch an Marie-Reine Pétit und trauerte um ein Leben, das durch unaussprechliche Bosheit beendet wurde. Ich fragte mich, wie es den Pétit-Kindern wohl ging. Der Vater im Gefängnis, weil er die Mutter ermordet hatte. Würden diese Kinder sich je wieder erholen, oder hatte das Grauen, das sie überfallen hatte, sie irreparabel geschädigt?
Im Vorübergehen schaute ich mir kurz die McDonald’s-Filiale auf der anderen Seite des St. Laurent an, die dem Palais de Justice direkt gegenüber lag. Die Besitzer hatten einen Versuch mit dem Kolonialstil gewagt. Die Torbögen hatten sie entfernt, dafür aber blaue Markisen aufgespannt. Eigentlich funktionierte es nicht, aber sie hatten sich wenigstens bemüht.
Die Erbauer des Montrealer Gerichtsgebäudes hatten sich mit architektonischer Harmonisierung nicht lange aufgehalten. Die mittleren Stockwerke waren ein rechteckiger Kasten mit vertikalen schwarzen Stangen über einem kleineren Kasten mit Glasfront. Die oberen Stockwerke ragten als gesichtloser Monolith in den Himmel. Das Gebäude passte in seine Umgebung wie ein Humvee, der in einer Amish-Kolonie parkt.
Das Palais war gesteckt voll, als ich es betrat. Alte Damen in knöchellangen Pelzmänteln. Gangsta-Teens in Klamotten, die groß genug für ganze Armeen waren. Männer in Anzügen. Anwälte und Richter in schwarzen Roben. Die einen warteten. Die anderen eilten hin und her. Ein Dazwischen schien es nicht zu geben.
Mich zwischen großen Topfpflanzen und Säulen mit vielfarbigen Strahlern hindurchschlängelnd, ging ich zu den Aufzügen am hinteren Ende der Eingangshalle. Kaffeeduft wehte aus dem Café Vienne herüber. Ich überlegte kurz, doch da ich bereits aufgedreht genug war, verzichtete ich auf eine vierte Tasse.
Oben präsentierte sich ein ähnliches Bild, allerdings überwogen hier die Wartenden. Die Leute saßen auf Bänken aus rotem Lochblech, lehnten an den Wänden oder standen in Gruppen zusammen und unterhielten sich leise. Einige berieten sich mit Anwälten in kleinen Befragungszimmern entlang des Korridors. Keiner sah besonders glücklich aus.
Ich suchte mir einen Platz vor 4.01 und zog die Pétit-Akte aus meiner Mappe. Zehn Minuten später kam Louise Cloutier aus dem Gerichtssaal. Mit den langen blonden Haaren und der übergroßen Brille wirkte die Staatsanwältin wie eine Siebzehnjährige.
»Sie sind meine erste Zeugin.« Cloutiers Gesicht war angespannt.
»Ich bin bereit«, sagte ich.
»Ihre Aussage wird entscheidend sein.«
Cloutiers Finger malträtierten eine Büroklammer. Sie hatte sich eigentlich tags zuvor mit mir treffen wollen, aber die Geschichte im Pizzakeller hatte das verhindert. Unser spätabendliches Telefongespräch hatte ihr dann nicht den Grad an Vorbereitung gebracht, den sie sich gewünscht hätte. Ich versuchte, sie zu beruhigen.
»Ich kann die Spuren an den Knochen nicht eindeutig mit Pétits spezieller Bügelsäge in Verbindung bringen, aber ich kann sehr entschieden sagen, dass sie mit einem identischen Werkzeug beigebracht wurden.«
Cloutier nickte. »Vereinbar mit.«
»Vereinbar mit«, pflichtete ich ihr bei.
»Ihre Aussage wird der Schlüssel sein, weil Pétit in seiner ursprünglichen Aussage behauptete, er hätte diese Säge nie gesehen. Eine Analytikerin aus Ihrem Labor wird aussagen, dass sie den Griff der Säge entfernt und am Schraubgewinde winzige Blutspuren entdeckt hat.« Das alles wusste ich schon aus unserem Gespräch vom letzten Abend. Cloutier rekapitulierte den Fall ebenso sehr für sich wie für mich.
»Ein DNS-Experte wird aussagen, dass das Blut von Pétit stammt. Das bringt ihn mit der Säge in Verbindung.«
»Und ich bringe die Säge mit dem Opfer in Verbindung.«
Cloutier nickte. »Der Richter ist ein richtiger Korinthenkacker, was Expertengutachter angeht.«
»Sind sie das nicht alle?«
Cloutier warf mir ein nervöses Lächeln zu. »Der Gerichtsdiener wird Sie in ungefähr fünf Minuten aufrufen.«
Es wurden dann eher zwanzig.
Der Gerichtssaal war ein nichts sagender, modern gehaltener Raum. Graue Strukturtapete an den Wänden. Grau strukturierter Teppichboden. Grau strukturierte Sitzbezüge auf langen, an den Boden geschraubten Bänken. Die einzigen Farbakzente befanden sich in der Saalmitte, innerhalb der Schranken, die die Zuschauer von den offiziellen Prozessbeteiligten trennten. Die roten, gelben und braunen Bezüge der Sessel der Anwälte. Das Blau, Rot und Weiß der Quebecer und der kanadischen Flagge.
Ungefähr ein Dutzend Leute saß auf den Zuschauerbänken. Augen folgten mir, als ich den Mittelgang entlangging und im Zeugenstand Platz nahm. Der Richter saß ein Stückchen links vor mir, die Jury mir direkt gegenüber. Monsieur Pétit war rechts von mir.
Ich habe schon oft vor Gericht ausgesagt. Ich habe mich Männern und Frauen gegenübergesehen, denen monströse Verbrechen vorgeworfen wurden. Mord. Vergewaltigung. Folter. Zerstückelung. Und bis jetzt war ich immer ein bisschen enttäuscht von den Angeklagten.
Auch dieser war keine Ausnahme. Rejean Pétit sah gewöhnlich aus. Er wirkte beinahe schüchtern. Der Mann hätte mein Onkel Frank sein können.
Der Gerichtsdiener nahm mir den Eid ab. Cloutier erhob sich und fing an, mich vom Tisch der Staatsanwaltschaft aus zu befragen.
»Bitte nennen Sie Ihren vollen Namen.«
»Temperance Deasee Brennan.«
Wir sprachen in Mikrofone, die von der Decke hingen, und unsere Stimmen waren die einzigen Geräusche im Saal.
»Was sind Sie von Beruf?«
»Ich bin forensische Anthropologin.«
»Wie lange üben Sie diesen Beruf schon aus?«
»Ungefähr zwanzig Jahre.«
»Wo üben Sie diesen Beruf aus?«
»Ich bin ordentliche Professorin an der University of North Carolina in Charlotte. Ich bin forensische Anthropologin der Provinz Quebec beim Laboratoire de Sciences Judiciaires et de Médecine Légale in Montreal und des Staates North Carolina beim Office of the Chief Medical Examiner in Chapel Hill.«
»Sie sind amerikanische Staatsbürgerin?«
»Ja. Ich habe eine kanadische Arbeitserlaubnis. Ich pendle zwischen Montreal und Charlotte.«
»Wie kommt es, dass eine Amerikanerin als forensische Anthropologin für eine kanadische Provinz arbeitet?«
»Es gibt keinen kanadischen Staatsbürger, der in diesem Bereich eine staatliche Zulassung besitzt und fließend Französisch spricht.«
»Zur Frage der staatlichen Zulassung kommen wir noch. Bitte sagen Sie uns, was Sie als berufliche Qualifikationen vorweisen können.«
»Ich besitze einen Bachelor of Arts in Anthropologie der American University in Washington, D. C. Ich besitze einen MA und einen Doktortitel in Biologischer Anthropologie der Northwestern University in Evanston, Illinois.«
Nun folgte eine endlose Reihe von Fragen über mein Aufbaustudium, die Themen meiner Diplom- und Doktorarbeiten, meine Forschungen, meine Stipendien, meine Veröffentlichungen. Wo? Wann? Mit wem? In welchen Fachzeitschriften? Ich dachte, sie würde mich noch nach der Farbe meines Slips am Tag meiner Promotion fragen.
»Haben Sie irgendwelche Bücher veröffentlicht, Dr. Brennan?«
Ich zählte sie auf.
»Gehören Sie irgendwelchen Berufsverbänden an?«
Ich zählte sie auf.
»Haben Sie in diesen Verbänden irgendwelche Ämter bekleidet?«
Ich zählte sie auf.
»Besitzen Sie Zulassungen von irgendwelchen Regulierungsbehörden?«
»Ich besitze die Zulassung des American Board of Forensic Anthropologists.«
»Bitte erklären Sie dem Gericht, was das bedeutet.«
Ich erläuterte den Prozess der Bewerbung, der Prüfung, der Begutachtung durch die Ethikkommission und erklärte die Bedeutung von Zulassungsbehörden für die Feststellung der Kompetenz derjenigen, die sich als Experten anbieten.
»Gibt es, neben den Gerichtsmedizinischen Instituten in Quebec und North Carolina, noch andere Kontexte, in denen Sie Ihren Beruf ausüben?«
»Ich habe für die Vereinten Nationen gearbeitet, für das United States Military Central Identification Laboratory in Honolulu, Hawaii, als Ausbilderin in der FBI Academy in Quantico, Virginia, und als Ausbilderin in der Royal Canadian Mounted Police Training Academy in Ottawa, Ontario. Ich bin Mitglied des United States National Disaster Mortuary Response Team. Gelegentlich berate ich auch private Klienten.«
Die Jury saß bewegungslos da, war entweder fasziniert oder komatös. Pétits Anwalt machte sich keine Notizen.
»Bitte erklären Sie uns, Dr. Brennan: Was macht ein forensischer Anthropologe?«
Ich sprach direkt zur Jury.
»Forensische Anthropologen sind Spezialisten für das menschliche Skelett. Für gewöhnlich, allerdings nicht immer, werden wir von Pathologen zu Fällen hinzugezogen. Unser Fachwissen ist gefragt, wenn eine normale Autopsie, die sich auf die Organe und das Bindegewebe konzentriert, entweder nicht möglich oder sehr eingeschränkt ist und die Knochen untersucht werden müssen, um Antworten auf grundlegende Fragen zu erhalten.«
»Was für Arten von Fragen?«
»Die Fragen betreffen meistens die Identität des Opfers, die Todesart und postmortale Verstümmelungen oder Schädigungen.«
»Wie können Sie bei Fragen der Identität helfen?«
»Durch die Untersuchung des Skeletts kann ich ein biologisches Profil erstellen, das Daten über das Alter, das Geschlecht, die Rasse und die Größe des Verstorbenen enthält. In bestimmten Fällen kann ich anatomische Merkpunkte, die ich an einer unbekannten Person feststelle, mit ähnlichen Merkpunkten vergleichen, die auf prämortalen Röntgenaufnahmen einer bekannten Person zu sehen sind.«
»Werden die meisten Identifikationen denn nicht mit Hilfe von Fingerabdrücken, Zahnstatus oder DNS erreicht?«
»Ja. Aber um medizinische oder dentale Informationen verwenden zu können, ist es zuerst nötig, den Kreis der in Frage kommenden Personen so weit wie möglich einzuschränken. Mit einem anthropologischen Profil kann ein Ermittlungsbeamter Vermisstenlisten durchgehen, Namen herausfiltern und sich dann deren individuelle Unterlagen beschaffen, um sie mit den Daten der geborgenen Überreste zu vergleichen. Oft liefern wir die erste Stufe der Analyse völlig unbekannter Überreste.«
»Wie können Sie bei Fragen bezüglich der Todesart helfen?«
»Durch die Analyse von Bruchmustern kann ein forensischer Anthropologe Ereignisse rekonstruieren, die zu diesen speziellen Verletzungen geführt haben.«
»Welche Arten von Verletzungen untersuchen Sie normalerweise, Dr. Brennan?«
»Verletzungen durch Schüsse. Scharfe Gegenstände. Stumpfe Gegenstände. Strangulation. Aber lassen Sie mich noch einmal darauf hinweisen, dass solche Untersuchungen nur in Fällen angefordert werden, in denen die Leiche so beschädigt ist, dass diese Fragen mit der Untersuchung von Bindegewebe und Organen alleine nicht zu beantworten sind.«
»Was meinen Sie mit beschädigt?«
»Eine Leiche, die verwest, verbrannt, mumifiziert oder skelettiert …«
»Verstümmelt ist?«
»Ja.«
»Vielen Dank.«
Die Jury war sichtlich munterer geworden. Drei Geschworene starrten mich mit weit aufgerissenen Augen an. Eine Frau in der hinteren Reihe hielt sich die Hand vor den Mund.
»Wurden Sie schon früher von den Gerichten der Provinz Quebec als Expertengutachterin zugelassen?«
»Ja. Schon viele Male.«
»Euer Ehren, wir bieten Dr. Temperance Brennan als Expertengutachterin im Bereich der forensischen Anthropologie auf.«
Die Verteidigung erhob keinen Einspruch.
Wir hatten es geschafft.
Gegen Mitte des Nachmittags war Cloutier mit mir fertig. Als der Verteidiger sich erhob, spürte ich, wie mein Magen sich zusammenzog.
Jetzt kommt’s dicke, dachte ich. Tatsachenverdrehungen, Skepsis, generelle Widerlichkeit.
Pétits Anwalt ging methodisch vor und blieb immer höflich.
Und war um fünf fertig.
Wie sich zeigen sollte, war sein Kreuzverhör nichts im Vergleich zu der Widerlichkeit, die ich bei der Beschäftigung mit den Knochen aus dem Pizzakeller noch erleben sollte.
3
Es war dunkel, als ich das Gerichtsgebäude verließ. Weiße Lämpchen funkelten in den Bäumen an der Rue Notre-Dame. Eine Kalesche rumpelte vorbei, die Pferde trugen rote Ohrschützer mit Troddeln und einen Fichtenzweig. Flocken trieben im Licht der falschen Gaslaternen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!