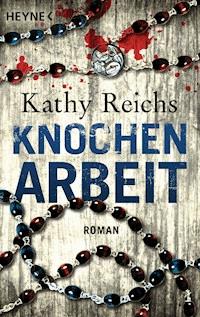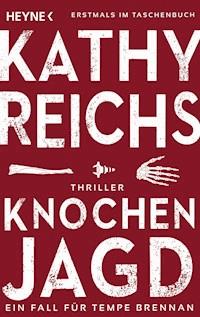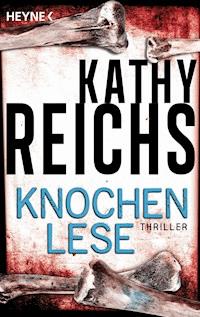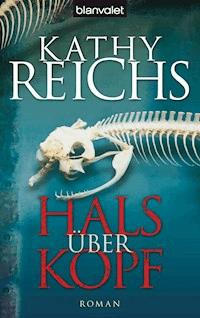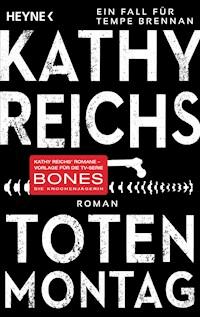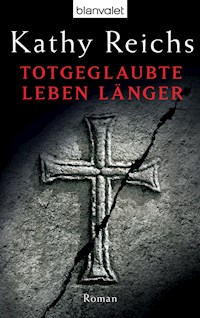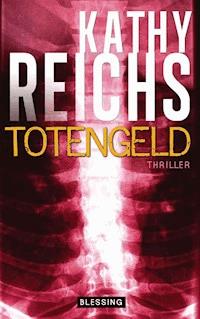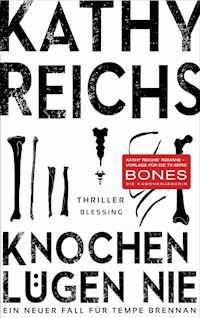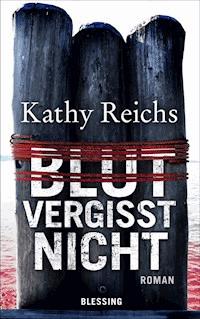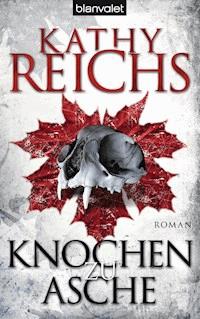9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Tempe-Brennan-Romane
- Sprache: Deutsch
In der drückenden Hitze von Charlotte, North Carolina, erholt sich die forensische Anthropologin Tempe Brennan von einer OP und kämpft mit Migräneanfällen und Albträumen. Da erhält sie eine Reihe von rätselhaften Nachrichten, Fotos von einer Leiche ohne Gesicht und Hände. Wer ist dieser Tote, und warum schickt man ausgerechnet ihr diese Bilder? Um Antworten auf diese und andere Fragen zu finden, muss Tempe den vorgeschriebenen Dienstweg verlassen – ihre neue Vorgesetzte hegt einen tiefen Groll gegen sie und will sie um jeden Preis von dem Fall fernhalten.
Tempe kommt der erstaunlichen Wahrheit allmählich näher – auch dank modernster forensischer Methoden. Doch je mehr sie aufdeckt, desto düsterer und bedrohlicher erscheint das Bild…
- Die Wahrheit stirbt im Dunkeln. Wie weit gehst du, um sie zu retten? Ein neuer Fall für Forensikerin Tempe Brennan.
- »Einer der absolut besten Thriller des Jahres! Sowohl Tempe Brennan als auch Kathy Reichs sind in Höchstform.« (Jeffery Deaver)
- Wer ist der Tote ohne Gesicht auf den Fotos, die ein Unbekannter an Tempe Brennan schickt? Die Forensikerin muss alles geben, um diesen Fall zu lösen.
- »Mit ›Das Gesicht des Bösen‹ stellt Kathy Reichs ein verblüffendes Maß an Schreibgeschick zur Schau. Ein packendes Buch von einer meiner Lieblingsautorinnen.« (Karin Slaughter)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch
In der drückenden Hitze von Charlotte, North Carolina, erholt sich die forensische Anthropologin Tempe Brennan von einem neurochirurgischen Eingriff – und kämpft mit Migräneanfällen und Albträumen. Da erhält sie eine Reihe von rätselhaften Nachrichten, Fotos von einer Leiche ohne Gesicht und Hände. Wer ist dieser Tote, und warum schickt man ausgerechnet ihr diese Bilder? Um Antworten auf diese und andere Fragen zu finden, muss Tempe den vorgeschriebenen Dienstweg verlassen – ihre neue Vorgesetzte hegt einen tiefen Groll gegen sie und will sie um jeden Preis von dem Fall fernhalten.
Tempe kommt der erstaunlichen Wahrheit allmählich näher – auch dank modernster forensischer Methoden. Doch je mehr sie aufdeckt, desto düsterer und schräger erscheint das Bild …
Zur Autorin
Kathy Reichs, geboren in Chicago, lebt in Charlotte und Montreal. Sie ist Professorin für Soziologie und Anthropologie, eine von nur einhundert in den USA zertifizierten forensischen AnthropologInnen und war jahrelang unter anderem für gerichtsmedizinische Institute in Quebec und North Carolina tätig. Ihre Romane erreichen regelmäßig Spitzenplätze auf internationalen und deutschen Bestsellerlisten und wurden in dreißig Sprachen übersetzt.
VON KATHY REICHS IN DER TEMPE-BRENNAN-REIHE ERSCHIENEN:
Die Sprache der Knochen
Knochen lügen nie
Totengeld
Knochenjagd
Fahr zur Hölle
Blut vergisst nicht
Das Grab ist erst der Anfang
Der Tod kommt wie gerufen
Knochen zu Asche
Hals über Kopf
Totgeglaubte leben länger
Totenmontag
Mit Haut und Haar
Knochenlese
Durch Mark und Bein
Lasst Knochen sprechen
Knochenarbeit
Tote lügen nicht
Kathy Reichs
Das Gesicht des Bösen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Klaus Berr
Blessing
Originaltitel: A Conspiracy of BonesOriginalverlag: Scribner, an Imprint of Simon & Schuster, Inc., New YorkDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Temperance Brennan, L. P.
Copyright © 2020 by Karl Blessing Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-19556-4V003www.blessing-verlag.de
Für Carolyn Reidy und Kevin Hanson.Ihr habt immer an mich geglaubt.
»Es ist viel schwerer, ein Phantom zu töten, als eine Realität.«
Virginia Woolf, Der Tod des Falters
1
Freitag, 22. Juni
Jeder reagiert anders auf Druck. Manche Menschen sind geschmeidig, lassen sich verformen. Andere sind spröde, können nicht nachgeben. Physiker sprechen von Stressbelastungskurven. Eines ist sicher: Wenn die Last zu groß ist oder zu schnell aufgeladen wird, kann jeder zerbrechen.
Ich weiß, wovon ich rede. Ich erreichte meine Belastungsgrenze im Sommer nach dem Mord an meinem Chef. Ich – das Magmagestein der Emotionen. Und ich rede nicht nur von den Albträumen.
Um ehrlich zu sein, Larabees Tod war nicht der unmittelbare oder einzige Auslöser. Da war auch noch Andrew Ryan, mein langjähriger Geliebter und Polizistenkollege bei Mordermittlungen in Quebec. Ich hatte seinem Drängen nachgegeben und war einverstanden gewesen, sowohl am Montrealer wie am Charlotter Ende unserer geografisch komplexen Beziehung mit ihm zusammenzuziehen. Da war Katys Entsendung nach Afghanistan. Mamas Krebserkrankung. Petes Nachricht über Boyd. Meine Diagnose, dann die Operation. Die Migräneanfälle. Ein ganzer Haufen Stressfaktoren scheuerte an meiner Belastungskurve.
Rückblickend muss ich zugeben, dass ich aus der Umlaufbahn geriet. Vielleicht war ich auf eigene Faust drauflosmarschiert, weil ich unsteuerbare Kräfte eben doch steuern wollte. Dem Älterwerden den Finger zeigen wollte, oder dem rebellierenden Blutgefäß, das in meinem Hirn zu wüten drohte. Vielleicht war es ein Schrei nach Ryans Aufmerksamkeit. Ein unbewusster Versuch, ihn zu verjagen? Oder vielleicht war es einfach nur die verdammte Hitze in Carolina.
Wer weiß? Ich hielt tapfer stand, bis der Mann ohne Gesicht mir den Rest gab. Seine Überreste und die anschließende Ermittlung rissen ein schwarzes Loch in meine gemütliche, kleine Welt.
Meine Mutter bemerkte die Veränderungen, lange bevor die rätselhafte Leiche auftauchte. Die Zerstreutheit, die Erregbarkeit, die Unbeherrschtheit. Sie schob das alles auf das Aneurysma. Vom Augenblick seiner Entdeckung war Mama überzeugt, dass das winzige Gerinnsel platzen und mein eigenes Blut mich umbringen würde. Ich machte mich über ihre Kritik an meinem Verhalten lustig, obwohl ich wusste, dass sie recht hatte. Ich ignorierte E-Mails und Anrufe. Ich lehnte Einladungen ab und zog mir stattdessen einen alten Hollywood-Schinken nach dem anderen rein. Verdammt, Der Stadtneurotiker, meinen Lieblingsfilm, hatte ich mir allen Ernstes vier Mal angeschaut.
Von den nächtlichen Heimsuchungen erzählte ich Mama nichts. Verquere Montagen voller dunkler Gestalten und unbestimmter Gefahren. Oder frustrierende Arbeiten, die ich nicht abschließen konnte. Ängste? Hormone? Die Kopfwehtabletten, die ich nehmen musste? Die Wurzel meiner Gereiztheit war unwichtig. Ich schlief nur wenig, war dauernd unruhig und erschöpft.
Man musste nicht Freud sein, um zu erkennen, dass ich in schlechter Verfassung war.
Da lag ich also, hellwach um Mitternacht, und versuchte, mich nach einem Traum über einen Sturm, ein paar Schlangen und Larabee zu beruhigen. Der alte Sigmund hätte dazu sicher etwas zu sagen gehabt.
Ich versuchte es mit tiefer Atmung. Dann mit einer Entspannungsübung, die bei den Zehen anfing.
Keine Chance.
Die Nerven zum Zerreißen gespannt, stand ich auf und ging zum Fenster. Zwei Etagen unter mir lag der Grund um mein Stadthaus herum dunkel und still da, nur ab und zu bewegte sich schlaff ein Blatt in einem gelegentlichen, halbherzigen Windstoß. Ich wollte mich schon wieder abwenden, als ich aus dem Augenwinkel heraus das Flackern einer Bewegung neben der Kiefer im vorderen Garten meines Nachbarn bemerkte.
Ich starrte hin und meinte, eine Silhouette zu erkennen. Stämmig. Männlich?
Auf dem Grund von Sharon Hall um Mitternacht?
Mit schneller schlagendem Herzen kniff ich kurz die Augen zusammen.
Die Silhouette war mit den Schatten verschmolzen.
War da überhaupt jemand gewesen?
Neugierig geworden, zog ich alte Shorts aus der Wäsche, schlüpfte in meine Nikes und ging nach unten. Ich hatte nicht vor, den Kerl zur Rede zu stellen, falls es ihn überhaupt gab, ich wollte nur herausfinden, warum er zu dieser Uhrzeit um mein Haus herumschlich.
In der Küche schaltete ich die Alarmanlage aus und trat durch die Hintertür auf meine Terrasse. Das Wetter war mehr als Dixie-warm, die Luft heiß und stickig, das Laub so schlaff und entmutigt, wie es von oben ausgesehen hatte. Da ich keinen Herumtreiber sah, umkreiste ich das Haus. Niemand. Ich ging einen der Pfade entlang, die das Gelände durchkreuzten.
Es hatte geregnet, als ich um zehn meine Mikrowellenpizza gegessen hatte, und die Feuchtigkeit hing noch immer schwer in der Luft. Pfützen glänzten schwarz auf dem Kies und wurden gelb, als mein verschwommener Schatten und ich unter höllisch heimeligen, von der Feuchtigkeit verzerrten Kutschenlaternen hindurchgingen.
Der winzige Teich war ein schwarzes Loch, fransig, wo das Wasser den Rand berührte. Trübe Schatten glitten über die Oberfläche, still, sich ihrer heiklen Lage bewusst. Die Hausbesitzervereinigung führt einen endlosen, oft kreativen Kampf gegen sie, doch wie die Abschreckungsmaßnahmen auch aussehen mögen, diese Gänse kommen immer wieder zurück.
Ich kam an einer Lego-Form vorbei, von der ich wusste, dass es ein kleiner Pavillon war, als ich jemanden hörte, nein, eher spürte. Ich blieb stehen. Spähte ins Dunkel.
Ein Mann stand in dem Schattenfleck im Inneren des Pavillons. Der Kopf war gesenkt, das Gesicht nicht zu sehen. Von mittlerer Größe und Statur. Sonst konnte ich kaum etwas erkennen. Bis auf zwei Dinge.
Erstens, ich kannte ihn nicht. Er war kein Anwohner, und ich hatte ihn auch noch nie als Besucher gesehen.
Zweitens trug der Mann, trotz der erdrückenden Hitze, einen Trenchcoat. Als er einen Arm hob, vielleicht um auf die Uhr zu schauen, leuchtete der Stoff in der Dunkelheit hell auf.
Ich schaute nervös über die Schulter.
Scheiße. Warum hatte ich mein Handy nicht dabei? Ganz einfach. Es hatte keinen Saft. Mal wieder.
Schön. Warum hatte ich nicht wenigstens das Terrassenlicht eingeschaltet? Sollte ich heimgehen und die 311 anrufen, um einen Herumtreiber zu melden? Oder die 911?
Ich drehte mich um. Der Pavillon war leer. Ich schaute den Pfad in beiden Richtungen entlang. Nach links, nach rechts. Der Mann war nicht da.
Aus dem Dunst wurde wieder Regen. Apathische Tropfen suchten Halt auf meinem Gesicht und den Haaren. Zeit, wieder reinzugehen.
Plötzlich sah ich jenseits der runden Einfahrt ein graues Flackern. Erst da, dann verschwunden.
Adrenalin schoss mir durch den Körper. Hatte es Trenchcoat auf mich abgesehen? Kundschaftete er Sharon Hall aus? Wenn nicht, was tat er dann hier im Regen mitten in der Nacht? Und warum so verstohlen?
Oder war mein Argwohn etwa nur ein Produkt der Paranoia, noch ein Geschenk meiner überstrapazierten Stressbelastungskurve? So oder so, ich war froh, dass ich das Pfefferspray von der letzten Joggingrunde noch in der Tasche meiner Shorts hatte.
Unerwünschte Bilder von Larabees letzten Augenblicken blitzten mir in den Kopf. Die grau-grüne Blässe seiner Haut. Das teilnahmslose Piepsen der Monitore, die ihre blutleeren Spitzen und Täler aufzeichneten. Die kreischende Stille, als das Piepsen aufhörte. Später, in einem Verhörzimmer, das nach Schweiß und Angst roch, die lümmelnde Gleichgültigkeit des hirnamputierten Junkies, der meinem Chef die Geschosse in den Bauch gejagt hatte.
Stopp!
Hatte ich das laut gerufen? Oder nur in meinem Kopf?
Meine Schritte wurden schneller, knirschten weich in der Stille.
Eine ganze Minute, dann eine Gestalt im Trenchcoat, weit oben, wo der Pfad in einen Anwohnerparkplatz mündete. Der Mann hatte mir den Rücken zugewandt und bewegte sich mit einem merkwürdig pendelnden Gang.
Plötzlich kamen von überall her Geräusche angeschossen. Das Rascheln von Blättern. Das Knirschen von Ästen. Brechende Zweige. Nächtliche Kreaturen? Trenchcoats durchgeknallte Kumpels auf der Suche nach mehr Meth?
Ich hatte keine Wertgegenstände bei mir – kein Geld, keine Uhr. Würde sie das wütend machen?
Oder waren die Geräusche nur eine Erfindung meiner überreizten Nerven?
Ich tastete nach dem Spray an meiner rechten Hüfte. Spürte die Dose. Pink und fies. Ein Molekül der Summe, die ich dafür hingelegt hatte, ging an die Brustkrebsforschung.
Kurze Unentschlossenheit.
Sollte ich mich nach Hause trollen? Den Pfad weitergehen und den Mann beobachten? Ihn auf dem Parkplatz zur Rede stellen? Dort standen Straßenleuchten, die zwar überfordert waren, aber ihr Bestes gaben.
Ich wurde langsamer. Trenchcoat war nur noch zehn Meter vor mir.
Genau in diesem Augenblick beschloss mein Hirn, ein Blockbuster-Szenario abzuspulen.
Wenn ich dem Mann zu nahe kam, würde er ein Messer ziehen und versuchen, mir die Kehle aufzuschlitzen.
Jesus Christus!
Warum ließ ich mir von diesem Kerl eine solche Angst einjagen? Bei der Arbeit ist mir schon Schlimmeres begegnet als ein Kerl, der sich anzieht wie Bogie in Casablanca. Kriminelle Biker, die die Köpfe und Hände ihrer ermordeten Rivalen mit Kettensägen abtrennen. Macho-Arschlöcher, die ihre verängstigten Ex-Frauen verfolgen und erdrosseln. Betrunkene Schläger, die ihre zappeligen Babys gegen die Wand knallen. Dieses Pack bringt mich nicht davon ab, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ganz im Gegenteil. Es inspiriert mich zu noch härterer Arbeit.
Warum dann das Drama wegen eines bemäntelten Mannes? Warum dieses Gefühl der Bedrohung? Ich bezweifelte, dass dieser Kerl ein Verrückter war. Eher ein harmloser alter Kauz, der empfindlich auf Feuchtigkeit reagierte.
Wie auch immer, ich war es den Nachbarn schuldig, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich würde die Hecke als Deckung benutzen und ihm eine Weile folgen. Wenn er sich verdächtig verhielt, würde ich die Polizei rufen.
Ich zwängte mich durch eine Lücke in den Sträuchern, ging auf der anderen Seite ein paar Meter und blieb dann stehen, um den Parkplatz zu überblicken.
Der Mann stand unter einer der überforderten Laternen. Er hatte das Kinn erhoben, die Gesichtszüge waren nur als dunkle Flecken in einem verschwommenen weißen Rechteck zu erkennen.
Mir stockte der Atem.
Der Kerl starrte mich direkt an.
Oder doch nicht?
Nervös drehte ich mich zu der Öffnung in der Hecke um. Fand sie nicht mehr. Zwängte mich dort hinein, wo die Dunkelheit weniger dicht wirkte. Die Lücke war schmal, kaum vorhanden. Zweige und Blätter streiften meine Arme und Haare, Skelettfinger, die mich festhalten wollten.
Mein Atem klang lauter, verzweifelter, als würde ich mich von der dichten Vegetation eingesperrt fühlen. In der Luft hing schwer der Geruch von nasser Rinde, feuchter Erde und meinem eigenen Schweiß.
Ein letzter Meter, dann war ich frei und eilte zum Teich zurück. Nicht auf dem Weg, den ich gekommen war, sondern eine andere Route, eine schattige, geschützte.
Fast unmerklich schlich sich eine neue Note in die Geruchsmischung. Ein vertrauter Geruch. Einer, der einen neuen Ansturm von Adrenalin auslöste.
Mir stach der Gestank verwesenden Fleischs in die Nase.
Unmöglich.
Und doch war er da. Grell und kalt wie die Bilder meiner Träume.
Nachdem ich mich um ein Gebüsch aus Azaleen und Philodendron herumgekämpft hatte, entdeckte ich in der Dunkelheit vor mir eine Aufhellung. Darin bewegten sich Winkel und Flächen aus Schatten über den Rasen.
Trenchcoats Komplizen, die mir auflauerten?
Ich war schon fast am Ende des Gartens, als ein bösartiges Knurren mich wie erstarrt stehen bleiben ließ. Während mein Verstand nach einer rationalen Erklärung suchte, stellte ein schriller, hoher Schrei mir die Haare auf den Unterarmen und im Nacken auf.
Mit zitternder Hand holte ich das Pfefferspray aus der Tasche und bewegte mich langsam vorwärts.
Hinter dem Gebüsch, wo der Rasen an die östliche Mauer des Anwesens stieß, kämpften zwei Hunde unerbittlich miteinander. Der größere, die zottige Folge einer Labrador-Pitbull-Affäre, schien nur aus aufgestellten Nackenhaaren, gefletschten Zähnen und weißer Augenhaut zu bestehen. Der kleinere, wahrscheinlich ein Terrier, duckte sich ängstlich zu Boden, das Fell eines Hinterlaufs mit Blut und Speichel verklebt. Beide Tiere waren mir unbekannt.
Ohne mich zu beachten, setzte der Pitbull zu einem weiteren Sprung an. Der Terrier jaulte und versuchte, sich noch tiefer zu kauern, um weniger Angriffsfläche zu bieten.
Der Pitbull hielt einen Augenblick inne, und als er dann sicher war, dass die Rangfolge etabliert war, drehte er sich um und trottete zu einer dunklen Wölbung am Fuß der Mauer. Während der Terrier sich mit eingezogenem Schwanz davonschlich, schnupperte der Pitbull seine Umgebung ab und senkte dann den Kopf.
Ich schaute gebannt zu, wollte wissen, was die Ursache dieses Kampfes gewesen war.
Ein kurzes Zerren und Reißen, dann hob der Sieger die Schnauze.
Im Maul des Hundes steckte der abgetrennte Kopf einer Gans, der verwüstete Hals schwarz glänzend, die Wangenpartien weiß grienend wie das Lächeln eines bösen Clowns.
Ich sah, wie Regen auf das blicklose Auge des Vogels fiel.
2
Freitag, 29. Juni
Eine Woche verging. Ziemlich genau. Und es passierte nicht viel. Verstört von den kämpfenden Hunden und der ermordeten Gans, hatte ich den Eindringling nicht gemeldet. Oder Spanner. Oder was auch immer er war. Habe ihn nie wiedergesehen.
In letzter Zeit hatte ich es nicht leicht. Gesundheitlich. Persönlich. Beruflich. Letzteres selbst verursacht. Ich hätte diplomatischer sein können, hätte den Mund halten können. Wer hätte schon ahnen können, dass meine Bemerkungen auf mich zurückfallen würden? Richtig. Tun sie das nicht immer? Vorwiegend beschäftigte ich mich mit diesen Problemen.
Und mal im Ernst: ein Herumtreiber in einem Trenchcoat? War das nicht das älteste Klischee überhaupt? War der Mann überhaupt da gewesen? Oder der ganze Vorfall die Nachwehe meines migräneinduzierten Albtraums?
Zwei unscharfe Kreise geronnen zu Scheinwerfern, die sich in meine Heckscheibe bohrten. Der Innenraum wurde heller, meine Gedanken kehrten in die Gegenwart zurück.
23:10 Uhr. Ich hatte eben Mama in ihrer neuen Unterkunft abgeliefert und musste auf der Sharon Amity an der Kreuzung mit der Providence Road halten. Während ich auf Grün wartete, schaute ich mich im Rückspiegel an.
Die Haare im Nacken zusammengeknotet, nicht toll, aber okay. Reste von Mascara, Rouge und Lipgloss, die versuchten, meine Erschöpfung zu überspielen.
Mama hatte sich nicht mokiert. Oder doch? Ich hatte nicht darauf geachtet.
Eine seidene Tunika, ein bisschen bohémien, aber nicht übertrieben. Sie verdeckte die engen, schwarzen Jeans, die dieser Tage ein bisschen schlabberten. Sandalen von Tory Burch. Roter Nagellack von I Stop for Red auf den Zehen.
Die Klamotten, die Schminke, der OPI-Lack: Ich gab mir Mühe. Und zwar damit, wieder in Kontakt mit der Welt zu treten, wie Mama sagen würde. Gesagt hatte. Mehrfach. Wenn sie nicht gerade nachschaute, ob meine Pupillen gleich groß waren.
Heute Abend stand Mahlers Symphonie Nr. 2 in c-Moll auf dem Programm. Die Auferstehung.
Ironisch.
Ich konnte kaum erwarten, nach Hause zu kommen.
Man verstehe mich nicht falsch: Ich genieße die Konzerte. Aber der Cocktailklatsch mit Mamas Freundinnen steht für mich auf gleicher Stufe mit einer Darmspiegelung. Wobei man sagen muss, dass der gute alte Getriebeservice wenigstens der Gesundheit zuträglich ist.
Meine Mutter, Katherine Daessee »Daisy« Lee Brennan ist eine Witwe mit Krebs und einem Freund, der unter der Woche ein Trockenreinigungsimperium von seiner Zentrale in Arkansas aus führt. Meine Schwester Harry lebt tausend Meilen entfernt in Texas. Und ist verrückt.
Sie wissen, was ich meine. Üblicherweise bin ich Mamas Notnagel.
Was ja ganz okay ist. Aber warum tue ich mir diese postkonzertanten Zusammenkünfte an? Ganz einfach. Meine Mutter beherrscht die Kunst des Passiv-Aggressiven in zuvor nicht gekannten Höhen. Und ich gebe immer nach.
Die Ampel sprang um. Ich gab Gas. Die Scheinwerfer hinter mir schrumpften, bogen links ab. Aus Sharon Amity wurde übergangslos Sharon Lane. Ohne Grund. Vor mir würde die Sharon Lane an einer T-Kreuzung in die Sharon Road übergehen. Ohne Grund. Vermutlich sind Charlottes verwirrende Straßennamen nur dazu da, Autofahrer von außerhalb zu trollen.
Schatten huschten über die Windschutzscheibe, als ich unter einem Geflecht aus hohen Eichen hindurchfuhr. Fetzen der abendlichen Unterhaltung gingen mir durch den Kopf. Dieselbe müde Unterhaltung wie immer.
»Deine Mutter sieht großartig aus.« Soll heißen, nicht tot.
»Ja, die Chemo läuft gut.«
»Wie geht’s Pete?« Ich habe gehört, dein Ex hat was mit einer Yoga-Lehrerin und Erbin einer internationalen Schifffahrtslinie.
»Dem geht’s gut, danke.«
»Unsere Gebete sind bei Katy.« Gott sei Dank hockt deine Tochter in einem Kriegsgebiet, nicht die unsere.
»Es geht ihr gut, danke.«
»Mein Neffe hat jetzt seine Scheidung durch und zieht nach Charlotte. Ihr müsst euch mal kennenlernen.« Lass mich dich aus deinem armseligen Leben retten.
»Mir geht’s gut, danke.«
Heute waren neue Themen hinzugekommen, inspiriert von meinem gegenwärtigen Fiasko.
»Unterrichtest du noch an der UNCC?« Bist du jetzt etwa gezwungen, wieder nur in deinem Alltagsjob zu arbeiten?
»Ein paar Grundkurse.«
»Dr. Larabees Tod war eine schreckliche Tragödie.«
»Das war er.«
»Wie kommst du mit der neuen ME zurecht?« Es geht das Gerücht, du bist mit deiner neuen Chefin in einen Shitstorm verwickelt.
»Entschuldigt mich, aber ich glaube, Daisy würde jetzt gern fahren.«
Bei diesen Begegnungen wünschte ich mir immer, ich würde noch trinken. Und zwar sehr viel.
Ich überquerte die Wendover. Die Straße verengte sich auf zwei Spuren. Ich überfuhr eine Bodenschwelle, das Auto machte einen Satz, sackte durch.
Mein iPhone leuchtete auf. Kein Klingelton. Ich hatte es während des Konzerts stumm gestellt und danach vergessen, wieder umzuschalten.
Ich schaute zum Handy, das auf dem Beifahrersitz lag. Ein grauer Kasten deutete auf eine eingegangene Nachricht hin. Ich vermutete, es war Mama, die befürchtete, dass meine Embolisation geplatzt war. Oder dass ich von somalischen Piraten entführt wurde.
Als ich Minuten später in der Einfahrt stand, tippte ich auf das Display. Die neue Nachricht war um 20:34 Uhr angekommen.
Ich öffnete die App, dann die Message.
Vier Fotos.
Unter meinem Brustbein kribbelte es.
Mein Stadthaus war dankenswert kühl und roch schwach nach Gips und frischer Farbe.
»Birdie?«, rief ich, während ich die Schlüssel auf die Anrichte warf.
Keine Antwort.
»Ich bin zu Hause, Bird.«
Nichts. Die Katze war noch immer sauer wegen der Renovierung. Gut. Ich hatte meine eigenen Probleme.
Ich verriegelte die Tür, stellte die Alarmanlage aus und durchquerte die Küche, ohne Licht zu machen. Dann marschierte ich durch Ess- und Wohnzimmer und stieg die Treppe hoch.
Besitzurkunden aus dem neunzehnten Jahrhundert bezeichnen den winzigen, zweistöckigen Bau als Annex, als Anbau. Anbau an was? Keine Menschenseele hat eine Ahnung. An das Haupthaus – inzwischen bestehend aus Eigentumswohnungen –, das die Ländereien von Sharon Hall beherrscht? An die umgebaute Remise daneben?
Ist mir schnurzpiepegal. Ich lebe seit über einem Jahrzehnt in den Zimmerchen dieses Annex’ – seit meiner Trennung von dem angehenden Gemahl der Schifffahrtslinienerbin. Und seit meinem Einzug habe ich außer Glühbirnen nichts ausgetauscht.
Bis vor Kurzem. Das Verfahren – Bauvorschriften, Genehmigungen, die Hysterie der Eigentümervereinigung – war grauenhaft gewesen. Und der Quell der Probleme wollte nicht versiegen. Klemmende Fenster. Ein durchgedrehter Elektriker. Ein Maler, der nie auftauchte.
Oben auf dem Absatz schaute ich nach rechts zu der Tür, die in das neue Zimmer führte. Wie gewöhnlich wurde mir die Brust eng, nur ein Schluckauf, aber doch so, dass ich es spürte. Wie dieses Zusammenzucken, das Einbruchsopfer spürten?
Ich hatte die Entscheidung getroffen, mit Ryan zusammenzuziehen. Wir hatten vereinbart, zwischen den beiden Städten zu pendeln, wie die Arbeit es verlangte und die Freiheit es gestattete. In Montreal hatten wir eine Eigentumswohnung gekauft. Ich hatte der Erweiterung hier zugestimmt. Genug Platz für einen Mitbewohner.
Warum dann diese Beklemmung? Warum die Weigerung, mich in dem Raum tatsächlich zu bewegen? Hinter der Tür lauerte nichts Schlimmeres als schlechte Verkabelung und die falsche Wandfarbe. Zwei Schreibtische, zwei Bücherregale, zwei Aktenschränke.
Zwei Zahnbürsten im Bad. Zwei Arten von Brot in der Gefriertruhe.
Alles paarweise.
Mein Leben unterteilt. Ich hatte das schon mal gemacht. Hatte nicht funktioniert.
Reiß dich zusammen, Brennan. Ryan ist nicht Pete. Er wird dich nie betrügen. Er ist attraktiv, intelligent, großzügig, nett. Und verdammt sexy. Warum weigerst du dich nur, dich zu binden?
Ich hatte wie immer keine Antwort.
Im Schlafzimmer warf ich meine Handtasche auf die Kommode, ließ mich in den Schaukelstuhl fallen und zog die Sandalen aus. Dann steckte ich mein Handy ein, damit das Ding nicht binnen Sekunden den Geist aufgab.
Ich sehe die ganze Zeit Tatort- und Autopsie-Fotos. Sie sind nie hübsch. Die aschfahle Haut, die leeren Augen, die blutverspritzten Räume oder Autositze. Auch wenn ich daran gewöhnt bin, nehmen diese traurigen Szenen mich immer mit. Die schonungslose Mahnung, dass hier ein menschliches Leben gewaltsam beendet wurde.
Diese jetzt trafen mich härter als die meisten.
Ich schluckte.
Auf dem ersten Foto war ein Mann, der auf dem Rücken in einem Leichensack lag, die Arme gerade an den Seiten. Der Sack war bis zur Taille geöffnet. Unterhalb seiner aufgekrempelten Ärmel und des Gürtels konnte ich nichts sehen.
Der Mann war in einem blutverkrusteten ecrufarbenen Hemd gestorben. Ein Paar Schuhe stand neben seinem Kopf, gefertigt aus demselben feinen, braunen Leder, das auch seine Hose hielt.
Über dem blutigen Kragen war das Gesicht des Mannes eine Horrorshow aus aufgeweichtem Fleisch und Knochen. Nase und Ohren fehlten, die Augenhöhlen gähnten dunkel und leer.
Blind wie die tote Gans an der Gartenmauer.
Die grausige Rückblende ließ mich wieder erschauern.
Die nächsten beiden Bilder waren Nahaufnahmen von den Händen. Oder wären es gewesen, wenn die beiden nicht auch gefehlt hätten. Die Unterarme waren ab den Ellbogen zerfetzt, Ellen und Speichen endeten in schartigen Spitzen knapp unterhalb der Hemdsärmel, durchtrennte Sehnen glänzten weiß im zerquetschten Fleisch.
Das letzte Foto zeigte die Bauchgegend des Mannes. Das Hemd war auf der einen Seite zurückgeschlagen. Sein Unterbauch klaffte weit aufgerissen unterhalb der Rippen, die den gebleichten Überresten eines Bootsrumpfes ähnelten. Was von seinen Eingeweiden noch zu erkennen war, ließ sich so gut wie nicht mehr identifizieren. Ich sah ein paar Organfetzen von Leber und Milz, nichts mehr an der Stelle, wo es sein sollte.
Die Nachricht wies weder einen Namen noch eine Nummer aus und war offensichtlich über Spam-artige Querverbindungen verschickt worden. Ich wusste, dass es Apps und Websites gab, die einem Absender den Wunsch nach Anonymität erfüllten. Tricks, die eine Identität verschleierten, und Einmal-E-Mail-Accounts. Aber wer würde so etwas tun? Und warum? Und wer könnte Zugang zu einer derart verstümmelten Leiche haben? Und zu meiner Handynummer?
Joe Hawkins vielleicht? Eine solche Missachtung des Protokolls passte nicht zu seinem Charakter. Joe war der älteste Todesermittler im Mecklenburg County Medical Examiner’s Office. Hawkins hatte schon Y-Schnitte zugenäht, als das MCME noch einen einzigen Pathologen und einen Assistenten hatte. Wahrscheinlich schon, als Custer am Little Big Horn fiel.
Falls Hawkins diese Fotos geschickt hatte, was war dann sein Motiv? Ja, das Opfer war übel zugerichtet. Aber wir hatten schon Schlimmeres gesehen. Viel Schlimmeres. War Hawkins vielleicht ein Verbündeter in meinem gegenwärtigen Konflikt? Ein stiller Helfer, der Infos an eine Genossin in Gefahr durchsteckte?
Wollte Hawkins mir eine Warnung zukommen lassen? Der Gesichtslose würde schwer zu identifizieren sein, wollte er deshalb andeuten, dass hier Anthropologie gebraucht würde? Jahrelang war ich die einzige Spezialistin in der Region gewesen. Früher wäre diese Aufgabe zweifellos mir zugefallen.
Bis Larabee getötet wurde und Margot Heavner in seine Kluft schlüpfte.
Eine kurze Erklärung. Da North Carolina ein für den ganzen Bundesstaat zuständiges Medical-Examiner-System hat, wurde die Stelle vom obersten ME in Chapel Hill vergeben. Das Büro des Mecklenburg County Medical Examiner, dem ich als Beraterin zur Verfügung stehe, ist eins von mehreren untergeordneten Instituten und zuständig für die fünf Countys in der Umgebung von Charlotte. Dank der laxen Waffengesetze erschießt man sich in den Carolinas mit großer Begeisterung gegenseitig. Deshalb brauchte der Chef nach dem Mord an Larabee sehr schnell einen Ersatz.
Das Gehalt ist nicht gerade astronomisch, deshalb war Heavner eine aus lediglich einer Handvoll Bewerberinnen und Bewerbern gewesen. Was sie überzeugte, war das im Vergleich zu North Dakota berauschende Klima in Charlotte. Was den Staat überzeugte: Sie war bereit, für wenig Geld zu arbeiten und sofort anzufangen.
Bingo! Dr. Margot Heavner, forensische Anthropologin, Autorin und Rampensau par excellence.
Kaum war sie da, fing sie schon an, mich hinauszuekeln. Ohne jede Feinsinnigkeit. Vom ersten Tag an machte sie klar, dass sie lieber mit Charles Manson arbeiten würde als mit mir.
Sie dürften es schon vermuten. Zwischen uns gibt es eine Vorgeschichte.
Vor sechs Jahren veröffentlichte Heavner ein Buch mit dem Titel: Die Rächerin des Todes: Mein Leben als Ärztin im Leichenschauhaus. Das für ein breites Publikum gedachte Werk war eine Sammlung von Fallstudien, die meisten ziemlich alltäglich, doch in der Absicht geschrieben, die Verfasserin als die größte Pathologin seit Erfindung des Skalpells darzustellen. Schön und gut. Stelle deinen Beruf vor, sei eine Inspiration für die nächste Generation.
Allerdings stellte sie sich nur selbst vor. Einige Wochen lang war Heavner überall. Talkshows, Printmedien, Onlinewerbung, soziale Medien. Damit konnte ich leben. Bis Frau Doktor Edelstahl einer rechtslastigen Dreckschleuder namens Nick Body eine Reihe von Interviews gab.
In Blogs und Podcasts im Internet und von dort aus auch über eine Reihe von Radiosendern sonderte Body jeden Schund ab, von dem er glaubte, dass er seine Ratings und seine Leserzahlen in die Höhe treiben würde. Impfgegnertum, Bewusstseinskontrolle durch die Regierung, Verwicklung des US-Militärs in die Angriffe auf die Twin Tower und die Kaserne in Beirut – alles war ihm recht, wie verletzend und absurd es auch sein mochte. Ebenso jede Sensationsgeschichte über Gewalttaten und zerstörte Leben.
Heavner hatte ihre Unterhaltungen mit Body nicht auf das Thema ihres Buchs beschränkt. Mehrmals sprach sie über den Fall eines getöteten Kindes. Ein brutaler Mord, für den noch kein Täter verurteilt war.
Damit hatte ich ganz eindeutig Schwierigkeiten.
Als mich ein Journalist nach meiner Meinung zu Heavners Verhalten fragte, kritisierte ich sie ziemlich scharf. Vielleicht stachelte er mich mit Fangfragen an. Vielleicht war es die Tatsache, dass ich drei Kindsmorde bearbeitete und den starken Wunsch hatte, die Opfer zu schützen. Vielleicht war ich müde. Warum auch immer, ich hielt mich nicht zurück.
Heavner war stocksauer. Drohte mit einem Prozess wegen Verleumdung oder Beleidigung oder was auch immer, ließ aber keine Taten folgen. Die Fehde wurde nie öffentlich. Für das Gezänk von Fachidioten interessiert sich kein Mensch. Aber in unserem kleinen Spezialistenkreis köchelte der Klatsch.
In jenem Jahr riet mir beim Jahrestreffen der American Academy of Forensic Science eine Entomologenkollegin namens Paulette Youngman, die Sache auf sich beruhen zu lassen. War das in Dallas gewesen? Baltimore? Die Veranstaltungen verschwimmen alle in meinem Hirn. Paulette und ich hatten eben eine Pause in einem interdisziplinären Workshop über Kindesmissbrauch, als Heavner in einem ihrer unvermeidlichen Desingnerfummel vorbeirauschte.
»Sie haben recht«, sagte Youngman. »Die Frau hat keine Skrupel.«
»Sie hat von einem ungeklärten Mordfall erzählt, um ihr Buch zu pushen.«
»Das ist egal.«
»Es ist nicht egal, wenn sie dadurch den Fall kompromittiert und dem Kind deshalb keine Gerechtigkeit widerfährt. Und der Fall war nicht der einzige. Sie hat über vermisste Kinder gesprochen. Man konnte Body praktisch aus dem Lautsprecher sabbern hören.«
Youngman ließ die Eiswürfel in ihrer Limo kreiseln und stellte den Styroporbecher dann ab. »Schon mal was von Ophiocordyceps camponoti-balzani gehört?«
»Ich glaube, ich habe eine Kolonie unter meinem Waschbecken.«
»Das ist ein Pilz, der aus den Köpfen von Ameisen im brasilianischen Regenwald wächst. Man nennt sie Zombie-Ameisen.«
»Klingt wie eine von Bodys hirnrissigen Verschwörungstheorien.«
»Aber die gibt es wirklich. Der Pilz kontrolliert das Verhalten der Ameisen.«
»Damit sie was tun? Die Republikaner wählen?«
»Er übernimmt das Hirn der Ameisen und tötet den Wirt, sobald der an einen Ort gewandert ist, der dem Erfolg des Pilzes förderlich ist.«
»Fies.«
»Es ist ein Pilz.«
Ich wusste nicht, worauf sie hinauswollte. »Soll heißen?«
»Heavners moralischer Kompass wurde gehackt von der Gier nach Ruhm und öffentlicher Bewunderung.«
»Sie wird zur Zombie-Anthropologin.«
Youngman zuckte die Achseln.
»Und deshalb sollte ich es sein lassen?«
»Am Ende verliert immer die Ameise.« Youngman senkte den Kopf, sodass sich in der unmodernen, schwarzen Brille weit unten auf ihrer Nase das Licht spiegelte.
Lange sagten wir beide nichts. Youngman brach das Schweigen.
»Hat Heavners Buch es auf die Bestsellerliste der New York Times geschafft?«
»Nicht mal in die Nähe.«
Youngman grinste.
Ich grinste zurück.
In den Jahren seitdem habe ich oft an diese Unterhaltung gedacht. Und angenommen, dass sie ein Nebenprodukt der Tatsache war, dass ich zu viele Bilder von misshandelten Kindern gesehen hatte.
Doch jetzt, sechs Jahre später, war sie wieder da, und Heavner hatte einen Ort gefunden, an dem sie gedeihen konnte. Doktor Edelstahl leitete das MCME. Ich war Persona non grata, und mein Leben ein Scherbenhaufen.
Ich schaute auf die Uhr. Fast Mitternacht. Sollte ich Hawkins anrufen?
Keine Chance, dass er noch wach sein würde.
Eine Katzenwäsche, dann kroch ich ins Bett.
Natürlich konnte ich nicht schlafen.
Im Dunkeln wirbelten Bilder umher, Bewohner meines Unterbewusstseins, die um Aufmerksamkeit bettelten. Heavner. Hawkins. Der Mann ohne Gesicht. Eine Schädigung in meiner linken Arteria communicans posterior, in der jetzt winzige Platinspulen steckten.
Irgendwann kam Birdie und rollte sich neben mir zusammen.
Half nichts. Mein Hirn war eine Gefahrenguthalde aus Zweifel, Kummer und unbeantworteten Fragen.
Zuallererst: Wer war die dem Untergang geweihte Ameise, und wer der Pilz, der eine glänzende Zukunft vor sich hatte?
3
Samstag, 30. Juni
Ich wurde von einer Drossel geweckt, die vor meinem Fenster ein lebhaftes Solo trällerte. Birdie war verschwunden, wahrscheinlich, um weiterzuschmollen.
Der Wecker zeigte 6:27 Uhr an. Der Himmel ging von Zinn- in Perlgrau über. Das Zimmer war eine Kollision von Schatten, deren Ränder langsam schärfer wurden.
Ich versuchte, mich noch einmal umzudrehen.
Eine Unterhaltung schwappte in mein schläfriges Hirn. Eine alte Frau mit zitternder Stimme, als wäre sie nicht sicher, ob sie wirklich ihre Stimme erheben wollte. Oder Angst davor hatte.
Ich kann die Worte der alten Frau noch immer in meinem Kopf hören. Blutsaugendes Luder. Benutzt den Tod meines süßen Kleinen, um sich aufzuspielen. Gott, der Herr, sieht alles.
Hardin Symes. So hieß der tote Junge.
Später erfuhr ich, dass die Anruferin Bethyl Symes war, Hardins Großmutter. Von Nick Body, dem hitzigen Provokateur, hatte ich natürlich gehört. Doch ich hatte mir nie seine Sendung angehört oder einen seiner Blogs gelesen.
Aber Bethyl war eine Stammhörerin. Und sie war erbost, weil Heavner aus dem Tod ihres Enkels eine Sensationsgeschichte gemacht hatte. Den Kummer ihrer Familie an die Öffentlichkeit gezerrt hatte.
Wegen Bethyl hörte ich mir das Interview mit Heavner an und schickte danach die Raketen los, die diese Fehde eröffneten.
Von Bethyl Symes habe ich nie wieder etwas gehört.
Genervt stand ich auf, machte mich flüchtig zurecht – Zähneputzen musste reichen – dann ging ich in die Küche. Nachdem ich Kaffee aufgesetzt hatte, füllte ich den Fressnapf meiner vorwurfsvollen Katze auf. Dann holte ich mir den Observer von der hinteren Türschwelle und setzte mich an den Tisch, um Geschichten zu überfliegen, die ich bereits im Internet gesehen hatte.
Warum diese dinosauriermäßige Art der Nachrichtenbeschaffung? Solidarität mit dem Jungen, der mir seit drei Jahren die Zeitungen von seinem Rad aus mit NASA-Präzision auf die Schwelle warf – Derek. Derek behauptet, er spart das Geld für Harvard. Vielleicht bin ich naiv. Die Geschichte bringt ihm außerdem ein Riesentrinkgeld vor den Ferien ein.
Ein Auffahrunfall auf der I-77 hatte eine fünfköpfige Familie auf dem Weg in ihre alljährliche Strandwoche das Leben gekostet. Im South End wurden neue Eigentumswohnungen gebaut. Das Justizministerium eröffnete eine Untersuchung der Finanzen eines örtlichen Kongressabgeordneten.
Nichts über den Mann ohne Gesicht. Mein eigentlicher Grund der Lektüre.
Noch ein Kaffee, dann zog ich meinen Laptop aus der Reisetasche und startete eine schnelle Onlinesuche. Keinerlei Erwähnung eines Funds menschlicher Überreste in der Nähe von Charlotte.
Bis acht beschäftigte ich mich mit Geschirr, E-Mails, Wäschewaschen. Dann wählte ich Hawkins’ Handynummer, weil ich wusste, dass er Frühaufsteher war. Er meldete sich nach dem ersten Klingeln.
»Schießen Sie los.« Die übliche Begrüßung.
»Ist ein Dankeschön angebracht?«
»Wofür?«
»Haben Sie mir gestern Abend eine Nachricht geschickt?«
»Nee.«
Überrascht berichtete ich ihm von den Fotos. »Irgendeine Ahnung, wer die geschickt haben könnte?«
»Nee.«
»Ist die Leiche im MCME?«
»Yep.« Hawkins, ganz die Quasselstrippe.
»Was ist passiert?«
»Der Kerl ist hungrigen Schweinen begegnet.«
»Ich hatte auf Hunde getippt.« Ein Blick auf die Fotos hatte mir gleich verraten, dass die Verstümmelungen durch Tierfraß entstanden waren.
»Wildschweine.«
»Wo?« Wenn ich mit Hawkins rede, falle ich oft in seinen schroffen Ton mit ein. Keine Absicht, der einsilbige Rhythmus färbt einfach auf einen ab.
»Cleveland County.«
Ich machte eine ermutigende Pause. Wie üblich vergebens.
»Leichenentsorgung?«
»Unklar.«
»Wann kam er rein?«
»Gestern Abend.«
»Die Autopsie ist am Montag?«
»Heute Vormittag. Ich bin dran.«
»Es ist Samstag. Was ist so dringend?«
»Keine Ahnung.«
»Wer schneidet ihn auf?«
»Heavner.«
»Was haben wir bis jetzt?«
»Eine Leiche ohne Gesicht, Bauch und Hände.«
Im Hintergrund hörte ich einen Fernseher. Hawkins war zu Hause, wo das auch sein mochte. In all unseren gemeinsamen Jahren habe ich ihn nie gefragt, wo er wohnt. Und er hat es nie von sich aus erzählt.
»Also keine visuelle Identifikation und nichts im IAFIS.« Ich meinte das Integrated Automated Fingerprint Identification System, eine Datenbank des FBI zur Identifikation von Fingerabdrücken. Manchmal hat man Glück und landet dort einen Treffer.
»Nee.«
»Wenn der Kerl keinen Führerschein in der Tasche hat, braucht Heavner ein Bio-Profil, das sie der Polizei geben kann.«
»Eine Sozialversicherungskarte würde auch reichen.« Metallisches Klappern übertönte den Fernsehdialog. Hawkins kochte oder baute etwas.
»Ich sag Ihnen Bescheid, wenn ich von Heavner was höre.« Als ich das sagte, zog sich mein Bauch zusammen. Ich wusste, dass Dr. Edelstahl nie anrufen würde.
Tat sie auch nicht.
Nicht während der ganzen Autopsie dieses Vormittags.
Um zehn startete ich einen längeren Lauf, powerte mich richtig aus und kam dann schweißgebadet und fast zitternd vor Muskelerschöpfung zurück. Keine Sprachnachricht auf meinem Handy. Kein rotes Blinken auf meinem Anrufbeantworter.
Ich weiß. Noch so eine Dino-Technologie. Und es gibt überhaupt keinen Grund dafür, den Festnetzanschluss zu behalten. Kein edler Lieferjunge. Nur Gewohnheit. Wie meine alten verschreibungspflichtigen Medikamente, längst abgelaufen und nutzlos, aber nie entsorgt.
In den folgenden Stunden sah ich immer wieder die Fotos vor mir. Fragte mich ein ums andere Mal, wer sie geschickt haben könnte. Fand einfach keinen plausiblen Kandidaten. Keine Erklärung.
Heavner rief auch mittags nicht an, als sie und Hawkins wahrscheinlich Pause machten.
Birdie schmollte immer noch. Mama rief nicht an, um zu kontrollieren, ob mein Kopf explodiert war. Oder sprühend vor neuer Reiseideen. Obwohl beide Überlebende von langjährigen Ehen waren, planten sie und der Reinigungszar die Mutter aller Hochzeiten an einem exotischen Ort. Zumindest Mama.
Auch Ryan rief nicht mit Neuigkeiten aus Montreal an.
Es hatte Zeiten gegeben, da konnte ich mir immer vorstellen, wo Ryan sich gerade aufhielt. Der Bereitschaftssaal des Crime contre la personne, acht Stockwerke unter meinem Labor im Édifice Wilfrid-Derome an der rue Parthenais. Seine Eigentumswohnung im Habitat ’67 – rechte Winkel und Glas und ein grandioser Ausblick auf den St. Lawrence River und Vieux Montréal am anderen Ufer. Seit er in den Ruhestand gegangen war – ein weiterer Stressfaktor in meiner Kurve –, wusste ich nie genau, wo er sich rumtrieb.
Auch Slidell hielt Funkstille. Erskine »Skinny« Slidell, eine Mischung aus derben Sprüchen und schlaffer Plautze und billigem Polyester, war jahrzehntelang Detective im Morddezernat des Charlotte Mecklenburg Police Department gewesen, also Ryans Äquivalent in Dixie. Nicht zwischen den Laken, nur bei Mordermittlungen. Wie Ryan war auch Slidell inzwischen im Ruhestand und arbeitete als Privatdetektiv, obwohl er weiterhin ehrenamtlich in der Altfallabteilung des CMPD mitarbeitete. In letzter Zeit wusste ich auch bei ihm nie genau, wo er sich aufhielt.
Ich hörte von niemandem. Sah nichts von meiner Katze. Im Annex war die Stille so total, dass ich mich fragte, ob die Migräne der vergangenen Woche einen Minischlaganfall samt Hörverlust verursacht hatte.
Um eins war ich so durchtränkt von manischer Energie, dass ich solo den Everest hätte besteigen können.
Okay, Brennan. Showtime.
Ich schnappte mir eine Cola light und den Laptop und rannte, immer zwei Stufen auf einmal, hoch in den schicken neuen Anbau.
Licht fiel streifig durch die Lamellen der Holzjalousie. Das graue Ding sollte eigentlich weiß sein. Ich nahm mir vor, den Bauleiter gleich am Montag in der Früh anzurufen. Fluchte, als mir wieder einfiel, dass er nach Puerto Rico gereist war, um seinem Bruder beim Wiederaufbau nach dem Hurrikan Maria zu helfen. Neue Geistesnotiz: Maler anrufen.
Die Luft war schwer vom süßen Geruch frisch gesägten Holzes. Zugegeben: Das war irgendwie recht angenehm.
Einer der beiden Schreibtische war neu, der Entwurf eines Edeldesigners, der seinen Stil wahrscheinlich Italienisch-Modernen Chic nannte. Dicke Glasplatte, Beine aus Edelstahl. Anfangs fand ich die nüchternen Linien misstönend. Musste allerdings zugeben, dass ich mich langsam daran gewöhnte.
Zwei Fotos hingen über dem glänzenden Glas, knapp unterhalb der Linie, wo die Dachschräge an die Wand stieß. Ryan, der zweite von rechts in der oberen Reihe, größer als die meisten Kollegen aus der Abschlussklasse der Polizeiakademie. Ryan in der Uniform der Sûreté du Québec, den Arm um die Schultern seiner Tochter Lily gelegt, die vor einigen Jahren an einer Heroinüberdosis gestorben war.
Auf der Glasplatte stand, beleuchtet von einem schrägen Streifen Sonnenlicht, ein Canadiens-Wackelkopf mit einem Autogramm von Guy Lafleur. Neben dem Wackelkopf prangte eine Lampe, die aussah wie ein verbogenes Stück Tragfläche einer Nebulon-Fregatte.
Ich setzte mich an den anderen Schreibtisch, der für mich altvertraut war, ein Flohmarktfund, den der Edeldesigner wahrscheinlich Heilsarmee-Ausschuss genannt hätte.
Kabel hingen von der Decke und ragten aus der Wand über mir, was mich an den Elektriker erinnerte, der so unfähig und unzuverlässig war wie der Maler. An die beiden Telefonate, die meinen Montag erhellen würden.
Auf meiner Schreibtischplatte warteten Diplome, die ich noch aufhängen musste. Magister- und Doktortitel von der Northwestern University. Ein Diplom des American Board of Forensic Sciences.
Neben den Urkunden standen Fotos auf der patinierten Eichenplatte. Mama und Daddy, die lächelnd hinter zwei Mädchen in Trägerkleidchen standen. Pete und ich mit der kleinen Katy auf dem Arm. Ryan und ich vor einer Herberge im ländlichen Quebec. Larabee und ich bei einem Forum der AAFS.
Daddy und Larabee. Beide tot. Pete und ich, zumindest im übertragenen Sinn. Die Chronologie eines gescheiterten Lebens?
Mein Gott, Brennan. Jetzt lass mal gut sein.
Ryan und Slidell, im Ruhestand und als Partner unterwegs. Als Privatdetektive, nicht Polizisten. Heavner an der Spitze des MCME und ich vom Institut verbannt. Die Umgestaltung meines so wohlgeordneten Lebens sprengte mir den arteriell beeinträchtigten Schädel.
Man mag es einen charakterlichen Makel nennen oder eine Folge des Alterns. Diese Schwäche gestand ich mir erst seit ein paar Monaten ein.
Ich mag keine Veränderungen.
Deshalb mein Widerwillen, in dieses neue Zimmer umzuziehen.
Aber jetzt war ich hier. Mit allem, was mit diesem Mann ohne Gesicht zu tun hatte. Eine neue Ermittlung. Eine neue Zeit. Den Rest meiner Akten und Dokumente würde ich Stück für Stück hochbringen.
Angetrieben von meinem Streit mit Heavner, klappte ich den Laptop auf, startete eine Suchmaschine und gab den Namen Hardin Symes ein.
Viel gab’s nicht zu lesen. Aber genügend.
Über das Verschwinden des Jungen und die darauffolgende intensive Suche war einiges berichtet worden. Auch über das tragische Ergebnis. In den grundlegenden Fakten stimmten alle Berichte überein.
Der siebenjährige Hardin Symes lebte mit Mutter, Großmutter und zwei Schwestern in einer Wohnung an der East India Avenue in Bismarck, North Dakota. Am 19. August 2012 wurde Hardin verschleppt, als er auf dem Rasen vor dem Wohnblock spielte. Nachbarn berichteten, sie hätten gesehen, wie ein dunkelhaariger Mann ein Kind in ein Auto zerrte. Fünf Tage später fanden Jäger Hardins verwesende Leiche fünfzehn Meilen von seinem Wohnort entfernt.
Ein Artikel in der Bismarcker Tribune berichtete vom Prozess gegen Jonathan Fox, den Verdächtigen, dem man den Mord an Hardin zur Last legte. Die Verteidigung argumentierte, sämtliche Beweise seien nur Indizien, und die öffentlichen Äußerungen des ME hätten den Beschuldigten vorverurteilt. Die Jury steckte in einem Patt fest, und der Richter erklärte den Prozess für fehlerhaft geführt.
Von besonderem Interesse war eine Geschichte, die zum dritten Jahrestag von Hardins Tod erschien. Siebzehn Monate vor Hardins Verschleppung verschwand der achtjährige Jack Jaebernin aus seiner Wohngegend im selben Viertel. Jacks Vater gab an, ein dunkelhaariger Mann habe seinen Sohn eingeladen, mit ihm in einen örtlichen Park zu gehen, um dort Frösche zu fangen. Obwohl man den Jungen gewarnt hatte mitzugehen, tat er es. An diesem Abend fand eine Familie bei einer Wanderung Jacks geschundene Leiche in einem Wald zwölf Meilen entfernt. Die Autopsie ergab, dass er erwürgt oder erstickt worden war.
Die Parallelen waren auffällig. Die beiden Jungs lebten nur einige Blocks entfernt. Beide waren ungefähr im gleichen Alter. Beide wurden in Waldgebieten ungefähr in gleicher Entfernung zu ihren Wohnorten abgelegt. Und vor allem hatte Jonathan Fox eine Wohnung im selben Apartmenthaus wie die Symes gemietet.
Obwohl die Polizei von Bismarck überzeugt war, dass man den Richtigen verhaftet hatte, kam Fox nicht mehr erneut vor Gericht. 2015 begannen Ermittler der Altfallabteilung des Morddezernats damit, in Schachteln zu wühlen, um Beweise aufzutreiben, anhand deren sich der Kerl vielleicht doch noch überführen ließ.
Weitere Berichte über diese Ermittlung fand ich nicht. Anscheinend hatte die Wiedereröffnung des Falls nichts ergeben.
Ich suchte nach Jonathan Fox und erfuhr Folgendes:
Fox hatte in der siebten Klasse die Schule abgebrochen und arbeitete anschließend an der Rezeption eines örtlichen Motels. Nach dem Prozess um den Mord an Hardin Symes zog er nach Baltimore.
2016 wurde Fox für den Mord an Chelsea Keller verurteilt. Chelsea war zehn Jahre alt. Sie verschwand aus dem Vorgarten ihres Zuhauses. Ihre Leiche wurde acht Meilen entfernt in einem Wald gefunden. 2017 wurde Fox im Western Correctional Institute in Cumberland, Maryland, erstochen.
Ich setzte mich auf, weil ich ein Zwicken im Bauch spürte. Dasselbe Zwicken, das ich gespürt hatte, als Heavner bei Body vom Leder gezogen hatte.
Letztendlich war mit Fox abgerechnet worden. Aber ich hatte recht behalten. Heavners Bemerkungen waren vor Gericht von seinem Anwalt benutzt worden. Und die Strategie hatte funktioniert.
Aber hinter dem Bauchzwicken steckte mehr als ein paar unangebrachte Bemerkungen über ein ermordetes Kind.
Nach der Überprüfung einiger alter Notizen in dem Aktenschrank im Arbeits- und Gästezimmer einen Stock tiefer suchte ich nach dem Namen Nick Body und bekam den Link zu seiner Radiosendung Body Language. Dort angekommen, klickte ich auf Archiv und gab das Datum ein, das ich eben herausgefunden hatte. 4. September 2013.
Widerwillig löhnte ich die verlangte Gebühr. Beantwortete die nicht optionalen Profilfragen. Dann öffnete ich die Audiodatei.
Das Interview lief genau so ab wie in meiner Erinnerung. Body fragte Heavner nach ihrem Buch und lenkte die Unterhaltung auf die blutigsten, bestürzendsten Fälle. Heavner spielte begeistert mit, ihr nasales Jaulen klang fast so ekelerregend wie Bodys heiser-rollendes Blaffen.
Nach zehn Minuten ging Body auf die Überholspur und fragte nach Hardin Symes. Ein kurzes Zögern, dann stieg Heavner ein und verriet Details, die den Autopsiesaal nie hätten verlassen dürfen. Ließ sich über die Verderbtheit des Täters aus.
Dann der Verrat, der meine Empörung damals durch die Decke gejagt hatte. Und das nach sechs Jahren immer noch tat.
Heavner erzählte der ganzen Welt, dass Hardin Symes Autist war. Diese Enthüllung gestattete Body, zu einem seiner Lieblingsthemen überzuleiten.
Vorher abgestimmt? Egal. Diese Enthüllung war falsch, ein Verstoß gegen jegliche Berufsethik.
Den Rest der Sendung geiferte Body über die schlimmen Gefahren von Schutzimpfungen. Seine Argumentation folgte wie üblich dem Zangengriff der Dummheit. Er bestritt zum einen, dass es wissenschaftliche Beweise für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Impfungen und der Reduzierung oder Ausmerzung von Krankheiten wie Pocken, Kinderlähmung, Masern oder Röteln gab. Zum anderen versprühte er den beliebten Unsinn, wonach Impfungen Autismus auslösen können.
Heavner, eine Ärztin, widersprach ihm nicht.
Heavners Enthüllungen über Hardin Symes waren unangemessen und gefühllos. Sie tat Hardins Familie weh. Sie kompromittierte die Verfolgung seines Mörders.
Dass Heavner es unterließ, Bodys Anti-Impfungs-Tirade zu widersprechen, machte das Lächerliche glaubhaft. Und das Gefährliche.
Das waren Verstöße, die ich nicht hinnehmen konnte.
Ich meldete mich zu Wort.
Um vier noch immer nichts.
Scheiß drauf.
Aufs Äußerste angespannt, schnappte ich mir meine Schlüssel und lief zum Auto.
Das Institut des MCME liegt an der Reno Avenue im Nordwesten der Stadt. Samstagnachmittag, nicht viel Verkehr. Ich war in zehn Minuten dort.
Als ich ankam, sah ich sofort, dass etwas im Busch war. Auf dem Parkplatz standen zu viele Fahrzeuge. Die Logos von lokalen Fernsehsendern grüßten von Transporterwänden.
Während meine Neuronen ein leises Summen aussendeten, zog ich meine Sicherheitskarte durch und fuhr durchs Tor.
4
Margot Heavner stand auf den Stufen des MCME-Gebäudes. Stufen, die ich unzählige Male hinaufgestiegen war. Schockiert, ungläubig schaute ich ihr zu.
Dr. Edelstahl trug aquamarinblaue Institutskluft. Frisch von einer Autopsie? Oder weil sie fürs Fernsehen die Pathologin spielte?
Journalisten hielten ihr Galgen- und Handmikrofone hin. Nicht viele, insgesamt fünf. Sie beendete eben eine vorbereitete Stellungnahme oder beantwortete eine Frage.
»… männlich, eins achtundsiebzig, von mittlerer Statur, möglicherweise Asiate.« Heavners Frisur und Make-up waren verdächtig frisch für jemanden, der gerade von einer Autopsie kam.
»Alter?«, fragte ein gelangweilt aussehender Reporter von WSOC, einem lokalen Ableger von ABC.
»Nicht alt, aber auch kein Jugendlicher mehr.«
»Das beschreibt mehr als die Hälfte der Bevölkerung«, schlaumeierte ein freier Journalist, der aussah wie eine Echse – wenn eine Echse sich in Cargo-Shorts der Größe 40 zwängen könnte. Ich hatte ihn schon mal getroffen. Gerry Irgendwas.
»Die Leiche weist fortgeschrittene Verwesung und starken Tierfraß auf.«
»Von was? Ratten?« Im Gegensatz zu meinem Zeitungsjungen würde Gerry nie nach Harvard gehen.
»Wildschweine, Mr. Breugger.« Dann, als hätte sie Angst, dass man ihr nicht glaubte: »Die sind in North Carolina ein großes Problem.«
»Wildschweine?«, wiederholte Fessie Green, frisch von der Uni und Polizeireporterin des Observer. Green klang, als würde sie ihrem Namen alle Ehre machen.
»Auch Schweine müssen fressen. Diese Schweine haben beschlossen, eine Leiche zu fressen.« Heavner deutete zu einer kinnlosen Elfe, die vielleicht sechs Kilo wog.
»Was meinen Sie mit möglicherweise Asiate?«
»Die Merkmale sind nicht eindeutig.«
»Soll heißen?« Die Elfe bohrte nach.
Heavners Finger wanderte zu einem schlauen, jungen Ding von FOX46.
»Wird Dr. Brennan den Fall bearbeiten?«
»Mein Institut steht in Kontakt mit örtlichen, bundesstaatlichen und nationalen Behörden. Zusammen werden wir diesen bedauernswerten Herrn identifizieren und seinen Angehörigen übergeben.«
Das neuronale Summen wich einer Hitze – eine Röte, die meinen Hals hochkroch und sich über die Wangen ausbreitete.
»Wie starb der Kerl?«, fragte Gerry.
»Über die Todesursache darf ich noch nichts sagen.«
»Denken Sie, es war Mord? Selbstmord?«
»Dieselbe Antwort.«
»Sie haben diese Party organisiert. Worüber können Sie denn etwas sagen?«
»Mein Büro wird weitere Informationen herausgeben, sobald sie zur Verfügung stehen.« Heavner zögerte, vermutlich der größeren Wirkung wegen. Dann sagte sie ernst und aufrichtig: »Im Interesse der schnellstmöglichen Aufklärung hier noch einige Details, die ich Ihnen nennen kann.«
Meine Finger verkrampften sich um die Autoschlüssel, die ich immer noch in der Hand hatte.
»Merkwürdigkeiten, die für jemanden, der davon liest oder hört, vielleicht etwas aussagen können.«
Gerry versuchte zu unterbrechen. Heavner ignorierte ihn.
»Der Mann hatte keine Kreditkarten, keinen Führerschein und auch sonst keine Form der Identifikation bei sich. Er hatte keine Brieftasche, aber eine Rolle Bargeld im Wert von zweihundert Dollar. Der einzige andere Gegenstand in seinem Besitz war eine Dose mit schwedischem Kautabak der Marke Göteborgs Rapé. Seine Schuhe scheinen europäischer Herkunft zu sein. Seine Kleidung ist hochwertig – das Hemd aus ungebleichtem Leinen mit kleinen Perlmuttknöpfen, die Hose hellbraun, eine Wolle-Kaschmir-Mischung. Die Shorts bestehen aus Qualitätsseide.«
Eine bedeutungsschwere Pause. Ein schweifender Blick.
»Aus allen Kleidungsstücken wurden die Etiketten entfernt. Auf der Tabakdose fand sich kein einziger Fingerabdruck. Die Bargeldrolle enthielt Euros und Dollars.«
Heavner erwartete eifrige Reaktionen. Doch die Reporter starrten sie nur verwirrt an. Dann ließ die Elfe eine lustlose Salve von Fragen vom Stapel. Andere stimmten mit ein.
»Die Etiketten wurden herausgeschnitten?«
»Das scheint der Fall zu sein.«
»Was hat das zu bedeuten?«
»Ich weiß es nicht.«
»Warum keine Abdrücke auf der Dose?«
»Ich weiß es nicht. Die Oberfläche ist glatt, und die Dose war in einer Hosentasche vor Umwelteinflüssen geschützt.«
»Starb der Mann da, wo seine Leiche gefunden wurde?«
»Zu diesem Zeitpunkt kann ich darüber nichts sagen.«
»Warum nicht?«
»Wenn der Kerl ermordet wurde, warum dann die zweihundert Dollar zurücklassen?«
»Ja, das ist die Frage.«
»Wie kam er an diesen Bach?«
»Auch das ist noch ein Rätsel. Vielen Dank für Ihre Geduld.« Heavner winkte kurz, drehte sich um und verschwand durch die Glastür hinter ihr.
Die FOX46-Reporterin sprach in die Kamera, wahrscheinlich gab sie zurück ins Studio.
Meine Schwachsinnsanzeige dröhnte wie eine Kesselpauke.
Heavner hatte eine Pressekonferenz einberufen. Vor meiner Ankunft hatte sie erläutert, wo die Leiche gefunden worden war. Wandte sie sich wirklich an die Medien, weil sie hoffte, dass jemand sich melden würde? War ich schon wieder paranoid? Beurteilte ich ihre Motive falsch?
Oder waren meine Instinkte richtig? Der grausige Hinweis auf Wildschweine und eine gesichtslose Leiche? War hier wieder Dr. Edelstahl am Werk? War ihr Auftritt nur der erste Akt einer Rampenlichtinszenierung gewesen, um für ein neues Buch zu werben?
Drauf gepfiffen.
Obwohl eine Stimme in meinem Kopf kreischte, dass das eine ganz schlechte Idee war, trat ich durch die Vordertür, stellte meine Tasche im Büro ab, warf einen Labormantel über und eilte dann durch weitere Sicherheitsschranken und den Verbindungsgang zur biologischen Abteilung zum großen Autopsiesaal.
Ein Tisch war besetzt. Ich ging hinüber und schlug die blaue Papierabdeckung zurück, die die Leiche verhüllte.
Der Mann ohne Gesicht lag nackt auf dem Edelstahl, sein Fleisch bleich im Neonlicht.
Ohne Zögern zog ich mein Handy heraus und schoss Fotos vom Kopf bis hinunter zu den Füßen. Als ich mit der Leiche fertig war, ging ich zur Arbeitsfläche und fotografierte Kleidung und persönliche Habe des Mannes. Dann legte ich das Handy weg und streifte Latexhandschuhe über.
Hawkins kam herein, als ich eben ein Abstrich-Set aus einer Schublade holte. Er sah aus wie immer – ein großer, skelettaler Zombie mit ölig aus dem Gesicht gekämmten Haaren, das von einer knochigen Nase, eingefallenen Wangen und drahtdünnen Lippen geprägt wurde. Sein Alter konnte ich nicht schätzen. Sechzig? Achtzig? Seit Jahren ging im MCME der Witz, Hawkins sei in den Achtzigern gestorben und niemand habe es bemerkt.
Nur eine Braue fragend gehoben, schaute Hawkins kommentarlos zu, wie ich dem offenen Brustkorb des Mannes ohne Gesicht eine Probe entnahm.
»Sie haben mir wirklich keine Fotos von dem Kerl hier geschickt?«, fragte ich mit leiser Stimme.
»Nee.«
»Eine Ahnung, wer sie geschickt haben könnte?«
Hawkins schüttelte den Kopf.
»Wer hatte Zugang zu ihm?«
»Ein paar Leute.«
Ich wusste, dass das stimmte. Ich war bereits in Gedanken eine Liste der Verdächtigen durchgegangen. Ein Pathologe des MCME. Ein weiterer Todesermittler. Der erste Beamte am Tatort. Ein Techniker, der das Transportfahrzeug begleitet hatte. Die Jungs, die die Leiche entdeckt hatten. Aber von denen kam keiner so richtig infrage. Und der Absender musste jemand sein, der meine Handynummer hatte.
»Wie’s aussieht, arbeitet die Chefin an ihrer Fernsehkarriere.« Hawkins sprach ebenfalls mezza voce.
»Nicht, wenn ich es verhindern kann.« Ich steckte den Tupfer in ein Röhrchen.
»Vielleicht kann ich Ihren Maulwurf ja aufscheuchen.«
»Fragen Sie herum?«
»Diplomatisch.«
Ich warf Hawkins einen kurzen Blick zu. »Ich will Sie nicht in die Zwickmühle bringen.«
»Wird nicht passieren.«
Ich hatte kaum den Deckel auf das Röhrchen geschraubt, als hinter uns eine hohe, nasale Stimme ertönte. Während ich mir die Probe in die Tasche steckte, nahm Hawkins diskret mein Handy von der Arbeitsfläche.
Wir drehten uns beide langsam um. Ich zwang mich zu einem Lächeln.
»Was treiben Sie hier?« Heavner machte ein Gesicht, als wäre sie mit ihren Guccis in einen Hundehaufen getreten.
»Ich fuhr gerade vorbei und bekam Ihre Pressekonferenz mit.« Ich wollte nicht, dass sie von der anonymen Nachricht erfuhr. »Als ich hörte, dass Sie eine verwesende Leiche untersuchen, habe ich mich dazugesellt.«
»Soweit ich weiß, sind Sie für dieses Institut nur als Gutachterin tätig, wenn Sie explizit mündlich oder schriftlich darum gebeten wurden.«
»Dr. Larabee und ich –«
»Ich bin nicht Dr. Larabee.«
Ich sagte nichts.
»Glauben Sie ernsthaft, dass dieses Institut ohne Sie nicht funktioniert, Dr. Brennan? Dass ich nicht in der Lage bin einzuschätzen, ob Spezialwissen gefragt ist?«
Einen kurzen, kalten Moment lang trafen sich unsere Blicke.
»Sollte ich Ihre Dienste benötigen, werde ich Sie kontaktieren. Und jetzt gehen Sie bitte.«
Ich tat es, mit einem Brennen in der Brust wie nach einem Marathon.
Als ich zum Auto ging, fielen mir Paulette Youngmans Worte wieder ein. Die Ameise verliert immer.
Ich hatte eben den Annex betreten, als mein Festnetz klingelte.
Nachdem ich auf die Anruferkennung geschaut hatte, nahm ich ab.
»Süße, alles okay bei dir?«, fragte Mama, die Vokale breiter und triefender als bei Scarlett auf Tara.
»Natürlich bin ich okay.«
»Warum gehst du nicht an dein Handy?«
»Ich habe Akkuprobleme.« Das stimmte, war aber keine Antwort auf ihre Frage.
»Wo bist du?«
»Zu Hause.«
»Geht’s dir nicht gut?«
»Doch, sehr gut sogar. Ich gehe nachher aus.« Ich bedauerte es, kaum dass ich es gesagt hatte.
Überraschenderweise stürzte sie sich nicht sofort darauf. »Sinitch ist heute angekommen.« Mamas Verlobter hieß Clayton Sinitch. Aus irgendeinem Grund benutzte sie nie seinen Vornamen. »Er bleibt bis Mittwoch.«
»Das ist nett.«
»Na, das hoffe ich«, sagte sie ein bisschen wehmütig, als wollte sie, dass ich nachfrage.
Ich tat es nicht. »Habt ihr große Pläne?«
»Ich muss was mit seinen Füßen tun.«
»Seinen Füßen.«
»Sie riechen wie Suppe aus schmutzigen Unterhosen.«
Darauf ging ich lieber nicht näher ein.
»Vielleicht sollte ich eins dieser Fußgeruchprodukte kaufen, die es im Supermarkt gibt. Ein bisschen was in seine Schuhe streuen, während er unter der Dusche ist. Man würde meinen, dass Wasser und Seife das Problem lösen sollten.«
»Mm.«
»Er ist jetzt gerade im Bad und schrubbt sich ab. Ein Vorteil des Duschens ist, dass man ihn so nackt kriegt.«
Ein Bild, das ich wohl nie wieder loswerde.
»Sinitch ist ein wunderbarer Mann, aber manchmal vermisse ich deinen Daddy schon noch.«
»Ich weiß, Mama. Ich auch.«
Meine frühe Kindheit war eine glückliche Zeit gewesen. Ich wurde nicht missbraucht, herumgeschubst oder in ein Korsett aus absurd strengen religiösen Regeln gezwängt. Ich brach mir nie einen Knochen, brauchte keine Operation, musste nie genäht oder psychologisch betreut werden. Meine Schwester Harry und ich kamen einigermaßen gut miteinander aus. Mama litt an etwas, das man heute bipolare Störung nennt. Ab und zu verschwand sie für einige Zeit in einer Klinik, kam aber immer wieder nach Hause. Dann starb mein kleiner Bruder an Leukämie, und alles ging in die Brüche. Mama fiel in ein schwarzes Loch, aus dem sie für Jahre nicht herauskam. Daddy fing an, heftig zu trinken, und kam schließlich im Familien-Buick von der Straße ab und ums Leben. Jahrzehnte später fehlte mir mein Vater immer noch sehr.
»Ich rufe an, weil ich gerade im Bett liege und eine sehr interessante Sendung sehe.« Mama senkte die Stimme zu einem vertraulichen Flüstern. »Bearbeitest du diese Leiche, die von Schweinen angenagt wurde?«
Nur zur Information. Meine zierliche, grauhaarige Mutter hat ein Hirn wie ein Autobahnkreuz mit einem Wirrwarr aus Auf- und Abfahrten. Gespräche mit ihr verzweigen und verästeln sich, kehren manchmal auf die Hauptroute zurück, manchmal auch nicht. Jetzt waren wir also offenbar bei meiner Arbeit gelandet, die sie, aus welchen Gründen auch immer, faszinierte.
Und noch eine Information. Egal auf welcher Abzweigung sie sich gerade befindet, kann meine Mama Ausflüchte aufspüren wie eine Nachtsichtdrohne. Deshalb machte ich mir gar nicht die Mühe, diese Frage abzubiegen.
»Anscheinend nicht«, sagte ich.
»Macht diese schreckliche Frau dir immer noch Kummer? Wie heißt sie gleich wieder?«
»Margot Heavner.«
»Warum um alles in der Welt geht sie mit dir nur so gehässig um?«
»Ich habe sie vor Jahren mal beleidigt.«
»Wie denn? Hast du ihren Papagei vergiftet? Ihr in den Porridge gespuckt?«
»Ist das wichtig?«
»Ja«, sagte sie bestimmt.
Ich erzählte ihr alles. Hardin Symes. Die Interviews mit Body. Die Enthüllung von Hardins Autismus. Heavner, die Bodys Impfgegnertirade nicht widersprach. Dass ich sie unprofessionell genannt hatte.
Während ich sprach, kam Birdie in die Küche und betrachtete mich kontemplativ. Entweder das, oder er hatte Hunger.
Ich beschloss, das Auftauchen der Katze als Geste der Wiederannäherung zu interpretieren, stand auf und füllte seinen Napf auf. Mit dem Zeug aus der Dose, das er mag, nicht mit dem Trockenfutter. Er schnupperte und streckte sich, um seine Gleichgültigkeit zu zeigen. Als ich mich abwandte, ließ er das Theater und machte sich mit Appetit über das Fressen her.
Als ich mit meiner Geschichte fertig war, kam Mamas Reaktion schnell und heftig.
»Ich kann dem Mann seine offensichtliche Dummheit verzeihen. Gott weiß, gegen den IQ, den man ihm zugeteilt hat, kann er nichts machen. Aber Nick Body ist niederträchtig, gewissenlos und hinterhältig wie eine Schlange.«
»Hörst du dir seine Sendung an?«, fragte ich überrascht.
»Ich höre mir alles an.«
»Aber wenn du ihn nicht magst –«
»Ich muss doch wissen, welche Dummheiten in der Welt herumfliegen.«
Ich sagte nichts.
»Ich habe mal gehört, wie Body sich darüber ausließ, dass die Regierung Katzen für Bewusstseinskontrolle abrichtet. Kannst du das glauben?«
Mein Blick wanderte zu Birdie. Ich glaubte es.
»Ein anderes Mal schwadronierte er über einen Genozid an den Weißen und behauptete, Einwanderung, Mischehen, Geburtenkontrolle und Abtreibung würden benutzt, um die Weißen auszurotten.«
»Von wem benutzt?«
»Da blieb er ein bisschen vage. Ganz zu schweigen von der Populationsgenetik. Der Mann ignoriert wissenschaftliche Tatsachen völlig. Er glaubt nicht an den Klimawandel, beharrt darauf, dass die Erderwärmung nur ein teuflischer Schwindel ist. Wie die Mondlandung. Und die Fluorisierung der Wasserversorgung.«
Ich versuchte, das Thema zu wechseln. Doch Mama hatte einen Lauf.
»Hast du gewusst, dass dieses kleine Wiesel sein Gesicht kaum mal in der Öffentlichkeit zeigt? Kein Mensch weiß, wo er lebt oder was er tut, wenn er die Luft nicht mit seinem Geschwafel verpestet.«
»Das habe ich gelesen.«
»Er spuckt sein Gift und versendet die Dateien dann über Server in Bosnien, Borneo und Weißrussland, damit die ursprüngliche IP-Adresse nicht mehr aufzuspüren ist.«
Eine letzte Information. Meine Mutter ist ein verdammtes Genie, was Computer und die Manipulation des World Wide Web angeht. Zum Teil bin ich daran schuld. Als sie mal wieder eine dunkle Phase gehabt und in einer Klinik gelebt hatte, hatte ich ihr einen Laptop gekauft, um sie zu beschäftigen. Zu meiner Überraschung hatte sie sich mit Verve aufs Internet gestürzt und jede Menge Kurse zu diversen Cyber-Skills besucht. Jetzt ist sie nicht mehr zu stoppen.
Ich schaute auf die Uhr. 17:20.
»Mama, ich sollte Schluss machen.«
Ich konnte mir vorstellen, wie sich die Winkel ihrer Dior-getönten Lippen senkten. Dann: »Schätzchen, ein guter Rat, mach damit, was du willst: Du sagst, Heavner hatte keine Skrupel, mit diesem Zirkusclown von einem Wichtigtuer zu plaudern. Du sagst, jetzt hält sie dich von dem Job fern, den du seit Jahrzehnten machst. Mach’s trotzdem.«
»Wie bitte?«
»Schlag sie mit ihren eigenen Waffen. Wenn du dich dazu in der Lage fühlst.«
»Mit ihren eigenen Waffen?« Ich hatte keine Ahnung, was sie meinte.
»Mein Gott. Du bist brillant, aber du kannst auch echt langsam sein.« Ein megageduldiges Seufzen. »Identifiziere den Gesichtslosen auf eigene Faust. Wenn du das schaffst, ärgert sich deine neue Chefin schwarz. Und du beeindruckst vielleicht den Oberboss in Chapel Hill.«
»Aber –«