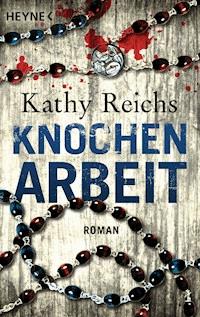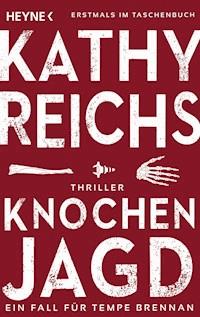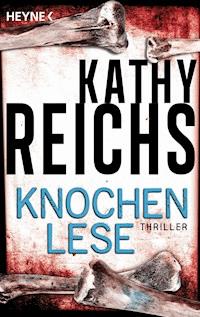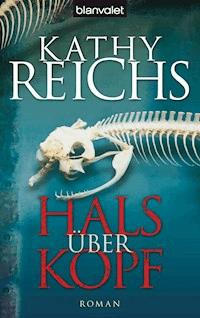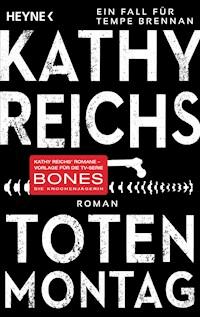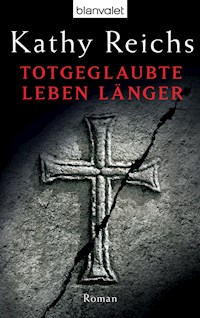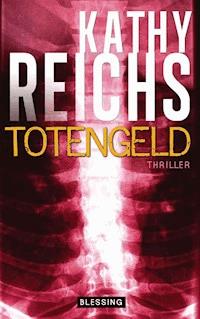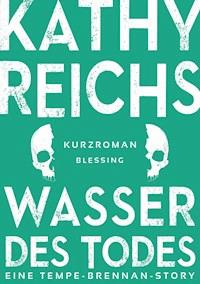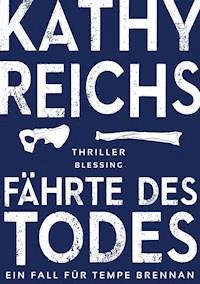7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Tempe-Brennan-Romane
- Sprache: Deutsch
»Ich kenne den Tod. Jetzt lauert er auf mich.«
Ein verlassenes Haus in Charlotte, North Carolina, ein grausiger Einsatz für Forensikerin Tempe Brennan: Neben Kupferkesseln, einem toten Huhn und seltsamen Artefakten liegt der abgetrennte Kopf eines Mädchens. Blitzartig geht ein Gerücht um: Ritualmord! Ein bibelfester Politiker auf Stimmenfang verdächtigt okkulte Kreise und ruft nach Vergeltung. Noch während Tempe den Tatort untersucht, bahnt sich in Charlotte eine gnadenlose Hexenjagd an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
DAS BUCH
Wie und wo das junge Mädchen zu Tode kam, kann Tempe sich nicht erklären, als sie im Dunkel des Kellers kniet. Genauso wenig wie die Herkunft eines Männertorsos, der wenig später am Ufer eines Sees gefunden wird. Als der Öffentlichkeit einige außergewöhnliche Details von den Fundorten bekannt werden, geraten in North Carolina ansässige religiöse Kulte in Verdacht — Santería, Wicca, Satanisten. Ein ehemaliger Prediger und wahlkämpfender Politiker denkt nicht daran, Brennans Ermittlungen abzuwarten. Er rät seinen Bürgern, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen.
»Einer der besten Thriller von Kathy Reichs!« NDR
»Packend, schonungslos im Detail und dennoch warmherzig.« TV Today
»Reichs neuer Thriller fasziniert.« Deutsche Presse-Agentur
DIE AUTORIN
Kathy Reichs, geboren in Chicago, lebt in Charlotte und Montreal. Sie ist Professorin für Soziologie und Anthropologie und unter anderem als forensische Anthropologin für gerichtsmedizinische Institute in Quebec und North Carolina tätig. Jeder ihrer Romane erreichte Spitzenplätze auf allen internationalen und deutschen Bestsellerlisten. Ihre Bücher wurden in 30 Sprachen übersetzt. Tempe Brennans Fälle laufen als höchst erfolgreiche Fernsehserie Bones – Die Knochenjägerin.
LIEFERBARE TITEL
Knochen zu Asche - Hals über Kopf - Mit Haut und Haar –Bones – Die Knochenjägerin - Mit Haut und Haar – Knochenlese-Durch Mark und Bein
1
Mein Name ist Temperance Deasee Brennan. Ich bin eins fünfundsechzig, reizbar und über vierzig. Mehrfach diplomiert. Überarbeitet. Unterbezahlt.
Dem Tode nah.
Ich strich dieses Fragment literarischer Inspiration durch und versuchte einen neuen Anfang.
Ich bin forensische Anthropologin. Ich kenne den Tod. Jetzt lauert er auf mich. Dies ist meine Geschichte.
O Mann. Die Wiedergeburt von Jack Webb und seinem Polizeibericht Los Angeles.
Wieder Striche durch die Zeilen.
Ich schaute auf die Uhr. 14 Uhr 45.
Ich ließ die autobiografischen Versuche sein und fing an zu kritzeln. Kreise in Kreisen. Das Ziffernblatt der Uhr. Das Konferenzzimmer. Der Campus der UNCC. Charlotte. North Carolina. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Erde. Die Milchstraße.
Um mich herum diskutierten meine Kollegen winzigste Details mit dem Eifer religiöser Fundamentalisten. In der augenblicklichen Debatte ging es um Formulierungen in einem Unterkapitel einer Selbststudie des Fachbereichs. Das Zimmer war stickig, das Thema zum Lidflattern langweilig. Die Sitzung dauerte schon über zwei Stunden, und die Zeit flog nicht gerade dahin. Ich fügte den äußersten meiner konzentrischen Kreise Spiralarme hinzu. Füllte Leerräume mit Punkten. Vierhundert Milliarden Sterne in der Galaxie. Am liebsten hätte ich meinen Stuhl auf Hyperdrive geschaltet und wäre zu einem von ihnen geflogen. Anthropologie ist ein sehr weites Feld, das aus verschiedenen, miteinander verbundenen Subspezialgebieten besteht. Biologisch. Kulturell. Archäologisch. Linguistisch. Unsere Fakultät hat das komplette Quartett. Und Mitglieder jeder Gruppe hatten das Bedürfnis mitzureden.
George Petrella ist Linguist, der über Mythen als Erzählungen der individuellen und kollektiven Identität forscht. Hin und wieder sagt er etwas, das ich verstehe.
In diesem Augenblick hatte Petrella etwas gegen die Formulierung »reduzierbar auf« vier unterschiedliche Bereiche. Er schlug als Ersatz »unterteilbar in« vor.
Cheresa Bickham, eine Archäologin aus dem Südwesten, und Jennifer Roberts, Spezialistin für kulturübergreifende Glaubenssysteme, hielten eisern an »reduzierbar auf« fest.
Da mir mein galaktischer Pointillismus langsam langweilig wurde und ich nicht wusste, wie ich meine Langeweile reduzieren oder in weniger langweilige Momente unterteilen sollte, verlegte ich mich auf die Kalligrafie.
Temperance. Von lateinisch temperantia, Mäßigung. Das Charaktermerkmal der Vermeidung von Exzessen.
Davon bitte eine doppelte Portion. Mit extra Zurückhaltung. Und ohne Ego.
Noch ein Blick auf die Uhr.
14 Uhr 58.
Das Gequassel ging weiter.
Um 15 Uhr 10 wurde eine Entscheidung getroffen. »Unterteilbar in« war der Sieger.
Evander Doe, der Fakultätsvorstand seit über einem Jahrzehnt, leitete die Sitzung. Obwohl er ungefähr so alt ist wie ich, sieht Doe aus wie jemand aus einem Gemälde von Grant Wood. Kahlköpfig. Mit Drahtgestellbrille, die ihn aussehen lässt wie eine Eule. Elefantenohren.
Fast alle, die Doe kennen, betrachten ihn als mürrisch. Ich nicht. Ich habe den Mann schon mindestens drei Mal lächeln gesehen.
Nachdem er »unterteilbar in« nun abhaken durfte, wandte Doe sich dem nächsten brennenden Thema zu. Ich unterbrach meine Krakeleien, um ihm zuzuhören.
Sollte die Selbstbeschreibung des Fachbereichs eher die historischen Beziehungen zu den Geisteswissenschaften und der kritischen Theorie betonen oder eher die immer wichtiger werdende Rolle der Naturwissenschaften und der empirischen Beobachtung unterstreichen?
Meine unvollendete Autobiografie hatte genau den Punkt getroffen. Ich würde wirklich sterben, bevor diese Sitzung abgeschlossen war.
Ein plötzlicher Einfall. Die berüchtigten Versuche zur sensorischen Deprivation in den 1950ern. Ich stellte mir Freiwillige mit blickdichten Brillen und gepolsterten Handschuhen vor, die auf Pritschen in schalldichten Kammern lagen.
Ich ging ihre Symptome durch und verglich sie mit meinem augenblicklichen Zustand.
Beklemmung. Depression. Antisoziales Verhalten. Halluzinationen.
Den vierten Punkt strich ich wieder. Ich war zwar gestresst und reizbar, aber Halluzinationen hatte ich keine. Noch nicht. Wobei ich nichts dagegen hätte. Ein lebhaftes Wahnbild wäre wahrscheinlich eine Ablenkung gewesen.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin noch keine Zynikerin, was die Lehre angeht. Ich bin sehr gern Professorin. Ich bedaure, dass der Austausch mit meinen Studenten von Jahr zu Jahr weniger wird.
Warum so wenig Zeit im Hörsaal? Zurück zu der Sache mit der Subspezialisierung.
Haben Sie mal versucht, einfach nur zum Arzt zu gehen? Vergessen Sie’s. Man muss zum Kardiologen. Zum Dermatologen. Zum Endokrinologen. Zum Gastroenterologen. Wir leben in einer spezialisierten Welt. In meinem Bereich ist das nicht anders.
Anthropologie: das Studium des menschlichen Organismus. Biologische Anthropologie: das Studium der Biologie, der Variabilität und der Evolution des menschlichen Organismus. Osteologie: das Studium der Knochen des menschlichen Organismus. Forensische Anthropologie: das Studium der Knochen des menschlichen Organismus zu juristischen Zwecken.
Folgen Sie einfach den Verzweigungen, und dort finden Sie mich. Obwohl ich von der Ausbildung her Bioarchäologin bin und meine Karriere mit der Ausgrabung und Untersuchung uralter Überreste begonnen habe, wechselte ich vor Jahren in die Forensik. Habe mich auf die dunkle Seite geschlagen, wie meine ehemaligen Kommilitonen mich noch immer aufziehen. Verlockt von Ruhm und Reichtum. Ja, genau. Eine gewisse Ruchbarkeit vielleicht. Aber Reichtum auf keinen Fall.
Forensische Anthropologen arbeiten mit den relativ frisch Verstorbenen. Wir werden engagiert von Ermittlungsbehörden, Leichenbeschauern, Staatsanwälten, Strafverteidigern, dem Militär, Menschenrechtsgruppen und Bergungsteams bei Massenkatastrophen. Ausgehend von unserem Wissen über Biomechanik, Genetik und Skelettanatomie beschäftigen wir uns mit Fragen der Identifikation, der Todesursache, des postmortalen Intervalls, auch Leichenliegezeit genannt, und der postmortalen Veränderung der Leiche. Wir untersuchen die Verbrannten, die Verwesten, die Mumifizierten, die Verstümmelten und Zerstückelten und die Skelettierten. Wenn wir diese Leichen zu Gesicht bekommen, sind sie oft bereits in einem viel zu schlechten Zustand, als dass eine Autopsie noch Ergebnisse liefern könnte.
Als Angestellte des Staates North Carolina stehe ich sowohl bei der UNC-Charlotte unter Vertrag wie beim Office of the Chief Medical Examiner, dem obersten Leichenbeschauer, der Einrichtungen in Charlotte und Chapel Hill hat. Zusätzlich bin ich als wissenschaftliche Beraterin für das Laboratoire de sciences judiciaires et de médicine légale in Montreal tätig.
North Carolina und Quebec? Außergewöhnlich. Aber davon später.
Wegen meines grenzüberschreitenden Engagements und meiner doppelten Verpflichtung in North Carolina unterrichte ich an der UNCC nur einen Kurs, ein Oberseminar in forensischer Anthropologie. So verbringe ich zweimal jährlich ein Semester im Klassenzimmer.
Und im Konferenzzimmer.
Auf das Unterrichten freue ich mich. Was ich nicht ausstehen kann, sind diese endlosen Sitzungen. Und die Fakultätspolitik.
Irgendjemand stellte den Antrag, dass die Fakultätsselbstbeschreibung an die Ausschüsse zurückverwiesen werden sollte. Was mich anging, hätte man das Ding auch nach Simbabwe schicken können, um es dort auf ewig zu verbuddeln.
Doe kam nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. Einrichtung eines Ausschusses für Berufsethik.
Innerlich aufstöhnend, begann ich mit einer Liste meiner noch zu erledigenden Pflichten.
1. Gewebeproben an Alex
Alex ist meine Laborassistentin. Aus meiner Sammlung würde sie ein Knochenquiz für das nächste Seminar zusammenstellen.
2. Bericht an LaManche
Pierre LaManche ist Pathologe und Chef der gerichtsmedizinischen Abteilung des LSJML. Der letzte Fall, den ich vor meiner Abreise aus Montreal in der vergangenen Woche bearbeitete, war das Opfer eines Fahrzeugbrands. Nach meiner Beurteilung handelte es sich um einen gut dreißigjährigen weißen Mann.
Pech für LaManche war nur, dass der Fahrer des Autos eine neunundfünfzigjährige Asiatin hätte sein sollen. Pech für das Opfer war, dass jemand ihm zwei Kugeln in den linken Scheitellappen gejagt hatte. Pech für mich war, dass der Fall ein Mord war und ich wahrscheinlich vor Gericht erscheinen musste.
3. Bericht an Larabee
Tim Larabee ist der Medical Examiner, der Leichenbeschauer des Mecklenburg County und Direktor der aus drei Pathologen bestehenden Einrichtung in Charlotte. Sein Fall war der erste gewesen, den ich mir nach meiner Rückkehr nach North Carolina vorgenommen hatte, ein aufgeblähter und verwester Torso, der am Catawba River ans Ufer gespült worden war. Die Beckenstruktur hatte darauf hingedeutet, dass es sich um eine männliche Person handelte. Die Skelettentwicklung hatte das Alter auf eine Zeitspanne zwischen zwölf und vierzehn Jahren eingegrenzt. Verheilte Frakturen der vierten und fünften Mittelfußknochen der linken Extremität deuteten die Möglichkeit einer Identifikation anhand von antemortalen Krankenhausberichten und Röntgenaufnahmen an, soweit diese gefunden werden konnten.
4. Larabee anrufen
Als ich heute auf den Campus kam, hatte ich eine Zwei-Wort-Nachricht vom MCME auf meinem Anrufbeantworter gefunden: Bitte zurückrufen. Ich hatte eben gewählt, als Petrella kam, um mich in die Sitzungshölle zu schleifen.
Als ich das letzte Mal mit Larabee gesprochen hatte, lag ihm noch keine vermisste Person vor, die zum Profil des Opfers vom Catawba River passte. Vielleicht hatte er jetzt eine. Ich hoffte es, der Familie zuliebe. Und des Jungen.
Ich dachte an das Gespräch, das Larabee mit den Eltern würde führen müssen. Ich hatte sie auch schon geführt, hatte diese lebenszerstörenden Nachrichten überbracht. Das ist das Schlimmste an meinem Job. Es gibt keine einfache Art, einer Mutter und einem Vater mitzuteilen, dass ihr Kind tot ist. Dass seine Beine gefunden wurden, der Kopf aber fehlt.
5. Empfehlungsschreiben für Sorenstein
Rudy Sorenstein war ein Diplomand, der sich Hoffnungen machte, sein Studium in Harvard oder Berkeley fortzusetzen. Kein Brief von mir würde das bewirken können. Aber Rudy gab sich große Mühe. Arbeitete gut mit anderen zusammen. Ich würde seinen mittelmäßigen Notendurchschnitt im bestmöglichen Licht erscheinen lassen.
6. Einkaufen mit Katy
Kathleen Brennan Petersons ist meine Tochter, die seit diesem Herbst in Charlotte lebt und als Rechercheurin im Büro des Pflichtverteidigers arbeitet. Nachdem sie die letzten sechs Jahre als Studentin an der Universität von Virginia verbracht hatte, brauchte Katy jetzt dringend irgendetwas in ihrer Garderobe, das nicht aus Jeansstoff bestand. Und Geld, um es zu kaufen. Ich hatte angeboten, ihr als Modeberaterin zu dienen. Und jetzt kommt die Ironie. Pete, mein von mir getrennter Ehemann, fungierte als Mittelbeschaffer.
7. Katzenstreu für Birdie
Birdie ist mein Kater. Er ist ziemlich pingelig, was seine Toilette angeht, und drückt sein Missfallen auf eine Art aus, die ich zu vermeiden versuche. Leider ist Birdies bevorzugte Streumarke nur bei Tierärzten erhältlich.
8. Kontrolluntersuchung beim Zahnarzt
Die Benachrichtigung hatte ich gestern in der Post. Klar. Das würde ich aber so was von sofort erledigen.
9. Reinigung
10. Autoinspektion
11. Duschtürgriff
Ich hörte, nein, spürte eher ein merkwürdiges Geräusch im Zimmer. Stille. Als ich den Kopf hob, sah ich, dass alle Augen auf mich gerichtet waren.
»Entschuldigung.« Ich schob so beiläufig wie möglich eine Hand über meinen Notizblock.
»Was bevorzugen Sie, Dr. Brennan?«
»Können Sie es bitte wiederholen?«
Doe las vor, was, wie ich annahm, drei heftigst debattierte Namen waren.
»Ausschuss zu professioneller Verantwortung und professionellem Verhalten. Ausschuss zur Evaluierung ethischer Verfahrensweisen. Ausschuss zu ethischen Standards und Praktiken.«
»Letzterer impliziert die Aufbürdung von Regeln durch ein externes Gremium oder eine externe Regulierungskommission.« Petrella gab sich bockig.
Bickham warf ihren Stift auf den Tisch. »Nein. Das tut er nicht. Das ist ganz einfach –«
»Die Fakultät setzt einen Ethikausschuss ein, oder?«
»Es ist wesentlich, dass der Name dieser Kommission ein präzises Abbild der philosophischen Grundlagen –«
»Ja.« Does Antwort auf meine Frage schnitt Petrella das Wort ab.
»Warum nennen wir ihn nicht Ethikausschuss?«
Zehn Augenpaare starrten in meine Richtung. Einige schauten verwirrt. Andere überrascht. Einige beleidigt.
Petrella sackte auf seinem Stuhl zusammen.
Bickham hüstelte.
Roberts senkte den Blick.
Doe räusperte sich. Bevor er etwas sagen konnte, unterbrach ein leises Klopfen die Stille.
»Ja?« Doe.
Die Tür ging auf, im Spalt erschien ein Gesicht. Rund. Sommersprossig. Besorgt. Zweiundzwanzig neugierige Augen drehten sich ihm zu.
»Entschuldigung, dass ich störe.« Naomi Gilder war die neueste der Fakultätssekretärinnen. Und die schüchternste. »Ich würde es natürlich nie tun, außer …«
Naomis Blick wanderte zu mir.
»Dr. Larabee meinte, er müsse dringend mit Dr. Brennan sprechen. «
Am liebsten hätte ich die Faust hochgerissen. Ja! Stattdessen hob ich entschuldigend Augenbrauen und Hände. Die Pflicht ruft. Was kann man da machen?
Ich raffte meine Papiere zusammen, verließ das Zimmer und tanzte fast durch den Empfangsbereich und den Gang mit den Fakultätsbüros entlang. Alle Türen waren geschlossen. Natürlich waren sie das. Die Benutzer waren eingepfercht in einem fensterlosen Zimmer, um administrative Trivialitäten zu besprechen.
Ich fühlte mich beschwingt. Frei!
Ich betrat mein Büro und wählte Larabees Nummer. Mein Blick wanderte zum Fenster. Vier Etagen unter mir strömten Studentengruppen zwischen Nachmittagsseminaren hin und her. Lange, schräge Strahlen bronzierten die Bäume und Farne im Van Landingham Glen. Als ich zu der Sitzung gegangen war, hatte die Sonne genau senkrecht gestanden.
»Larabee.« Seine Stimme war ein wenig hoch und hatte einen weichen, südlichen Akzent.
»Tempe hier.«
»Hab ich Sie aus irgendwas Wichtigem herausgerissen?«
»Prätentiöse Wichtigtuerei.«
»Wie bitte?«
»Egal. Geht’s um die Wasserleiche aus dem Catawba River?«
»Ein Zwölfjähriger aus Mount Holly namens Anson Tyler. Die Eltern waren auf Zockertour in Las Vegas. Kamen vorgestern zurück und stellten fest, dass der Junge seit einer Woche nicht mehr zu Hause war.«
»Wie konnten sie das so genau feststellen?«
»Sie haben die verbliebenen Pop-Tarts gezählt.«
»Haben Sie sich medizinische Unterlagen beschaffen können?«
»Ich will natürlich Ihre Meinung hören, aber ich würde wetten, dass die gebrochenen Zehen auf Tylers Röntgenaufnahmen denen unseres Opfers entsprechen.«
Ich stellte mir den kleinen Anson allein zu Hause vor. Fernsehen. Erdnussbutter-Sandwiches schmieren und Pop-Tarts toasten. Bei eingeschaltetem Licht schlafen.
Meine Beschwingtheit verschwand. »Welche Trottel verreisen und lassen einen zwölfjährigen Jungen allein zu Hause?«
»Die Tylers werden bestimmt nicht für die Eltern des Jahres nominiert.«
»Werden sie sich wegen Vernachlässigung verantworten müssen? «
»Minimal.«
»Ist Anson Tyler der Grund Ihres Anrufs?« Laut Naomi hatte Larabee gesagt, es sei dringend. Eine eindeutige Identifikation fällt normalerweise nicht in diese Kategorie.
»Zuerst.Aber jetzt nicht mehr. Hatte eben einen Anruf von den Jungs vom Morddezernat. Kann sein, dass die eine ziemlich üble Sache haben.«
Ich hörte zu.
Beklommenheit vertrieb auch noch den letzten Rest meines beschwingten Zwischenhochs.
2
»Kein Zweifel, dass die Knochen menschlich sind?«
»Zumindest ein Schädel.«
»Es gibt mehr als einen?«
»In der Meldung wurde diese Möglichkeit angedeutet, aber die Beamten wollten nichts anrühren, solange Sie nicht da sind.«
»Gut mitgedacht.«
Szenario: Bürger stolpert über Knochen, ruft die 911. Polizei kommt, denkt, es ist altes Zeug, fängt an, einzutüten und zu beschriften. Ende vom Lied: Der Kontext ist verloren, der Fundort versaut. Ich muss in einem Vakuum arbeiten.
Szenario: Hund buddelt heimliches Grab auf. Der örtliche Coroner macht sich mit Schaufeln und einem Leichensack daran. Ende vom Lied: Teile werden übersehen. Ich bekomme Überreste mit vielen Lücken.
Wenn ich mich mit solchen Situationen herumschlagen muss, sind meine Bemerkungen nicht immer freundlicher Natur. Im Lauf der Jahre ist meine Botschaft angekommen.
Dazu kommt, dass ich für den ME in Chapel Hill und die Polizei von Charlotte-Mecklenburg einen Leichenbergungs-Workshop gebe.
»Der Cop meinte, der Fundort stinkt.«
Das klang nicht gut.
Ich griff mir einen Stift. »Wo?«
»Greenleaf Avenue, drüben im First Ward. Haus wird gerade renoviert. Der Klempner hat eine Wand aufgeschlagen und eine Art unterirdische Kammer entdeckt. Moment mal.«
Papier raschelte, dann las Larabee die Adresse vor. Ich schrieb mit.
»Anscheinend war dieser Klempner völlig aus dem Häuschen. «
»Ich kann sofort hinfahren.«
»Das wäre gut.«
»Bis in dreißig Minuten dann.«
Ich hörte ein Stocken in Larabees Atmung.
»Probleme?«, fragte ich.
»Ich habe ein Mädchen offen auf dem Tisch liegen.«
»Was ist passiert?«
»Die Fünfjährige kam aus dem Kindergarten nach Hause, aß einen Donut, klagte über Bauchschmerzen und kippte um. Zwei Stunden später wurde sie im CMC für tot erklärt. Die Geschichte ist herzzerreißend. Das einzige Kind, keine Vorerkrankungen, bis zu dem Vorfall völlig symptomfrei.«
»O Gott. Was hat sie umgebracht?«
»Kardio-Rhabdomyom.«
»Das ist?«
»Ein verdammt großer Tumor in der Herzscheidewand. Kommt in dem Alter sehr selten vor. Die Kinder sterben normalerweise bereits als Säuglinge.«
Der arme Larabee hatte mehr als nur ein herzzerreißendes Gespräch vor sich.
»Beenden Sie Ihre Autopsie«, sagte ich. »Ich kümmere mich um die Kammer des Schreckens.«
Charlotte: Alles begann mit einem Fluss und einer Straße.
Der Fluss war zuerst da. Nicht der Mississippi oder der Orinoko, aber ein recht ansehnliches Flüsschen, an dessen Ufern sich Hirsch, Bison und Truthahn tummelten. Große Taubenschwärme flogen darüber hinweg.
Diejenigen, die zwischen den wilden Erbsenranken am Ostufer lebten, nannten ihren Flusslauf Eswa Taroa, »den großen Fluss«. Sie selbst nannte man deshalb die Catawba, »die Menschen des Flusses«.
Das Hauptdorf der Catawba, Nawvasa, lag im Quellgebiet des Sugar Creek, auch Soogaw oder Sugau genannt, und diese Siedlung, deren Name einfach nur »Ansammlung von Hütten« bedeutete, gründete sich nicht ausschließlich auf ihre Nähe zum Fluss. Nawvasa schmiegte sich außerdem an eine geschäftige indianische Handelsroute, den Großen Handelspfad. Waren und Nahrungsmittel strömten auf diesem Pfad von den Great Lakes zu den Carolinas und weiter zum Savannah River.
Nawvasa bezog seinen Lebenssaft sowohl vom Fluss wie von der Straße.
Die Ankunft fremder Männer auf großen Schiffen beendete das alles.
Als Dank für ihre Mithilfe bei seiner Wiedererlangung der Macht schenkte der englische König Charles II. acht Männern das Land südlich von Virginia und in westlicher Richtung bis zur »Südsee«. Charlies neue »Landeigentümer« schickten prompt Leute, die ihre Besitztümer vermessen und erkunden sollten.
Im Verlauf des nächsten Jahrhunderts kamen Siedler mit Planwagen, auf Pferden oder auch auf durchgelatschten Schuhsohlen. Deutsche, Hugenotten, Schweizer, Iren und Schotten. Langsam, aber unausweichlich gingen der Fluss und die Straße von den Catawba in europäische Hände über.
Blockhütten und Farmen ersetzten die indianischen Rindenhäuser. Tavernen, Gasthöfe und Läden entstanden. Kirchen. Ein Gericht. An einer Kreuzung mit einer weniger bedeutenden Straße saß nun ein neues Dorf mitten auf dem Großen Handelspfad.
1761 heiratete George III. die Herzogin Sophia Charlotte von Mecklenburg-Strelitz aus Deutschland. Anscheinend hatte seine siebzehnjährige Braut die Fantasie der Leute, die zwischen Fluss und Straße lebten, sehr angeregt. Vielleicht wollte sich die Bevölkerung bei dem verrückten britischen König aber auch nur einschmeicheln. Warum auch immer, sie nannten ihr kleines Dorf Charlotte Town und ihr County Mecklenburg.
Aber diese Freundschaft war wegen der Entfernung und der politischen Entwicklung zum Scheitern verurteilt. Die amerikanischen Kolonien wurden immer wütender, waren reif für die Revolte. Mecklenburg County machte da keine Ausnahme.
Im Mai 1775 versammelten sich die Führer von Charlotte Town. Sie waren verärgert über die Weigerung seiner Majestät, ihrem geliebten Queens College den Freibrief zu gewähren, und erzürnt darüber, dass Rotröcke in Lexington, Massachusetts, auf Amerikaner geschossen hatten. Ohne groß auf Diplomatie und taktvolle Formulierungen zu achten, verfassten sie die Mecklenburg Declaration of Independence, die Unabhängigkeitserklärung für ihr County, in der sie sich selbst zum »freien und unabhängigen Volk« erklärten.
Jessir. Die Männer, die diese Mec Dec schrieben, fackelten nicht lange. Ein Jahr, bevor der Continental Congress Feder und Papier zur Hand nahm, schickten sie Old George bereits in die Wüste.
Der Rest der Geschichte ist bekannt. Revolution. Emanzipation und Bürgerkrieg. Rekonstruktion und Jim Crow. Industrialisierung. Was in North Carolina Textilindustrie und Eisenbahn bedeutete. Weltkriege und Depression. Segregation und Bürgerrechte. Der Niedergang des Rostgürtels, der Schwerindustriestaaten im Nordosten, und der Wiederaufstieg des Sonnengürtels, der klimatisch begünstigten Südstaaten.
Bis 1970 war die Bevölkerung von Charlotte auf etwa vierhunderttausend angewachsen. 2005 hatte sich diese Zahl bereits verdoppelt. Warum? Etwas Neues reiste auf diesem Pfad. Geld. Und Orte, an denen man es verwahren konnte. Während viele Staaten Gesetze hatten, die die Anzahl von Filialen, die eine Bank haben durfte, einschränkten, sagte die Legislative von North Carolina: »Seid fruchtbar und mehret euch.«
Und sie vermehrten sich. Die vielen Filialen führten zu vielen Konten, und die vielen Konten erwiesen sich als sehr fruchtbar. Kurz gesagt, die Queen City ist die Heimat von zwei Schwergewichten der Finanzindustrie, der Bank of America und der Wachovia. Wie die Bürger Charlottes häufig und mit großem Vergnügen bemerken, nimmt ihre Stadt gleich hinter New York City den zweiten Platz als amerikanisches Finanzzentrum ein.
Die Trade und die Tryon Street überdecken nun den alten Handelspfad und die Querroute. Diese Kreuzung wird beherrscht vom Bank of America Corporate Center, ein passendes Totem aus Glas, Stein und Stahl.
Von Trade und Tryon aus erstreckt sich der alte Kern Charlottes als Block von Quadranten, die, nicht sehr kreativ, First, Second, Third und Fourth Ward genannt werden, also erster, zweiter, dritter und vierter Bezirk. Geblendet von der Vision ihrer Stadt als Kind des Neuen Südens, hatten die Einwohner Charlottes wenig Interesse daran, das historische Erbe dieser Innenstadtviertel zu bewahren. Die einzige und relativ junge Ausnahme ist der vierte Bezirk.
Der nordwestliche Quadrant, Fourth Ward, wurde von der städtischen Elite des neunzehnten Jahrhunderts erbaut und glitt dann in vornehmen Verfall ab. Mitte der Siebziger wurde der Fourth Ward, dank des ehrenamtlichen Engagements zahlreicher Stahl-Magnolien und einiger freundlicher Finanzierungsmodelle der Banken, zum Ziel intensiver Renovierungs- und Restaurierungsbemühungen. Heutzutage teilen sich prächtige, alte Stadthäuser schmale Straßen mit traditionellen Pubs und mäßig modernen Wohnhäusern. Gaslaternen. Kopfsteinpflaster. Ein Park in der Mitte. Sie wissen, was ich meine.
Früher war der Second Ward die Kehrseite des lilienweißen Fourth. Südöstlich des Stadtzentrums gelegen, bedeckte Log Town, später auch Brooklyn genannt, den größten Teil der Fläche des Ward. War Brooklyn ehemals Heimat von schwarzen Predigern, Ärzten, Zahnärzten und Lehrern, existiert dieses Viertel heute so gut wie nicht mehr, nachdem es für den Bau des Marshall Park, des Education Center, eines Verwaltungsgebäudes und eines Autobahnzubringers zur Interstate 77 planiert wurde.
First und Third Ward liegen im Nordwesten und im Südwesten. Drängten sich dort früher Lagerhallen, Fabriken, Gleise und Spinnereien, so reihen sich jetzt Wohnblöcke, Stadthäuser und Eigentumswohnanlagen aneinander. Courtside. Quarterside. The Renwick. Oak Park. Trotz der städtischen Strategie »Aus alt mach neu« existieren hier und da noch immer einige alte Wohnstraßen. Larabees Wegbeschreibung führte mich in den Third Ward.
Als ich von der I-77 auf die Morehead einbog, streifte mein Blick die Monolithen, die die Skyline der Stadt bildeten. One Wachovia Center. The Westin Hotel. Das Panthers-Stadion mit vierundsiebzigtausend Sitzplätzen. Was, so fragte ich mich, würden die Bewohner von Nawvasa von der Metropolis halten, die jetzt ihr Dorf überwucherte?
Am Ende der Ausfahrt bog ich links ab, dann noch einmal auf die Cedar und fuhr dann an einer Ansammlung erst kürzlich zu Wohnzwecken umgebauter Lagerhäuser vorbei. Einer gestutzten Eisenbahnlinie. Den Light Factory Fotostudios. Einem Obdachlosenasyl.
Rechts von mir erstreckte sich das Trainingszentrum der Panthers, das Grün der Sitze stumpf im Licht der frühen Dämmerung. Als ich nach links in die Greenleaf einbog, fuhr ich plötzlich durch einen Tunnel aus Weideneichen. Direkt vor mir lag eine offene Fläche, von der ich wusste, dass es der Frazier Park sein musste.
Die Häuser links und rechts der Straße unterteilten sich in zwei Gruppen. Viele waren von Yuppies gekauft worden, die die Nähe zum Stadtzentrum suchten und die ihren neuen Besitz mit Farben wie Queen Anne Lila oder Smythe Tavern Blau gestrichen hatten. Andere gehörten noch ihren ursprünglichen afroamerikanischen Besitzern, einige davon verwittert und heruntergekommen im Vergleich zu ihren herausgeputzten Nachbarn und mit Bewohnern, die ängstlich auf die neue Grundsteuereinschätzung warteten.
Trotz des Kontrastes zwischen den Wiedererstandenen und den noch zu Restaurierenden war die Arbeit fleißiger Hände überall in der Straße sichtbar. Wege waren gefegt. Rasen waren gemäht. Fensterkästen quollen über vor Ringelblumen und Chrysanthemen.
Larabees Adresse gehörte zu den wenigen Ausnahmen, eine schäbige Hütte mit geflickter Außenverkleidung, durchhängenden Zierleisten und abblätternder Farbe. Der Garten bestand vorwiegend aus Erde und Staub, und auf der vorderen Veranda stapelten sich Wagenladungen biologisch nicht abbaubaren Mülls. Ich parkte hinter einem Streifenwagen der Polizei von Charlotte-Mecklenburg und fragte mich, wie viele potentielle Käufer schon an die verwitterte grüne Haustür des Bungalows geklopft hatten.
Ich stieg aus, verschloss den Mazda und holte meine Ausrüstung aus dem Kofferraum. Zwei Häuser weiter unten warf ein etwa zwölfjähriger Junge einen Ball in einen am Garagentor befestigten Korb. Aus seinem Ghettoblaster hämmerte Rap, während der Ball mit sanftem Plonk auf die Kieseinfahrt fiel.
Der Bürgersteig war holperig, weil Baumwurzeln die Platten anhoben. Ich hielt den Blick gesenkt, als ich die verzogenen Stufen zur Veranda hochstieg.
»Sind Sie die, wo ich mit reden muss, damit ich nach Hause kann?«
Ich hob den Kopf.
Ein Mann saß in einer verrosteten und gefährlich schiefen Hollywoodschaukel. Er war groß und dünn, seine Haare hatten die Farbe von Aprikosenkonfitüre. Über seiner Brusttasche waren der Name Arlo und ein stilisierter Schraubenschlüssel eingestickt.
Arlo hatte mit gespreizten Knien, die Ellbogen auf den Oberschenkeln und das Gesicht in den Händen dagesessen, bis er meine Schritte gehört und den Kopf gehoben hatte.
Bevor ich antworten konnte, stellte er eine zweite Frage.
»Wie lange muss ich noch hierbleiben?«
»Sind Sie der Herr, der neun-eins-eins angerufen hat?«
Arlo verzog das Gesicht und zeigte dabei einen verfaulten Zahn unten rechts.
Ich betrat die Veranda. »Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben?«
»Hab ich schon.« Arlo verschränkte schmutzige Hände. Seine graue Hose war am linken Knie aufgerissen.
»Sie haben eine Aussage abgegeben?« Sanft. Die Körpersprache des Mannes deutete auf echtes Leid hin.
Arlo nickte, und der Kopf wippte gegenläufig zum Torso, der so schief hing wie die Schaukel.
»Können Sie zusammenfassen, was Sie gesehen haben?«
Jetzt wackelte der Kopf von links nach rechts. »Das Werk des Teufels.«
Okay.
»Sie sind Arlo …?«
»Welton.«
»Der Klempner.«
Arlo nickte noch einmal. »Verlege seit dreißig Jahren Rohre. So was ist mir noch nie untergekommen.«
»Erzählen Sie mir, was passiert ist.«
Arlo schluckte. Schluckte noch einmal.
»Ich wollte die Anschlüsse auswechseln. Die Frau des neuen Besitzers will irgend ’ne neumodische Waschmaschine reinstellen, irgendwas Grünes, was die Umwelt rettet. Das Ding braucht andere Rohranschlüsse. Gott weiß, warum sie damit anfangen will, wo in dem Haus noch so viel zu richten ist. Aber das geht mich nichts an. Wie auch immer, ich fange also an einer Wand an, und mir fällt ein Ziegel runter, der ein Loch in den Bodenbelag schlägt. Ich denke mir, Arlo, wenn du den Bodenbelag kaputt machst, dann ziehen sie dir die Reparatur von deinem Lohn ab. Also rolle ich den Bodenbelag zurück, und was finde ich drunter? Ein dickes, altes Holzbrett.«
Arlo hielt inne.
Ich wartete.
»Weiß auch nicht, warum, aber ich stupse das Ding mit meiner Schuhspitze an, und das andere Ende kippt nach oben.«
Wieder hielt Arlo inne, weil er sich, wie ich vermutete, an ein bisschen mehr als an einen Stups erinnerte.
»Das Brett gehörte zu einer Luke?«
»Das Ding hat so eine Art Schlupfloch abgedeckt. Ich muss zugeben, die Neugier war stärker als ich. Ich hab mir meine Taschenlampe geschnappt und reingeleuchtet.«
»In einen Unterkeller.«
Arlo zuckte die Achseln. Ich ließ ihm Zeit, damit er weiterredete. Er tat es nicht.
»Und?«, fragte ich noch einmal.
»Ich bin ein guter Kirchgänger. Immer Sonntag und Mittwoch. Gesehen habe ich den Teufel noch nie, aber ich glaube an ihn. Glaube, dass er in der Welt ist und unter uns sein böses Werk tut.«
Arlo fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund.
»Was ich gesehen habe, war der Satan persönlich.«
Obwohl der Tag noch immer warm war, überlief mich ein Schauer.
»Sie haben berichtet, Sie hätten einen menschlichen Schädel gesehen.« Sehr sachlich.
»Ja, Ma’am.«
»Was sonst noch?«
»Will das Böse nicht in Worte fassen. Ist besser, Sie sehen es mit eigenen Augen.«
»Sind Sie in den Unterkeller gestiegen?«
»Auf gar keinen Fall.«
»Was haben Sie getan?«
»Bin so schnell nach oben, wie ich konnte. Hab dann die Polizei gerufen. Kann ich jetzt gehen?«
»Der Beamte ist unten?«
»Ja, Ma’am. Den Gang entlang, dann durch die Küche.«
Arlo hatte recht. Besser, ich sah es mit eigenen Augen.
»Danke, Mr. Welton. Das sollte nicht mehr lange dauern.«
Ich ging über die Veranda und betrat das Haus. Hinter mir quietschte die Schaukel, als Arlo das Gesicht wieder in die Hände stützte.
Die Haustür öffnete sich direkt in einen schmalen Korridor. Rechts lag ein gallegrünes Wohnzimmer. Ein kaputtes Fenster war mit Pappkarton und Isolierband repariert. Möbel gab es kaum. Einen mottenzerfressenen Lehnsessel. Ein übel von Katzenkrallen zugerichtetes Sofa.
Links lag ein Esszimmer, leer bis auf ein Sideboard aus Astkiefer, eine Matratze und einen Stapel Reifen.
Ich ging weiter den Gang entlang und betrat dann eine Küche, die 1956 bereits retro gewesen wäre. Philco-Kühlschrank mit Kuppeldach. Kelvinator-Herd. Essecke aus rotem Resopal und Chrom. Grau gesprenkelte Resopal-Arbeitsflächen.
Links des Kelvinators stand eine Tür offen. Dahinter konnte ich eine Holztreppe erkennen und hörte Stimmen, die von unten heraufdrangen.
Ich nahm meinen Koffer in die linke Hand, griff mit der rechten nach dem Geländer und stieg langsam nach unten. Schon nach zwei Stufen stellten sich mir die Nackenhaare auf.
Unbewusst schaltete ich auf Mundatmung um.
3
Der Geruch war zwar nur schwach, aber unverkennbar – süß und muffig-eklig. Er kündete von verfaulendem Fleisch.
Aber das war nicht der widerliche Gestank, bei dem es einem den Magen umdreht und der mir so vertraut ist. Der Gestank aktiver Verwesung. Der Gestank von Eingeweiden, die von Maden und aasfressenden Insekten verwüstet werden. Von Fleisch, das im Wasser grün und aufgebläht wurde. Kein anderer Geruch kann da mithalten. Er sickert in die Poren, die Nase, die Lunge, die Kleidung, und er begleitet einen nach Hause wie Rauch aus einer Bar. Noch lange nach dem Duschen hängt er in den Haaren, klebt er im Mund und in den Gedanken.
Der Geruch hier war milder. Aber unbestreitbar.
Ich hoffte auf ein Eichhörnchen. Oder einen Waschbär, der sich durch eine Wand genagt hatte und dann in dem Keller gefangen war. Doch dann dachte ich an Larabees Worte und Arlos Aufregung, und beide Szenarien kamen mir sehr unwahrscheinlich vor.
Die Temperatur sank mit jedem Schritt nach unten. Die Feuchtigkeit stieg. Als ich den Kellerboden erreicht hatte, fühlte sich das Geländer kühl und feucht an.
Bernsteinfarbenes Licht strömte aus einer Birne, die an einem fransigen Kabel von der Decke hing. Ich trat auf das festgestampfte Erdreich und schaute mich um.
Der Keller war knapp zwei Meter hoch und unterteilt in eine Reihe kleiner Verschläge. Sperrholzwände und vorfabrizierte Türen deuteten darauf hin, dass die Unterteilung erst lange nach dem Bau des Hauses erfolgt war.
Jede Tür in meinem Sichtfeld war offen. Durch eine sah ich ein niedriges Regal, wie man es zur Lagerung selbst gemachter Marmelade und eingekochter Tomaten benutzt. Durch eine andere waren Waschzuber zu erkennen. Aufgestapelte Kisten durch eine dritte.
Ein Uniformierter der Polizei von Charlotte-Mecklenburg wartete am anderen Ende des Kellers, hinter einem Heizbrenner, der aussah wie eine Erfindung Jules Vernes. Im Gegensatz zu den anderen dreien sah die Tür hinter ihm alt aus. Sie war aus solider Eiche, der Lack dick und vom Alter vergilbt.
Der Beamte stand breitbeinig da, die Daumen in den Gürtel gehakt. Er war ein stämmiger Mann mit Brauen wie Beau Bridges und einem Gesicht wie Sean Penn, eine nicht gerade vorteilhafte Kombination. Beim Näherkommen konnte ich das Schild auf seiner Hemdbrust lesen: D. Gleason.
»Was haben wir?«, fragte ich, nachdem ich mich vorgestellt hatte.
»Sie haben schon mit dem Klempner gesprochen?«
Ich nickte.
»So gegen sechzehn Uhr rief Welton die neun-eins-eins an. Sagte, er hätte in einem Hohlraum Tote gefunden. Ich übernahm die Sache und entdeckte Überreste, die meiner Ansicht nach menschlich sind. Rief in der Zentrale an. Dort sagte man mir, ich solle vor Ort bleiben. Und ich sagte Welton, er solle dasselbe tun.«
Ich mochte Gleason. Er war knapp und präzise.
»Waren Sie schon unten?«
»Nein, Ma’am.« In dem Verschlag hinter Gleason hing eine zweite Glühbirne. Das schräg durch die Tür fallende Licht ließ seine Brauen Schatten werfen und seine ohnehin kantigen Gesichtszüge noch schärfer wirken.
»Der ME sagte mir, Sie hätten den Verdacht, dass es sich um mehr als eine Leiche handelt.«
Gleason wackelte mit der Hand. Vielleicht ja, vielleicht nein.
»Gibt’s da unten was, das ich wissen sollte?«
Ich dachte an den Keller einer Pizzabude in Montreal. Detective Luc Claudel schoss Ratten ab, während ich Knochen ausbuddelte. Ich sah ihn vor mir, wie er in seinem Kaschmirmantel und den Gucci-Handschuhen in diesem unterirdischen Loch stand, und musste beinahe lächeln. Beinahe. Die Knochen waren die von heranwachsenden Mädchen gewesen.
Gleason verstand meine Frage falsch. »Scheint irgend so eine Voodoo-Sache zu sein. Aber das ist Ihr Job, Doc.«
Richtige Antwort. Auf Uneingeweihte wirken Skelette oft bedrohlich. Sogar glänzend weiße Anatomiemodelle. Bei dem Gedanken wurde mir ein bisschen leichter. Vielleicht war es ja genau so etwas. Eine Schädelnachbildung, die man vor langer Zeit in einem Keller vergessen hatte.
Ich dachte noch einmal an den Pizzabuden-Fall. Die erste Frage damals war die nach dem PMI gewesen. Nach dem postmortalen Intervall. Wann war der Tod eingetreten? Vor zehn Jahren? Fünfzig? Hundertundfünfzig?
Noch ein optimistischeres Szenario. Vielleicht erwies der Schädel sich als uralter Kopf, den jemand von einer archäologischen Grabungsstätte geklaut hatte.
Labormodelle und archäologische Fundstücke riechen nicht nachVerwesung.
»Stimmt natürlich«, sagte ich zu Gleason. »Aber ich dachte an Ratten, Schlangen?«
»Bis jetzt noch keine Gesellschaft. Aber ich halte Ausschau nach ungebetenen Gästen.«
»Das beruhigt mich sehr.«
Ich folgte Gleason durch die Tür in einen fensterlosen, etwa drei mal vier Meter großen Raum. Zwei Ziegelwände schienen die Außenmauern zu bilden, Teile des ursprünglichen Fundaments. Zwei waren Innenwände. An diesen beiden standen Werkbänke.
Mit schnellem Blick überflog ich das Durcheinander auf den Bänken. Rostige Werkzeuge. Schachteln mit Nägeln, Schrauben, Beilagscheiben. Drahtrollen. Maschendraht. Ein Schraubstock.
Große Rollen grauen Plastiks mit Strukturprägung lagen unter den Werkbänken. Die Unterseite jeder Rolle war mit Erde verkrustet.
»Was ist das für Plastikzeug?«
»Vinyl.«
Ich hob fragend eine Augenbraue.
»Bodenbelag aus Vinyl. Habe ich letztes Jahr in meiner Garage verlegt. Wird normalerweise verklebt. Hier wurde er einfach lose auf die Erde und die Luke gelegt.«
»Welton hat ihn aufgerollt und beiseitegelegt?«
»Das sagt er.«
Bis auf die Werkbänke und den Bodenbelag war der Raum leer.
»Die Öffnung ist da drüben.« Gleason führte mich in die Ecke, wo die beiden Außenwände zusammenstießen.
In der östlichen Wand war etwa auf Schulterhöhe eine dreißig mal sechzig Zentimeter große Öffnung zu sehen. Schartige Ränder und ein deutlicher Farbunterschied zeigten, dass das Loch sehr frisch war. Ziegel- und Verputzbrocken lagen auf dem Boden darunter. An dieser Stelle hatte Welton die Wand geöffnet, um an die Rohre zu kommen.
Durch die Öffnung war ein Rohrgewirr zu erkennen. Auf dem Boden klaffte neben dem Geröll ein schwarzes Rechteck, das von einer ramponierten Luke aus Holzbrettern nur zum Teil abgedeckt wurde.
Ich stellte meinen Koffer ab und spähte hinunter in die Schwärze. Von hier aus war nicht zu erkennen, was sich dort unten befand.
»Wie weit ist es bis zum Boden?«
»Vier, vielleicht fünf Meter. Wahrscheinlich ein alter Kartoffelkeller. Einige von diesen Häusern haben die noch.«
Ich spürte das vertraute Gruseln. Die Enge in der Brust.
Ganz ruhig, Brennan.
»Warum so tief?«, fragte ich mit bemüht gelassener Stimme.
Gleason zuckte die Achseln. »Warmes Klima, keine Kühlschränke. «
Ich öffnete meinen Koffer, faltete einen Overall auf und streifte ihn über. Dann legte ich mich mit dem Gesicht über der Öffnung auf den Bauch.
Gleason gab mir seine Taschenlampe. Der Lichtstrahl tanzte eine provisorische Treppe hinab, die so steil war, dass sie eher wie eine Leiter wirkte.
»Das Zeug ist drüben an der Ostwand.«
Ich richtete den Strahl in diese Richtung. Und erkannte rostiges Metall, Flecken von Rot und Gelb. Etwas gespenstisch Bleiches, wie Leichenfleisch. Dann sah ich es.
Der Schädel stand auf einer Art rundem, niedrigem Podest, der Unterkiefer fehlte, die Stirn wirkte in dem kleinen Lichtoval merkwürdig gesprenkelt. Ein Objekt ruhte genau auf der Mitte des Schädeldachs.
Ich starrte den Schädel an. Die leeren Augenhöhlen starrten zurück. Die Zähne grinsten, als wollten sie mich herausfordern.
Ich stemmte mich auf alle viere, kauerte mich auf die Hacken und wischte mir Staub von Brust und Armen. »Ich mache jetzt ein paar Fotos, dann entfernen wir die Luke und ich gehe hinunter. «
»Diese Stufen scheinen schon einige Jahre auf dem Buckel zu haben. Wie wär’s, wenn ich erst mal schaue, ob sie überhaupt sicher sind?«
»Es wäre mir lieber, wenn Sie hier oben bleiben und mir herunterreichen, was ich brauche.«
»Mach ich.«
Das Klicken meines Kameraverschlusses. Das Rieseln von Erde, die von der Lukenunterseite in die Tiefe fiel. In der absoluten Stille des Kellers wirkte jedes Geräusch verstärkt. Es war irrational, aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass diese Stille nichts Gutes bedeutete.
Nachdem ich mir Gummihandschuhe übergestreift hatte, steckte ich mein Mag-Lite in den Hosenbund. Dann testete ich die erste Stufe. Stabil genug. Ich drehte das Gesicht zur Treppe, umfasste mit der einen Hand das Geländer und mit der anderen im Hinuntersteigen eine Stufe nach der anderen.
Die Luft wurde feucht-muffig, der Todesgeruch intensiver. Und meine Nase schnappte auch andere Dinge auf, eher olfaktorische Hinweise als wirkliche Gerüche. Andeutungen von Urin, saurer Milch, zerfallendem Gewebe.
Nach sechs Stufen drang fast kein Licht mehr von oben herunter. Ich hielt inne, damit meine Pupillen sich an die Dunkelheit gewöhnen konnten. Und meine Nerven an die Umgebung. Der Tunnel, durch den ich hinunterstieg, war etwa sechzig Zentimeter im Quadrat, feucht und stinkend.
Mein Herz hämmerte. Die Kehle wurde mir eng.
Jetzt ist es raus. Brennan, die legendäre Tunnelratte, hat Klaustrophobie.
Atmen.
Das Geländer krampfhaft umklammert, stieg ich die nächsten vier Stufen hinunter und durch den Tunnel in einen größeren Raum. Auf der fünften durchstach ein Splitter das Latex, das meine linke Hand schützte. Ich riss sie instinktiv zurück.
Noch mehr Selbstbesänftigung.
Ganz ruhig.
Atmen.
Noch zwei Stufen.
Atmen.
Mit einem merkwürdigen, leichten Klacken berührte meine Schuhspitze festen Boden. Behutsam tastete ich mit dem Fuß die nächste Umgebung ab. Nichts.
Ich stieg ganz von der Treppe herunter. Schloss die Augen, ein Reflex, um das aufschäumende Adrenalin ein wenig zurückzudrängen. Sinnlos. Alles um mich herum war pechschwarz.
Ich ließ das Geländer los, schaltete meine Taschenlampe ein, drehte mich um und ließ den Strahl durch den Raum und zur Decke wandern.
Ich stand in einem Kubus von etwa zweieinhalb Metern Kantenlänge, dessen Wände und Decke mit roh behauenen Holzbalken verstärkt waren. Der Boden war mit derselben Vinyl-Rollware bedeckt wie oben.
Das Objekt des Interesses befand sich rechts von mir. Vorsichtig bewegte ich mich dorthin, der Strahl meiner Lampe stach durch die Schatten.
Kessel, ein großer, ein kleiner. Ein verrosteter Topf. Sperrholz. Werkzeuge, Statuen. Kerzen. Perlenschnüre und Geweihe an der Wand.
Gleason hatte es korrekt bezeichnet. Die Kammer beherbergte eine Art rituelle Inszenierung.
Der große Kessel bildete den Mittelpunkt, die restlichen Utensilien breiteten sich sternförmig um ihn aus. Ich stieg über einen Halbkreis aus Kerzen und richtete meine Lampe aufs Zentrum.
Der Kessel bestand aus Eisen und war mit Erde gefüllt. In seiner Mitte erhob sich eine makabere Pyramide.
Ein Tierschädel bildete den Sockel. Nach der Form und dem zu urteilen, was ich von den Zähnen sehen konnte, schien er von einem kleinen Wiederkäuer zu stammen, vielleicht von einer Ziege oder einem Schaf. Überreste vertrockneten Gewebes säumten die Augenhöhlen und andere Öffnungen.
Auf dem Tierschädel ruhte der menschliche Schädel, der dem Klempner solche Angst eingejagt hatte. Der Knochen war glatt und fleischlos. Das Schädeldach und die Stirn wirkten merkwürdig lumineszierend und wurden verdunkelt von einem unregelmäßigen Fleck. Ein Fleck, der genauso rotbraun war wie getrocknetes Blut.
Ein kleiner Vogelschädel bildete die Spitze des Aufbaus. Auch an ihm hafteten noch vertrocknete Fragmente von Haut und Muskeln.
Ich richtete den Strahl auf den Boden.
Vor dem Kessel lag etwas, das wie ein Stück Eisenbahnschiene aussah. Und darauf lag ein enthauptetes und zum Teil verwestes Huhn.
Die Quelle des Gestanks.
Ich bewegte den Lichtstrahl nach links zu dem Topf. Drei halbkugelförmige Objekte nahmen Gestalt an. Ich bückte mich, um sie genauer anzuschauen.
Ein Schildkrötenpanzer. Zwei halbe Kokosnussschalen.
Ich richtete mich wieder auf und trat seitlich an dem großen Kessel vorbei zum kleineren. Auch der war mit Erde angefüllt. Oben drauf lagen drei Eisenbahnnägel, ein Geweih und drei gelbe Perlenschnüre. Ein Messer steckte bis zum Heft in der Erde.
Eine Kette war um den Rand des Kessels gewickelt. Eine Machete lehnte links daran. Eine Sperrholzplatte rechts.
Ich ging zu dem Sperrholz und kauerte mich hin. Es war von Symbolen bedeckt, die, wie ich vermutete, mit schwarzem Magic Marker darauf gemalt waren.
Daneben stand eine billige Gipsstatue. Die Frau trug eine lange, weiße Kutte, ein rotes Cape und eine Krone. In der einen Hand hielt sie einen Kelch, in der anderen ein Schwert. Neben ihr war eine winzige Burg oder ein Turm zu sehen.
Ich versuchte, mich an die katholischen Heiligendarstellungen meiner Jugend zu erinnern. Irgendein Abbild der Heiligen Jungfrau? Eine Heilige? Obwohl mir die Darstellung irgendwie bekannt vorkam, konnte ich die Dame nicht identifizieren.
Schulter an Schulter mit der Dame stand eine geschnitzte Holzfigur mit zwei Gesichtern, die in entgegengesetzte Richtungen schauten. Sie war etwa dreißig Zentimeter hoch, hatte lange, schlanke Gliedmaßen und einen erigierten Penis.
Eindeutig nicht die Jungfrau, dachte ich.
Die letzten in dieser Reihe waren zwei Puppen in gerüschten Baumwollkleidern mit mehreren Unterröcken, eins gelb, das andere blau. Beide Puppen waren weiblich und schwarz. Beide trugen Armreifen, Kreolen-Ohrringe und Medaillons an Halsketten. Blau hatte eine Krone, Gelb ein Kopftuch.
Und ein winziges Schwert steckte in ihrer Brust.
Ich hatte genug gesehen.
Der Schädel war nicht aus Plastik. Es waren also menschliche Überreste vorhanden. Das Huhn war noch nicht lange tot.
Vielleicht waren die an diesem Altar vollzogenen Rituale harmlos. Vielleicht nicht. Um sicherzugehen, musste die Bergung präzise nach Vorschrift durchgeführt werden. Scheinwerfer. Kameras. Eine Dokumentation der Bergungssequenz, damit jeder Schritt der Inbesitznahme nachgewiesen werden konnte.
Ich ging zur Treppe. Nach zwei Stufen hörte ich ein Geräusch und hob den Kopf. Durch die Öffnung spähte ein Gesicht auf mich herab.
Es war ein Gesicht, das ich nicht gern sah.
4
Erskine »Skinny« Slidell ist ein Detective des Charlotte-Mecklenburg PD Felony Investigative Bureau/Homicide Unit. Also ein Beamter des Morddezernats der Kriminalpolizei von Charlotte-Mecklenburg.
Im Lauf der Jahre habe ich schon ein paar Mal mit Slidell gearbeitet. Meine Meinung? Der Kerl hat die Persönlichkeit einer verstopfen Nase. Aber gute Instinkte.
Slidells pomadisierter Kopf hing über der Tunnelöffnung.
»Doc.« Slidell begrüßte mich gefühlsarm wie gewohnt.
»Detective.«
»Sagen Sie mir, dass ich nach Hause gehen, mir ein Bier aufmachen und meine Mannschaft anfeuern kann.«
»Heute Abend nicht.«
Slidell seufzte verärgert und verschwand dann aus meinem Sichtfeld.
Während ich nach oben stieg, erinnerte ich mich an unsere letzte Zusammenarbeit.
August. Der Detective betrat eben das Gerichtsgebäude des Mecklenburg County. Ich hatte als Zeugin ausgesagt und war auf dem Weg nach draußen.
Slidell ist nicht gerade der Allerschnellste im Denken. Weder auf der Straße noch vor Gericht. Eigentlich ist das eine Untertreibung. Scharfe Verteidiger machen Hackfleisch aus ihm. An diesem Vormittag war seine Nervosität offensichtlich gewesen, die Augen waren dunkel umrandet, vermutlich hatte er die ganze Nacht kein Auge zugemacht.
Als ich aus dem Treppenschacht stieg, fiel mir auf, dass Slidell an diesem Tag ein wenig besser aussah. Von seinem Sakko konnte man das nicht sagen. Bestehend aus grünem Polyester mit orangefarbenen Steppnähten sah das Ding sogar in diesem düsteren Keller grell und grässlich aus.
»Der Beamte hier sagt, wir haben’s mit einem Hexendoktor zu tun.« Slidell drehte das Kinn in Gleasons Richtung.
Ich beschrieb ihm, was ich in dem Unterkeller gesehen hatte.
Slidell schaute auf die Uhr. »Wie wär’s, wenn wir uns die Sache morgen vornehmen?«
»Rendezvous heute Abend, Skinny?«
Hinter Slidell machte Gleason ein gedämpftes Geräusch in seiner Kehle.
»Wie gesagt. Bier und Spiel.«
»Sie hätten Ihren TiVo stellen sollen.«
Slidell schaute mich an, als hätte ich ihm vorgeschlagen, er solle die nächste Shuttle-Mission programmieren.
»Ist wie ein Videorekorder«, erklärte ich und zog einen Handschuh aus.
»Wundert mich, dass das noch keine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.« Slidell schaute in die Öffnung zu meinen Füßen. Er meinte die Medien.
»Dabei sollten wir es auch belassen«, sagte ich. »Rufen Sie die Spurensicherung über Ihr Handy an.«
Ich streifte den zerrissenen Handschuh ab. Der Daumenballen war rot und geschwollen und juckte wie die Pest.
»Sagen Sie ihnen, wir brauchen einen Generator und tragbare Scheinwerfer.« Ich warf beide Handschuhe in meinen Koffer. »Und etwas, das einen Kessel voller Erde anheben kann.«
Kopfschüttelnd tippte Slidell die Nummer in sein Handy.
Vier Stunden später ließ ich mich in meinen Mazda fallen. Die Greenleaf badete im Mondschein. Ich badete in meinem eigenen Schweiß.
Beim Verlassen des Hauses hatte Slidell eine Frau entdeckt, die mit einer kleinen Digitalkamera durch ein Fenster fotografierte. Nachdem er sie verjagt hatte, hatte er zwei Camels geraucht, etwas von Grundbucheintragungen und Steuerdaten gemurmelt und war in seinem Taurus davongerauscht.
Die Spurensicherungstechniker waren in ihrem Transporter davongefahren. Sie würden die Puppen, Statuen, Werkzeuge und alle anderen Artefakte im Forensikinstitut abliefern.
Auch der Transporter des Leichenschauhauses war bereits wieder weg. Joe Hawkins, der diensthabende Todesermittler des MCME an diesem Abend, transportierte die Schädel und das Huhn ins ME-Labor. Die Kessel ebenfalls. Larabee würde über die Sauerei zwar alles andere als begeistert sein, aber mir war es lieber, die Kesselinhalte unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen.
Wie erwartet, hatte der große Kessel die größten Probleme gemacht. Da er ungefähr genauso viel wog wie die Freiheitsstatue, hatte die Bergung eine Winde, viel Muskelkraft und ein ganzes Lexikon farbenfroher Ausdrücke erfordert.
Ich fuhr von dem Grundstück und die Greenleaf hoch. Der Frazier Park vor mir war ein schwarzes Loch in der Stadtlandschaft. Ein Klettergerüst wuchs aus den Schatten, eine silbrige, kubistische Skulptur über dem Schlangengrinsen des Irwin-Creek-Kanals.
Über Westbrook und Cedar fuhr ich am Rand der Innenstadt entlang und dann in südöstlicher Richtung zu meinem eigenen Viertel, Myers Park. In den 1930ern als Charlottes erster Vorort mit Straßenbahnanschluss erbaut, ist das Viertel heute zu teuer, zu schnieke und zu republikanisch. Trotz seiner jungen Jahre erscheint es elegant und grün.
Zehn Minuten, nachdem ich den Third Ward verlassen hatte, stand mein Auto neben meiner Terrasse. Nachdem ich abgeschlossen hatte, ging ich in mein Stadthaus.
Das verlangt einige Erklärungen.
Ich wohne auf dem Anwesen von Sharon Hall, einem Herrenhaus aus dem neunzehnten Jahrhundert direkt neben dem Campus der Queens University, das in einen Komplex aus Eigentumswohnungen umgewandelt wurde. Mein kleines Nebengebäude trägt den Namen Annex, »der Anbau«. Anbau zu was? Das weiß kein Mensch. Das winzige, zweigeschossige Gebäude taucht auf keinem der Originalpläne des Anwesens auf. Das Haupthaus ist dort vorhanden. Die Remise. Der Kräutergarten und der Park. Kein Annex. Das Ding wurde offensichtlich aus einer Laune heraus erbaut.
Die Spekulationen von Freunden, Familienmitgliedern und Gästen reichen von Räucherhaus über Treibhaus bis hin zu Darre. Es interessiert mich nicht sonderlich, die ursprüngliche Absicht des Erbauers zu ergründen. Obwohl gerade einmal einhundertzehn Quadratmeter groß, genügt das Häuschen doch meinen Ansprüchen. Schlafzimmer und Bad oben. Küche, Esszimmer, Wohnzimmer und Arbeitszimmer unten. Ich zog in das Haus ein, als meine Ehe mit Pete in die Brüche ging. Ein Jahrzehnt später wohne ich immer noch dort.
»Hey, Bird«, rief ich in die leere Küche.
Kein Kater.
»Birdie, ich bin zu Hause.«
Das Summen des Kühlschranks. Eine Serie leiser Schläge von der Kaminuhr meiner Großmutter.
Ich zählte. Elf.
Mein Blick schlich zum Anzeigenlämpchen am Telefon. Keine einzige Nachricht.
Ich stellte meine Handtasche ab und ging sofort unter die Dusche.
Während ich den Kellerdreck mit Grüntee-Duschgel vertrieb, mit Rosmarin-Minze-Shampoo und so heißem Wasser, wie ich es gerade noch ertragen konnte, drifteten meine Gedanken zu dem so grausam dunklen Signallämpchen des Anrufbeantworters und zu der Stimme, die ich zu hören hoffte.
Bonjour, Tempe. Du fehlst mir. Wir sollten reden.
Ein Bild blitzte auf. Schlaksige Gestalt, sandfarbene Haare, Carolina-blaue Augen. Andrew Ryan, lieutenant-détective, Section des crimes contre la personne, Sûreté du Québec.
Hier also die Geschichte mit Quebec. Ich habe zwei Jobs, einen in Charlotte, North Carolina, USA, einen in Montreal, Quebec, Kanada, wo ich forensische Anthropologin für das Bureau du Coroner bin. Ryan ist Detective im Morddezernat der Provinzpolizei. Mit anderen Worten, bei Morden in La Belle Province kümmere ich mich um die Opfer und Ryan ermittelt.
Als ich vor Jahren in dem Institut in Montreal anfing, hatte Ryan den Ruf des Schwerenöters des Reviers. Und ich hatte es mir selbst zur Regel gemacht, keine Büro-Romanze anzufangen. Allerdings zeigte es sich, dass der lieutenant-détective kein großer Regelfreund war. Als jede Hoffnung, meine Ehe zu retten, schließlich den Bach hinuntergegangen war, fingen wir an, uns auch privat zu sehen. Eine Weile lief alles gut. Sehr gut.
In meinem Kopf lief ein nicht jugendfreier Film aus unvergesslichen Szenen ab. Beaufort, South Carolina, der erste abgewehrte Annäherungsversuch, ich in abgeschnittenen Jeans ohne Slip, an Bord eines Sieben-Meter-Chris-Craft im Yachthafen von Lady’s Island. Charlotte, North Carolina, der erste Volltreffer, ich in einem männermordenden, schwarzen Kleid und einem von Victorias größten Geheimnissen.
Als ich mich an andere sportliche Leistungen erinnerte, bekam ich ein Kribbeln im Bauch. Ja, der Kerl war gut. Und gut aussehend.
Dann riss Ryan mir ein Loch ins Herz. Die Tochter, die er gerade getroffen, davor aber nie gekannt hatte, war rebellisch, wütend, heroinsüchtig. Gequält von Schuldgefühlen, hatte Daddy beschlossen, sich wieder mit Mommy zusammenzutun und gemeinsam zu versuchen, die Tochter zu retten.
Und ich war out wie die Lippenstiftfarbe vom letzten Jahr. Das war vor vier Monaten.
»Scheiß drauf.«
Das Gesicht unter dem Duschkopf, krähte ich eine verwässerte Version von Gloria Gaynor.
»I will survive. Oh, no not I. I’ve got all my life to live –«