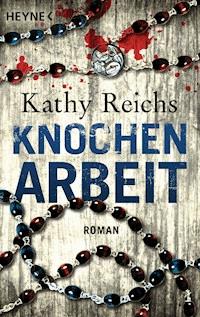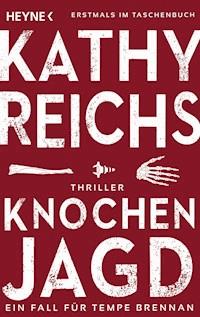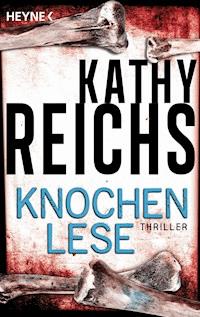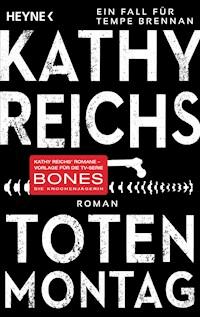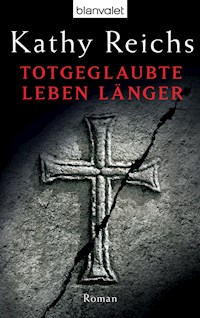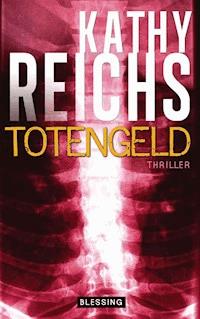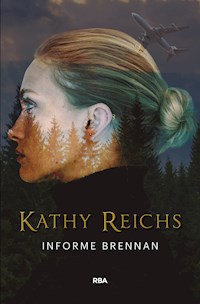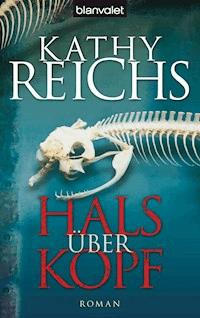
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Tempe-Brennan-Romane
- Sprache: Deutsch
Tempe Brennan ist zurück – und der Tod wartet schon!
Was wie ein harmloser Exkurs auf eine idyllische Ferieninsel beginnt, endet für die forensische Anthropologin Tempe Brennan in einem Albtraum. Archäologische Grabungen im Sand von Dewees Island, South Carolina, fördern nicht nur bestattete Ureinwohner zutage, sondern auch eine Leiche, die erst vor wenigen Jahren verscharrt worden ist. Damit nicht genug. In einem Sumpfgebiet auf dem Festland werden Überreste eines vermeintlichen Selbstmörders entdeckt. Eigenartige Einkerbungen an den Halswirbeln des Toten sagen Tempe, dass eine makabre Verbindung zwischen den beiden Fällen bestehen muss ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Zwei Wochen lang hat Temperance Brennan eine Studentengruppe bei Ausgrabungen einer alten indianischen Stätte auf Dewees Island an der Küste von South Carolina begleitet. Doch um die autofreie Inselidylle ist es geschehen, als die Dünen am vorletzten Tag des Projekts einen Toten freigeben, der offenbar erst unlängst hier deponiert wurde. Und der – wie Tempe wenig später im Labor feststellt – wohl keines natürlichen Todes starb. Kaum hat sie ihre Untersuchung abgeschlossen, da wird in den Sümpfen auf dem Festland eine weitere Leiche entdeckt. Selbstmord durch Erhängen, so trägt es der örtliche Sheriff ins Protokoll ein, doch Tempe ist skeptisch: Die Rückenwirbel des Toten weisen dieselben Kerben auf wie die des Opfers von Dewees. Gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann, dem Rechtsanwalt Janis »Pete« Peterson, der an die Küste gekommen ist, um die vermisste Tochter eines Klienten zu suchen, wird Tempe auf den machtgierigen Fernsehprediger Aubrey Herron aufmerksam, bei dem das verschwundene Mädchen zuletzt gesehen wurde. Ist er in die Mordfälle verwickelt? Oder der verdächtig verschwiegene Chefarzt, dessen Klinik Herron großzügig unterstützt? Und warum wird sie auf Schritt und Tritt von Dickie Dupree verfolgt, einem Bauunternehmer, der große Pläne für einen gewissen Strandabschnitt auf Dewees Island hat? Tempe und Pete hatten als Ehepaar kein Glück. Doch als Detektivduo dürfen sie sich noch weniger einen Fehltritt erlauben, sonst könnten sie bald länger zusammen am Strand liegen, als ihnen lieb ist …
Autorin
Kathy Reichs, geboren in Chicago, lebt in Charlotte und Montreal. Sie ist Professorin für Soziologie und Anthropologie und unter anderem als forensische Anthropologin für gerichtsmedizinische Institute Quebec und South Carolina tätig. Jeder ihrer Romane wurde zu einem höchst erfolgreichen Weltbestseller und erreichte Spitzenplätze auf allen internationalen und deutschen Bestsellerlisten. Tempe Brennans Fälle sind inzwischen eine höchst erfolgreiche Fernsehserie: »BONES-Die Knochenjägerin«.
Weitere Informationen finden sie unter www.kathy-reichs.de und auf der offiziellen Homepage von Dr. Kathy Reichs: www.kathyreichs.com
Inhaltsverzeichnis
In liebendem Andenken an Arvils Reichs 9. Februar 1949–23. Februar 2006
Dusi saldi
1
Es ist immer so. Man ist eben dabei, eine Grabung abzuschließen, da landet jemand den Coup der Saison.
Okay. Ich übertreibe. Aber was passiert ist, geht schon sehr in diese Richtung. Und was letztendlich dabei herauskam, war viel verstörender als die Entdeckung irgendeiner Topfscherbe oder einer Feuerstelle in letzter Minute.
Es war der achtzehnte Mai, der vorletzte Tag des archäologischen Ausgrabungsseminars. Ich hatte zwanzig Studenten, die eine Stätte auf Dewees, einer Barriere-Insel nördlich von Charleston, South Carolina, bearbeiteten.
Außerdem hatte ich einen Journalisten. Mit dem IQ von Plankton.
»Sechzehn Leichen?« Plankton zog einen Spiralblock hervor, während Visionen von Dahmer und Bundy durch sein Hirn zuckten. »Opfer schon identifiziert?«
»Die Gräber sind prähistorisch.«
Zwei Augen verdrehten sich, schmal unter geschwollenen Lidern. »Alte Indianer?«
»Eingeborene Amerikaner.«
»Die haben mich geschickt, um was über alte Indianer zu schreiben?« Dieser Kerl bekam keinen Preis für politische Korrektheit.
»Die?« Eisig.
»Die Moultrie News. Die Lokalzeitung von East Cooper.«
Charleston ist, wie Rhett Scarlett erzählte, eine Stadt, die charakterisiert wird durch die wohltuende Anmut vergangener Tage. Ihr Herz ist die Peninsula, die Halbinsel, ein Bezirk mit Häusern aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg, Kopfsteinpflaster-Straßen und Freiluftmärkten, der von den Flüssen Ashley und Cooper begrenzt wird. Die Bürger von Charleston definieren ihr Revier anhand dieser Wasserstraßen. Angrenzende Viertel werden als »West Ashley« oder »East Cooper« bezeichnet, wobei zu Letzterem auch der Mount Pleasant und drei Inseln gehören, Sullivan’s, die Isle of Palms und Dewees. Ich nahm an, dass Planktons Zeitung dieses Gebiet abdeckte.
»Und Sie sind?«, fragte ich.
»Homer Winborne.«
Mit seinem Bartschatten und der Fastfood-Wampe sah er eher aus wie Homer Simpson.
»Wir sind hier ziemlich beschäftigt, Mr. Winborne.«
Winborne ignorierte das. »Ist das denn nicht illegal?«
»Wir haben eine Genehmigung. Die Insel wird erschlossen, und auf diesem Gelände hier sollen Wohnhäuser entstehen.«
»Warum sich dann die Mühe machen?« Schweiß benetzte Winbornes Haaransatz. Als er nach einem Taschentuch griff, bemerkte ich eine Zecke, die seinen Kragen entlangkrabbelte.
»Ich bin eine Anthropologin der University of North Carolina in Charlotte. Meine Studenten und ich sind im Auftrag des Staates hier.«
Normalerweise führte die Neue-Welt-Archäologin der UNCC jedes Sommersemester im Mai eine studentische Ausgrabung durch. Ende März dieses Jahres hatte die Dame bekannt gegeben, dass sie eine Stelle an der Purdue angenommen habe. Da sie den ganzen Winter damit beschäftigt gewesen war, Lebensläufe und Bewerbungen zu verschicken, hatte sie das Ausgrabungsseminar völlig vergessen. Sayonara. Keine Dozentin. Keine Ausgrabungsstätte.
Obwohl mein Spezialgebiet die Forensik ist, und ich inzwischen mit Toten arbeite, die zu Coroners und Leichenbeschauern geschickt werden, waren meine Promotionszeit und die Anfänge meiner akademischen Karriere den nicht so frisch Verstorbenen gewidmet. Für meine Doktorarbeit hatte ich tausende von prähistorischen Skeletten untersucht, die man in nordamerikanischen Begräbnishügeln gefunden hatte.
Das Ausgrabungsseminar ist einer der beliebtesten Kurse der Anthropologischen Fakultät und war deshalb, wie üblich, entsprechend voll. Der unerwartete Abgang meiner Kollegin brachte den Fakultätsvorstand völlig aus dem Häuschen. Er bat mich, zu übernehmen. Die Studenten erwarteten, dass das Seminar stattfand. Eine Rückkehr zu meinen Wurzeln. Zwei Wochen am Strand. Zusätzliche Bezahlung. Ich hatte fast den Eindruck, er würde noch einen Buick drauflegen.
Ich hatte ihm Dan Jaffer vorgeschlagen, ein Bioarchäologe und mein professionelles Pendant beim Leichenbeschauer/Coroner-System im Great Palmetto State im Süden von uns. Ich berief mich auf mögliche Fälle im Institut des Leichenbeschauers in Charlotte oder im Laboratoire de Sciences Judiciaires et de Médecine Légale in Montreal, die beiden Behörden, für die ich regelmäßig als externe Beraterin arbeite.
Der Vorstand versuchte es. Gute Idee, schlechtes Timing. Dan Jaffer war unterwegs in den Irak.
Ich hatte Jaffer angerufen, und er hatte Dewees als mögliche Ausgrabungsstätte vorgeschlagen. Ein Gräberfeld sollte zerstört werden, und er wollte die Bulldozer aufhalten, bis die Bedeutung der Stätte geklärt war. Wie vorauszusehen, ignorierte der Bauunternehmer seine Anfragen.
Ich hatte mich mit dem Büro des staatlichen Archäologen in Verbindung gesetzt, und auf Dans Empfehlung hin hatte man dort mein Angebot akzeptiert, einige Testgrabungen durchzuführen, was dem Bauunternehmer natürlich sehr missfiel.
Und hier war ich nun. Mit zwanzig Studenten. Und, an unserem dreizehnten und vorletzten Tag, mit Plankton-Hirn.
Meine Geduld franste aus wie ein altes Seil.
»Name?« Winborne hätte auch nach Grassamen fragen können.
Ich bekämpfte den Drang, ihn einfach stehen zu lassen. Gib ihm, was er will, sagte ich mir.
Er wird schon wieder verschwinden. Oder, mit etwas Glück, an einem Hitzschlag sterben.
»Temperance Brennan.«
»Temperance?« Amüsiert.
»Ja, Homer.«
Winborne zuckte die Achseln. »Den Namen hört man nicht so oft.«
»Man nennt mich Tempe.«
»Wie die Stadt in Utah.«
»Arizona.«
»Richtig. Was für Indianer?«
»Wahrscheinliche Sewee.«
»Woher haben Sie gewusst, dass das Zeug da ist?«
»Von einem Kollegen in South Carolina.«
»Und woher wusste er es?«
»Bei einer Begehung nach Bekanntgabe der geplanten Erschließung entdeckte er kleine Hügel.«
Winborne nahm sich ein wenig Zeit, um sich Notizen auf seinem Spiralblock zu machen. Vielleicht brauchte er die Zeit aber auch, um zu formulieren, was er sich unter einer intelligenten Frage vorstellte. In der Entfernung konnte ich Studentengeplapper und das Klappern von Eimern hören. Über mir schrie eine Möwe, eine andere antwortete.
»Hügel?«
»Nach der Schließung der Gräber wurden Muschelschalen und Sand darübergehäuft.«
»Und was bringt es, die wieder auszugraben?«
Jetzt reichte es. Ich knallte dem kleinen Kretin vor den Latz, was jedes Interview beendete. Fachkauderwelsch.
»Man weiß noch nicht sehr viel über Bestattungsbräuche bei indigenen südöstlichen Küstenpopulationen, und diese Stätte könnte bisherige ethnohistorische Befunde entweder bestätigen oder widerlegen. Viele Anthropologen sind der Ansicht, dass die Sewee ein Teil des Cusabo-Stammes waren. Nach einigen Quellen gehörten zu den Bestattungspraktiken der Cusabo das Entfleischen der Leichen und die anschließende Verwahrung der Knochen in Stoffbündeln oder Kisten. Andere berichten von einer Aufbahrung der Leichen, damit sie vor der Bestattung in Gemeinschaftsgräbern verwesten.«
»O Mann. Das ist krass.«
»Krasser, als wenn man Leichen das Blut abzapft und es durch chemische Substanzen ersetzt, dann Wachse und Duftstoffe injiziert und Make-up auflegt, um Leben zu simulieren? Und sie anschließend in luftdichten Särgen und Grüften bestattet, um das Verfaulen zu verlangsamen?«
Winborne schaute mich an, als hätte ich Sanskrit gesprochen. »Wer macht das?«
»Wir.«
»Und was finden Sie?«
»Knochen.«
»Nur Knochen?« Die Zecke krabbelte jetzt an Winbornes Hals hoch. Sollte ich etwas sagen? Nein. Der Kerl nervte mich zu sehr.
Ich spulte meine übliche Coroner-und-Polizisten-Masche ab. »Das Skelett erzählt uns eine Geschichte über ein Individuum. Geschlecht. Alter. Größe. Abstammung. In manchen Fällen auch Krankengeschichte und Todesart.« Mit einem nachdrücklichen Blick auf meine Uhr ließ ich nun noch meine archäologische Platte folgen. »Alte Knochen sind eine Informationsquelle über ausgestorbene Populationen. Wie die Menschen lebten, wie sie starben, was sie aßen, an welchen Krankheiten sie litten –«
Winbornes Blick wanderte über meine Schultern. Ich drehte mich um.
Topher Burgess kam auf uns zu, den sonnenverbrannten Oberkörper bedeckt mit verschiedenen Formen von organischem und anorganischem Dreck. Klein und dick, mit einer Strickmütze, Drahtgestellbrille und buschigen Koteletten erinnerte er mich an eine jugendliche Version von Captain Hooks Smee.
»Da ragt was Komisches in Drei-Ost hinein.«
Ich wartete, aber mehr Informationen kamen von Topher nicht. Was nicht überraschte, denn bei Prüfungen bestanden seine Aufsätze oft aus knappest möglichen Sätzen. Allerdings illustriert.
»Komisch?«, fragte ich nach.
»Es ist anatomisch korrekt angeordnet.«
Ein vollständiger Satz. Erfreulich, aber nicht sehr erhellend. Ich wedelte mit den Fingern, um ihm mehr zu entlocken.
»Wir glauben, es ist intrusiv.« Topher verlagerte sein Gewicht von einem nackten Fuß auf den anderen. Er hatte eine Menge zu verlagern.
»Ich schau mir das gleich an.«
»Was hat das zu bedeuten, anatomisch korrekt angeordnet?« Die Zecke hatte Winbornes Ohr erreicht und überlegte sich offensichtlich eine alternative Route.
»Dass die Knochen so in der Erde liegen, wie sie im Körper angeordnet sind. Bei sekundären Bestattungen, wenn die Leichen erst nach dem Fleischverlust in die Erde gelegt werden, ist das ungewöhnlich. Die Knochen sind dann normalerweise durcheinander geworfen, manchmal in ganzen Haufen. Es kommt nur gelegentlich vor, dass in solchen Gemeinschaftsgräbern ein oder zwei Skelette anatomisch korrekt angeordnet sind.«
»Warum?«
»Dafür kann es viele Gründe geben. Vielleicht starb jemand unmittelbar vor Schließung des Gemeinschaftsgrabs. Vielleicht wollte die Gruppe weiterziehen und hatte keine Zeit mehr, die Verwesung abzuwarten.«
Ganze zehn Sekunden lang machte er sich Notizen. Die Zecke verschwand aus meinem Blickfeld.
»Intrusiv. Was heißt das?«
»Dass eine Leiche erst später in das Grab gelegt wurde. Wollen Sie es sich ansehen?«
»Genau dafür lebe ich.« Winborne wischte sich mit dem Taschentuch über die Stirn und seufzte dabei, als würde er auf der Bühne stehen.
Nun bekam ich doch Mitleid mit ihm. »Sie haben da eine Zecke am Kragen.«
Winborne reagierte schneller, als man es von einem Mann seiner Masse für möglich halten würde. Mit einer einzigen Bewegung fuhr er sich an den Kragen, bückte sich und schlug sich auf den Hals. Die Zecke purzelte in den Sand und richtete sich wieder auf, offensichtlich war sie an Zurückweisung gewöhnt.
Ich ging los, vorbei an Büscheln von Seehafer, dessen Ährenköpfe bewegungslos in der schweren Luft standen. Es war erst Mai, und schon kletterte das Thermometer auf über dreißig Grad. Obwohl ich das Lowcountry liebe, war ich froh, nicht im Sommer hier graben zu müssen.
Ich bewegte mich schnell, wohlwissend, dass Winborne mir nicht würde folgen können. Gemein? Ja. Aber die Zeit war knapp. Und an diesen Trottel von Reporter hatte ich keine zu verschwenden.
Außerdem war mein Gewissen jetzt rein, wegen der Zecke. Aus Tophers Gettoblaster dröhnte ein Song, den ich nicht kannte, von einer Gruppe, deren Namen ich nicht kannte und den ich mir auch nicht merken würde, falls man ihn mir sagte. Seevögel und Brandung wären mir lieber gewesen, aber immerhin war das Programm dieses Tages besser als das Heavy-Metal-Zeug, das die Studenten normalerweise hörten.
Während ich auf Winborne wartete, ließ ich den Blick über die Ausgrabungsstätte wandern. Zwei Testgräben waren bereits ausgehoben und wieder aufgefüllt worden. Der erste hatte nur sterile Erde ergeben. Im zweiten hatte man allerdings menschliche Knochen gefunden, eine frühe Bestätigung von Jaffers Vermutung.
Drei weitere Gräben waren noch offen. An jedem arbeiteten Studenten mit Kellen, schleppten Eimer und siebten Erde durch Drahtgitter, die auf Sägeböcken lagen.
Topher schoss eben Fotos am östlichsten Graben. Der Rest seines Teams saß mit untergeschlagenen Beinen da und betrachtete, was ihn so interessierte.
Als Winborne mich einholte, war er an der Grenze zwischen Schnaufen und Keuchen. Er wischte sich die Stirn und rang nach Atem.
»Heiß heute«, sagte ich.
Winborne nickte. Sein Gesicht hatte die Farbe von Himbeersorbet.
»Alles okay mit Ihnen?«
»Bestens.«
Ich ging auf Topher zu, doch Winbornes Stimme stoppte mich.
»Wir bekommen Besuch.«
Als ich mich umdrehte, sah ich einen Mann in einem pinkfarbenen Poloshirt und Khakihose, der über die Dünen lief, nicht um sie herum. Er war klein, fast wie ein Kind, und hatte kurz geschorene, silbergraue Haare. Ich erkannte ihn sofort. Richard L. »Dickie« Dupree, Unternehmer, Baulöwe und Gauner durch und durch.
Dupree wurde begleitet von einem Basset, dem Bauch wie Zunge fast bis auf den Boden hingen.
Zuerst ein Journalist, jetzt Dupree. Den Tag konnte man abhaken.
Ohne Winborne zu beachten, steuerte Dupree mit der ganzen entschlossenen Selbstgerechtigkeit eines Taliban-Mullahs auf mich zu. Der Basset blieb zurück, weil er einem Büschel Seehafer ausweichen musste.
Wir alle wissen, was persönlicher Freiraum ist: der Abstand zwischen einem selbst und anderen. Für mich muss er mindestens fünfundvierzig Zentimeter betragen. Ist er geringer, werde ich nervös.
Einige Fremde kommen einem zu nahe, weil sie schlecht hören oder sehen. Andere, weil sie aus einem anderen kulturellen Hintergrund stammen. Nicht Dickie. Dupree war der Überzeugung, dass Nähe ihm größere Überzeugungskraft verlieh.
Dreißig Zentimeter vor mir blieb er stehen, verschränkte die Arme und blinzelte zu mir hoch.
»Ich gehe davon aus, Sie werden morgen fertig?« Eher eine Aussage als eine Frage.
»Werden wir.« Ich trat einen Schritt zurück.
»Und dann?« Duprees Gesicht hatte etwas Vogelartiges, scharfe Knochen unter rosiger, durchscheinender Haut.
»Ich werde nächste Woche dem Büro des staatlichen Archäologen einen vorläufigen Bericht übermitteln.«
Der Basset kam dazu und beschnupperte mein Bein. Er sah aus, als wäre er mindestens achtzig Jahre alt.
»Colonel, sei nicht unhöflich zu der kleinen Dame.« Und zu mir: »Colonel wird langsam alt. Er vergisst seine Manieren.«
Die kleine Dame kraulte Colonel hinter einem struppigen Ohr.
»Wäre doch eine Schande, die Leute nur wegen ein paar alter Indianer zu enttäuschen.« Dupree schenkte mir, was er zweifellos als sein charmantes Südstaaten-Gentleman-Lächeln betrachtete. Wahrscheinlich übte er es vor dem Spiegel, wenn er sich die Nasenhaare schnitt.
»Viele betrachten das historische Erbe dieses Landes als etwas Wertvolles«, sagte ich.
»Aber man kann doch nicht zulassen, dass diese Dinge den Fortschritt behindern, oder?«
Ich erwiderte nichts.
»Sie verstehen meine Position, Ma’am?«
»Ja, Sir, das tue ich.«
Ich verabscheute Duprees Position. Sein einziges Ziel war Geld, und er war bereit, es mit allen Mitteln zu verdienen, die ihn nicht ins Gefängnis brachten. Zur Hölle mit dem Regenwald, den Feuchtgebieten, Meeresküsten, Dünen und der Kultur, die bereits hier war, als die Engländer ankamen. Dickie Dupree würde den Artemis-Tempel sprengen, falls er dort stand, wo er Eigentumswohnungen hinklatschen wollte.
Winborne hinter uns war verstummt. Ich wusste, dass er zuhörte.
»Und was wird in diesem vorzüglichen Dokument stehen?« Noch ein Lächeln wie vom Sheriff von Mayberry.
»Dass sich unter diesem Gelände eine präkolumbische Begräbnisstätte befindet.«
Duprees Lächeln zitterte kurz, blieb aber. Colonel, der Spannung spürte oder vielleicht nur gelangweilt war, ließ von mir ab und wandte sich Winborne zu. Ich wischte mir die Hände an meinen abgeschnittenen Jeans ab.
»Sie kennen diese Leute oben in Columbia ebenso gut wie ich. Ein Bericht dieser Art wird mich für eine ziemliche Zeit lahm legen. Und die Verzögerung wird mich Geld kosten.«
»Eine archäologische Stätte ist eine nicht erneuerbare kulturelle Ressource. Ist sie erst einmal verschwunden, dann bleibt sie es für immer. Ich kann nicht ruhigen Gewissens zulassen, dass Ihre Bedürfnisse meine Funde beeinflussen, Mr. Dupree.«
Das Lächeln verschwand, und Dupree betrachtete mich kalt.
»Darum werden wir uns kümmern müssen.« Diese verhüllte Drohung wurde von seinem sanft säuselnden Lowcountry-Akzent kaum abgemildert.
»Ja, Sir. Das werden wir.«
Dupree zog eine Packung Kools aus der Tasche, riss in der hohlen Hand ein Streichholz an und zündete sich eine Zigarette an. Dann warf er das Streichholz achtlos weg, inhalierte tief und machte sich auf den Rückweg über die Dünen. Colonel watschelte hinter ihm her.
»Mr. Dupree«, rief ich ihm nach.
Dupree blieb stehen, drehte sich aber nicht um.
»Es ist ökologisch unverantwortlich, über die Dünen zu laufen.«
Dupree winkte nur kurz und ging einfach weiter.
In mir stiegen Wut und Abscheu hoch.
»Dickie ist wohl nicht Ihre erste Wahl für den Mann des Jahres?«
Ich drehte mich um. Winborne wickelte eben einen Juicy Fruit aus. Ich sah zu, wie er sich den Kaugummi in den Mund schob, und warnte ihn mit einem Blick, das Papier nicht so wegzuwerfen, wie Dupree es mit seinem Streichholz gemacht hatte.
Er kapierte die Botschaft.
Wortlos drehte ich mich um und ging auf Drei-Ost zu.
Die Studenten verstummten, als ich bei ihnen war. Ich sprang in den Graben. Acht Augen folgten mir. Topher gab mir eine Kelle. Ich kauerte mich hin, und sofort umfing mich der Geruch frisch umgegrabener Erde.
Und noch etwas anderes. Süß. Faulig. Schwach, aber unbestreitbar.
Ein Geruch, der eigentlich nicht da sein dürfte.
Mein Magen zog sich zusammen.
Ich ging auf alle viere und untersuchte Tophers komisches Ding, ein Stück Wirbelsäule, die sich etwa in der Mitte der westlichen Wand nach außen wölbte.
Von oben riefen mir die Studenten Informationen zu.
»Wir waren eben dabei, die Seiten zu säubern, Sie wissen schon, damit wir Fotos der Stratigraphie machen können.«
»Wir haben verfärbte Erde entdeckt.«
Topher fügte noch ein kurzes Detail hinzu.
Ich hörte nicht zu. Ich schabte mit der Kelle, um eine Profilansicht der Bestattung, die sich an der Westseite des Grabens befand, zu bekommen. Mit jedem Kratzen wurden meine Befürchtungen schlimmer.
Nach dreißig Minuten waren ein Rückgrat und ein oberer Beckenrand erkennbar.
Ich setzte mich auf. Meine Kopfhaut kribbelte. Eine düstere Vorahnung beschlich mich.
Die Knochen waren durch Muskeln und Bänder verbunden.
Während ich meinen Fund noch anstarrte, schwirrte schon die erste Fliege herbei, die Sonne glitzerte auf ihrem smaragdgrünen Körper.
O Gott.
Ich stand auf und wischte mir Erde von den Knien. Ich musste unbedingt zu einem Telefon.
Dickie Dupree hatte jetzt bedeutend größere Probleme als nur alte Sewee.
2
Die Bewohner von Dewees Island sind streng bis zur Arroganz, was die ökologische Reinheit des Lebens »am anderen Ufer« angeht. Fünfundsechzig Prozent ihres kleinen Königreichs sind Naturschutzgebiet. Neunzig Prozent sind unbebaut. Die Anwohner haben nach eigener Aussage alles lieber naturbelassen. Kein Jäten, kein Veredeln.
Keine Brücke. Nach Dewees kommt man mit der Fähre oder mit einem privaten Boot. Die Straßen sind ausschließlich Sandpisten, Verbrennungsmotoren sind nur gestattet bei Bau- und Lieferfahrzeugen. Ach ja. Die Insel hat einen Krankenwagen, ein Feuerwehrauto und ein geländegängiges Fahrzeug zur Buschfeuerbekämpfung. Sosehr ihnen Ruhe und Unberührtheit auch am Herzen liegen, naiv sind die Hausbesitzer nicht.
Wie ich das finde? Die Natur ist großartig, wenn man im Urlaub ist. Sie ist verdammt lästig, wenn man versucht, einen verdächtigen Todesfall zu melden.
Dewees ist nur knappe fünfhundert Hektar groß, aber mein Trupp grub in der entferntesten südöstlichen Ecke, in einem Streifen Küstenwald zwischen dem Lake Timicau und dem Atlantischen Ozean. Keine Chance, hier ein Handy-Netz zu bekommen.
Nachdem ich Topher die Aufsicht über die Stätte übertragen hatte, lief ich den Strand hoch zu einem hölzernen Steg, überquerte darauf die Dünen und sprang dann in einen unserer sechs Golfkarren. Ich drehte eben den Schlüssel, als ein Rucksack auf den Sitz neben mir klatschte, gefolgt von Winbornes Hintern in seinem Polyesterfutteral. Da ich nur darauf bedacht war, ein funktionierendes Telefon zu finden, hatte ich nicht gehört, dass er mir folgte.
Okay. Besser, als den Trottel unüberwacht herumschnüffeln lassen.
Wortlos gab ich Gas oder was man bei Elektrofahrzeugen eben tut. Winborne stützte sich mit einer Hand am Armaturenbrett ab und umklammerte mit der anderen eine Stützstrebe des Dachs.
Auf dem Pelican Flight fuhr ich zuerst parallel zum Meer, bog dann rechts in die Dewees Inlet ein, kam am Picknick-Pavillon, dem Schwimmbad, dem Tennisplatz und dem Naturkundezentrum vorbei und bog dann, an der Spitze der Lagune, nach links in Richtung Wasser ab. An der Fähranlegestelle hielt ich an und wandte mich Winborne zu.
»Endstation.«
»Was?«
»Wie sind Sie hierher gekommen?«
»Mit der Fähre.«
»Und mit der Fähre sollt Ihr zurückkehren.«
»Auf gar keinen Fall.«
»Machen Sie, was Sie wollen.«
Da er mich missverstanden hatte, lehnte Winborne sich wieder in seinem Sitz zurück.
»Schwimmen Sie«, differenzierte ich.
»Sie können mich doch nicht einf-«
»Raus.«
»Ich habe an Ihrer Ausgrabungsstätte einen Karren stehen gelassen.«
»Ein Student wird ihn zurückbringen.«
Winborne stieg aus, das Gesicht verkniffen zu einer Maske teigigen Missfallens.
Als ich auf der Old House Lane nach Osten brauste, kam ich vorbei an schmiedeeisernen Toren, die mit phantasievollen Muschelschalen-Arrangements verziert waren, und erreichte schließlich das Infrastruktur-Areal der Insel. Feuerwache. Wasseraufbereitungsanlage. Verwaltungsgebäude. Residenz des Insel-Managers.
Ich kam mir vor wie ein Überlebender nach einer Neutronenbomben-Explosion. Alle Gebäude intakt, aber nirgendwo ein lebender Mensch zu sehen.
Frustriert kehrte ich zur Lagune zurück und hielt hinter einem zweiflügeligen Gebäude, das von einer riesigen Veranda eingerahmt wurde. Mit seinen vier Gästesuiten und dem winzigen Restaurant war Huyler House das einzige Zugeständnis Dewees’ an Fremde, die ein Bett oder ein Bier brauchten. Außerdem beherbergte es das Gemeinschaftszentrum der Insel. Ich sprang aus dem Karren und lief darauf zu.
Auch wenn mir vor allem der grausige Fund in Drei-Ost durch den Kopf ging, konnte ich mich der Faszination des Gebäudes vor mir nicht entziehen. Die Gestalter des Huyler House wollten den Eindruck von Jahrzehnten von Sonne und Salzluft vermitteln. Verwittertes Holz. Natürliche Verfärbungen. Obwohl das Haus noch nicht einmal zehn Jahre stand, sah es aus wie ein historisches Denkmal.
Das genaue Gegenteil traf auf die Frau zu, die jetzt durch eine Seitentür trat. Althea Hunneycut »Honey« Youngblood sah alt aus, war vermutlich aber uralt. Einer lokalen Legende nach war Honey Zeugin der Übereignung Dewees’ an Thomas Cary durch King William III. im Jahre 1696 gewesen.
Honeys Geschichte ist Thema ausufernder Spekulationen, aber in gewissen Punkten stimmen die Inselbewohner überein. Zum ersten Mal besuchte Honey Dewees als Gast der Familie Coulter Huyler vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Huylers führten dort ein ziemlich spartanisches Leben, seit sie die Insel 1925 erworben hatten. Kein Strom. Kein Telefon. Ein von einer Windmühle angetriebener Brunnen. Nicht gerade das, was ich mir unter Erholung am Strand vorstelle.
Honey kam damals mit einem Ehemann, wobei die Meinungen auseinander gehen, welchen Rang dieser Gentleman in der Abfolge ihrer Herrenbekanntschaften tatsächlich bekleidete. Als dieser Gatte starb, kam Honey dennoch immer wieder und heiratete schließlich in die Familie R.S. Reynolds ein, der die Huylers ihren Besitz 1956 verkauft hatten. Genau. Die Aluminium-Dynastie. Danach konnte Honey tun und lassen, was sie wollte. Sie beschloss, auf Dewees zu bleiben.
Die Reynolds verkauften ihren Grund 1972 an eine Investment-Gesellschaft, und im darauffolgenden Jahrzehnt wurden die ersten Privathäuser gebaut. Honeys war das erste, ein kompakter, kleiner Bungalow über Dewees Inlet. Nach der Gründung der IPP, der Island Preservation Partnership, des örtlichen Naturschutzvereins, wurde Honey dessen ansässige Naturkundlerin.
Kein Mensch wusste, wie alt sie wirklich war. Honey ließ sich darüber nicht aus.
»Wird ’n Heißer heute.« Honey eröffnete jedes Gespräch unweigerlich mit einem Kommentar zum Wetter.
»Ja, Miss Honey. Sieht ganz so aus.«
»Schätze, wir schaffen’s heute über dreißig.« Honey war eine Meisterin südstaatlicher Aussprachevarianten, und viele ihrer Silben nahmen zumindest für auswärtige Ohren ein Eigenleben an. Bei unseren vielen Unterhaltungen hatte ich gemerkt, dass das alte Mädchen mit den Vokalen spielen konnte wie sonst kaum jemand.
»Das glaube ich auch.« Mit einem Lächeln versuchte ich, an ihr vorbeizueilen.
»Gott und allen seinen Engeln sei Dank, dass es Klimaanlagen gibt.«
»Ja, Ma’am.«
»Ich grabt doch da drüben bei dem alten Turm, nicht?«
»Ganz in der Nähe.« Der Turm war während des Zweiten Weltkriegs zur U-Boot-Überwachung gebaut worden.
»Schon was gefunden?«
»Ja, Ma’am.«
»Großartig. Wir könnten ein paar neue Exponate für unser Naturkundezentrum gebrauchen.«
Aber nicht diese Art von Exponaten.
Ich lächelte und versuchte noch einmal, an ihr vorbeizukommen.
»Ich komme in den nächsten Tagen mal vorbei.« Die Sonne ließ die blau-weißen Locken aufleuchten. »Muss mich doch auf dem Laufenden halten, was auf der Insel so passiert. Habe ich Ihnen schon erzählt –«
»Bitte verzeihen Sie, aber ich habe es ziemlich eilig, Miss Honey.« Ich fertigte sie nur höchst ungern so ab, aber ich musste wirklich dringend zu einem Telefon.
»Natürlich. Wo sind nur meine Manieren geblieben?« Honey tätschelte meinen Arm. »Sobald Sie mal frei haben, fahren wir zum Fischen. Mein Neffe wohnt jetzt hier, und er hat ein klasse Boot.«
»Wirklich?«
»Natürlich, hab’s ihm ja selbst geschenkt. Kann zwar selber nicht mehr so am Ruder stehen wie früher, aber ich fische immer noch gerne. Ich ruf ihn an, und wir fahren raus.«
Und damit schritt Honey den Pfad entlang, den Rücken gerade wie eine Weihrauchkiefer.
Zwei Stufen auf einmal nehmend, lief ich auf die Veranda und ins Gemeindezentrum. Es war verlassen, wie alle anderen öffentlichen Gebäude.
Wussten die Einheimischen etwas, das ich nicht wusste? Wo waren sie nur alle?
Ich betrat das Büro, ging zum Schreibtisch, wählte die Auskunft und tippte dann die Nummer ein, die man mir genannt hatte. Nach dem zweiten Läuten meldete sich eine Stimme.
»Charleston County, Büro des Coroners.«
»Temperance Brennan hier. Ich habe vor ungefähr einer Woche angerufen. Ist der Coroner inzwischen zurück?«
»Einen Augenblick, bitte.«
Ich hatte Emma Rousseau kurz nach meiner Ankunft in Charleston angerufen, musste aber zu meiner Enttäuschung erfahren, dass sich meine Freundin in Florida aufhielt, wo sie den ersten Urlaub seit fünf Jahren machte. Schlechte Planung meinerseits. Ich hätte ihr eine E-Mail schreiben sollen, bevor ich hierher kam. Aber so hat unsere Freundschaft noch nie funktioniert. Wenn wir räumlich getrennt sind, kommunizieren wir kaum. Wenn wir uns dann wiedersehen, herrscht sofort eine Vertrautheit, als wären wir nur wenige Stunden getrennt gewesen.
»Einen Augenblick, bitte, sie kommt sofort«, sagte mir die Telefonistin.
Während ich wartete, erinnerte ich mich an meine erste Begegnung mit Emma Rousseau.
Acht Jahre war das her. Ich war Gastdozentin am College of Charleston. Emma, von der Ausbildung her eigentlich Krankenschwester, war eben zum Coroner des Charleston County gewählt worden. Sie hatte in einem Skelettfall die Todesart als »unbestimmbar« definiert, und die Familie zog diesen Befund in Zweifel. Da sie nun ein externes Gutachten brauchte, mich unbedingt als Gutachterin wollte, aber Angst hatte, ich würde ablehnen, schleppte Emma die Knochen in einer großen Plastikwanne in meine Vorlesung. Beeindruckt von so viel Mut, war ich bereit gewesen, ihr zu helfen.
»Emma Rousseau.«
»Ich hab da einen Mann in einer Wanne, der dich zum Sterben gern kennen lernen würde.« Schlechter Witz, aber zwischen uns fast schon ein Erkennungszeichen.
»O Mann, Tempe. Du bist in Charleston?« Emmas Vokale waren nicht ganz so gut wie Honeys, aber sie kamen ihnen verdammt nahe.
»Irgendwo in deinem Eingangsstapel muss eine telefonische Nachricht von mir liegen. Ich leite gerade ein archäologisches Ausgrabungsseminar auf Dewees. Wie war Florida?«
»Heiß und feucht. Du hättest Bescheid sagen sollen, dass du kommst. Ich hätte den Urlaub auch verschieben können.«
»Wenn du dir freigenommen hast, dann hattest du es sicher nötig.«
Darauf erwiderte Emma nichts. »Warum gräbst du eigentlich hier? Ist das nicht Jaffers Revier?«
»Dan ist nicht im Lande.«
»Hast du Miss Honey schon kennen gelernt?«
»O ja.«
»Ich liebe diese alte Dame. Noch immer voller Schwung und Witz.«
»Das ist sie wirklich. Hör mal, Emma. Kann sein, dass ich hier ein Problem habe.«
»Schieß los.«
»Jaffer hat mich auf dieses Gelände gebracht, weil er dachte, es könnte eine Begräbnisstätte der Sewee sein. Er hatte Recht. Seit dem ersten Tag finden wir Knochen, aber es ist typisch präkolumbisches Zeug. Trocken, ausgebleicht, viel postmortale Schädigung.«
Emma unterbrach mich nicht mit Fragen oder Bemerkungen.
»Heute Morgen haben meine Studenten in knapp fünfzig Zentimetern Tiefe eine frische Bestattung entdeckt. Die Knochen sehen intakt aus, die Wirbel sind durch Bindegewebe verbunden. Ich habe freigelegt, was mir sicher erschien, ohne den Fundort zu kontaminieren, dann dachte ich mir, ich sage lieber mal jemandem Bescheid. Ich weiß nicht genau, wer für Dewees zuständig ist.«
»Wenn’s um ein Verbrechen geht, der Sheriff. Bei der Beurteilung eines verdächtigen Todesfalls könnte ich die Gewinnerin sein. Hast du irgendwelche Hypothesen?«
»Keine, die irgendwas mit den alten Sewee zu tun hat.«
»Du meinst, die Bestattung ist neueren Datums?«
»Die Fliegen haben ’ne Kantine aufgemacht, als ich die Erde wegkratzte.«
Pause. Ich konnte mir vorstellen, dass Emma auf ihre Uhr schaute.
»Ich bin in eineinhalb Stunden bei dir. Brauchst du irgendwas?«
»Einen Leichensack.«
Ich wartete am Pier, als Emma in einem zweimotorigen Sea Ray ankam. Ihre Haare steckten unter einer Baseball-Kappe, und ihr Gesicht wirkte schmaler, als ich es in Erinnerung hatte. Sie trug eine Sonnenbrille von Dolce & Gabbana, Jeans und ein gelbes T-Shirt mit der schwarzen Aufschrift Charleston County Coroner.
Ich sah zu, wie Emma Fender an die Bordwand hängte, an den Steg manövrierte und das Boot vertäute. Als ich am Boot war, reichte sie mir einen Leichensack heraus, nahm dann ihre Kameraausrüstung und stieg an Land.
Im Golfkarren erzählte ich ihr, dass ich nach unserem Telefongespräch zur Ausgrabungsstätte zurückgekehrt war, ein schlichtes, drei mal drei Meter großes Planquadrat abgesteckt und ein paar Fotos geschossen hatte. Dann beschrieb ich detaillierter, was ich im Boden gesehen hatte. Und warnte sie, dass meine Studenten völlig aus dem Häuschen seien.
Emma sprach wenig während der Fahrt. Sie wirkte irgendwie niedergeschlagen, abgelenkt. Vielleicht verließ sie sich auch einfach darauf, dass ich ihr alles sagen würde, was sie wissen musste. Alles, was ich wusste.
Hin und wieder warf ich ihr einen Seitenblick zu. Die Sonnenbrille machte ihre Mimik unkenntlich. Im Wechsel des Lichts bei der Fahrt zeichneten die Schatten Muster auf ihr Gesicht.
Ich sagte ihr nicht, dass ich ein unbehagliches Gefühl hatte, Angst, dass ich mich vielleicht irrte und nur Emmas Zeit vergeudete.
Oder genauer, Angst, dass ich Recht haben könnte.
Ein flaches Grab an einem einsamen Strand. Mir fielen ein paar mögliche Erklärungen ein, aber alle hatten mit verdächtigen Todesarten und Leichenbeseitigung zu tun.
Emma wirkte gelassen. Wie ich hatte auch sie schon dutzende, vielleicht hunderte solcher Fälle bearbeitet. Verbrannte Körper, abgetrennte Köpfe, mumifizierte Kleinkinder, in Plastik eingewickelte Leichenteile. Für mich war das nie einfach. Ich fragte mich, ob Emmas Adrenalinpegel so hoch war wie meiner.
»Ist der Kerl da ein Student?« Emmas Frage riss mich aus meinen Gedanken.
Ich schaute in ihre Blickrichtung.
Homer Winborne. Sooft Topher ihm den Rücken zudrehte, fotografierte der Mistkerl mit einer Mini-Digitalkamera.
»Hurensohn.«
»Ich nehme das als Verneinung.«
»Er ist Reporter.«
»Sollte hier eigentlich nicht fotografieren.«
»Sollte überhaupt nicht hier sein.«
Ich sprang aus dem Karren und baute mich vor Winborne auf. »Was zum Teufel tun Sie hier?«
Meine Studenten erstarrten.
»Hab die Fähre verpasst.« Winbornes rechte Schulter sackte nach unten, als er den Arm hinter dem Rücken versteckte.
»Her mit der Nikon.« Scharf wie ein Rasiermesser.
»Sie haben kein Recht, mein Eigentum zu konfiszieren.«
»Verschwinden Sie bloß von hier. Sonst rufe ich den Sheriff und lasse Sie einbuchten.«
»Dr. Brennan.«
Emma stand direkt hinter mir. Winborne kniff die Augen zusammen, als er die Aufschrift auf ihrem T-Shirt las.
»Vielleicht könnte der Herr aus einer gewissen Entfernung zusehen.« Emma, die Stimme der Vernunft.
Ich schaute von Winborne zu Emma. Ich war so sauer, dass mir keine angemessene Erklärung einfiel. »Auf gar keinen Fall« hatte zu wenig Stil, »nur über meine Leiche« war wohl etwas unangebracht.
Emma nickte fast unmerklich, um mir zu verstehen zu geben, dass ich mitspielen sollte. Winborne hatte natürlich Recht. Ich hatte nicht die Befugnis, sein Eigentum zu konfiszieren oder ihm Befehle zu erteilen. Und auch Emma hatte Recht. Lieber die Presse kontrollieren, als sie gegen sich zu haben.
Oder dachte Madame Coroner bereits an die nächste Wahl?
»Macht, was ihr wollt.« Diese Antwort war nicht besser als die zuvor verworfenen.
»Vorausgesetzt, wir können die Kamera in sichere Verwahrung nehmen.« Emma streckte die Hand aus.
Mit einem selbstzufriedenen Lächeln in meine Richtung händigte Winborne ihr die Kamera aus.
»Das ist doch alles Kinderkram«, murmelte ich.
»Wie soll sich Mr. Winborne denn entfernen?«
»Wie wär’s mit dem Festland?«
Doch wie sich zeigen sollte, war Winbornes Anwesenheit nur von untergeordneter Bedeutung.
Innerhalb weniger Stunden überschritten wir einen Ereignishorizont, der meine Ausgrabung, meinen Sommer und meine Ansichten über die menschliche Natur völlig veränderte.
3
Topher und ein Student namens Joe Horne fingen an, innerhalb meines Drei-Meter-Quadrats mit langstieligen Spaten behutsam die oberste Erdschicht abzuheben. Bereits nach fünfzehn Zentimetern entdeckten wir Verfärbungen.
Jetzt war das A-Team an der Reihe.
Zuerst fotografierte und filmte Emma, dann nahmen sie und ich Kellen zur Hand und entfernten das Erdreich, das den Fleck umgab. Topher arbeitete am Sieb. Auch wenn er leicht vertrottelt wirkte, war er bei dieser Arbeit Weltklasse. Während des ganzen Nachmittags kamen immer wieder Studenten vorbei, um sich über unsere Fortschritte zu informieren, doch ihre Spurensicherungsbegeisterung erlahmte, je dichter die Fliegenpopulation wurde.
Bis um vier hatten wir einen gerade noch anatomisch korrekt angeordneten Torso, Knochen von Gliedmaßen, einen Schädel und einen Unterkiefer freigelegt. Die Überreste waren in verrottetes Gewebe gehüllt, auf dem Schädel waren noch Büschel heller, bleicher Haare zu erkennen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!