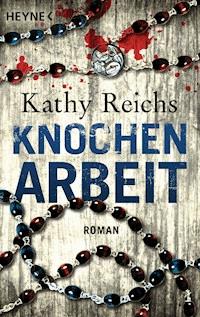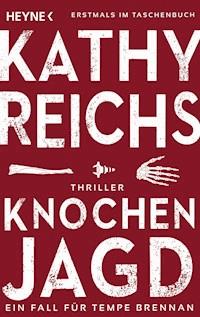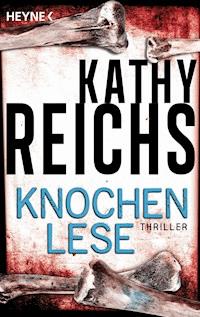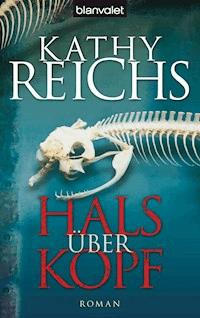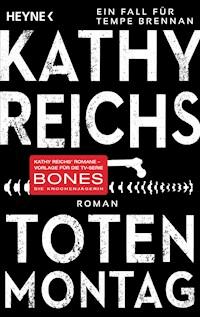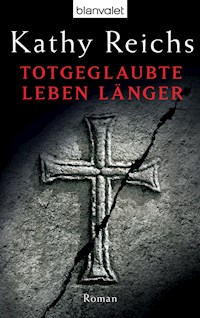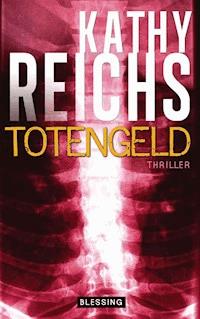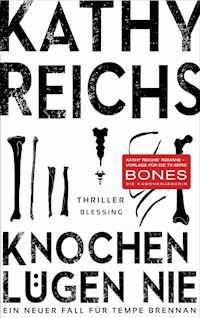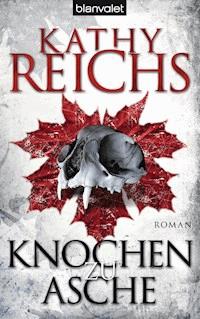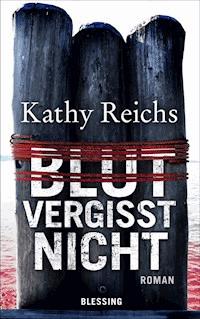
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Tempe-Brennan-Romane
- Sprache: Deutsch
Kann ein Mensch zweimal sterben? Ein neuer Fall für Tempe Brennan
Das Leben ist vergänglich. Der Tod ist unbestechlich. Tempe Brennans Arbeit als Forensikerin bringt manche Gewissheit mit sich. Denn: Einmal stirbt jeder, richtig? Falsch. An Brennans neustem Fall ist nichts so, wie es scheint. Das beginnt mit einem Mann, der nicht ein-, sondern gleich zweimal den Tod gefunden hat. Die Leiche von James »Spider« Lowry wird am Ufer eines Sees nahe Québec entdeckt. Tempe stellt fest: Spider kam vor wenigen Tagen ums Leben, und zwar durch einen äußerst bizarren Unfall. Die nächste Überraschung: Laut seiner Akte ist der Mann seit 1968 tot, als Soldat bei einem Hubschrauberabsturz in Vietnam verunglückt. Doch wer ruht dann in Spiders Grab? Und wie kommt Spiders Leiche in einen kanadischen See? Brennan reist nach Hawaii, wo die staatliche Behörde zur Auffindung vermisster US-Soldaten tätig ist. Und wird von einer Kollegin prompt mit einem weiteren Toten konfrontiert – mit den von Haien verunstalteten, rätselhaft tätowierten Überresten eines vorbestraften Kleindealers. Nicht nur der Temperaturen wegen entpuppt sich das Inselparadies Hawaii sehr bald als heißes Pflaster für Tempe. Denn Spiders Spuren führen nicht zufällig hierher. Und die örtlichen Drogenhändler reagieren auf neugierige Ermittlerinnen so instinktiv wie Haie auf einen blutigen Köder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für Henry Charles Reichs geboren am 20. Dezember 2009
BIS SIE ZU HAUSE SIND
Das Motto des Joint POW/MIA Accounting Command
1
Die Luft roch nach sonnenwarmer Rinde und Apfelknospen, die sich reckten, um aufzublühen und das Leben neu zu beginnen. Über meinem Kopf tanzte eine Million kleiner Blätter im Wind.
Von dem Obsthain aus, in dem ich stand, breiteten sich Felder aus, die frisch umgepflügte Erde fett und schwarz. Die Adirondacks krochen über den Horizont, leuchtend bronzefarben und grün im prächtigen Sonnenlicht.
Ein Tag, gemacht aus Diamanten.
Der Satz flatterte mir zu aus einem Kriegsdrama, das ich im Filmklassikerkanal gesehen hatte. Van Johnson? Egal. Das Bild passte perfekt auf diesen Nachmittag Anfang Mai.
Ich bin ein Carolina-Mädchen, kein Fan polaren Klimas. Jonquils im Februar. Azaleen, Hartriegel, Ostern am Strand. Obwohl ich seit Jahren im Norden arbeite, überrascht mich nach jedem langen, dunklen, ermüdenden Winter die Schönheit des Frühlings in Quebec noch immer.
Eine Welt, die funkelt wie ein Neunkaräter.
Ein unerbittliches Summen zog meinen Blick wieder zu der Leiche, die vor meinen Füßen lag. Nach Angaben des SQ-Beamten André Bandau, der jetzt so viel Distanz wie möglich wahrte, war die Leiche gegen Mittag ans Ufer gekommen.
Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Obwohl es noch kaum drei Uhr war, krabbelten und schwirrten Fliegen in einer Orgie des Fressens. Oder der Fortpflanzung. Ich wusste das nie so genau.
Rechts von mir schoss ein Techniker Fotos. Links spannte ein anderer polizeiliches Absperrband um den Uferstreifen, auf dem die Leiche lag. Auf den Jacken der beiden stand Service de l’identité, Division des scènes de crime. Quebecs Version von CSI, dem Spurensuche- und Tatortsicherungsteam.
Hinter mir saß Ryan in einem Streifenwagen und sprach mit einem Mann mit einer Truckerkappe.
Lieutenant-détective Andrew Ryan, Section de Crimes contre la Personne, Sûreté du Québec. Klingt nach was ganz Besonderem. Ist es nicht.
In La Belle Province werden Verbrechen in den Großstädten von lokalen Kräften bearbeitet, draußen auf dem flachen Land von der Provinzpolizei. Ryan ist ein Detective des Morddezernats von letzterer Truppe, der SQ.
Die Leiche wurde in einem Teich in der Nähe der Stadt Hemmingford entdeckt, fünfundvierzig Meilen südlich von Montreal. Hemmingford. Ländliche Gegend. SQ. Sie verstehen, was ich meine.
Aber warum Ryan, ein Mordermittler der Montrealer Einheit der SQ?
Da der Verstorbene in Plastik eingewickelt war und am Fuß einen Stein als Schwimmflosse trug, vermutete die örtliche SQ ein Verbrechen. Deshalb kam Ryan ins Spiel.
Und ich. Temperance Brennan, forensische Anthropologin.
Ich arbeite für das Laboratoire de Sciences Judiciaires et de Médecine Légale und beschäftige mich im Auftrag der Provinz mit den Verwesten, den Mumifizierten, den Verstümmelten, den Zerstückelten und den Skelettierten, ich helfe dem Coroner bei der Identifikation und der Bestimmung der Todesursache und des postmortalen Intervalls, also der Zeit, die seit Eintritt des Todes vergangen ist.
Liegt eine Leiche im Wasser, bedeutet das einen nicht unbedingt unverfälschten Zustand, als Ryan deshalb den Anruf wegen einer Wasserleiche bekam, holte er sofort mich hinzu.
Durch die Windschutzscheibe sah ich Ryans Gesprächspartner erregt gestikulieren. Der Mann war vermutlich fünfzig, mit grauen Bartstoppeln und Gesichtszügen, die auf eine Zuneigung zu geistigen Getränken hindeuteten. Schwarze und rote Buchstaben auf seiner Kappe verkündeten I Love Canada. Anstelle des traditionellen Herzsymbols sah man hier ein Ahornblatt.
Ryan nickte. Schrieb etwas in sein kleines Notizbuch.
Ich konzentrierte mich wieder auf die Leiche und machte mir auf meinem eigenen Spiralblock Notizen.
Die Leiche lag auf dem Rücken und war in transparentes Plastik eingewickelt, aus dem nur das linke untere Bein herausragte. Isolierband versiegelte das Plastik unter dem Kinn und an der linken Wade.
Der aus dem Plastik herausragende Fuß trug einen schweren Motorradstiefel. Über dem Rand waren etwa fünf Zentimeter Fleisch zu sehen, das die Farbe von Hafergrütze hatte.
Ein Stück gelbes Polypropylenseil war um den Schaft des Stiefels gebunden. Am anderen Ende war mittels eines komplizierten Geflechts aus Knoten ein schwerer Stein befestigt.
Der Kopf des Opfers war separat eingewickelt, in einer Plastiktüte, die aussah wie eine normal große Einkaufstüte. Ein Röhrchen ragte seitlich aus der Tüte heraus und war ebenfalls mit Isolierband befestigt. Auch um den Hals war die Tüte mit Isolierband verklebt.
Was zum Geier …?
Als ich mich hinkauerte, drehten die Fliegen völlig durch. Glänzend grüne Geschosse prasselten auf mein Gesicht und meine Haare.
So nahe dran, war der Fäulnisgeruch unmissverständlich. Angesichts der Verpackung des Opfers war das merkwürdig.
Diptera wegwedelnd beugte ich mich ein Stück über die Leiche, um mir die andere Seite besser ansehen zu können.
Eine dunkle Masse pulsierte etwa in Höhe des rechten Oberschenkels. Ich verscheuchte den Schwarm mit einer behandschuhten Hand.
Und ärgerte mich.
Durch einen frischen Schnitt im Plastik war der obere Teil des rechten Beins zu sehen. Fliegen kämpften am Handgelenk und offensichtlich auch weiter oben am Arm um die besten Plätze.
Verdammt.
Ich unterdrückte meinen Ärger und wandte mich dem Kopf zu.
Algen breiteten sich in den Falten der Tüte oben am Kopf und am Hinterkopf aus. Auch eine Seite des merkwürdigen Röhrchens zeigte schleimigen Bewuchs.
Unter der durchscheinenden Bedeckung erkannte ich verschwommene Gesichtszüge. Ein Kinn. Den Rand einer Augenhöhle. Eine zur Seite gebogene Nase. Aufblähung und Verfärbung deuteten darauf hin, dass es mit einer visuellen Identifikation wohl nichts werden würde.
Ich stand auf und schaute zu dem Teich hinüber.
Ans Ufer hochgezogen lag ein kleines Aluminiumboot mit einem 3-PS-Außenborder. Im Heck sah ich auf dem Boden eine Kühltasche, eine Utensilienbox und eine Angelrute.
Neben dem Boot lag ein rotes Kanu auf die Steuerbordseite gekippt. Auf der Backbordflanke stand in weißen Buchstaben Navigator.
Ein Polypropylenseil spannte sich von einem Knoten an der Mittschiffsruderbank zu einem Stein auf der Erde. Mir fiel auf, dass der Knoten auf diesem Stein dem auf dem Fußanker des Opfers ähnelte.
Im Kanu lag auf der Steuerbordseite ein Paddel. Unter dem Hecksitz klemmte ein Leinwandsack. Daneben lagen ein Messer und eine Rolle Isolierband.
Ein Motorengeräusch mischte sich unter das Fliegensummen und das Rascheln und Klicken der Techniker um mich herum. Ich ignorierte es.
Fünf Meter den Strand hoch stand ein verrostetes, rotes Moped unter einem frühzeitig blühenden Baum. Von meiner Position aus war das Nummernschild nicht zu lesen. Zumindest nicht mit meinen Augen.
Zwei Rückspiegel. Seitenständer. Transportkoffer hinter dem Sitz. Das Ding erinnerte mich an meinen fahrbaren Untersatz aus Unizeiten. Ich hatte diesen Hobel geliebt.
Als ich die Strecke zwischen dem Boot und dem Moped abging, sah ich einen Satz Reifenspuren, der zu dem Pick-up am Straßenrand passte, und eine Spur, die von dem Moped stammte. Keine Fuß- oder Stiefelabdrücke. Keine Zigarettenkippen, Getränkedosen, Kondome oder Schokoriegelverpackungen. Auch ansonsten absolut kein Müll.
Auf dem Rückweg am Wasserrand entlang notierte ich weiter meine Beobachtungen. Das Motorengeräusch wurde lauter.
Teich mit schlammigem Ufer, flach, keine Wellenbewegungen. Apfelbäume knappe zwei Meter vom Ufer entfernt. Zehn Meter bis zu einem Kiesweg, der zum Highway 219 führte.
Reifen knirschten. Das Motorengeräusch brach ab. Autotüren wurden geöffnet und zugeknallt. Männliche Stimmen, die Französisch sprachen.
Da fest stand, dass mir dieser Fundort keine weiteren Informationen liefern würde und ich mit dem fleißigen Beamten Bandau ein paar Worte wechseln wollte, drehte ich mich um und ging zu den Fahrzeugen, die am Wegrand parkten.
Ein schwarzer Transporter stand nun hinter Ryans Jeep, dem blauen Spurensicherungslaster, dem Pick-up des Anglers und Bandaus SQ-Streifenwagen. Gelbe Beschriftung auf dem Van kündigte das Bureau du Coroner an.
Ich kannte den Fahrer des Transporters, einen Autopsietechniker namens Gilles Pomerlau. Neben ihm saß mein neuer Assistent, Roch Lauzon.
Nach gegenseitigen Bonjours versicherte ich Pomerlau und Lauzon, dass sie nicht lange würden warten müssen. Sie gingen zur Leiche, um sie sich anzusehen. Ryan saß mit dem glücklosen Angler weiter im Streifenwagen.
Ich ging zu Bandau, einem schlaksigen Mittzwanziger mit einem weizenblonden Schnurrbart und Haut, die aussah, als würde sie die Sonne wirklich hassen. Seine Haare waren von seiner Kappe verdeckt. Ich stellte sie mir blond und besorgniserregend schütter vor.
»Was ist mit der Plastikverpackung?«, fragte Bandau auf Französisch und schaute an mir vorbei zu der Leiche.
»Gute Frage.« Ich hatte keine Erklärung.
»Männlich oder weiblich?«
»Ja«, sagte ich.
Bandau drehte mir das Gesicht wieder zu, sodass ich mein Spiegelbild in seiner Pilotenbrille sah. Mein Ausdruck war kein glücklicher.
»Soweit ich weiß, haben Sie als Erster auf den Notruf reagiert.«
Bandau nickte, seine Augen waren hinter den dunklen Gläsern nicht zu sehen.
»Wie lief das ab?«
Bandau deutete mit dem Kinn zu dem Streifenwagen. »Ein Ortsansässiger namens Gripper fand das Opfer. Behauptet, er wäre beim Fischen gewesen, als er das Kanu entdeckte. Er fährt mit dem Boot hin, um nachzusehen, und etwas verheddert sich in seinem Propeller. Sagte, er wäre hingepaddelt, hätte gesehen, dass sein Fang eine Leiche war, und auf seinem Handy 911 angerufen. Während er wartete, schleppte er die Leiche ans Ufer und holte dann das Kanu.«
»Gründlicher Typ.«
»Kann man so sagen.«
»Ist er glaubwürdig?«, fragte ich.
Bandau zuckte die Achseln. Wer weiß?
»Angaben zur Person?«
»Lebt mit seiner Frau an der Avenue Margaret. Arbeitet als Wartungstechniker im Naturpark.«
Hemmingford liegt in der Region Montéregié, dicht an der Grenze zwischen Quebec und den USA. Die Region Montéregié ist berühmt für ihre Äpfel, ihren Ahornsirup und den Parc Safari, eine Mischung aus befahrbarem Naturschutzgebiet und Vergnügungspark.
Als ich anfing, in Quebec zu arbeiten, berichteten die Medien über eine Gruppe Rhesusaffen, die aus dem Park entkommen war. Ich stellte mir vor, wie die Horde nachts auf dem Bauch nach Süden kroch, um den Grenzkontrollen zu entgehen, wie sie alles riskierte für eine Green Card und ein besseres Leben. Zwanzig Jahre später muss ich bei dem Gedanken immer noch grinsen.
»Weiter«, sagte ich.
»Ich erhielt den Anruf so gegen Mittag, fuhr hier raus und sicherte den Fundort.«
»Und nahmen der Leiche Fingerabdrücke ab.« Frostig.
Bandau spürte meine Missbilligung, spreizte die Füße und hakte die Daumen in den Gürtel. »Ich dachte, das beschleunigt die Identifikation.«
»Sie haben das Plastik aufgeschnitten.«
»Ich hatte Handschuhe an.« Defensiv. »Sehen Sie, ich habe diese neue Kamera, also habe ich Nahaufnahmen gemacht und die Datei elektronisch verschickt.«
»Sie haben den Fundort kompromittiert.«
»Was für einen Fundort? Der Kerl dümpelte in einem Teich.«
»Die Fliegen werden zusammenlegen, um Ihnen ein Bier zu spendieren. Vor allem die Damen. Während wir hier reden, legen die gerade voller Freude ihre Eier.«
»Ich wollte doch nur helfen.«
»Sie haben die Verfahrensvorschriften missachtet.«
Bandau kniff die Lippen zusammen.
»Was ist mit den Abdrücken passiert?«
»Ich konnte von allen fünf Fingern Wellenmuster abnehmen. Jemand vom Revier schickte sie an das CPIC. Und von dort gingen sie weiter ans NCIC und ans New York State System.«
CPIC ist das Canadian Police Information Center, ein computerisierter Index von Informationen zu Kriminalfällen. NCIC ist das amerikanische Äquivalent, das National Crime Information Center des FBI.
»Warum wurden die Abdrücke nach Süden geschickt?«
»Da wir hier dicht an der Grenze sind, kommen viele Amerikaner durch. Und das Moped hat ein New Yorker Kennzeichen. «
Nicht schlecht, Bandau.
Eine Autotür wurde zugeschlagen, und wir drehten uns beide um.
Ryan kam auf uns zu. Gripper, der für den Augenblick erlöst war, lehnte mit Unbehagen im Gesicht an seinem Pick-up.
Ryan nickte Bandau zu und wandte sich dann an mich.
»Was denkst du?«
»Der Kerl ist tot.«
»Kerl?«
»Allein ausgehend von der Größe.«
»Wie lange?«
»Schwer zu sagen. Bei den warmen Temperaturen dieser Woche und der Plastikverpackung würde ich sagen, ein oder zwei Tage. Es gibt leichte Verwesung, aber nicht viel.« Ich warf Bandau einen bedeutungsvollen Blick zu. »Das wird sich jetzt ändern, da man den Insekten ein Einfallstor geöffnet hat.«
Ich berichtete Ryan, was Bandau getan hatte.
»Was war denn das für ein Anfängerfehler?«
Bandaus Wangen wurden himbeerrot.
»So schaffen Sie es sicher nicht die Karriereleiter hoch, mein Sohn.«
Ryan wandte sich wieder mir zu.
»Vierundzwanzig bis achtundvierzig Stunden passt zu den Angaben des Zeugen. Gripper sagt, er kommt an seinen freien Tagen hierher, normalerweise am Dienstag und am Donnerstag. Er schwört, dass der Teich vorgestern noch kanu- und leichenfrei war.«
»Algenbewuchs deutet darauf hin, dass die Leiche mit dem Kopf an oder knapp unter der Wasseroberfläche trieb«, sagte ich.
Ryan nickte. »Laut Gripper hing die Leiche mit dem Kopf nach oben im Wasser, und der gestiefelte Fuß war mit einem Stein auf dem Grund verbunden. Er schätzt, dass der Teich an der Stelle, wo er den Kerl fand, ungefähr zweieinhalb Meter tief ist.«
»Wo war das Kanu?«
»Neben dem Opfer. Gripper sagt, das ist der Grund, warum sich das Seil in seinem Außenborder verhedderte.«
Ryan wandte sich nun an Bandau: »Prüfen Sie nach, ob es schon eine Rückmeldung wegen der Fingerabdrücke gibt.«
»Jawoll, Sir.«
Ryan und ich sahen Bandau zu seinem Streifenwagen latschen.
»Wahrscheinlich zu viele Copserien gesehen«, sagte Ryan.
»Nicht die richtigen.«
Ryan schaute flüchtig zu der Leiche, dann wieder zu mir.
»Was denkst du?«
»Komische Sache«, sagte ich.
»Selbstmord? Unfall? Mord?«
Ich breitete die Hände aus, was »Keine Ahnung« heißen sollte.
Ryan grinste. »Deshalb nehme ich dich ja mit.«
»Das Opfer hatte das Kanu wahrscheinlich am Teich und fuhr mit dem Moped hin und her.«
»Hin und her von wo?«
»Keine Ahnung.«
»Ja. Was würde ich nur ohne dich machen?«
Über uns trällerte eine Walddrossel. Eine andere antwortete. Der fröhliche Austausch stand in starkem Kontrast zu der grimmigen Unterhaltung darunter.
Als ich nach oben sah, verscheuchten eilige Schritte den Vogel.
»Hab ihn.« Bandaus Pilotenbrille hing nun an einem Bügel an seiner Brusttasche. »Volltreffer in den Staaten. Übereinstimmung an dreizehn Punkten.«
Kann sein, dass Ryans Brauen noch höher schnellten als meine.
»John Charles Lowery. Geburtsdatum 15. August 1950.«
»Nicht schlecht, Bandau.« Diesmal sagte ich es laut.
»Es gibt nur ein Problem.«
Bandaus bereits tiefe Stirnfurchen wurden noch tiefer.
»John Charles Lowery starb 1968.«
2
»Wie kann Lowery heute eine Wasserleiche sein, wenn er vor vier Jahrzehnten den Löffel abgegeben hat?« Ryan sprach die Frage aus, die ich mir ebenfalls gestellt hatte.
Ich hatte keine Antwort.
Wir fuhren auf der Fifteen nach Norden. Der Transporter des Coroners war irgendwo hinter uns. Pomerlau und Lauzon würden ihren triefenden Passagier in die Leichenhalle bringen, wo er in der Kühlung warten würde, bis ich ihn am nächsten Morgen auswickelte.
»Vielleicht war der Treffer ein Fehler.«
»Bei dreizehn übereinstimmenden Punkten?« Mein Ton verriet meine Skepsis.
»Kannst du dich noch an diesen Anwalt in Oregon erinnern? «
Brandon Mayfield. Das FBI hatte ihn aufgrund von Fingerabdruckindizien mit dem Bombenanschlag auf den Zug in Madrid in Verbindung gebracht. Wie sich herausstellte, war die Übereinstimmung falsch gewesen.
»Das war ein Patzer«, sagte ich. »Glaubst du, dass die Abnahme der Fingerabdrücke am Fundort Konsequenzen haben wird?«
»Für den guten Herrn Beamten schon. Eine hirnrissige Aktion, hat aber wahrscheinlich nicht viel geschadet.«
»Er hat’s nur gut gemeint.«
Ryan schüttelte ungläubig den Kopf.
Einige Meilen lang herrschte Schweigen im Jeep. Ryan beendete es.
»Willst du nach Hause?«
Ich nickte.
Minuten später überquerten wir den St. Lawrence auf der Champlain Bridge. Unter uns floss kalt und dunkel der Strom. Auf der einen Seite zwinkerten winzige Gärten und Rasenflächen zwischen den Wohnanlagen mit frischem Grün.
Hier in der Stadt bewegte sich der Verkehr wie Schlamm durch einen Strohhalm. Der Jeep ruckte und zuckte, während Ryan immer wieder zwischen Gas und Bremse wechselte.
Freundlich, ja. Witzig, positiv. Großzügig, absolut. Geduldig, auf gar keinen Fall. Reisen mit Ryan war oft eine Prüfung.
Ich schaute auf die Uhr. Zehn nach fünf.
Normalerweise hätte Ryan mich inzwischen nach meinen Plänen fürs Abendessen gefragt. Hätte ein Restaurant vorgeschlagen. An diesem Abend tat er es nicht.
Machte es mir etwas aus?
Ich kurbelte mein Fenster herunter. Der Geruch von öligem Wasser wehte in den Jeep. Von warmem Zement und Auspuffgasen.
Ja. Es machte mir etwas aus.
Würde ich fragen?
Auf gar keinen Fall. Seit unserer Trennung hatten wir uns auf eine neue, bilaterale Balance geeinigt. Berufliche Beziehung: So wie immer. Private Beziehung: Nichts fragen, nichts sagen.
War eigentlich meine Entscheidung gewesen. Obwohl Lutetia wieder einmal Geschichte war, tat es immer noch weh, dass Ryan mich wegen seiner Ex sitzen gelassen hatte.
Das gebrannte Kind scheut das Feuer.
Und da gab es ja auch noch Charlie Hunt.
Schnappschuss. Charlie auf der Dachterrasse seines Backsteinhauses in den Außenbezirken von Charlotte. Zimtfarbene Haut. Smaragdgrüne Augen. So groß wie sein Daddy, der in der NBA gespielt hatte.
Nicht schlecht.
Ich warf Ryan einen Seitenblick zu. Sandfarbene Haare. Die blauesten aller Augen. Lang und schlank wie sein Daddy in Nova Scotia.
Auch nicht schlecht.
Um ehrlich zu sein, nach jahrzehntelanger Ehe, dann einer wackeligen Wiederannäherung nach der Trennung, gefolgt von einer Periode braver Solidität und einer unverdienten Abschiebung zum alten Eisen fand ich die Wer-zweimal-mit-demselben-pennt-Schiene gerade richtig dufte.
Bis auf zwei winzige Details. Ryan hatte seit unserer Trennung im letzten Sommer das Bett nicht mehr mit mir geteilt. Charlie Hunt war noch kein Zugang gewährt worden.
Auf beiden Ebenen war es ein langer, kalter Winter gewesen.
Der Klang von Ryans Handy riss mich aus meinen Gedanken.
Ich hörte, wie er oft oui sagte und ein paar Fragen stellte. Aus Letzteren schloss ich, dass es bei dem Anruf um John Lowery ging.
»Bandau hat eine Anfrage Richtung Süden geschickt«, sagte Ryan nach dem Auflegen zu mir. »Wie’s aussieht, ist unser Junge in Vietnam im Kampf gefallen.«
»Hast du jetzt die Titelmelodie der Sesamstraße als Klingelton? «
»Keeping the clouds away«, sang Ryan.
»Hast du Bettwäsche mit Big Bird drauf?«
»Bien sûr, Madam.« Großes Zwinkern. »Willst du sie sehen?«
»Lowery? Vietnam?«
»Schon mal was von einem Laden namens JPAC gehört?«
»Sicher. Ich habe für die gearbeitet. Das Joint POW/MIA Accounting Command. Zuständig für Kriegsgefangene und im Einsatz Vermisste. Hieß bis 2003 noch CILHI.«
»Halleluja. Buchstabensuppe.«
»Now I’ve said my A B C’s«, sang ich.
»Wir sollten es mit der Metapher nicht zu weit treiben.«
Central Identification Laboratory Hawaii. Das Zentrale Identifikationsinstitut auf dieser schönen Insel. JPAC entstand aus der Zusammenlegung des CILHI und der Joint Task Force – Full Accounting Commission. Die Laborabteilung des JPAC nennt sich jetzt CIL. Das ist das größte Forensiklabor der Welt.
»Lowery kam nicht vom JPAC, aber da ist seine Akte gelandet. Was hattest du mit dem Laden zu tun?«
»Jede eindeutige Identifikation beim JPAC muss durch Unmengen von Gutachtern bestätigt werden, einige davon sind Zivilisten und gehören nicht zum CIL. Ich habe in dieser Eigenschaft viele Jahre für sie gearbeitet.«
»Richtig. Ich habe diese Hawaiiflüge mitten im Winter ganz vergessen.«
»Für die Laborkontrolle waren zwei Reisen pro Jahr erforderlich. «
»Und ein bisschen Surfen, meine Kokosnussprinzessin?«
»Ich surfe nicht.«
»Wie wär’s, wenn ich mein Brett in deine Richtung steure und wir –«
»Ich hatte kaum mal Zeit, einen Fuß an den Strand zu setzen. «
»Aha.«
»Wann wurde Lowery identifiziert?«, fragte ich.
»Hat Bandau nicht gesagt.«
»Falls das damals in den Sechzigern war, da war alles noch ganz anders.«
Ryan bog von der Rue Ste-Catherine ab, fuhr einen halben Block und hielt vor einem grauen Steinkomplex mit prächtigen Erkerfenstern, die auf den Bürgersteig hinausschauten. Leider liegt meine Wohnung nach hinten raus und profitiert nicht von dieser architektonischen Schrulle.
»Hast du vor, dir den Plastikmann gleich morgen in der Früh vorzunehmen?«
»Ja. Der Zeitunterschied ist fünf Stunden, also werde ich das CIL gleich heute Abend noch anrufen und mal sehen, was ich über Lowery herausfinden kann.«
Ich spürte Ryans Blick auf meinem Rücken, als ich zur Tür ging.
Für gewöhnlich bringt mir der Frühling in Quebec viel Arbeit auf den Tisch. Flüsse und Seen tauen. Der Schnee schmilzt. Leichen tauchen auf. Die Bürger verlassen ihre Sofas und wagen sich ins Freie. Manche entdecken Leichen. Andere werden selber welche.
Weil mein Mai-Turnus in Montreal normalerweise ziemlich lange dauert, begleitet Birdie mich als Handgepäck unterm Sitz. Vom Flug selbst abgesehen, ist Birdie eine ziemlich gute Gesellschaft.
Die Katze wartete hinter der Wohnungstür.
»Hey, Bird.« Ich kauerte mich hin, um ihn zu streicheln.
Birdie schnupperte an meinen Jeans; den Hals gereckt, die Schnauze gehoben, saugte er in schnellen Zügen die Luft ein.
»Schönen Tag gehabt?«
Birdie trottete davon, setzte sich und legte geziert die Pfoten aneinander.
»Eau de Vèrwesüng nicht dein Duft?« Ich stand auf und warf meine Tasche aufs Sideboard.
Bird erhob sich und leckte eine Pfote.
Meine Eigentumswohnung ist nicht groß. L-förmige Kombination aus Wohnzimmer und Esszimmer mit angrenzender Küche vorne, zwei Schlafzimmer und zwei Bäder hinten. Sie liegt im Erdgeschoss, in einem Flügel eines vierstöckigen, u-förmigen Gebäudes. Vom Wohnzimmer aus führen Terrassentüren in einen winzigen Garten. Auf der anderen Seite gelangt man vom Esszimmer aus durch ebensolche Türen in einen zentralen Innenhof.
Der direkte Zugang zum Rasen auf der einen Seite und zum Garten auf der anderen war beim Kauf der wichtigste Grund für meine Entscheidung gewesen. Mehr als zehn Jahre später bin ich noch immer in dieser Wohnung.
Trotz der olfaktorischen Beleidigung trottet Birdie hinter mir her in die Küche. Sein Appetit war offensichtlich noch intakt.
Die Innenausstattung der Wohnung besticht durch Erdtöne und gebrauchte Möbel, die ich zu Antiquitäten gemacht habe. Echtholzzierleisten. Steinerner Kamin. Ein gerahmtes Poster von Jean Dubuffet. Eine Vase voller Muschelschalen als Erinnerung an die Strände in den Carolinas.
Mein Anrufbeantworter flackerte wie ein defekter Blinker.
Ich hörte die Nachrichten ab.
Meine Schwester Harry in Houston ist nicht glücklich mit ihrem augenblicklichen Rendezvouspartner.
Meine Tochter Katy in Charlotte hasst ihren Job, ihr Privatleben und das Universum im Allgemeinen.
Die Gazette will Abos verkaufen.
Harry.
Mein Nachbar Sparky beschwert sich über Birdie. Schon wieder.
Harry.
Charlie Hunt. »Denke an dich.«
Harry.
Ich löschte alles und stellte mich unter die Dusche.
Das Abendessen bestand aus Linguine mit Olivenöl, Spinat, Pilzen und Feta. Birdie leckte den Käse von seinen Nudeln und machte sich dann über den Rest der knusprigen, braunen Brocken in seiner Schüssel her.
Nachdem ich das Geschirr abgeräumt hatte, rief ich das CIL an.
Fünftausend Meilen von der Tundra entfernt wurde gleich nach dem ersten Läuten ein Hörer abgenommen. Nachdem ich meinen Namen genannt hatte, fragte ich nach Roger Merkel, dem wissenschaftlichen Direktor des Instituts.
Merkel war in Washington, DC.
»Dr. Tandler?«
»Einen Augenblick, bitte.«
Daniel »Danny« Tandler ist der Stellvertretende Direktor des CIL. Wir beide sind gleich alt und haben uns gemeinsam in der forensischen Hierarchie hochgearbeitet, wenn auch in verschiedenen Institutionen. Kennengelernt haben wir uns bereits zu Studienzeiten, in der Studentenorganisation der American Academy of Forensic Sciences. Vor Urzeiten, als die Welt noch ziemlich jung war, hatten wir ein kurzes, fleischliches Techtelmechtel. Viel Spaß, aber schlechtes Timing. Auftritt Pete Petersons. Ich heiratete, machte mein Diplom an der Northwestern und unterrichtete anschließend zuerst an der Northern Illinois University, dann an der University of South Carolina in Charlotte. Danny blieb die ganze Zeit an der University of Tennessee und machte sich nach seiner Promotion schnurstracks auf nach Hawaii.
Da ging mir einer durch die Lappen? Vielleicht. Sei’s drum. Danny Tandler ist inzwischen verheiratet und nicht mehr im Spiel.
Im Lauf der Jahre haben Danny und ich uns gegenseitig viel geholfen, als Fürsprecher bei der Dissertation, bei Lizenzprüfungen, Bewerbungs- und Beförderungsgesprächen. Als das CIL einen neuen externen Gutachter brauchte, brachte Danny meinen Namen ins Spiel. Das war Anfang der Neunziger. Fast zehn Jahre lang arbeitete ich in dieser Funktion.
Ich wartete auf Tandler nur unwesentlich länger als auf die erste Abnahme des Hörers.
»Tempe, mein Mädchen. Wie geht’s?« Eine Stimme, die nach Land und weiten, offenen Flächen klang.
»Gut.«
»Sag mir, dass du es dir überlegt hast und wieder mit an Bord kommst.«
»Noch nicht.«
»Im Augenblick haben wir hier siebenundzwanzig Grad. Moment mal.« Dramatisches Rascheln. »Okay. Hab jetzt die Sonnenbrille auf. Die Sonne, die sich im Wasser spiegelt, hat mich geblendet.«
»Du bist in einem Gebäude auf einer Militärbasis.«
»Palmwedel streichen zärtlich über mein Fenster.«
»Heb’s dir für den Winter auf. Hier ist es im Augenblick auch sehr schön.«
»Welchem Anlass verdanke ich diese unerwartete Überraschung? «
Ich berichtete ihm von dem Teich, der Plastikfolie, der Fingerabdruckidentifikation des Opfers als Lowery.
»Warum die Verpackung?«
»Keine Ahnung.«
»Bizarr. Mal sehen, ob ich Lowerys Akte finde.«
Es dauerte volle zehn Minuten.
»Tut mir leid. In weniger als einer Stunde fängt bei uns hier eine Ankunftszeremonie an. Die meisten sind bereits drüben am Hangar. Im Augenblick kann ich dir nur das Allerwesentlichste sagen. Details müssen warten.«
»Verstehe.«
Das tat ich wirklich. Eine Ankunftszeremonie ist ein feierliches Ereignis zu Ehren eines unbekannten Soldaten, Matrosen, Fliegers oder Marineinfanteristen, der fern der Heimat in Ausübung seiner Pflicht fiel. Nach Bergung und Rückführung auf amerikanische Erde ist das der erste Schritt auf einem komplizierten Weg zur Wiedereinbürgerung.
Während meiner Zeit beim JPAC nahm ich an mehreren Ankunftszeremonien teil. Ich stellte mir die Szene vor, die sich in Kürze abspielen würde. Das eben gelandete Flugzeug. Die stillstehenden Soldaten und Soldatinnen. Das mit der Flagge verhüllte Überführungsbehältnis. Die feierliche Fahrt quer über den Stützpunkt zum CIL-Labor.
»John Charles Lowery war ein achtzehn Jahre alter, einfacher Soldat. Kam am 24. Juni 1967 in Vietnam an.« Dannys Tonfall ließ darauf schließen, dass er den Text überflog und nur die wichtigsten Fakten herauspickte. »Am 23. Januar 1968 stürzte Lowery in der Nähe von Long Binh mit einem Huey-Hubschrauber ab.« Pause. »Die Leiche wurde am nächsten Tag geborgen, identifiziert, zurückgebracht und der Familie zur Beerdigung übergeben.«
»Wo beerdigt?«
»Bei dir um die Ecke. Lumberton, North Carolina.«
»Im Ernst?«
Im Hintergrund hörte ich eine Stimme. Danny sagte etwas. Die Stimme antwortete.
»Tut mir leid, Tempe. Muss los.«
»Kein Problem. Ich rufe dich morgen wieder an. Ich sollte mehr wissen, wenn ich unseren Kerl erst mal untersucht habe.«
Doch so lief es nicht.
3
Am nächsten Tag stand ich um sieben auf. Dreißig Minuten später schlich ich in meinem Mazda durch den Ville-Marie-Tunnel. Das Wetter war wieder prächtig.
Das Édifice Wilfrid-Derome ist ein hoch aufragender, T-förmiger, dreizehnstöckiger Gebäudekomplex im Distrikt Hochelaga-Maisonneuve östliche von centre-ville. Das Laboratoire de Sciences Judiciaires et de Médecine Légale nimmt die beiden obersten Stockwerke ein. Das Bureau du Coroner liegt im elften Stock, die Leichenhalle ist im Keller. Der Rest der Fläche gehört der SQ.
Jawohl. Ryan und ich arbeiten nur acht Stockwerke voneinander entfernt.
Obwohl die morgendliche Personalbesprechung keine unangenehmen Überraschungen für die Anthropologin bereithielt, war es ein ungewöhnlich arbeitsreicher Donnerstag gewesen. Ein tödlicher Arbeitsunfall durch Stromschlag und ein Tod durch Stichverletzungen gingen an einen Pathologen. Ein verdächtiger plötzlicher Kindstod und ein Feueropfer gingen an einen anderen. Pierre LaManche, Direktor der rechtsmedizinischen Abteilung des LSJML, wies sich selber den angeblichen Selbstmord eines zehnjährigen Jungen zu.
LaManche übernahm auch die Verantwortung für LSJML-49744, die Fallnummer, die man John Lowery zugewiesen hatte, bat mich aber, den Ball ins Rollen zu bringen. Da die Identifikation bereits über die Fingerabdrücke erfolgt war, würde, abhängig vom Zustand der Leiche, nach Abschluss der Präliminarien entweder LaManche eine normale Autopsie durchführen, oder ich würde die Knochen säubern und eine Skelettanalyse machen.
Um halb zehn war ich unten in Salle d’ autopsie Nummer 4, ein Raum, der speziell für Verweste, Wasserleichen und andere Stinker ausgestattet ist. Ich arbeite dort ziemlich häufig.
Nachdem ich das Fach gefunden hatte, in dem LSJML-49744 wartete, holte ich mir die Nikon und kontrollierte die Batterie. Dann zog ich an dem Edelstahlgriff.
Der Geruch fauligen Fleisches drang mit dem Schwall gekühlter Luft aus dem Fach. Ich löste die Fußbremse und zog die Bahre heraus.
Pomerlau und Lauzon hatten auf den üblichen Leichensack verzichtet. Bei Lowerys exotischer Aufmachung war das verständlich.
Ich machte eben Weitwinkelaufnahmen, als eine Tür aufging und Schritte über die Fliesen quietschten.
Sekunden später tauchte Lisa Savard auf.
Mit ihren honigblonden Haaren, dem immer paraten Lächeln und dem Dolly-Parton-Busen ist Lisa der Liebling jedes männlichen heterosexuellen Mordermittlers in Quebec. Sie ist auch mein Liebling, allerdings aus anderen Gründen. Die Frau ist die beste Autopsietechnikerin in der Provinz.
Weil sie ihre Sprachbeherrschung verbessern will, spricht Lisa mit mir immer Englisch.
»Komischer Fall, ja?«
»Eindeutig.«
Lisa schaute kurz auf Lowery hinunter.
»Sieht aus wie eine Ken-Puppe noch in Originalverpackung. Radiologie?«
»Ja, bitte.«
Während Lisa Röntgenaufnahmen machte, ging ich Lowerys Dossier durch. Bis jetzt enthielt es nur wenig. Den Polizeibericht. Das Aufnahmeformular der Leichenhalle. Bandaus Bericht über den NCIC-Treffer. Ein Fax, das eine alte Fingerabdruckkarte zeigte.
Ich kontrollierte die Herkunft des Fax. NCIC.
Komisch. Wenn Lowery 68 starb, warum war er dann im System? Wurden so alte Abdrücke im Normalfall überhaupt eingegeben?
Spontan rief ich die Fingerabdruckabteilung des Service de l’identité judiciaire an. Ein Sergeant Boniface meinte, ich solle zu ihm raufkommen. Ich schnappte mir die Akte und stieg die Treppe in den ersten Stock hoch.
Als ich vierzig Minuten später wieder hinunterstieg, wusste ich eine schwindelerregende Menge über Schleifen, Bögen und Windungen. Das Wesentliche jedoch:Auch wenn Boniface nicht genau wusste, warum Lowery in der FBI-Datenbank war, hatte er keinen Zweifel an der Korrektheit der Übereinstimmung.
Lowery lag jetzt auf einem in den Boden geschraubten Tisch in der Mitte des salle 4. Fliegen krabbelten über seine Plastikumhüllung und schwirrten durch die Luft darüber. Ein Polizeifotograf schoss von einer Leiter aus Fotos.
LaManche und Lisa untersuchten die Röntgenaufnahmen auf den Lichtkästen an der Wand. Ich ging zu ihnen, und gemeinsam bewegten wir uns die Reihe entlang.
Auf jedem Film leuchtete das Skelett weiß im blassen Grau des Fleisches. An Schädel und Knochen fiel mir nichts Ungewöhnliches auf.
Wir waren bei der fünften Aufnahme, als LaManches knotiger Finger auf ein Objekt bei Lowerys linkem Fuß tippte. Das Ding war strahlenundurchlässig und lag schräg über dem Fersenbein.
»Un couteau«, sagte Lisa. Ein Messer.
»Oui«, sagte LaManche.
Ich stimmte ihnen zu.
Das nächste Beutestück tauchte in einer Thoraxaufnahme auf. Das zweite Objekt war etwa acht Zentimeter lang und zwei Zentimeter breit und leuchtete so hell wie das erste.
»Mais, oui.« LaManche nickte langsam, nun endlich begriff er. »Oui.« Aus dem Nicken wurde ein Kopfschütteln. »Sacre bleu.«
Klasse. Mein Chef schien diesen bizarren Todesfall jetzt zu verstehen. Ich kapierte ihn immer noch nicht.
Ich schaute mir die Form auf Lowerys Brust genauer an. Ein zweites Messer war es nicht. Es war auch keine Uhr, keine Gürtelschnalle oder ein Stück Anglerausrüstung. Ich hatte keine Ahnung.
LaManche ging zu der Leiche und fing an, seine Beobachtungen in ein Diktiergerät zu sprechen.
»Das Opfer steckt in einem offensichtlich selbst gemachten Sack, bestehend aus einer großen Plastikplane, die einmal gefaltet und mit Isolierband zugeklebt wurde. Die Unterkante und die eine Seite wurden bis auf die oberen zehn Zentimeter von außen versiegelt. Das Halsende und die obersten zehn Zentimeter der Seite wurden von innen versiegelt. Die Folie wurde erst kürzlich aufgeschnitten, sodass die rechte Hand frei liegt. Im Bereich des Schnitts ist mäßige Insektenaktivität deutlich ersichtlich.«
Während LaManche weitere Details aufzählte, knipste der Fotograf und positionierte dabei für jede Aufnahme die Tafel mit der Fallnummer neu.
»Allem Anschein nach stieg das Opfer in den Sack, sicherte dann das Plastik mit einem Arm, den er durch die zehn Zentimeter lange, seitliche Öffnung streckte, die anschließend von innen versiegelt wurde.«
LaManche wies Lisa an, das Seilstück am Knöchel abzumessen.
»Der linke Fuß steckt in einem Stiefel, der mittels eines zwanzig Zentimeter langen Stücks Polypropylenseils mit einem Stein verbunden ist. Das Opfer scheint das Seil zuerst um den Stein gebunden zu haben und dann um den Knöchel, der linksseitig aus dem Plastik herausragt.«
Während Lisa mit dem Maßband hantierte, diktierte LaManche die Abmessungen. »Die äußere Plastikumhüllung ist einen Meter breit und insgesamt zweieinhalb Meter lang und liegt eng am Körper an.«
LaManche ging zum Kopfende des Tisches. Verärgert summend stiegen Fliegen auf. Hinter mir klatschten winzige Körper gegen die Lichtkästen.
»Der Kopf ist separat umhüllt. Ein Atemrohr, das mit Isolierband an der Tüte befestigt ist, ragt seitlich heraus.«
Atemrohr?
Ich schaute mir den schleimigen Zylinder an. War dieses Kunststoffarrangement eine Art selbst gebastelter Taucheranzug?
»Die Unterseite der Tüte ist am Hals dicht verklebt.«
Und so weiter. Lisa nahm die Maße. LaManche diktierte Längen, Positionen, Öffnungsgrößen. Schließlich tastete er den Kopf in der Tüte ab.
»Das Atemrohr ist im Verhältnis zum Mund zur Seite und nach hinten verschoben.«
Ich weiß nicht recht, warum, vielleicht weil ich plötzlich das Bild vor mir hatte, wie die Röhre aus Lowerys Mund rutscht. Eine Röhre, durch die er Luft holen wollte.
Plötzlich machte es klick. Der eingewickelte Körper. Der Stein am Knöchel. Das Messer, mit dem er sich befreien wollte, das ihm aber aus der Hand glitt.
Ich kam mir vor wie ein Trottel. Mein Chef hatte lange vor mir begriffen, worum es ging.
Aber unter Wasser? Ich nahm mir vor, die einschlägige Literatur zu konsultieren.
In diesem Augenblick klingelte mein Handy.
Ryan.
Ich zog die Handschuhe aus, ging in den Vorraum und nahm den Anruf entgegen.
»Was läuft?«
»Wir wickeln Lowery gerade aus.«
»Du scheinst dir ziemlich sicher zu sein, wer das ist.«
Ich berichtete ihm von meiner Sitzung mit Boniface.
»Zu früh für Aussagen über die Todesursache?«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass LaManche an autoerotische Manipulation denkt. Der Kerl hat sich rausgeputzt, um sich einen runterzuholen.«
»In einem Teich?« Ryan klang skeptisch.
»Alles ist möglich, wenn man seinen Träumen folgt.«
»Rentiert es sich schon, einen Blick zu riskieren?«
»Bei Autoerotikern eigentlich immer.«
»Ansonsten, ich dachte mir, das interessiert dich vielleicht. Das Kennzeichen auf dem Moped führte zu einem Morgan Shelby in Plattsburgh, New York. Ich habe eben mit ihm telefoniert.
Shelby sagt, er hat den Hobel an einen Mann aus Hemmingford mit dem Namen Jean Laurier verkauft. Die Transaktion ging, sagen wir mal, informell vonstatten.«
»Bar bezahlt, kein Papierkram, Laurier bringt das Ding nach Norden, ohne Einfuhrzoll bezahlen zu müssen.«
»Genau. Laut Shelby behauptete der Käufer, er würde sich in Quebec um Anmeldung und Versicherung kümmern.«
»Hat er aber nicht getan.«
»Der Verkauf fand erst vor zehn Tagen statt.«
»Jean Laurier. John Lowery.«
»Oui, Madame.«
»Was weiß man über ihn?«
»Bandau hat sich ein bisschen umgehört und ein paar Ansässige gefunden, die den Kerl kannten. Einer sagte, Laurier hätte in Hemmingford gelebt, solange er sich erinnern kann.«
»Seit 1968.«
»So genau sagte der Gentleman das nicht.«
»Was machte Laurier?«
»Arbeitete als Handwerker, strikt freiberuflich.«
»Wieder alles bar?«
»Oui, Madame. Laurier hatte für unsere Verwaltung nicht viel übrig. Keine Wählerregistrierung, keine Steuerakte. Keine Sozialversicherungsnummer. Bandaus Informant sagt, der Kerl sei ein Einzelgänger gewesen, komisch, aber nicht bedrohlich.«
»Hast du eine LBA?« Letzte bekannte Adresse.
»Oui, Madame. Dachte mir, ich stelle die Bude morgen auf den Kopf. Lust, mitzukommen?«
»Ich habe Zeit.«
»Wir haben ein Rendezvous.«
»Wir haben kein Rendezvous, Ryan.«
Ryans nächster Satz klang, als würde er dabei seine Augenbrauen hüpfen lassen. »Wie wär’s dann, wenn wir danach meine Bude auf den Kopf stellen?«
»Ich habe Bird versprochen, ihm gefüllte Eier zu machen.«
»Ich habe außerdem die Polizei in Lumberton angerufen.« Ryans Vokale wurden länger als Dixie. »Nette, freundliche Jungs dort unten.«
»Aha.«
»Ein Lowery lebt immer noch dort. Der Kerl, mit dem ich gesprochen habe, konnte sich sogar noch an John erinnern und versprach, in die Bibliothek zu gehen und das Foto des Jungen aus dem Schuljahrbuch zu kopieren.«
»Warum waren Lowerys Fingerabdrücke im System?«
»Wegen eines Teilzeitjobs, den er während der Highschoolzeit hatte. Sanitätsassistent? Pfleger in einem Nervenkrankenhaus? So was in der Richtung.«
»Ich bin beeindruckt.«
»Ich bin Ermittler. Ich ermittle. Ich komme runter, sobald Lowerys Gesicht per Fax reinkommt.«
Mittags hingen die Einkaufstüte und die Körperhülle aus Plastik auf Trockengestellen im Gang. Das Atemrohr erwies sich als ganz gewöhnlicher Schnorchel. Man hatte Fotos und einen Abstrich gemacht und es dann nach oben zur Analyse geschickt.
Wie auch einen kleinen Streifen Plastik, den man mit einer Schleife verknotet um Lowerys Penis gefunden hatte. Auch den würde man nach Körperflüssigkeiten untersuchen.
Lowery lag mit dem Rücken auf Edelstahl, das Gesicht verzerrt, der Hodensack geschwollen, der Bauch aufgebläht und grün. Alles in allem jedoch war der Kerl in ziemlich gutem Zustand. Eine Skelettanalyse würde nicht nötig sein.
»Männlicher Weißer, fünfzig bis sechzig Jahre alt«, diktierte LaManche. »Schwarze Haare. Braune Augen. Beschnitten. Keine Narben, Piercings oder Tätowierungen.«
Ich half Lisa beim Abmessen.
»Größe ungefähr einhundertundfünfundsiebzig Zentimeter.«
Ryan kam an, als LaManche langsam um die Leiche herumging und Augen, Hände, Schädelschwarte und Körperöffnungen untersuchte. Er gab mir das Fax aus Lumberton.
Das Bild war so klein und unscharf, dass es irgendwer hätte sein können. Die schwarzen Haare waren seitlich gescheitelt und kurz.
»Das Opfer zeigt keine Hinweise auf äußerliche Verletzungen. « LaManche schaute hoch. Nickte zum Gruß. »Detective. «
Nachdem Ryan die Herkunft erklärt hatte, gab er ihm das Fax. Er und Lisa betrachteten es.
»Bitte säubern Sie ihn«, wies LaManche Lisa an.
Lisa benutzte eine Handbrause für Lowerys Kopf. Nachdem sie die Haare mit einem Handtuch getrocknet und seitlich gescheitelt hatte, legte sie das ausgedruckte Bild direkt neben sein rechtes Ohr.
Acht Augen sprangen zwischen dem Fax und dem Gesicht hin und her.
Vier Jahrzehnte Leben und zwei Tage Tod trennten den Mann auf dem Tisch von dem Jungen auf dem Foto. Die Nase war knollenförmiger und die Kinnlinie schlaffer, aber das Opfer aus dem Teich hatte dieselben Haare und Augen, dieselben Al-Pacino-Brauen.
War die Wasserleiche aus Hemmingford eine ältere Version des Jungen aus Lumberton?
Ganz sicher war ich mir nicht.
»Glauben Sie, das ist er?«, fragte ich LaManche.
Mein Chef zuckte auf seine typisch unergründlich französische Art die Schultern. Wer weiß? Warum fragen Sie mich? Was für Kräuter tun Sie in Ihr Ragout?
Ich schaute Ryan an. Sein Blick klebte auf dem Mann auf dem Tisch.
Kein Wunder.
Es war ein bizarrer Anblick.
Bei seinem Tod hatte John Lowery folgende Kleidungsstücke getragen: einen weichen Baumwoll-BH in Pink der Marke Glamorise, Größe vierundvierzig B; ein Damen-Hüfthöschen in Pink der Marke Blush, Größe L; eine Schwesternhaube aus Baumwolle-Polyester, blau-weiß gestreift, in Einheitsgröße; einen Stiefel mit Stahlkappe der Marke Harley Davidson in Schwarz am linken Fuß, Größe zweiundvierzig.
Und das war nur die Bekleidung.
Lowery hatte in seiner Plastiktüte zwei Werkzeuge bei sich: ein Proktoskop, für einen Sport, den ich mir lieber nicht vorstellen wollte, und ein Schweizer Taschenmesser, um sich zu befreien, wenn die Party vorbei war.
Das Proktoskop hing in einem Stoffsäckchen noch um seinen Hals. Das Messer war neben seinen Füßen gelandet.
Bissspuren auf dem Mundstück des Schnorchels deuteten darauf hin, dass das nicht Lowerys erster Versuch einer submarinen Solosause war. Aber irgendwie ging es diesmal schief. Wahrscheinlichstes Szenario: Das Rohr rutschte ihm aus dem Mund, das Messer glitt ihm aus der Hand.
Das Arrangement war ungewöhnlich, aber der erste Eindruck meines Chefs war höchstwahrscheinlich korrekt. Lowerys Tod würde als tödlicher Unfall durch Ersticken im Zusammenhang mit autoerotischer Aktivität beschrieben werden.
John Charles Lowery war ums Leben gekommen, als er unter Wasser in einer selbst gebastelten Ziploc-Tüte unartige Krankenschwester spielte.
4
Der Samstagmorgen präsentierte wieder einen makellos blauen Himmel. Und wieder versprachen die Meteorologen siebenundzwanzig Grad.
Drei schöne Frühlingstage hintereinander. In Montreal vermutlich ein Rekord.
LaManche rief gegen neun an. Eine reine Höflichkeit, die nicht notwendig gewesen wäre. Das gefiel mir an ihm.
Seine Autopsieergebnisse waren wie erwartet. Abgesehen von einer leichten Arteriosklerose hatte Lowery keine Vorerkrankungen gehabt. Keine Verletzungen. Leichtes Lungenödem. Blutalkohol 132 mg/100 ml.
Todesursache war Ersticken durch Sauerstoffmangel. Ein Unfall im Kontext autoerotischer Aktivität.
Um zehn fuhren Ryan und ich in Richtung Süden nach Hemmingford. Er war bester Laune. Ein rauschender Freitagabend? Wenig Verkehr? Zu viele Donuts? Ich fragte nicht nach.
Was ich allerdings fragte, war, wie lange Laurier/Lowery unter der Adresse gewohnt hatte, zu der wir jetzt fuhren. Ryan sagte, sehr lange.
Davon ausgehend, fragte ich weiter, wie Laurier/Lowery es geschafft hatte, durchs Raster zu schlüpfen. Ryan erzählte mir eine komplizierte Geschichte über schwammige Mietvereinbarungen und wechselnde Hauseigentümer. Es lief darauf hinaus, dass Laurier/Lowery einfach im Haus wohnen blieb, als der letzte Besitzer ohne Erben starb. Anstatt Miete zu zahlen, bezahlte er die Steuern und Nebenkosten im Namen des Verstorbenen. So oder so ähnlich.
Die Unterhaltung wandte sich nun Jean Laurier/John Lowerys unglücklichem Abgang zu. Wie hätten wir auch widerstehen können.
»Lowery holte sich also seinen Kick, indem er sich in Plastik einwickelte, abtauchte und sich im Teich einen runterholte.« Ryan klang angeekelt.
»Als Krankenschwester verkleidet.«
»Anscheinend zog er sich im Kanu um. In dem Leinwandsack waren Jeans, Socken, Turnschuhe und ein Hemd.«
»Verlangt einiges an Balancekünsten.«
»Außerdem war noch eine Taschenlampe drin.«
»Was darauf hindeutet, dass er nachts zu dem Teich fuhr.«
»Würdest du das nicht?« Ryan schüttelte den Kopf. »Ich kapier das nicht. Wo ist der Witz?«
In Ermangelung eines Privatlebens hatte ich am Abend zuvor recherchiert und herausgefunden, dass der Begriff autoerotisch jede allein vollzogene sexuelle Aktivität bezeichnet, bei der ein Requisit, ein Instrument oder eine Vorrichtung zur Erhöhung der sexuellen Stimulation verwendet wird. Ich wusste, dass Ryan das alles wusste.
»Die meisten autoerotischen Aktivitäten finden zu Hause statt«, sagte ich.
»Ach. Warum wohl?«
»Zum Tod kommt es meistens aufgrund eines Versagens vorbereiteter Fluchtmechanismen.«
»Lowery hat wahrscheinlich seinen Schnorchel verloren, geriet in Panik und ließ das Messer fallen, das er benutzen wollte, um sich loszuschneiden.«
»So sieht es LaManche. Und es ist plausibel. Die meisten autoerotischen Todesfälle sind Unfälle. Die Person stranguliert sich oder erstickt durch irgendeine Aufhängung oder die Verwendung einer Drosselvorrichtung oder einer Plastiktüte. Mögliche Szenarien sind auch Zufügung eines Stromschlags, Fremdkörpereinführung, das Tragen mehrerer Schichten Kleidung oder das Einwickeln des Körpers.«
»Einwickeln des Körpers?«
»Eine Plastiktüte über dem Kopf ist ziemlich häufig, das Einwickeln des ganzen Körpers weniger. Gestern Abend las ich über einen sechzigjährigen Mann, den man eingewickelt in sieben vernähte Decken fand, sein Penis war mit einer Plastiktüte umhüllt. Einen sechsundvierzigjährigen Mann fand man mit sieben Paar Strümpfen an den Beinen, einem Kleid und Damenunterwäsche, die vorne aufgeschnitten war, um Mr. Happy einen Sitz in der ersten Reihe zu ermöglichen. Ein dreiundzwanzigjähriger Lehrer starb in einem Regenponcho aus Plastik, sieben Baumwollhemden, einem Trenchcoat und einer Plastik –«
»Ich verstehe, worauf du hinauswillst. Was soll das Ganze?«
»Um die sexuelle Erregung zu verstärken.«
Die Mörderblauen wanderten in meine Richtung. »Ich kann mir bessere Wege zu diesem Ziel vorstellen.«
Ach, konnte er das? Ich spürte, wie ich rot wurde. Hasste es. Konzentrierte mich auf das, was ich am Abend zuvor herausgefunden hatte.
»Autoerotische Erregung entsteht durch eine begrenzte Anzahl von Mechanismen.« Ich zählte sie an meinen Fingern ab. »Erstens, direkte Stimulation der erogenen Zonen.« Mein Daumen bewegte sich zum nächsten Finger. »Zweitens, Stimulation der Sexualzentren im zentralen Nervensystem.«
»Wie durch Strangulieren oder Aufhängen.«
»Oder durch Umhüllen des Kopfes. Es ist allgemein bekannt, dass Sauerstoffmangel im Hirn zu verstärkter sexueller Lust führen kann.«
Der Daumen wanderte weiter.
»Drittens, die Erzeugung von Angst oder Stress im Kontext masochistischer Aktivitäten. Das Ganze noch etwas aufpeppen mit Stromschlägen oder das Eintauchen in Wasser.«
»Schniedelrubbeln unter Wasser dürfte nicht allzu häufig sein.«
»Es gibt sogar einen Begriff dafür. Aquaerotik. Ich habe in der Literatur Berichte über ein paar Fälle gefunden. Ein Opfer benutzte einen am Knöchel befestigten Stein, wie Lowery.«
Ryan fuhr auf den Highway 219. Wir kamen an dem Teich vorbei, und wenige Minuten später hielt er am Straßenrand vor einem Briefkasten mit der von Hand auf eine Seite gepinselten Nummer 572. Ein Streifenwagen der SQ war bereits da.
Ryan und ich schauten uns das Haus an.
Laurier/Lowerys kleiner Bungalow stand ein Stückchen von der Straße zurückversetzt und war von einem dichten Kiefernbestand zum Teil verdeckt. Holzhaus mit grüner Rahmenabsetzung. Nur Erdgeschoss. Rechts war ein kleiner Schuppen angebaut.
Als wir den Kiesweg hochgingen, sah ich frisch lackierten Zierbesatz und ordentlich aufgestapeltes Holz. Ein großer Garten hinter dem Haus schien frisch gepflügt zu sein.
Als ich in einem Fenster Bewegung sah, schaute ich Ryan an. Auch er hatte es gesehen.
»Bandau sollte besser nicht noch so eine Lone-Ranger-Nummer abziehen.«
Die äußere Tür stand offen, der Rahmen war auf Höhe des Knaufs aufgestemmt und gesplittert. Ryan und ich traten direkt in ein Wohnzimmer, das mit Möbeln, die offensichtlich von der Heilsarmee stammten, nur spärlich eingerichtet war. Bandau stand in dem Zimmer. Als er Schritte hörte, drehte er sich um.
Hinter Bandaus Rücken stand ein Schreibtisch mit einem MacBook Pro darauf, das offensichtlich ziemlich neu war. Der Deckel stand offen.
»Na, ist der Herr Beamte mal wieder ein wenig voreilig?« Ryans Lächeln war eisig.
»Nein, Sir.«
»Sie sind ohne Durchsuchungsbeschluss hier eingedrungen.«
»Wollte nur die Szene sichern.«
»Dann wollen wir mal hoffen, dass das stimmt.«
Bandau sagt nichts im Sinne einer Rechtfertigung oder Entschuldigung.
Ryan und ich gingen methodisch vor, denn wir wussten nicht so recht, was wir suchten.
In den Küchenschränken standen angeschlagenes Geschirr, Reinigungsmittel, Fertigprodukte aus dem Supermarkt und genügend Selbsteingemachtes, um den nächsten Advent zu überdauern.
Der Kühlschrank zeigte das übliche Sortiment aus Würzsaucen, Milchprodukten, Frühstücksfleisch und Brot. Kein Kaviar. Keine Kapern. Kein französisches Mineralwasser in Glasflaschen.
Ein Teller, ein Glas und Besteck klemmten in einem Trockengestell aus Plastik. Auf einer Arbeitsfläche stand eine halb leere Flasche Scotch.
Das Bad war, wie die Küche, überraschend sauber. Im Medizinschränkchen rezeptfreie Medikamente und persönliche Pflegeprodukte. In der Dusche billiges Shampoo und billige Seife.
Das Schlafzimmer war ähnlich unauffällig. Doppelbett mit grauer Wolldecke, Kissen, keine Tagesdecke. Nachtkästchen mit Lampe, Radiowecker und Augentropfen. Hölzerne Kommode mit Boxershorts und T-Shirts, einer gestreiften Krawatte und einem halben Dutzend zusammengerollte Socken, alle schwarz, in den Schubladen.
Der Wandschrank hatte die Größe eines Briefkastens. Jeans und Hemden. Schwarze Polyesterhose. Ein hässliches Sportsakko, hellbrauner Cordsamt.
Auf dem Boden standen zweieinhalb Paar Stiefel, ein Paar Schnürhalbschuhe und ein Paar Sandalen mit Reifengummi als Sohlen.
Auf dem obersten Regalbrett lagen Stapel von Magazinen.
Ryan zog ein paar heraus und blätterte sie durch. »Aber hallo.«
Ich las die Titel. Titten-Mann. Ärsche-Mann.
»Der Kerl ist flexibel«, sagte ich.
Ryan nahm ein anderes zur Hand. Lollipop-Mädchen. Die erste Geschichte hatte den Titel Park ihn in meinem Höschen. Ich versuchte, dieses literarische Juwel zu entziffern. Gab es auf. Die Aufforderung ergab keinen Sinn.
Ich schaute Ryan an. Seine Augen und die Brauen waren schon wieder in Bewegung. Ich wusste, dass ich gleich einen Höschenkommentar zu hören bekommen würde.
»Anstandsformen, Sir.«
»Dorthinnen wir zu jenem trefflichen Computer?«, fragte Ryan bescheiden.
»Dorthin ist kein Verb.«
»Lasst uns voran, flachshaar’ge Maid.«
Mein Augenverdreher dürfte eine persönliche Bestleistung gewesen sein.
»Ich unterwerfe mich den überleg’nen Künsten meiner edlen Dame.«
»Vielen Dank.«
»Und ihrer unbefleckten Unterwäsche.«
Ich boxte Ryan auf den Arm und dorthinnte zum Schreibtisch.
Bandau stand weiter am Fenster, die Beine gespreizt, die Ellbogen angewinkelt, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, und schaute hinaus.
»Kein Telefon«, sagte ich. »Keine Kabel. Hatte Laurier ein ISP-Konto?«
»Soll heißen?«
»Internal Service Provider.Wie Videotron oder Bell?«
»Soweit ich das feststellen konnte, nicht.«
Der Mac erwachte schnurrend zum Leben und fragte nach einem Passwort. Ich versuchte PASSWORT. 123456. ABCDEF. Verschiedene Kombinationen aus Jean und Laurier. Lauriers Adresse und den Straßennamen. Das alles durcheinander gemischt und von hinten nach vorne. Kein Erfolg.
LOWERY.
Nichts.
YREWOL.
Ich nahm die Initialen JCR und wandelte sie um in die Positionsziffern im Alphabet. 100318. Drehte die Abfolge um. 813001. Nahm die Initialen von hinten nach vorne. 180310. Drehte auch das um. 0130081.
Doch der kleine Cursor widerstand mir noch immer.
Ich stellte mir ein Telefon vor und probierte die Ziffernschlüssel der Buchstabenfolge LOWERY.
569379.
Ich war drin.
Als der Computer komplett hochgefahren war, entdeckte ich am rechten Rand der Symbolleiste ein fächerförmiges Icon. Drei Streifen. Ich klickte es an.
»Er hat sich ins Signal der Nachbarn eingehackt.« Ich deutete auf den Codenamen eines Netzwerks. Fife.
»Kann er das tun?«
»Die Fifes haben wahrscheinlich ihre Telefonnummer als Passwort benutzt. Viele Leute tun das. Laurie kannte sie oder schaute sie nach.Vielleicht fragte er sie auch um Erlaubnis. Wie auch immer, sobald das Passwort eingegeben ist, erinnert sich der Computer an das Netzwerk und wählt es automatisch an. Die Fifes können nicht weit weg sein. Das Signal ist schwach, aber es reicht.«
Während Ryan den Namen Fife in sein Notizbuch schrieb, schaute ich mir die Anwendungen an.
Lauter Mac-Standardprogramme. Numbers. Mail. Safari. iCal.
Laurier/Lowery hatte keine Tabellen oder Dokumente abgespeichert. Er hatte keine Kontakte ins Adressbuch, keine Termine in den Kalender eingegeben.
»Er benutzte Mailprogramm«, sagte ich. »Oder iTunes, iPhoto, iMovie, DVD.«
»Verstehe.«
Noch ein Augenverdreher. »Mal sehen, was er im Internet amüsant fand.«
Ich startete Safari und klickte mich bis zum Browser-Verlauf durch.
In den letzten zwei Wochen hatte der User recherchiert über Mulch und Düngemittel, Maishybride, Sporttauchen, Hypoxie, Giftefeu, Kupferdraht, Dachziegel, nordamerikanische Eichhörnchen, Zahnärzte in Quebec und eine Reihe von Vitaminen.