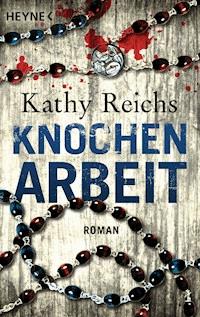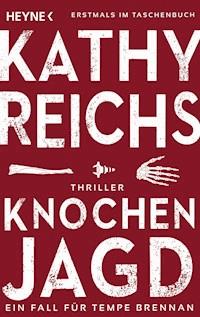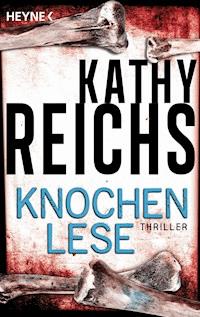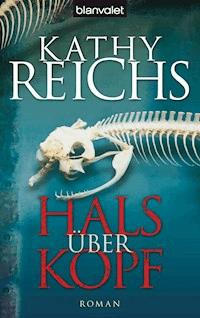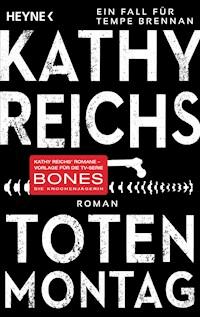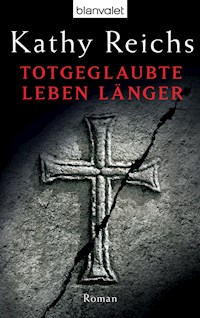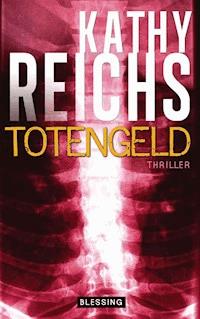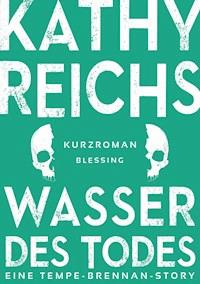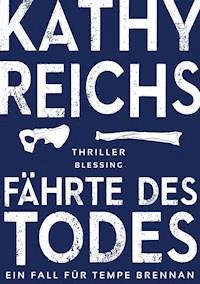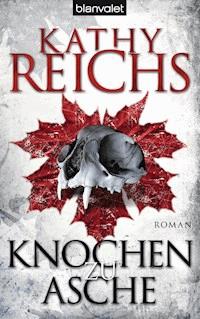
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Tempe-Brennan-Romane
- Sprache: Deutsch
Thrill hoch 10! - Worte können lügen. Knochen nicht
Das vermisste Mädchen hat Tempe Brennan nie vergessen. Auch wenn es damals noch kein Fall für sie war. Tempe war 13 Jahre alt, als ihre beste Freundin Evangéline ohne Abschied spurlos verschwand. Nun liegen Jahre alte Knochen eines weiblichen Teenagers zur forensischen Untersuchung vor Tempe und reißen alte Wunden auf. Hängt dieser Skelettfund mit Evangélines Verschwinden zusammen? Haben die Parallelen zu einer Reihe von Mädchen, die in den letzten Jahren in Quebec verschwanden, etwas zu bedeuten? War Evangéline das erste Opfer eines Serientäters? Tempe findet unerwartete Antworten an unerwarteter Stelle: in einem besonders dunklen Kapitel der Geschichte Kanadas …
Knochen sprechen ihre eigene Sprache: Jahrzehnte alte Gebeine, jüngst verschwundene Mädchen, ein Trauma aus Kindertagen – der neue Fall trifft Tempe Brennan bis ins Mark.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Kathy Reichs
Knochen zu Asche
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Klaus Berr
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Bones to Ashes« bei Scribner, New York.
Deutsche Erstausgabe Mai 2009 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Copyright © Temperance Brennan, L.P., 2007 Published by arrangement with Scribner, an imprint of Simon & Schuster, Inc. Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2007 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH. Covergestaltung: HildenDesign, München, unter Verwendung eines Motivs von © luxuz:: /photocase MD ∙ Herstellung: RF Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-06790-8 V003
Buch
Tempe Brennan war erst sechs Jahre alt, als ihr kleiner Bruder plötzlich starb, wenig später verunglückte ihr Vater tödlich. In dieser Zeit fand sie Trost bei ihrer besten Freundin, mit der sie unvergessliche Sommerferien verbrachte: Evangeline. Bis das Mädchen eines Tages spurlos verschwand. Jahrzehnte später eröffnet sich Tempe die Chance, endlich Gewissheit über Evangelines Schicksal zu erlangen. Ein Spezialist für »cold cases« aus Montreal bittet die forensische Anthropologin um Hilfe bei der Analyse eines Skeletts, das aus dem Neuschottland zu stammen scheint. Ihre Ermittlungen führen Tempe zu einem Kapitel kanadischer Geschichte, über das die Bewohner der Küstenregion eisern schweigen. Und nicht nur die Vergangenheit gibt unheimliche Rätsel auf. Denn der Fall offenbart mehr und mehr Parallelen zu einer Reihe vermisster Mädchen, die vor kurzem in Québec verschwanden. Eines der Kinder wird tot aus dem Lac des Deux Montagne geborgen. Ist dies der Beginn einer ganzen Serie von Gewalttaten? Wurde auch Evangeline Opfer einer solchen Grausamkeit? Als ihr »Knochen zu Asche« – ein schmales rotes Heft voller Gedichte – in die Hände fällt, hofft Tempe auf Antworten. Doch was hier zwischen den Zeilen steht, stellt all ihre Erinnerungen und Erwartungen auf den Kopf...
Autorin
Kathy Reichs ist Vizepräsidentin der American Academy of Forensic Sciences, forensische Anthropologin für die Provinz Quebec und Professorin für Anthropologie an der Universität von North Carolina-Charlotte. Ihre Romane mit Tempe Brennan werden in über dreißig Sprachen übersetzt und ihre Protagonistin ermittelt in der von Reichs produzierten Serie »Bones« auch im Fernsehen. »Knochen zu Asche« ist ihr zehnter Bestseller.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.kathy-reichs.de
Für die großschnäuzigen, großherzigen, großartigen Akadier
On ouaira quosse que d’main nous amèneras …
1
Babys sterben. Menschen verschwinden. Menschen sterben. Babys verschwinden.
Diese Erkenntnisse prasselten schon sehr früh auf mich ein. Natürlich hatte ich ein kindliches Verständnis dafür, dass alles sterbliche Leben endet. In der Schule redeten die Nonnen von Himmel, Fegefeuer, Vorhölle und Hölle. Ich wusste, dass die älteren Leute irgendwann »dahinscheiden«. Mit diesem Begriff umschrieb meine Familie das Thema. Die Leute schieden dahin. Gingen, um bei Gott zu sein. Ruhten in Frieden. So akzeptierte ich auf etwas verquere Art, dass das irdische Leben nur ein vorübergehendes ist. Dennoch trafen mich der Tod meines Vaters und der meines kleinen Bruders hart.
Und für Évangéline Landrys Verschwinden gab es einfach keine Erklärung.
Aber ich greife vor.
So ist es passiert.
Als kleines Mädchen lebte ich an der Südseite von Chicago, in dem weniger vornehmen Ausläufer eines Viertels mit dem Namen Beverly. Ursprünglich erbaut als ländliches Rückzugsgebiet für die Elite der Stadt nach dem Großen Feuer von 1871, präsentiert sich das Viertel heute mit weiten Rasenflächen und großen Ulmen und irisch-katholischen Clans mit Stammbäumen, die verzweigter sind als die Ulmen. War Beverly damals schon ein bisschen heruntergekommen, wurde es später wieder aufgemotzt von Boomgewinnlern, die im Grünen und doch zentrumsnah wohnen wollten.
Unser Haus, ursprünglich ein Farmhaus, war älter als alle seine Nachbarn. Es war ein weiß gestrichenes Holzhaus mit grünen Fensterläden, hatte eine umlaufende Veranda und im Hinterhof eine Wasserpumpe sowie eine Garage, die einmal Pferde und Kühe beherbergt hatte.
Ich habe glückliche Erinnerungen an diese Zeit und diesen Ort. Wenn es kalt war, liefen die Nachbarschaftskinder Schlittschuh auf einer Eisfläche, die man mithilfe von Wasserschläuchen auf einer unbebauten Fläche geschaffen hatte. Daddy stützte mich dann immer auf meinen Doppelkufen und wischte mir Matsch von meinem Schneeanzug, wenn ich einmal hinfiel. Im Sommer spielten wir auf der Straße Fußball, Fangen oder Himmel und Hölle. Meine Schwester Harry und ich fingen Glühwürmchen in Gläsern mit durchlöcherten Schraubverschlüssen.
In den endlosen Wintern des Mittleren Westens versammelten sich zahllose Brennan-Tanten und -Onkel zum Kartenspielen in unserem ausgesucht schäbigen Wohnzimmer. Der Ablauf war immer derselbe. Nach dem Abendessen holte Mama Tischchen aus einem Schrank in der Diele, wischte die Platten ab und klappte die Beine aus. Harry breitete ein weißes Leinentuch darüber, und ich postierte Spielkarten, Servietten und Schüsselchen mit Erdnüssen in der Mitte.
Wenn der Frühling kam, ersetzten die Schaukelstühle auf der Veranda die Kartentische, und statt Canasta und Bridge gab es lange Gespräche. Ich verstand nicht viel davon. Die WarrenKommission. Der Golf von Tonkin. Chruschtschow. Kossygin. Es machte mir nichts aus. Das Zusammenkommen der Leute, die meine eigene Doppelhelix trugen, bestätigte mir, dass es mir gut ging, wie das Klappern der Münzen in der Beverly-Hillbillies -Spardose auf meinem Nachtkästchen. Die Welt war berechenbar, bevölkert mit Verwandten, Lehrern und Kindern wie ich aus Haushalten wie dem meinen. Das Leben bestand aus der St.-Margaret’s-Schule, den Pfadfinder-Wölflingen, der Messe am Sonntag und den Tagescamps im Sommer.
Dann starb Kevin, und mein sechs Jahre altes Universum zerbrach in Splitter des Zweifels und der Ungewissheit. Nach meinem Verständnis der Weltordnung holte der Tod die alten Großtanten mit mäandernden blauen Äderchen und durchscheinender Haut. Keine kleinen Jungs mit dicken, roten Wangen.
An Kevins Krankheit erinnere ich mich kaum noch. An sein Begräbnis noch weniger. Dass Harry neben mir in der Kirchenbank zappelte. Ein Fleck auf meinen schwarzen Lacklederschuhen. Woher? Das schien mir damals sehr wichtig zu sein. Ich starrte den kleinen, grauen Tropfen an. Starrte weg von der Wirklichkeit, die sich um mich herum offenbarte.
Natürlich kam die ganze Familie zusammen, die Stimmen gedämpft, die Gesichter versteinert. Mamas Zweig kam aus North Carolina. Nachbarn. Gemeindemitglieder. Männer aus Daddys Anwaltskanzlei. Fremde. Sie strichen mir über den Kopf. Murmelten irgendwas vom Himmel und den Engeln.
Das Haus quoll über vor Kasserollen und Kuchen und Gebäck in Plastik- und Alufolie. Normalerweise liebte ich Sandwiches mit abgeschnittener Rinde. Nicht wegen des Thunfisch- oder Eiersalats zwischen den Scheiben. Sondern wegen der reinen Dekadenz dieser leichtfertigen Verschwendung. An diesem Tag nicht. Und seitdem nie mehr. Schon merkwürdig, wie gewisse Dinge einen beeinflussen.
Kevins Tod veränderte bei mir mehr als nur meine Meinung zu Sandwiches. Er änderte das ganze Fundament, auf dem sich bisher mein Leben abgespielt hatte. Die Augen meiner Mutter, die immer freundlich und oft fröhlich geblickt hatten, sahen nie mehr so aus, wie sie sollten. Mit dunklen Ringen und tief in den Höhlen. Mein kindliches Gehirn konnte ihren Ausdruck nicht interpretieren, ich spürte nur Traurigkeit. Jahre später sah ich das Foto einer Frau aus dem Kosovo, wie sie zwischen zwei schnell zusammengezimmerten Särgen mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn stand. Irgendetwas kam mir daran vertraut vor. Konnte ich sie kennen? Unmöglich. Dann die Erkenntnis. Ich sah dasselbe Zerstörtsein und dieselbe Hoffnungslosigkeit, die ich in Mamas Blick gesehen hatte.
Aber nicht nur Mamas Aussehen veränderte sich. Sie und Daddy genehmigten sich nun keinen Cocktail vor dem Abendessen mehr, und sie blieben auch nicht beim Kaffee am Tisch sitzen und redeten. Sie schauten auch nicht mehr gemeinsam fern, wenn das Geschirr abgeräumt war und Harry und ich in unseren Pyjamas steckten. Sie hatten die Comedyshows immer sehr genossen, hatten einander angesehen, wenn Lucy oder Gomer etwas Albernes taten. Daddy hatte dann immer Mamas Hand genommen, und sie hatten beide gelacht.
Alles Lachen floh, als die Leukämie Kevin besiegte.
Auch mein Vater suchte sein Heil in der Flucht. In stillem Selbstmitleid wie Mama letztendlich auch. Michael Terrence Brennan, Anwalt, Connaisseur und unbezähmbarer Bonvivant, zog sich auf direktem Weg zurück in eine Flasche guten, irischen Whiskeys. In viele Flaschen, um genau zu sein.
Anfangs fiel mir die häufige Abwesenheit meines Vaters gar nicht auf.Wie ein Schmerz, der sich so allmählich aufbaut, dass sein Ursprung nicht bestimmbar ist, fiel mir eines Tages auf, dass Daddy nicht mehr so oft bei uns war. Immer öfter gab es Abendessen ohne ihn. Er kam abends immer später nach Hause, bis er in meinem Leben nicht viel mehr war als ein Phantom. In einigen Nächten hörte ich schwankende Schritte auf der Treppe, eine Tür, die fest gegen eine Wand geschlagen wurde. Die Toilettenspülung. Dann Stille. Oder gedämpfte Stimmen aus dem Schlafzimmer meiner Eltern, deren Tonfall mir Vorwürfe und Groll vermittelte.
Bis heute jagt mir ein Telefon, das nach Mitternacht klingelt, einen Schauer über den Rücken. Vielleicht bin ich eine Panikmacherin. Oder einfach nur Realistin. Meiner Erfahrung nach bringen nächtliche Anrufe nie gute Nachrichten. Es hat einen Unfall gegeben. Eine Verhaftung. Einen Kampf.
Mamas Anruf kam lange achtzehn Monate nach Kevins Tod. Damals klingelten Telefone noch anständig. Keine polyfonen Songfetzen von Grillz oder Sukie in the Graveyard. Ich wachte beim ersten vollklingenden Ton auf. Hörte einen zweiten. Das Bruchstück eines dritten. Dann ein leises Geräusch, halb Schreien, halb Stöhnen, dann das Klappern eines Hörers gegen Holz.Verängstigt zog ich mir die Decke bis zu den Augen hoch. Niemand kam zu mir ans Bett.
Es habe einen Unfall gegeben, sagte Mama am nächsten Tag. Daddys Auto war von der Straße abgedrängt worden. Über den Polizeibericht oder den Blutalkoholpegel von 2,7 Promille verlor sie nie ein Wort. Diese Details schnappte ich so nebenbei auf. Lauschen ist für eine Achtjährige ein Instinkt.
An Daddys Beerdigung erinnere ich mich noch weniger als an Kevins. Ein Bronzesarg, bedeckt mit weißen Blumen. Endlose Lobreden. Gedämpftes Schluchzen. Mama, gestützt von zwei der Tanten. Psychotisch grünes Friedhofsgras.
Diesmal kamen Mamas Verwandte in noch größerer Zahl. Daessees. Lees. Cousins und Cousinen, an deren Namen ich mich nicht erinnere. Noch mehr heimliches Mithören enthüllte Brocken ihres Plans. Mama müsse mit ihren Kindern nach Hause zurückkommen.
Der Sommer nach Daddys Tod war einer der heißesten in der Geschichte von Illinois, mit Temperaturen, die wochenlang nicht unter dreißig Grad sanken. Der Wetterbericht sprach zwar immer von der kühlenden Wirkung des Lake Michigan, aber wir waren weit vom Wasser entfernt, abgeschnitten von zu vielen Gebäuden und zu viel Beton. Wir hatten keine Seebrise. In Beverly schalteten wir Ventilatoren ein, rissen Fenster auf – und schwitzten. Harry und ich schliefen in Feldbetten auf der überdachten Veranda.
Den ganzen Juni und bis weit in den Juli hinein hielt Grandma Lee ihre Telefonkampagne mit dem Motto »Rückkehr nach Dixie« aufrecht. Immer wieder tauchten auch Brennan-Verwandte bei uns auf, jetzt allerdings allein oder nur zu zweit, Männer mit schweißnassen Achseln, Frauen in feucht-schlaffen Baumwollkleidern. Die Gespräche waren eher zurückhaltend, Mama war nervös und immer den Tränen nahe. Ein Onkel oder eine Tante tätschelte ihr die Hand. Mach, was das Beste ist für dich und die Kinder, Daisy.
Auf meine kindliche Art spürte ich eine neue Rastlosigkeit in diesen Familienbesuchen. Eine Ungeduld, dass das Trauern endlich aufhören und das Leben neu beginnen möge. Die Besuche wurden zu Patrouillengängen, unangenehm, aber unabdingbar, weil Michael Terrence einer der Ihren gewesen war und die Sache mit der Witwe und den Kindern in anständiger Manier gelöst werden musste.
Der Tod brachte auch Veränderungen in meinem eigenen sozialen Umfeld.
Kinder, die ich schon mein Leben lang kannte, mieden mich jetzt. Wenn wir uns zufällig trafen, starrten sie auf ihre Füße. Verlegen? Verwirrt? Angst vor Ansteckung? Die meisten fanden es einfacher, wegzubleiben.
Mama hatte uns nicht für die Tagescamps eingeschrieben, deshalb verbrachten Harry und ich die langen, schwülen Tage allein. Ich las ihr Geschichten vor. Wir spielten Brettspiele, inszenierten Puppentheater und gingen zu Woolworths an der 95th Street, um Comics oder Limonade zu kaufen.
Im Verlauf dieser Wochen wuchs auf Mamas Nachtkästchen eine kleine Apotheke. Wenn sie unten war, untersuchten wir die kleinen Fläschchen mit ihren steifen, weißen Kappen und den ordentlich beschrifteten Etiketten.Wir schüttelten sie. Spähten durch das gelbe oder braune Plastik. Die winzigen Kapseln verursachten bei mir ein Flattern in der Brust.
Mitte Juli traf Mama ihre Entscheidung. Vielleicht traf aber auch Grandma Lee sie für sie. Ich hörte zu, wie sie es Daddys Brüdern und Schwestern erzählte. Sie tätschelten ihr die Hand. Vielleicht ist es das Beste, sagten sie und klangen dabei – wie? Erleichtert? Was weiß eine Achtjährige von Nuancen?
Grandma kam an dem Tag an, als in unserem Garten ein Schild aufgestellt wurde. Im Kaleidoskop meiner Erinnerungen sehe ich sie aus einem Taxi aussteigen, eine alte Frau, dünn wie eine Vogelscheuche, die Hände knotig und trocken wie Eidechsenhaut. In diesem Sommer wurde sie sechsundfünfzig.
Binnen einer Woche saßen wir alle in dem Chrysler Newport, den Daddy vor Kevins Diagnose gekauft hatte. Grandma fuhr. Mama saß auf dem Beifahrersitz. Harry und ich saßen hinten, mit einer Barriere aus Malkreiden und Spielen zwischen uns, die unsere Territorien abgrenzte.
Zwei Tage später waren wir in Grandmas Haus in Charlotte. Harry und ich bekamen das Schlafzimmer im Obergeschoss mit der grün gestreiften Tapete. Der Wandschrank roch nach Mottenkugeln und Lavendel. Harry und ich sahen zu, wie Mama unsere Kleider auf Bügel hängte. Winterkleider für Partys und die Kirche.
Wie lange bleiben wir, Mama?
Mal sehen. Die Bügel klapperten leise.
Gehen wir hier zur Schule?
Mal sehen.
Beim Frühstück am nächsten Morgen fragte uns Grandma, ob wir den Rest des Sommers gern am Strand verbringen würden. Harry und ich schauten sie nur über unsere Rice Crispies hinweg an, schockiert von den donnernden Veränderungen, die über unser Leben hereinbrachen.
Natürlich wollt ihr das, sagte sie.
Woher weißt du, was ich will oder nicht?, dachte ich. Du bist nicht ich. Sie hatte natürlich recht. Das hatte Grandma meistens. Aber darum ging es nicht.Wieder war eine Entscheidung getroffen worden, und ich konnte nichts daran ändern.
Zwei Tage nach unserer Ankunft in Charlotte saß unsere kleine Truppe wieder im Chrysler, Grandma hinterm Lenkrad. Mama schlief und wachte nur auf, als das Wimmern der Reifen verkündete, dass wir über den Damm fuhren.
Mama hob den Kopf von der Rückenlehne. Sie drehte sich nicht zu uns um. Sie lächelte nicht, und sie trällerte auch nicht: »Pawleys Island, hier sind wir!«, wie sie es in glücklicheren Zeiten getan hatte. Sie ließ sich einfach nur wieder in den Sitz sinken.
Grandma tätschelte Mama die Hand, eine exakte Kopie der Geste, die auch die Brennans benutzt hatten. »Jetzt wird alles wieder gut«, gurrte sie in einem Singsang, der genauso klang wie der ihrer Tochter. »Vertrau mir, Daisy, Darling. Jetzt wird alles wieder gut.«
Bei mir wurde alles gut, als ich Évangéline Landry kennenlernte.
Und so blieb es die nächsten vier Jahre.
2
Ich wurde im Juli geboren. Für ein Kind ist das gleichermaßen gut und schlecht.
Da ich alle meine Sommer im Strandhaus der Lee-Familie auf Pawleys Island verbrachte, wurden meine Geburtstage immer mit einem Picknick und einem Ausflug in den Gay-Dolphin-Park an der Myrtle-Beach-Promenade gefeiert. Ich liebte diese Stunden im Vergnügungspark, vor allem die Fahrten mit der Wild Mouse, auf der ich – mit klopfendem Herzen, die Hände um die Haltestange gekrallt, dass die Knöchel weiß wurden – in die Höhe sauste und in die Tiefe stürzte, bis mir die Zuckerwatte hochkam.
Wirklich klasse. Aber so konnte ich nie Geburtstagstörtchen in die Schule mitnehmen.
Ich wurde acht in dem Sommer nach Daddys Tod. Mama schenkte mir ein pinkfarbenes Schmuckkästchen mit einer Spieluhr und einer tanzenden Ballerina. Harry malte ein Familienporträt, zwei große und zwei kleine Strichmännchen, die Finger ausgestreckt und sich überkreuzend, auf keinem Gesicht ein Lächeln. Grans Geschenk war ein Exemplar von Lucy Maud Montgomerys Anne auf Green Gables.
Zwar bereitete Grandma auch in diesem Jahr das traditionelle Picknick aus Schokoladenkuchen, Brathähnchen, gekochten Shrimps, Kartoffelsalat, gefüllten Eiern und Keksen vor, aber nach der Völlerei gab es keine Achterbahnfahrt. Harry bekam einen Sonnenbrand und meine Mama Migräne, und so blieb ich allein am Strand und vertiefte mich in Annes Abenteuer mit Marilla und Matthew.
Zuerst bemerkte ich sie gar nicht. Irgendwie ging sie im weißen Rauschen der Brandung und der Seevögel unter. Als ich den Kopf hob, stand sie weniger als zehn Meter von mir entfernt, die Hände an die Hüften gestemmt, die dünnen Arme abgespreizt.
Wortlos musterten wir einander. Ihrer Größe nach war sie ein oder zwei Jahre älter als ich, auch wenn ihre Taille noch babydick war und ihr Badeanzug sich flach um ihre Brust spannte.
Sie machte als Erste den Mund auf. Mit dem Daumen auf mein Buch zeigend, sagte sie: »Ich war da.«
»Warst du nicht«, sagte ich.
»Ich hab die Königin von England gesehen.« Der Wind fuhr ihr in das dunkle Gestrubbel auf ihrem Kopf, hob Strähnen an und ließ sie wieder fallen wie jemand, der sich in einem Geschäft bunte Bänder aussucht.
»Hast du nicht«, sagte ich und kam mir sofort blöd dabei vor. »Die Königin lebt in einem Palast in London.«
Das Mädchen wischte sich Locken von den Augen. »Ich war da. Mein grand-père hat mich hochgehoben, damit ich sie sehen konnte.«
Ihr Englisch hatte einen eigentümlichen Akzent, weder das flache Näseln des Mittleren Westens noch der rundvokalig gedehnte Singsang der südöstlichen Küste. Ich zögerte, war mir unsicher.
»Wie hat sie ausgesehen?«
»Sie hat Handschuhe getragen und einen lila Hut.«
»Wo war das?« Skeptisch.
»Tracadie.«
Das gutturale »r« klang für mein achtjähriges Ohr sehr aufregend.
»Wo ist das?«
»En Acadie.«
»Noch nie gehört.«
»Das ist der Urwald. Murmelnde Kiefern und Schierling.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und blinzelte nur zu ihr hoch.
»Das ist ein Gedicht.«
»Ich war im Art Institute in Chicago«, sagte ich, weil ich das Gefühl hatte, Poesie mit etwas ähnlich Hochgestochenem kontern zu müssen. »Da gibt’s viele berühmte Bilder, wie das mit den Leuten im Park, die mit lauter Pünktchen gemalt sind.«
»Ich wohne bei meiner Tante und meinem Onkel«, sagte das Mädchen.
»Ich bin zu Besuch bei meiner Großmutter. «Von Harry oder Mama sagte ich nichts. Oder von Kevin. Oder Daddy.
Ein Frisbee segelte zwischen dem Mädchen und dem Ufer in den Sand. Ich sah zu, wie ein Junge es aufhob und zurückwarf.
»Green Gables kann man nicht in echt besuchen«, sagte ich.
»Doch, kann man schon.«
»Das gibt’s nicht in echt.«
»Gibt es schon.« Das Mädchen zog einen braunen Zeh durch den Sand.
»Ich hab heute Geburtstag«, sagte ich, weil mir nichts Besseres einfiel.
»Bonne fête.«
»Ist das Italienisch?«
»Französisch.«
Meine Schule in Beverly hatte Französisch angeboten, das Lieblingsprojekt einer frankophilen Nonne namens Schwester Mary Patrick. Auch wenn meine Kenntnisse damals kaum über »Bonjour« hinausreichten, merkte ich doch, dass dieses Mädchen ganz anders klang als die Französischlehrerin, die ich in der ersten und zweiten Klasse gehabt hatte.
Einsam? Neugierig? Bereit, mir alles anzuhören, was mich von der Trübsal in Grandmas großem Haus ablenkte? Wer weiß das schon. Ich biss auf jeden Fall an.
»War der Prinz bei ihr?«
Das Mädchen nickte.
»Wie ist dieses Tracadie denn so?« Bei mir klang es wie Track-a-day.
Das Mädchen zuckte die Achseln. »Un beau petit village. Ein kleines Städtchen.«
»Ich bin Temperance Brennan. Du kannst mich Tempe nennen.«
»Évangéline Landry.«
»Ich bin acht.«
»Ich bin zehn.«
»Willst du meine Geschenke sehen?«
»Dein Buch mag ich sehr.«
Ich lehnte mich wieder zurück. Évangéline setzte sich im Schneidersitz neben meinen Stuhl in den Sand. Eine Stunde lang redeten wir über Anne und diese berühmte Farm auf Prince Edward Island.
So begann unsere Freundschaft.
Die achtundvierzig Stunden nach meinem Geburtstag waren stürmisch, der Himmel wechselte tagsüber zwischen Zinngrau und kränklichem Graugrün. Der Regen kam in windgepeitschten Güssen und spritzte salzige Tropfen auf die Fenster von Grandmas Haus.
Immer wenn es gerade einmal nicht regnete, bettelte ich, an den Strand gehen zu dürfen. Doch Grandma erlaubte es mir nicht, sie fürchtete die Unterströmungen in der Brandung, die in weißer Gischt über den Sand rollte. Frustriert starrte ich durch die Fenster hinaus, doch Évangéline Landry war nirgends zu sehen.
Schließlich riss der Himmel auf, blaue Flecken verdrängten die Wolken. Die Schatten unter dem Strandhafer und den Plankenwegen über die Dünen wurden schärfer. Die Vögel trällerten wieder. Die Temperatur stieg, und die Luftfeuchtigkeit verkündete, dass sie im Gegensatz zum Regen nicht wieder verschwand.
Trotz des Sonnenscheins vergingen Tage, ohne dass ich von meiner Freundin etwas sah.
Ich fuhr gerade Rad, als ich sie die Myrtle Avenue entlangschlendern sah, den Kopf nach vorn gestreckt wie eine Schildkröte, einen Lutscher im Mund. Sie trug Flipflops und ein ausgewaschenes Beach-Boys-T-Shirt.
Sie blieb stehen, als ich neben ihr anhielt.
»Hey«, sagte ich und stellte einen Turnschuh vom Pedal auf den Asphalt.
»Hi«, sagte sie.
»Hab dich ’ne Weile nicht gesehen.«
»Musste arbeiten.« Sie wischte sich klebrig rote Finger an ihren Shorts ab.
»Du hast einen Job?« Ich staunte, dass man einem Kind eine so erwachsene Beschäftigung gestattete.
»Mein Onkel fischt vor Murrell’s Inlet. Manchmal helf ich ihm auf dem Boot.«
»Toll.«Visionen von Gilligan, Ginger und dem Captain.
»Pff.« Sie prustete die Luft durch die Lippen. »Ich kratz die Innereien aus den Fischen.«
Ich schob mein Fahrrad, und wir gingen nebeneinanderher.
»Manchmal muss ich auf meine kleine Schwester aufpassen«, sagte ich, um eine gewisse Gleichheit herzustellen. »Sie ist fünf.«
Évangéline drehte sich mir zu. »Hast du einen Bruder?«
»Nein.« Mit brennendem Gesicht.
»Ich auch nicht. Meine Schwester Obéline ist zwei.«
»Dann musst du also Fische putzen. Ist aber trotzdem toll, den Sommer am Strand zu verbringen. Wo du herkommst, ist es da ganz anders?«
Irgendetwas funkelte in Évangélines Augen und war wieder verschwunden, bevor ich es deuten konnte.
»Meine Mama ist dort. Im Krankenhaus hat man sie entlassen, deshalb hat sie jetzt zwei Jobs nebeneinander. Sie will, dass Obéline und ich gut Englisch lernen, deshalb bringt sie uns hierher. C’est bon. Meine Tante Euphémie und mein Onkel Fidèle sind nett.«
»Erzähl mir von diesem Urwald.« Ich wollte vom Thema Familie ablenken.
Évangélines Blick folgte einem vorbeifahrenden Auto und kehrte dann wieder zu mir zurück.
»L’Acadie ist der schönste Flecken Erde auf der ganzen Welt.«
Offensichtlich.
Den ganzen Sommer lang erzählte Évangéline Geschichten aus ihrer Heimat in New Brunswick. Ich hatte natürlich schon von Kanada gehört, aber meine kindliche Fantasie reichte kaum über Mounties und Iglus hinaus. Oder Hundeschlitten, die an Karibus und Eisbären vorbeisausten, oder Seehunde auf Eisschollen. Évangéline erzählte von dichten Wäldern, Steilklippen oder Orten mit Namen wie Miramichi, Kouchibouguac oder Bouctouche.
Sie erzählte außerdem von der akadischen Geschichte, von der Vertreibung ihrer Vorfahren aus ihrer Heimat. Wieder und wieder hörte ich ihr zu und stellte Fragen. Erstaunt. Entrüstet über die nordamerikanische Tragödie, die ihre Leute Le Grand Dérangement nannten. Dass die französischen Akadier durch einen britischen Deportationsbefehl ins Exil getrieben und ihres Landes und ihrer Rechte beraubt wurden.
Évangéline war es, die mir die Poesie näherbrachte. In diesem Sommer stolperten wir durch Longfellows großes Epos, der Inspiration für ihren Namen. Ihr Exemplar war auf Französisch, ihre Muttersprache. Sie übersetzte, so gut sie konnte.
Obwohl ich die Verse kaum begriff, verwandelte sie die Geschichte in ein Zaubermärchen. Unser kindlicher Verstand stellte sich das akadische Milchmädchen weit weg von ihrem Geburtsort in Nova Scotia vor. Wir improvisierten Kostüme und inszenierten das Drama dieser Diaspora und der glücklosen Liebenden.
Évangéline hatte vor, eines Tages Dichterin zu werden. Ihre Lieblingsgedichte hatte sie auswendig gelernt, die meisten auf Französisch, einige auf Englisch. Edward Blake, Elizabeth Barrett Browning, der Barde aus New Brunswick, Bliss Carman. Ich hörte zu. Und gemeinsam schrieben wir schlechte Gedichte.
Mir waren Geschichten mit einer Handlung lieber. Obwohl ihr das Englische schwerfiel, versuchte Évangéline sich an meinen Lieblingsautoren: Anne Sewell, Carolyn Keene, C. S. Lewis. Und endlos unterhielten wir uns über Anne Shirley und stellten uns ihr Leben auf der Green-Gables-Farm vor.
In dieser Zeit hoffte ich noch, Tierärztin zu werden. Auf meine Veranlassung hin führten wir Notizbücher über die Reiher in den Marschen und die Pelikane, die im Wind segelten. Wir errichteten Schutzwälle um Schildkrötennester. Wir fingen Frösche und Schlangen mit langstieligen Netzen.
An manchen Tagen veranstalteten wir raffinierte Teepartys für Harry und Obéline. Drehten ihnen Locken in die Haare. Zogen sie an wie Puppen.
Tante Euphémie kochte uns poutine râpée, fricot au poulet, tourtière. Ich sehe sie noch heute in ihrer Schürze mit den Rüschenträgern, wie sie uns in gebrochenem Englisch Geschichten über die Akadier erzählt. Geschichten, die sie von ihrem Vater und der von dem seinen gehört hatte. Das Jahr 1775. Zwölftausend Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden.
Wohin sind sie gegangen?, fragte dann Harry manchmal. Europa, Karibik, Amerika. Die in Louisiana wurden zu den Cajuns.
Wie konnte so was passieren?, fragte ich. Die Briten wollten unsere Farmen und Deiche. Sie hatten Gewehre.
Aber die Akadier sind zurückgekehrt? Einige.
In diesem ersten Sommer impfte Évangéline mir eine lebenslange Gier nach Nachrichten ein. Vielleicht, weil sie aus einer so isolierten Ecke des Planeten kam.Vielleicht, weil sie ihr Englisch üben wollte.Vielleicht, weil sie einfach nur so war, wie sie war. Évangélines Durst nach jeder Art Wissen war unstillbar.
Radio, Fernsehen, Zeitungen. Wir verschlangen und verstanden alles auf unsere kindliche Art. Abends saßen wir auf ihrer Veranda oder meiner, und während Junikäfer gegen die Fliegengitter knallten und aus dem Transistorradio die Monkees, die Beatles, die Isley Brothers plärrten, sprachen wir über einen Mann mit einem Gewehr in einem Hochhaus in Texas. Über den Tod von Astronauten. Über den schwarzen Bürgerrechtler Stokely Carmichael und eine merkwürdige Gruppe namens SNCC.
Mit meinen acht Jahren hielt ich Évangéline Landry für das klügste und exotischste Wesen, das ich je kennenlernen würde. Sie war auf dunkel zigeunerhafte Weise wunderschön, sprach eine fremde Sprache und kannte Lieder und Gedichte, die ich noch nie gehört hatte. Aber obwohl wir uns gegenseitig Geheimnisse anvertrauten, spürte ich damals schon eine gewisse Reserviertheit in meiner Freundin, etwas Rätselhaftes. Und noch etwas. Eine verborgene Traurigkeit, von der sie nichts erzählte und die ich nicht benennen konnte.
Die heißen, schwülen Tage verstrichen, während wir unsere kleine Lowcountry-Insel erkundeten. Ich zeigte ihr Plätze, die ich von früheren Besuchen her kannte. Gemeinsam entdeckten wir neue.
Langsam verblasste mein Schmerz, wie er es unweigerlich tut. Meine Gedanken waren mit anderen Dingen beschäftigt. Angenehmen Dingen.
Dann war es August und Zeit für die Abreise.
Mama kehrte nie nach Chicago zurück. In meinem Leben entwickelte sich eine neue Geborgenheit in Charlotte. Ich lernte, Grandmas altes Haus in Dilworth zu lieben, den Duft von Geißblatt, das den hinteren Zaun überwucherte, den dunklen Tunnel der Weideneichen, die unsere Straße überwölbten.
Natürlich fand ich Freundinnen, aber keine war so exotisch wie meine sommerliche Seelenschwester. Keine, die Gedichte schrieb, Französisch sprach und Green Gables und die Königin von England gesehen hatte.
Wenn Évangéline und ich getrennt waren, schrieben wir uns Briefe mit Nachrichten über unser Leben im Winter, unsere Poesie, unsere kindlichen Ansichten über das, was in den Nachrichten kam. Biafra. Warum schickten andere Länder diesen Leuten keine Lebensmittel? My Lai. Brachten Amerikaner wirklich unschuldige Frauen und Kinder um? Chappaquiddick. Haben auch Prominente solche Probleme? Wir machten uns Gedanken über Schuld oder Unschuld von Jeffrey MacDonald. Konnte ein Mann so schlecht sein, dass er seine eigenen Kinder umbrachte? Das Böse des Charlie Manson. War er der Teufel? Wir strichen die Tage bis zum Sommer auf unseren Kalendern aus.
Das Schuljahr endete in Charlotte früher als in Tracadie, so war ich immer die Erste auf Pawleys Island. Eine Woche später rollte Madame Landrys verrosteter Ford Fairlane über den Damm. Laurette verbrachte eine Woche bei ihrer Schwester und ihrem Schwager in deren kleinem Haus in den Marschen und kehrte dann zu ihren Jobs in einer Hummerkonservenfabrik und in einem Touristenmotel zurück. Im August wiederholte sie dann die lange Fahrt.
In der Zwischenzeit lebten Évangéline, Obéline, Harry und ich unsere Sommerabenteuer. Wir lasen, wir schrieben, wir redeten, wir erkundeten. Wir sammelten Muschelschalen. Ich lernte einiges über das Fischen als Lebensunterhalt. Ich lernte ein wenig schlechtes Französisch.
Unser fünfter Sommer begann wie die vorangegangenen vier. Bis zum 26. Juli.
Psychologen sagen, dass sich einige Daten für immer ins Gedächtnis einprägen. 7. Dezember 1941. Der japanische Angriff auf Pearl Harbor. 23. November 1963. Das Attentat auf Präsident Kennedy. 11. September 2001. Das World Trade Center in Flammen.
Auf meiner Liste steht auch der Tag, an dem Évangéline verschwand.
Es war ein Donnerstag. Die Landry-Kinder waren seit sechs Wochen auf der Insel und sollten noch einmal vier bleiben. Évangéline und ich hatten vor, schon früh an diesem Morgen zum Krabbenfangen zu gehen. Andere Details sind nur noch Fragmente.
Ich radelte, das Krabbennetz quer über der Lenkstange, durch eine neblige Morgendämmerung. Ein Auto auf der Gegenfahrbahn, die Silhouette eines Mannes hinter dem Steuer. Onkel Fidèle? Ein schneller Blick nach hinten. Auf dem Rücksitz noch eine Silhouette.
Das Tick-Tick-Tick von Kieseln, die ich an das Fliegengitter vor Évangelinés Fenster warf. Euphémies Gesicht in einem schmalen Türspalt, die Haare mit Klemmen festgesteckt, die Augen rot, die Lippen leichenblass.
Sie sind weg. Du darfst nicht mehr hierherkommen.
Wohin sind sie, ma tante?
Geh weg. Vergiss sie.
Aber warum?
Sie sind jetzt gefährlich.
Dann die Rückfahrt, kräftiges Strampeln, Tränen auf den Wangen, in einiger Entfernung ein Auto, das vom Nebel auf dem Damm verschluckt wurde. Weg? Ohne Ankündigung? Ohne Abschied? Kein »Ich schreibe dir«. Komm nicht mehr hierher? Vergiss sie?
Meine Freundin und ihre Schwester verbrachten nie mehr einen Sommer auf Pawleys Island.
Ich fuhr wieder und wieder zu dem kleinen Haus in den Marschen und bettelte um Nachrichten, doch immer wurde ich abgewiesen. Tante Euphémie und Onkel Fidèle sagten mir nichts, sondern wiederholten nur immer wieder: »Geh weg. Sie sind nicht hier.«
Ich schrieb einen Brief nach dem anderen. Einige kamen als unzustellbar zurück, andere nicht, aber nie kam eine Antwort von Évangéline. Ich fragte Grandma, was ich tun könnte. »Nichts«, sagte sie. »Gewisse Ereignisse können ein ganzes Leben verändern. Denk dran, du bist aus Chicago weggegangen.«
Voller Verzweiflung schwor ich mir, sie zu finden. Nancy Drew, die jugendliche Detektivheldin meiner Kindertage, hat es auch geschafft, dachte ich mir. Und ich versuchte es auch, so sehr, wie eine Zwölfjährige es konnte, als es noch kein Handy und kein Internet gab. Für den Rest dieses Sommers und einen Großteil des nächsten spähten Harry und ich Tante Euphémie und Onkel Fidèle aus. Wir erfuhren rein gar nichts.
Auch in Charlotte probierten wir es weiter. Die Büchereien in unserer Reichweite hatten zwar keine Telefonbücher für New Brunswick, Kanada, aber immerhin fanden wir die Vorwahl für Tracadie-Sheila heraus. In dieser Region gab es mehr Landrys, als die Vermittlung ohne Vornamen sortieren konnte.
Laurette.
Kein Eintrag. Zweiunddreißig L. Landrys.
Weder Harry und ich konnten uns erinnern, dass Évangéline je den Namen ihres Vaters erwähnt hätte.
Dann die Erkenntnis. Trotz all der langen Tage, die Évangéline und ich über Jungs, Sex, Longfellow, Green Gables oder Vietnam geredet hatten, hatten wir, wie in stillschweigender Übereinkunft, das Thema Väter nie angeschnitten.
Von einer Telefonzelle aus und mit Münzen aus unseren Sparbüchsen riefen Harry und ich jede und jeden L. Landry in Tracadie an. Dann auch in den Orten der näheren Umgebung. Keiner kannte Évangéline oder ihre Familie. Zumindest behaupteten das alle.
Meine Schwester verlor das Interesse am Detektivspielen lange bevor ich es tat. Évangéline war meine Freundin gewesen und fünf Jahre älter als sie. Und Obéline war noch so jung gewesen, nur halb so alt wie Harry.
Letztendlich gab dann auch ich die Suche auf. Aber die Fragen verschwanden nie aus meinem Kopf. Wohin? Warum? Wie konnte ein vierzehnjähriges Mädchen eine Bedrohung sein? Schließlich war ich so weit, dass ich an meiner Erinnerung an Tante Euphémies Worte zweifelte. Hatte sie wirklich »gefährlich« gesagt?
Die Leere, die Évangéline hinterlassen hatte, war ein dunkles Loch in meinem Leben, bis der Trubel der Highschool Nachdenken und Trauern verdrängte.
Kevin. Daddy. Évangéline. Der Schmerz dieses dreifachen Schlags ist verblasst, wurde gedämpft von der Zeit, die verging, und verlor sich im Stress des Alltags.
3
Ich war schon eine volle Stunde in Montreal, als LaManche anrief. Bis dahin war mein Juni-Abstecher in die frisch aufgetaute Tundra am St. Lawrence problemlos verlaufen.
Der Flug von Charlotte wie auch der Anschluss in Philadelphia waren beide planmäßig gestartet. Birdie hatte mir nur minimalen Kummer bereitet, lediglich bei Starts und Landungen hatte er protestierend miaut. Mein Gepäck war mit mir gelandet. Zu Hause angekommen, hatte ich auch meine Wohnung in einigermaßen gutem Zustand vorgefunden. Mein Mazda war beim ersten Versuch angesprungen. Das Leben war schön.
Dann rief LaManche mich auf meinem Handy an.
»Temperance?« Er alleine verweigerte sich dem eher benutzerfreundlichen »Tempe«, das der Rest der Welt verwendete. Mein Name rollte von LaManches Zunge wie ein hochpariserisches Tempéronce.
»Oui.« Mein Hirn schaltete sofort auf Französisch um.
»Wo sind Sie?«
»Montreal.«
»Dachte ich mir schon. Der Flug war gut?«
»So gut, wie’s geht.«
»Das Fliegen ist auch nicht mehr das, was es mal war.«
»Nein.«
»Können Sie morgen früher reinkommen?« Ich ahnte Anspannung in der Stimme des alten Mannes.
»Natürlich.«
»Ein Fall ist eingetroffen, der …« Ein kurzes Zögern.»… kompliziert ist.«
»Kompliziert?«
»Ich glaube, ich erkläre Ihnen das lieber persönlich.«
»Acht Uhr?«
»Bon.«
Beim Auflegen spürte ich eine leichte Beklommenheit. La-Manche rief mich nur selten an. Und wenn er es tat, dann hatte er nie gute Nachrichten. Fünf verbrannte Biker in einem Chevrolet Blazer. Eine Frau mit dem Gesicht nach unten im Pool eines Senators. Fünf Leichen in einem Hohlraum unter einem Haus.
LaManche war seit dreißig Jahren forensischer Pathologe und seit zwanzig Leiter unserer gerichtsmedizinischen Abteilung. Er wusste, dass ich an diesem Tag zurückkommen und mich sofort am nächsten Morgen im Institut melden würde. Was konnte so kompliziert sein, dass er meinte, sich meiner Verfügbarkeit versichern zu müssen?
Oder so grausig.
Während ich auspackte, einkaufen ging, den Kühlschrank bestückte und einen Nizza-Salat aß, gingen mir diverse Szenarios durch den Kopf, eins schlimmer als das andere.
Als ich ins Bett stieg, beschloss ich, mein Eintreffen auf sieben Uhr dreißig vorzuverlegen.
Einen Vorteil hat das Fliegen: Es macht einen müde. Trotz meiner Befürchtungen schlief ich schon während der Elf-Uhr-Nachrichten ein.
Der nächste Morgen war wie aus einem Reiseprospekt. Milde Luft. Eine leichte Brise. Türkisblauer Himmel.
Da ich bereits sehr viel länger, als ich zugeben will, nach Montreal pendle, war ich mir sicher, dass dieser klimatische Ausreißer nur kurzfristig sein würde. Ich wollte eine Fahrradtour machen, auf dem Berg picknicken, auf dem Weg am Lachine-Kanal Rollerblades fahren.
Alles,außer sich mit LaManches »kompliziertem« Fall herumschlagen müssen.
Um sieben Uhr vierzig parkte ich am Édifice Wilfrid-Derome, einem T-förmigen Hochhaus in einem Arbeiterviertel knapp östlich des centre-ville. Das Gebäude funktioniert folgendermaßen:
Das Laboratoire de Sciences Judiciaires et de Médecine Légale, das LSJML, ist das zentrale gerichtsmedizinische Institut für die gesamte Provinz Quebec. Uns gehören die beiden obersten Stockwerke des Gebäudes, zwölf und dreizehn. Das Bureau du Coroner befindet sich auf zehn und elf. Die Leichenhalle und die Autopsieräumlichkeiten befinden sich im Keller. Die Provinzpolizei, La Sûreté du Québec, oder SQ, beansprucht den übrigen Platz.
Ich zog meine Sicherheitskarte durch den Scanner, ging durch Metalltüren, betrat den nur für LSJML/Coroner zugelassenen Aufzug, zog die Karte noch einmal durch und fuhr mit einem Dutzend anderen, die alle »Bonjour« und »Comment ça va?« murmelten, in die Höhe. Um diese Uhrzeit sind »Guten Morgen« und »Wie geht’s?« in jeder Sprache nur oberflächlich gemeint.
Vier von uns stiegen im zwölften Stock aus. Nach dem Empfangsbereich zog ich eine zweite Karte durch einen Scanner und betrat das Institut. Durch Beobachtungsfenster und offene Türen sah ich Sekretärinnen, die Computer hochfuhren, Techniker, die in Tabellen blätterten, Wissenschaftler und Analysten, die Labormäntel anzogen. Jeder hatte Kaffee griffbereit.
Hinter ein paar Kopiergeräten zog ich die Karte noch einmal durch. Glastüren gingen zischend auf, und ich betrat den gerichtsmedizinischen Flügel.
Die Anwesenheitstafel zeigte, dass vier von fünf Pathologen im Haus waren. In dem Kästchen neben Michel Morins Namen stand: Témoignage: Saint-Jérôme. Zeugentermin in Saint-Jérôme.
LaManche saß hinter seinem Schreibtisch und stellte die Fallliste für die Personalbesprechungen dieses Morgens zusammen. Obwohl ich an seiner Tür kurz stehen blieb, hob er den Blick nicht von seinen Papieren.
Weiter den Korridor entlang, kam ich links an den Pathologie-, Histologie- und Anthropologie/Odontologie-Laboren und rechts an den Büros der Pathologen vorbei. Pelletier. Morin. Santangelo. Ayers. Das meine war das letzte in dieser Reihe.
Noch mehr Sicherheit. Ein Schlüssel für ein gutes, altmodisches Zylinderschloss.
Ich war einen Monat weg gewesen. Das Büro sah aus, als wäre ich weg gewesen, seit wir in dieses Gebäude eingezogen waren.
Fensterputzer hatten die gerahmten Bilder meiner Tochter Katy und alle anderen Souvenirs vom Fensterbrett auf einen Aktenschrank gestellt. Bodenpfleger hatten den Papierkorb und zwei Pflanzen auf dem danach praktischerweise leeren Fensterbrett platziert. Neue Spurensicherungs-Overalls und -Stiefel stapelten sich auf einem Stuhl, frische Labormäntel auf einem anderen. Mein laminiertes Dubuffet-Poster war von der Wand gefallen und hatte einen Bleistifthalter umgeworfen.
Auf meinem Schreibtisch stapelte sich Material, das man aus meinem Postfach im Sekretariat hierher transferiert hatte. Briefe, Prospekte, Werbung. Darüber hinaus konnte ich noch Folgendes identifizieren: eine aktualisierte Liste der internen Durchwahlnummern; vier Umschläge mit Abzügen von den Fotografen der Section d’identité judiciaire; zwei Sätze antemortaler Röntgenaufnahmen und zwei medizinische Berichte; ein Exemplar von Voir Dire, dem Klatschblättchen des LSJML; und drei demande d’expertise en anthropologie-Formulare, also Anforderungen für anthropologische Gutachten.
Nachdem ich die verstreuten Kulis und Bleistifte wieder eingesammelt hatte, ließ ich mich auf meinen Stuhl fallen, räumte ein kleines Stück der Tischplatte frei und nahm mir die erste Anforderung vor.
Pathologe: M. Morin. Ermittelnder Beamter: H. Perron. Service de Police de la Ville de Montréal. SPVM. Früher unter dem Namen Service de Police de la Communauté urbaine de Montréal oder SPCUM bekannt, war die SPVM die städtische Polizei. Dieselbe Truppe, neues Image. Nom: Inconnu. Name: Unbekannt. Die jeweiligen Fallnummern von LSJML, Leichenhalle und Polizei ließ ich aus und wandte mich gleich der Zusammenfassung der bekannten Fakten zu.
Auf einer Baustelle westlich von centre-ville waren bei Aushubarbeiten Skelettteile entdeckt worden. Ob ich bestimmen könnte, ob die Knochen menschlich waren? Und wenn, von wie vielen Personen? Eintritt des Todes? Falls jüngeren Datums, könnte ich Alter, Geschlecht, Rasse und Größe bestimmen und charakteristische Merkmale für jeden Knochensatz beschreiben? Könnte ich die Todesart bestimmen?
Das Alltagsgeschäft eines forensischen Anthropologen.
Das zweite Formular kam ebenfalls von SPVM, der Stadtpolizei. Emily Santangelo war die zuständige Pathologin und koordinierte deshalb alle Fachgutachten in Bezug auf die Leiche. In diesem Fall ging es um ein Feuer in einem Wohnhaus, eine verbrannte Leiche und ein bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschmolzenes Gebiss. Man bat mich festzustellen, ob Übereinstimmung zwischen den verkohlten Überresten und einem dreiundneunzigjährigen Mann bestand, der angeblich in diesem Haus wohnte.
Drittes Formular. Aus dem Lac des Deux Montagnes hatte man in der Nähe von L’Île-Bizard eine aufgeblähte und stark verweste Leiche gezogen. Außer der Tatsache, dass das Opfer weiblich war, hatte der Pathologe, LaManche, nur sehr wenig feststellen können. Zähne waren zwar vorhanden, hatten jedoch keinen Treffer ergeben, als man die Daten in das CPIC, das kanadische Äquivalent des amerikanischen NCIS, eingespeist hatte. Könnte ich die Knochen auf Verletzungen hin untersuchen?
Im Gegensatz zu den ersten beiden kam LaManches Fall von der SQ, der Provinzpolizei.
Eine Stadt, zwei Polizeieinheiten? Klingt kompliziert. Ist es aber nicht.
Montreal ist eine Insel, Teil eines Archipels im Zusammenfluss des Ottawa River und des St. Lawrence River. Im Süden wird die Stadt vom Fleuve Saint-Laurent begrenzt, im Norden von der Rivière de Prairies.
Die kleine Insel ist nur fünfzig Kilometer lang und zwischen fünf und dreizehn Kilometer breit, schmal an den Spitzen, breiter zur Mitte hin. Das beherrschende Merkmal ist der Mount Royal, ein Brocken Eruptivgestein, der sich stolze zweihunderteinunddreißig Meter über den Meeresspiegel erhebt. Les Montréalais nennen diesen winzigen Buckel la montagne, den Berg.
Was die polizeilichen Zuständigkeiten angeht, ist Montreal anhand dieser geologischen Eigentümlichkeiten unterteilt. Auf der Insel: SPVM. Auf dem Festland: SQ. Sofern es dort keine örtliche Polizei gibt. Rivalitäten kommen zwar vor, aber im Allgemeinen – ça marche - funktioniert es.
Mein Blick fiel auf den Namen des ermittelnden SQ-Beamten. Detective-Lieutenant Andrew Ryan.
Mein Magen machte einen kleinen Satz.
Aber davon später mehr.
Pierre LaManche ist ein großer Mann, wenn auch vom Alter schon ein wenig gebeugt. Da er Kreppsohlen und leere Taschen bevorzugt, bewegt er sich so leise, dass er völlig unbemerkt einen Raum betreten kann.
»Ich möchte mich entschuldigen, dass ich Sie gestern Abend so spät noch belästigt habe.« LaManche stand in meiner Tür, Klemmbrett in einer Hand, Stift in der anderen.
»Kein Problem.« Ich stand auf, ging um den Schreibtisch, hob die Labormäntel auf und hängte sie auf einen Haken an meiner Tür.
LaManche setzte sich auf den nun freien Stuhl. Ich wartete auf seine Erklärung.
»Sie kennen natürlich maître Asselin.«
In Quebec sind Coroner entweder Mediziner oder Anwälte. Ein komisches System, aber ça marche. Es funktioniert. Michelle Asselin war Juristin, deshalb der Titel maître.
Ich nickte.
»Maître Asselin ist genauso lang Coroner, wie ich in diesem Labor bin.« LaManche strich sich übers Kinn, wie um zu kontrollieren, ob er sich an diesem Morgen rasiert hatte. »Sie steht kurz vor der Pensionierung.«
»Der komplizierte Fall ist der ihre?«
»Indirekt. Maître Asselin hat einen Neffen, der in der Nähe von St.-Antoine-Abbé eine Farm besitzt. Théodore Doucet. Théodore und seine Frau Dorothée haben nur ein Kind, eine Tochter. Geneviève ist zweiunddreißig, hat aber spezielle Bedürfnisse und lebt zu Hause.«
LaManche schien die Positionierung meines Papierkorbs zu hinterfragen. Ich wartete.
»Dorothée war eine regelmäßige Kirchgängerin, aber eines Tages kam sie nicht mehr. Kein Mensch kann sich an das genaue Datum erinnern. Man wusste zwar, dass die Familie sehr zurückgezogen lebte, dennoch machten die Nachbarn sich irgendwann Sorgen. Gestern besuchten zwei Gemeindemitglieder die Doucet-Farm. Sie fanden Dorothée und Geneviève tot oben in einem Schlafzimmer. Théodore saß unten und spielte Silent Hunter auf seinem Computer.«
LaManche missverstand meinen fragenden Blick. »Das ist ein Computerspiel. Man macht da irgendwas mit U-Booten.«
Ich wusste das. Es überraschte mich allerdings sehr, dass La Manche es wusste.
»Sie waren dort?«, fragte ich.
LaManche nickte. »Das Haus war ein Albtraum, die Zimmer waren vollgestopft mit nutzlosem Zeug. Haferflockenschachteln. Zeitungen. Blechdosen. Benutzte Tempos. Fäkalien in Ziploc-Tüten.«
»Théodore wurde zur psychiatrischen Begutachtung eingeliefert?«
LaManche nickte. Er sah müde aus. Der alte Mann sah allerdings meistens müde aus.
»Beide Frauen waren vollständig bekleidet, sie lagen auf dem Rücken, und die Decken waren bis zum Kinn hochgezogen. Die Köpfe waren einander zugeneigt und berührten sich, die Arme waren untergehakt.«
»Aufgebahrt.«
»Ja.«
Ich fragte mich, was das mit mir zu tun hatte. Wenn sie nicht gerade zerstückelt, verstümmelt oder ohne Identifikationsmerkmale wie Fingerkuppen oder Zähne aufgefunden wurden, fielen frische Leichen selten in mein Fachgebiet.
»Ich habe das Gefühl, dass Dorothée seit mindestens zwei Wochen tot ist«, fuhr LaManche fort. »Ich werde das heute noch genau bestimmen. Das Problem ist Geneviève. Ihre Leiche lag neben einem Heizlüfter.«
»Und die heiße Luft blies über sie hinweg«, vermutete ich. Ich hatte das schon öfter gesehen.
LaManche nickte. »PMI wird schwierig werden.«
Mumifizierte Leiche. Unklares postmortales Intervall; die Zeit, die seit Todeseintritt verstrichen ist. Jawoll. Da kam ich ins Spiel.
»Hinweise auf Verletzungen?«, fragte ich.
»Bei Dorothées äußerer Untersuchung konnte ich nichts entdecken. Genevièves Leiche ist viel zu vertrocknet. Auf den Röntgenaufnahmen konnte ich weder bei der Mutter noch bei der Tochter etwas entdecken.«
»Oberste Priorität?«
LaManche nickte. Dann bohrten sich seine Jagdhundaugen in die meinen. »Ich bin mir sicher, dass diese Sache diskret und mit Anteilnahme behandelt werden kann.«
Im Gegensatz zu den Doucet-Frauen waren nur wenige, die durch unsere Türen geschoben wurden, in ihren Betten gestorben. Unsere Fälle waren die Ermordeten, die Selbstmörder, diejenigen, deren Leben durch schlechtes Timing, schlechtes Urteilsvermögen oder einfach nur Pech beendet worden war.
LaManche wusste, wie sehr mir die Toten und die Hinterbliebenen am Herzen lagen. Er hatte gesehen, wie ich mit Familien umging oder aber mit Journalisten, die nur etwas Reißerisches für die Fünf-Uhr-Nachrichten suchten.
LaManche wusste, dass er das eben Gesagte gar nicht hätte sagen müssen. Dass er es trotzdem getan hatte, zeigte, wie sehr ihn das persönlich mitnahm. Der alte Mann mochte Michelle Asselin sehr gern.
Um neun waren alle Verwaltungsprobleme besprochen, alle Fälle zugewiesen und die Personalbesprechung abgeschlossen. Ich kehrte in mein Büro zurück, zog einen Labormantel über und ging ins Anthropologielabor. Die Knochen, die man auf der Baustelle gefunden hatte, lagen auf zwei Arbeitstischen.
Schon nach dem ersten Blick wusste ich, dass in diesem Fall keine detaillierte Untersuchung nötig war. Nachdem ich mir jeden Knochen kurz angeschaut hatte, schrieb ich meinen Bericht gleich online.
Les ossements ne sont pas humains. Die Knochen sind nicht menschlich. Zwanzig Minuten und fertig.
Als Nächstes gab ich meinem Labortechniker Denis Anweisungen in Bezug auf die Säuberung des verkohlten Leichnams. Verkohlte Leichen können empfindlich sein und erfordern eine behutsame Zerlegung des Skeletts und Entfernung des Bindegewebes per Hand.
Dann hieß es hinunter in die Leichenhalle.
Klemmbrett. Greifzirkel. Formular für die skelettale Autopsie.
Ich hatte meine Hand schon am Türknauf, als das Telefon klingelte. Ich hätte es beinahe ignoriert. Hätte ich vielleicht besser tun sollen.
4
»Doc Brennan?« Die Stimme klang wie Stacheldraht auf Wellblech. »C’est moé, Hippo.«
»Comment ça va?« Eine Formalität, wie im Aufzug. Ich wusste, wenn der Anrufer die Frage ernst genommen hätte, dann hätte er sehr detailliert geantwortet. Ich mochte den Kerl zwar, aber im Augenblick hatte ich nicht die Zeit dafür.
»Ben. J’vas parker mon châr. Chu-«
»Hippo?« Ich fiel ihm ins Wort.
Sergent-enquêteur Hippolyte Gallant gehörte zur L’unité »Cold Cases« du Service des enquêtes sur le crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. Mächtiger Titel. Schlichte Übersetzung. Provinzpolizei. Gewaltverbrechen. Abteilung für unerledigte Fälle, für alte oder kalte Fälle also.
Obwohl Hippo und ich seit Gründung der Einheit 2004 einige Fälle bearbeitet hatten, hatte ich seinen Akzent nie kapiert. Es war nicht joual, der Slang der Französisch sprechenden Arbeiterklasse Quebecs. Es war eindeutig nicht pariserisch, belgisch, nordafrikanisch oder schweizerisch. Woher es auch stammen mochte, Hippos Französisch war für mein amerikanisches Ohr ein Rätsel.
Zum Glück sprach Hippo beide Sprachen fließend.
»Sorry, Doc.« Er wechselte ins Englische. Obwohl mit starkem Akzent und slanggefärbt, war es doch verständlich. »Bin unten und stelle eben mein Auto ab. Hab da was, das ich Ihnen zeigen muss.«
»LaManche hat mir eben einen dringenden Fall zugewiesen. Bin unterwegs in die Leichenhalle.«
»Zehn Minuten?«
Schon jetzt zeigte meine Uhr 9:45.
»Kommen Sie rauf.« Resigniert. Hippo würde mich sowieso finden.
Zwanzig Minuten später tauchte er auf. Durch das Beobachtungsfenster sah ich, wie er sich den Gang entlangarbeitete und immer wieder stehen blieb, um die Pathologen zu begrüßen, die noch in ihren Büros waren. Mit einer Dunkin-Donuts-Tüte betrat er dann mein Labor.
Wie soll man Hippo beschreiben? Mit seinem Übergewicht, der Brille mit Plastikrahmen und seiner Retro-Stoppelfrisur sah er eher aus wie ein Programmierer als wie ein Polizist.
Hippo kam an meinen Schreibtisch und stellte die Tüte darauf. Ich schaute hinein. Doughnuts.
Zu sagen, dass Hippo sich nicht unbedingt für gesunde Ernährung interessierte, wäre so, als würde man sagen, dass die Amish sich nicht unbedingt für Corvettes begeistern. Einige seiner Kollegen nannten ihn Hochbelastungs-Hippo. Ironischerweise, denn sein Magen war in ständigem Aufruhr.
Hippo nahm sich einen Doughnut mit Ahornsirupglasur. Ich einen mit Schokolade.
»Hab mir gedacht, dass Sie vielleicht das Frühstück ausgelassen haben.«
»Mm.« Ich hatte einen Bagel mit Frischkäse und einem Riesenlöffel Himbeeren gegessen.
»Ist das Ihr dringender Fall?« Hippo deutete mit dem Kinn auf die Lamm- und Geflügelknochen von der Baustelle.
»Nein.« Ich ging nicht näher darauf ein. Es war inzwischen fast zehn. Und mein Mund war voller Schokolade und Hefeteig.
»Würd gern Ihre Meinung zu ’ner Sache hören.«
»Ich muss wirklich nach unten.«
Hippo zog einen Stuhl an meinen Schreibtisch. »In zehn Minuten bin ich wieder weg.« Er setzte sich und leckte Zucker von den Fingern. Ich gab ihm ein Papiertaschentuch. »Ist allerdings nichts, wofür Sie zuständig wären.«
Ich bedeutete ihm mit einer Geste, er solle endlich loslegen.
»Knochen. Hab sie selber noch gar nicht gesehen. Die Sache kommt von einem Kumpel bei der SQ. Er ist seit achtzehn Jahren bei der Provinzpolizei und wurde eben erst von Rimouski nach Gatineau versetzt. Wir haben ein paar Bier miteinander getrunken, als er in Montreal war.«
Ich nickte, dachte aber eigentlich an die Doughnuts. Ob da noch eins mit Ahornsirupglasur in der Tüte war?
»Ich und Gaston, so heißt er. Wir sind schon seit Ewigkeiten Kumpel. Sind in einer Kleinstadt in den Maritimes aufgewachsen.« Endlich eine Erklärung für Hippos Akzent. Chiac, eine französische Mundart ähnlich wie joual, die aber nur in einigen Provinzen an der Atlantikküste gesprochen wurde.
»Da ist dieses Skelett, das Gaston schon ein paar Jahre lang nervt. Er ist ein halber Micmac, wissen Sie. Ureinwohner?«
Ich nickte noch einmal.
»Ist ihm so ’ne Art Anliegen, dass die Toten anständig bestattet werden. Glaubt, dass die Seele im Arsch ist, wenn man nicht sechs Fuß unter der Erde liegt. Wie auch immer, ein SQ-Kollege in Gastons letzter Dienststelle hatte einen Schädel auf seinem Schreibtisch. Und den Rest des Skeletts in einem Karton.«
»Wie kam dieser Detective zu diesen Knochen?« Ich nahm die Tüte zur Hand und hielt sie ihm entgegen. Hippo schüttelte den Kopf. Ich schaute mäßig interessiert hinein. Ja! Eins mit Ahornsirupglasur. Ich stellte die Tüte wieder ab.
»Gaston weiß es nicht. Aber sein Gewissen plagt ihn, weil er nicht mehr getan hat, um den Knochen ein anständiges Begräbnis zu verschaffen.«
»Kein Grab, kein Leben nach dem Tod.«
»Bingo.«
»Und da komme ich ins Spiel.«
»Gaston hat mich gefragt, ob ich da so eine Knochenlady hier in Montreal kenne. Ich sag, soll das ein Witz sein? Doc Brennan und ich sind sympatique.« Hippo hob und verschränkte zwei nikotinfleckige Finger.
»Er ist sicher, dass die Knochen menschlich sind?«
Hippo nickte. »Ja, und er glaubt, dass es ein Kind ist.«
»Warum?«
»Sie sind klein.«
»Gaston sollte sich an den Coroner vor Ort wenden.« So beiläufig, wie es nur ging, griff ich in die Tüte und holte den mit Ahornsirupglasur heraus.
»Hat er. Der Kerl hat ihn abblitzen lassen.«
»Warum?«
»Die Knochen sind nicht gerade frisch.«
»Sind sie archäologisch?« Ahornsirup war nicht schlecht, aber Schokolade war besser.
»Soweit ich weiß, sind sie trocken, und in den Löchern, wo die Augen waren, sind Spinnweben.«
»Spinnweben können darauf hindeuten, dass die Knochen eine gewisse Zeit über der Erde lagen.«
»Bingo.« Hippo mochte das Wort. Benutzte es häufig. »Der Coroner meinte, das Zeug würde schon zu lange rumliegen.«
Ich hörte auf zu kauen. Das war nicht korrekt. Wenn die Knochen menschlich waren, dann waren sie formal unidentifizierte Überreste und fielen deshalb in die Zuständigkeit des Coroners. Es war Aufgabe eines forensischen Anthropologen, festzustellen, ob der Tod so kürzlich eingetreten war, dass der Fall noch von forensischem Interesse war.
»Wer ist dieser Coroner?« Ich griff nach Papier und Stift.
Hippo klopfte sich auf sein Jackett, das nicht unerwähnt bleiben sollte. Der Stoff hatte gelbe und orange Streifen, die horizontal und vertikal auf einem rostbraunen Hintergrund verliefen. Mit dem goldfarbenen Polyester-Einstecktuch wäre dieses Kleidungsstück haute couture im ländlichen Rumänien gewesen.
Hippo zog einen Spiralblock heraus und blätterte.
»Dr. Yves Bradette. Wollen Sie die Nummer?«
Ich nickte und notierte.
»Hören Sie, Gaston will niemandem auf die Füße treten.«
Ich hob den Kopf und schaute ihn direkt an.
»Okay, okay.« Hippo streckte mir die Handflächen entgegen. »Aber seien Sie diskret. Das Zeug liegt in der SQ-Zentrale in Rimouski.« Hippo schaute auf seine Notizen. »Das ist der Distrikt Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.« Typisch Hippo. Zu viele Informationen.
»Ich kann mich aber nicht gleich darum kümmern.«
»Schon gut. Pas d’urgence.« Keine Eile. »Wenn Sie mal Zeit haben.«
Wenn eine Leiche ihr Verfallsdatum überschreitet, kann sie das auf drei Arten tun: Verwesung, Mumifizierung oder Verseifung. Keine davon ist hübsch.
Eine warme, feuchte Umgebung mit Bakterien, Insekten und/oder Raubtieren auf der Suche nach ihrem Mittagessen sorgt für Verwesung. Zur Verwesung gehören Hautablösung, Verfärbung, Aufblähung, Ausstoß von Abdominalgasen, Einsinken des Bauchs,Verfaulen des Fleisches und schließlich der Zerfall des Knochengerüsts.
Eine warme, trockene Umgebung, ohne Beteiligung von Insekten oder anderen Tierchen, sorgt für Mumifizierung. Zur Mumifizierung gehören Zerstörung der inneren Organe durch Autolyse und Darmbakterienaktivität sowie Muskel- und Hautaustrocknung und -verhärtung durch Verdunstung.
Keiner ist sich wirklich sicher, aber Verseifung scheint eine kühle Umgebung und sauerstoffarmes Wasser zu erfordern, wobei das Wasser auch von der Leiche selbst kommen kann. Zur Verseifung gehören die Umwandlung von Fetten und Fettsäuren in Adipocire, eine käsige, stinkende Masse, die auch Leichenwachs genannt wird. Adipocire ist ursprünglich weiß und seifenartig, kann aber mit der Zeit hart werden. Hat sich das Zeug erst einmal gebildet, kann es sich sehr lange halten.
Aber die Zersetzung entscheidet sich nicht so einfach für Tür A, B oder C. Verwesung, Mumifizierung und Verseifung können getrennt voneinander und in jeder Kombination auftreten.
Geneviève Doucets Leiche hatte in einer einzigartigen Mikroumgebung gelegen. Die warme Luft vom Heizlüfter war von Decken und Kleidung konserviert worden und hatte so einen Minikonvektionsofen um die Leiche herum erzeugt. Voilà! Tür B.
Die Kopfbehaarung war noch vorhanden, Genevièves Gesicht hingegen nicht, zu sehen war nur noch vertrocknetes Gewebe in den Augenhöhlen und über den Gesichtsknochen. Glieder und Brust waren von einer dicken, harten Schale umhüllt.
Ich hob Geneviève sanft an den Schultern an und untersuchte ihren Rücken. Ledrige Muskel- und Sehnenstränge klebten an Rückgrat, Becken und Schulterblättern. Wo die Leiche auf der Matratze aufgelegen hatte, war Knochen zu sehen.
Ich schoss zur Sicherheit ein paar Polaroids und ging dann zu den Lichtkästen an der einen Wand. Genevièves Knochen leuchteten weiß vor dem Grau ihres restlichen Gewebes und dem Schwarz des Films. Ich schaute mir die einzelnen Aufnahmen eingehend an.
LaManche hatte recht. Keine offensichtlichen Hinweise auf Gewalteinwirkung. Keine Kugeln, Kugelsplitter, Hülsen oder sonst irgendwelche metallischen Spuren. Die Knochen zeigten keine Haarrisse, keine linearen, ausstrahlenden oder Kompressionsfrakturen. Keine ausgerenkten Gelenke. Keine fremden Objekte. Für eine komplette Untersuchung des Skeletts musste die Leiche entfleischt werden.
Ich kehrte zum Autopsietisch zurück und suchte, mich methodisch von Genevièves Kopf bis zu den Füßen vorarbeitend, nach Hinweisen auf Krankheiten, Verletzungen und Insektenaktivität. Auf irgendetwas, das den Todeszeitpunkt und/oder die Todesart genauer bestimmen könnte.
Wie schon bei den Röntgenaufnahmen, rein gar nichts.
Als Nächstes versuchte ich, Genevièves Bauch aufzuschneiden. Das dauerte eine Weile, da Haut und Muskeln so hart geworden waren. Schließlich stieß mein Skalpell durch. Während ich den Schnitt vergrößerte, drang Gestank heraus und füllte den Raum.
Mit einiger Mühe erzeugte ich so eine Öffnung von etwa zwanzig Zentimetern im Quadrat. Ich nahm eine kleine Taschenlampe zur Hand, hielt den Atem an, beugte mich über Genevièves Bauch und spähte hinein.
Die inneren Organe waren nur noch eine dunkle, zähe Masse. Ich konnte keine einzige Made, kein Ei und keine Puppenhülle entdecken.
Ich richtete mich auf, nahm die Schutzbrille ab und überlegte.
Beobachtungen:Austrocknung des äußeren Gewebes. Bloßlegung von Knochen. Zerstörung der Eingeweide. Keine Fliegen- oder Käferaktivität vorhanden.
Schlussfolgerung: Der Tod war im vergangenen Winter eingetreten. Lange genug her, um die Gewebezerstörung zu erklären, und zu einer Zeit, als es keine Insekten gab. Geneviève war Monate vor ihrer Mutter gestorben.
Willkommen in der Realität, ihr Fans der Forensikserien. Kein Todesdatum, keine Stunde und keine Minute des Todeseintritts. Der Zustand dieser Leiche erlaubte keine größere Präzision.
Ich hielt mich nicht lange damit auf, was das zu bedeuten hatte. Geneviève, die in ihrem Bett wie mit einem Föhn ausgetrocknet wird. Dorothée, die ihr einige Monate später nachfolgt. Und unterdessen Théodore, der unten an seinem PC U-Boote befehligt.
Nachdem ich Anweisungen bezüglich der Säuberung von Genevièves Überresten gegeben hatte, zog ich die Laborkluft aus, wusch mich und fuhr wieder in den zwölften Stock.
Der alte Mann saß wieder in seinem Büro. Er hörte mir mit einem Gesicht zu, das eine angespanntere Version dessen war, was er normalerweise zeigte. LaManche wusste, was die Zukunft für Théodore Doucet bereithielt. Und auch für Michelle Asselin.
Ein verlegenes Schweigen entstand, als ich geendet hatte. Ich sagte, es tue mir leid. Lahm, ich weiß. Aber beim Bedauern bin ich eine Niete. Man möchte meinen, dass ich mir in meinem Gewerbe einige derartige Fähigkeiten angeeignet habe. Man könnte sich täuschen.
LaManche stand auf und ließ beide Schultern hängen. Das Leben ist hart. Nicht zu ändern.
Dann war ich wieder in meinem Labor. Hippos Tüte stand noch immer auf meinem Schreibtisch, darin ein einsamer rosa Donut. Rosa? Irgendwas stimmte da nicht.
Ich schaute auf die Uhr. 13:46.
Der Zettel mit der Telefonnummer von Hippos Coroner fiel mir ins Auge. Ich nahm ihn und ging in mein Büro.
Die Papierberge waren nicht kleiner geworden. Abfalleimer und Pflanzen hatten sich nicht von alleine wieder an ihre Plätze gestellt. Die Spurensicherungsutensilien waren nicht, ordentlich zusammengelegt, in einem Schrank verschwunden.
Zum Teufel mit häuslicher Ordnung. Ich setzte mich hinter den Schreibtisch und wählte Yves Bradettes Nummer.
Sein Telefondienst meldete sich. Ich hinterließ meinen Namen und meine Nummer.
Ein Knurren aus der Magengegend sagte mir, dass die Doughnuts nicht gereicht hatten.
Schnelles Mittagessen. Geflügelsalat in der Cafeteria im ersten Stock.
Als ich zurückkehrte, blinkte das rote Licht an meinem Telefon. Yves Bradette hatte angerufen.
Wieder wählte ich Rimouski an. Diesmal meldete sich Bradette.
»Was kann ich für Sie tun, Dr. Brennan?« Nasal. Ein bisschen winselnd.
»Vielen Dank, dass Sie mich so schnell zurückgerufen haben.«
»Natürlich.«
Ich erzählte, ohne Namen zu nennen, Hippos Geschichte.
»Darf ich fragen, wie Sie davon erfahren haben?« Ein kühles und sehr formelles vous.
»Ein Polizeibeamter hat mich von der Situation in Kenntnis gesetzt.«
Bradette sagte nichts. Ich fragte mich, ob er versuchte, sich an Gastons Anfrage bezüglich der Knochen zu erinnern, oder ob er sich eine Ausrede für seine Untätigkeit zurechtlegte.
»Ich glaube, man sollte einmal einen Blick darauf werfen«, sagte ich.
»Ich habe diese Angelegenheit untersucht.« Noch unterkühlter.
»Sie haben das Skelett untersucht?«
»Flüchtig.«
»Das heißt?«
»Ich ging in die SQ-Zentrale. Ich kam zu dem Schluss, dass die Knochen alt sind. Vielleicht sogar sehr alt.«
»Das ist alles?«
»Meiner Ansicht nach sind die Überreste Knochen eines Mädchens in der Pubertät.«
Ruhig bleiben, Brennan.
Ein Coroner oder ein Pathologe bestellt sich ein Lehrbuch oder nimmt an einem kurzen Einführungskurs teil, und – Trara! – schon ist er oder sie forensischer Anthropologe. Warum sich nicht ein Exemplar von Herzchirurgische Praxis bestellen, ein Schild an die Tür hängen und Brustkörbe aufschneiden? Auch wenn es nicht oft vorkommt, dass eine unterqualifizierte Person mir in meinen Bereich hineinpfuscht, bin ich alles andere als erfreut, wenn es tatsächlich einmal passiert.
»Verstehe.« War Bradette unterkühlt, war ich arktisch.
»Auf Anfrage gab der Beamte zu, dass er die Knochen schon viele Jahre besaß. Außerdem gab er an, dass sie aus New Brunswick stammten. New Brunswick gehört nicht mehr zu meinem Zuständigkeitsbereich.«
Monate, vielleicht Jahre vergehen ohne einen einzigen Gedanken an Évangéline Landry. Dann blitzt unerwartet eine Synapse auf. Ich weiß nie, was der Auslöser sein mag. Ein vergessener Schnappschuss, der zusammengerollt ganz unten in einem Karton liegt. Wörter, die mit einer bestimmten Betonung ausgesprochen werden. Ein Lied. Eine Zeile aus einem Gedicht.
Hippos chiac-Akzent. New Brunswick. Das Skelett eines Mädchens, das schon viele Jahre tot ist.
Neuronen feuerten.
5
»Ich will, dass diese Knochen konfisziert und in mein Institut geschickt werden.« Meine Stimme hätte Marmor schneiden können.
»Meiner beruflichen Auffassung nach ist das Zeitverschw-«
»Bis morgen.« Granit.
»Pierre LaManche muss ein offizielles Anforderungsformular übermitteln.«
»Geben Sie mir Ihre Faxnummer, bitte.«
Das tat er.
Ich notierte sie mir.
»Sie haben die Unterlagen innerhalb einer Stunde.«
Nachdem ich das Formular ausgefüllt hatte, machte ich mich auf die Suche nach einer Unterschrift.
LaManche stand inzwischen, mit Gesichtsmaske und einer im Nacken und im Kreuz zusammengebundenen Plastikschürze, an einer seitlichen Arbeitsfläche im Pathologielabor.Vor ihm lag auf einem Korkbrett eine aufgeschnittene Bauchspeicheldrüse. Als er meine Schritte hörte, drehte er sich um.
Ich erzählte ihm von Gastons Skelett. Ich erwähnte weder Évangéline Landry noch ihr Verschwinden vor fast vier Jahrzehnten als mögliche Motivation, warum ich mir diese Knochen aus New Brunswick genauer anschauen wollte. Ich glaubte nicht ernsthaft, dass es da eine Verbindung geben könnte, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich sei es Évangéline schuldig, die Identität des Skeletts aus New Brunswick zu erforschen.
Und doch spürte ich eine gewisse Enge in der Brust.
»Noveau-Brunswick?«, fragte LaManche.
»Die Überreste sind gegenwärtig in Quebec.«