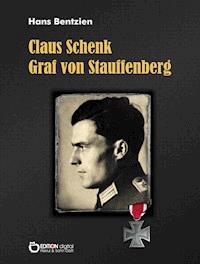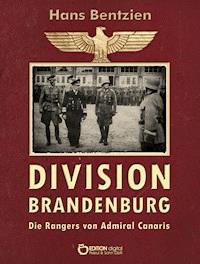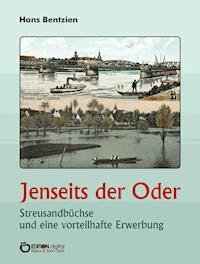5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die preußischen Könige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. wurden in der Gruft der Potsdamer Garnisonskirche beigesetzt. Vor den heranrückenden sowjetischen Truppen werden zum Ende des 2. Weltkrieges die beiden Sarkophage in einen Kalistollen ausgelagert und letztendlich zur Hohenzollernburg gebracht. Was schon in den letzten Jahren der DDR angedacht wurde, wurde 1991 ausgeführt: Beide Sarkophage gelangen nach Potsdam zurück. Das bisher nicht beachtete Testament Friedrichs II. spielt dabei ebenso eine Rolle. Das E-Book beschreibt die Irrwege der beiden Sarkophage und das Für und Wider der Rückführung. Es ist gleichzeitig ein kurzer Abriss der preußischen Geschichte unter beiden Herrschern und eine Bekenntnis dazu. LESEPROBE: Die Kritiker Preußens verwiesen auf den Widerspruch zwischen Ziel und Realität der Toleranzpolitik, den Juden sei sie kaum gewährt worden, die Pressefreiheit hätte nicht lange gedauert und wäre mit Rücksicht auf mögliche Informationen des Kriegsgegners wieder eingestellt worden, und auch die Folter sei zwar eingeschränkt, aber nicht völlig abgeschafft worden. Die Kriege hätten das Land zwar erheblich vergrößert, die Bevölkerung jedoch stark beeinträchtigt, Städte und Dörfer stark in Mitleidenschaft gezogen und durch den Siebenjährigen Krieg völlig verarmt. Beide Lager haben wohl immer zu einem Teil recht, denn sowohl das eine wie auch das andere machte die Wirklichkeit Preußens zu Lebzeiten der beiden Könige aus: Die von oben verordnete und erzwungene Staatsräson, das kaum vorhandene Bürgertum als politische Kraft, die daraus sich ergebende Dominanz des Adels mit seinen Privilegien und die ausschließliche Entscheidung aller wichtigen Angelegenheiten durch den Monarchen. Eine Diskussionsrunde von Historikern und Publizisten konnte sich darauf verständigen, die beiden preußischen Könige seien zwar Despoten gewesen, aber Friedrich habe sich von den anderen zeitgenössischen Herrschern Europas dadurch erfreulich abgehoben, dass er ein Mann der Aufklärung gewesen sei, eben ein „aufgeklärter Despot“. Klar wurde auch, dass alle Einseitigkeiten, zum Beispiel die Betonung der Kunstförderung auf der einen wie die Verdammung des Militärischen auf der anderen Seite, für eine historische Klärung unfruchtbar sind. Als diese ausgleichenden Töne durch die Medien gingen, waren die Handwerker auf der Hohenzollernburg bereits dabei, die Vorbereitungen für die Heimkehr zu treffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Hans Bentzien
Die Heimkehr der Preußenkönige
Gedenkausgabe 17. August 1991
ISBN 978-3-95655-465-0 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1991 im Verlag Volk & Welt Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Geleitwort
Die beiden Könige sind der Inbegriff Preußens, seiner Tugenden und Untugenden, seiner Tradition und Geschichte. Friedrich Wilhelm I. - Muster an Sparsamkeit und Zähheit - schuf die Grundlagen, auf denen das Preußen Friedrichs II. erblühen konnte.
Bei der Beschäftigung mit Preußen und den Persönlichkeiten, die dieses Land prägten, stößt man auf Widersprüche, die es uns schwer machen, eine klare Position zu beziehen. Da ist der aufgeklärte Staat, offen für Verfolgte aus ganz Europa, der für die Gleichheit der Menschen eintritt und als höchstes Regierungsziel „des Landes Vorteil“ ansieht. Da ist aber auch das machthungrige, kämpferische Preußen, das die Schlesischen Kriege führt, die Unsummen verschlingen, während das Volk hungert.
Wenn die Landesregierung der Bitte des Hauses Hohenzollern entsprochen hat, die Sarkophage der beiden Preußenkönige in Sanssouci beizusetzen, dann soll dies ein Zeichen für den würdigen und kritischen Umgang mit der Geschichte unseres Landes sein. Es geht nicht darum, zu verdammen oder zu vergötzen. Sondern es geht darum, sich die Erfahrungen Preußens und dessen, was sich später aus Preußen entwickelt hat, vor Augen zu führen und zu fragen: Was bedeuten sie heute? Für mich steht Preußen für Toleranz, Aufbauwillen, Gemeinschaftssinn und eine leistungsfähige Verwaltung.
Die Irrfahrt der Sarkophage ist ein Symbol für die deutschen Irrwege. Ich bin der festen Überzeugung: Auf dem Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, dem Weg des gemeinsamen demokratischen Deutschlands, können die beiden Könige ihre endgültige Ruhe finden.
Seien sie in ihrer Heimat willkommen.
Potsdam, am 17. August 1991
Manfred Stolpe
Ministerpräsident des Landes Brandenburg
Mein Gruß
gilt den Potsdamern und ihren Gästen am heutigen Tage. Am Höhepunkt meines Lebens ist es mir vergönnt, meine beiden großen Vorfahren nach langer Irrfahrt, ausgelöst durch Kriegs- und Nachkriegsfolgen, in meine Vaterstadt zu begleiten. Als ich 1987, zum ersten Mal seit dem 2. Weltkrieg, in unsere Stadt kommen durfte, weigerte ich mich noch innerlich, mein Elternhaus, den Cecilienhof, zu betreten. Heute ist die Mauer, die gleich daneben Ost und West teilte, verschwunden, und mit dem heutigen Tag ist meine Hoffnung stärker geworden, dass sie auch aus unseren Köpfen und Herzen verschwinden möge. Die Fahrt der Sarkophage von der Hohenzollernburg bei Hechingen in die Lieblingsstadt der Hohenzollern, nach Potsdam, ist das äußere Sinnbild dafür. Ich danke allen, die dabei geholfen haben.
Potsdam, am 17. August 1991, dem 205. Todestag Friedrichs II.
Louis Ferdinand Prinz von Preußen
Irrfahrt
Bevor die Grabesruhe der beiden großen Preußenkönige brutal gestört wurde, standen ihre Sarkophage, das wusste jeder Deutsche seit seiner Schulzeit, in der Potsdamer Garnisonkirche. Ihr Glockenturm, von dem aus das allen wohlvertraute „Üb' immer Treu und Redlichkeit ...“ ertönte, gehörte zu den bekanntesten und bestimmenden Bauwerken der einst so schönen Stadt an der Havel. Was Peterhof für Leningrad, Moritzburg für Dresden, Versailles für Paris, das war Potsdam für Berlin.
Als der Soldatenkönig im Jahre 1713 das Zepter in Brandenburg-Preußen übernahm, erklärte er Potsdam zur Garnisonstadt und verlegte sein Leibbataillon aus Brandenburg in die Häuser der Potsdamer Bürger, auf jeden zweiten Potsdamer kam ein Soldat. Morgens traten die Langen Kerls im Lustgarten zum Exerzieren an. Ihre Zahl wurde immer größer, die Garnisonstadt ebenfalls.
Die Soldaten versammelten sich anfänglich zum Gottesdienst in der Schlosskirche, doch dann wurde ihnen eine eigene Kirche gebaut (1720/21). Der anspruchslose Fachwerkbau hielt den Bewegungen des unsicheren Unterbaus nicht stand und senkte sich, die Mauern zeigten bald Risse, so dass auf sicherem Fundament neu gebaut werden musste. 1732 wurde die Kirche eingeweiht. Ihre 3000 Plätze waren besetzt, um das Gebäude standen Schützen und feuerten beim Choral „Herr Gott, Dich loben wir“ Salut.
In der unter der Kanzel eingerichteten Gruft wollte Friedrich Wilhelm I. neben seiner Gattin Sophie Dorothea beigesetzt werden. Sein Sarkophag, aus gotländischem Marmor von holländischen Bildhauern gestaltet, blieb allein. Die Königin überlebte ihren Gatten um 17 Jahre und wurde 1757 im Berliner Dom beigesetzt. Beim feierlichen Leichenbegängnis seines Vaters, das der einfachen Beisetzung etwas später, am 22. Juni 1740, folgte, besuchte Friedrich II., wahrlich kein Kirchgänger, die Garnisonkirche zum letztenmal.
Von Anfang an hatte er sich, im Einklang mit Gedanken der Naturphilosophie und des Naturrechts, eine völlig andere und damals neue Art der Bestattung ausbedungen. Der aufgeklärte Mensch betrachtete sich im 18. Jahrhundert als Schöpfung der Natur, als einen Teil von ihr, der aus den gleichen Elementen zusammengesetzt war wie alle andere Materie auch. Aus diesen Elementen war man entstanden, mit ihnen wollte man sich wieder verschmelzen, anstatt in engen, kalten Kirchengrüften auf den Tag der Auferstehung zu warten. So begann im aufgeklärten Adel bereits Ende des 17. Jahrhunderts eine Bewegung der Außenseiter, der Markgraf von Kleve machte den Anfang, er ließ sich unter einem Baum auf seinem Grund und Boden bestatten.
Nur drei Jahre nach seinem Regierungsantritt entdeckte Friedrich II. bei einem Picknick auf dem „wüsten Berg“ nicht weit vor der Stadt die wunderbare Lage des Platzes mit seinem weiten Blick über die Stadt bis hin zur Havel und entschied, dass hier sein Grab und sein Schloss gebaut werden sollten. Dazu war der Berg zu terrassieren, wie es in der Anweisung Friedrichs an Baudirektor Diterichs hieß, denn der Sandberg sollte in einen Weinberg verwandelt werden und hoch über allem ein Lustschloss stehen, in dem Friedrich sans souci (ohne Sorgen) leben wollte. Das Grab wurde zuerst gebaut, das Bild von Frisch ist erst später entstanden und deutet das Schloss nur an. Der Maler war sich wohl nicht genau über die Reihenfolge im Klaren, oder er wollte den zeitlichen Ablauf auf seine Weise darstellen.
Friedrich II. war erst 32 Jahre alt, als er seine Gruft bauen ließ, doch im 1. Schlesischen Krieg hatte er bereits die Kugeln pfeifen gehört und war nur knapp der Gefangenschaft und dem Tod auf dem Schlachtfeld entkommen; auch für einen jungen Mann ausreichend Anlass, die Endlichkeit des Daseins zu begreifen. Außerdem war er der europäischen Aufklärung, etwa den Ideen seiner Vertrauten Wolff aus Halle und Voltaire aus Frankreich, so sehr verpflichtet, dass er als freidenkerischer Geist nicht nach dem kirchlichen Zeremoniell begraben werden wollte. So legte er den Ritus seiner Bestattung von vornherein fest und wiederholte ihn im Verlaufe seines Lebens mehrmals gleichlautend. Man solle ihn ohne Aufwand und Pomp, um Mitternacht beim Schein nur einer Laterne in der Gruft durch Handwerker beisetzen lassen. Ein Gefolge verbat er sich. Bei diesen Bestimmungen werden wir an die Beisetzungen von Mozart(?) oder Schiller erinnert.
In seiner testamentarischen Verfügung vom 8. Januar 1769 drückt er seinen Willen ganz klar aus:
Übersetzung:
Unser Leben ist eine schnelle Reise vom Augenblick unsrer Geburt bis zu dem unsres Todes. Während dieses kurzen Zeitraums ist der Mensch bestimmt, für das Wohl der Gesellschaft, deren Mitglied er ist, zu arbeiten. Seitdem ich zur Leitung der Geschäfte gelangte, habe ich mich mit allen Kräften, welche die Natur mir gegeben hatte, und nach meinen schwachen Fähigkeiten bemüht, diesen Staat, den ich zu regieren die Ehre gehabt habe, glücklich und blühend zu machen; ich habe die Gesetze und die Gerechtigkeit herrschen lassen, ich habe Ordnung und Klarheit in die Finanzen gebracht, und ich habe das Heer in solcher Zucht erhalten, die es den andern Truppen Europas überlegen gemacht hat. Nach Erfüllung dieser Pflichten gegen den Staat müsste ich mir einen ewigen Vorwurf machen, wenn ich dasjenige, was meine Familie betrifft, vernachlässigte. Um den Zerwürfnissen vorzubeugen, die sich zwischen meinen Verwandten in Betreff meiner Erbschaft erheben könnten, erkläre ich deshalb durch diesen feierlichen Akt meinen Letzten Willen:
1, Ich gebe willig und ohne Bedauern diesen Lebenshauch, der mich beseelt, der wohltätigen Natur zurück, die ihn mir verliehen hat, und meinen Leib den Elementen, aus denen er zusammengesetzt ist. Ich habe als Philosoph gelebt, und ich will als solcher beerdigt werden, ohne Gepränge, ohne Prunk, ohne Pomp; ich will weder seziert noch einbalsamiert werden; man soll mich in Sanssouci oben auf den Terrassen in einem Grabe, welches ich mir habe bereiten lassen, beerdigen. Prinz Moritz von Nassau ist ebenso in einem Gehölz nahe bei Kleve begraben worden. Wenn ich zur Zeit eines Krieges oder auf einer Reise sterbe, so soll man meinen Leib im nächsten Orte beisetzen und ihn im Winter nach Sanssouci an den Ort bringen, den ich oben bezeichnet habe.
32, Ich empfehle meinem Nachfolger, sein Blut zu achten in der Person seiner Oheime, seiner Tanten und aller Verwandten. Der Zufall, welcher das Geschick der Menschen bestimmt, regelt die Erstgeburt: deshalb ist man aber als König nicht mehr wert als die andren. Ich empfehle allen meinen Verwandten, in guter Eintracht zu leben und zu wissen, wann sie ihre persönlichen Interessen dem Wohl des Vaterlandes und dem Vorteil des Staates zu opfern haben.
Meine letzten Wünsche im Augenblick des Todes werden dem Glück dieses Reiches gelten. Möge es immer mit Gerechtigkeit, Weisheit und Kraft regiert werden, möge es der glücklichste der Staaten sein durch die Milde der Gesetze, der am gerechtesten verwaltete in Hinsicht der Finanzen und der am tapfersten verteidigte durch einen Kriegerstand, der nur Ehre und schönen Ruhm atmet, und möge es blühen und dauern bis zum Ende der Jahrhunderte!
33, Ich ernenne zu meinem Testamentsvollstrecker den regierenden Herzog Karl von Braunschweig, von dessen Freundschaft, Geradheit und Redlichkeit ich mir verspreche, dass er die Vollstreckung meines Letzten Willens auf sich nehmen wird.
Gegeben zu Berlin am 8. Januar 1769.
Friedrich.
Es war auch keine besondere Merkwürdigkeit, dass Friedrich zusammen mit seinen liebsten Geschöpfen aus der Tierwelt, den Windspielen, begraben werden wollte. Ja, als zwischen 1830 und 1840 der Eingang zur Gruft wegen der verfaulten Stützbalken über der Treppe einstürzte, entdeckte der Wachsoldat einen hölzernen Kasten mit einem Hundegerippe in der Gruft, wahrscheinlich von Friedrichs Lieblingshund Biche. Die anderen Tiere hatten im Halbrondell ihren Platz gefunden. Über dem Kreuzgewölbe der Gruft steht eine allegorische Figur, die Göttin der Pflanzen und Blumen, Flora. 1860 öffnete sich die Gruft noch einmal aus dem gleichen Grunde, die Deckenbretter über dem Eingang waren durchgefault. Seitdem ist die Gruft nicht angetastet worden. Über dem Gewölbe lag eine etwa dreißig Zentimeter dicke Rasenschicht. Das Grab geriet in Vergessenheit; dass es leer blieb, hängt mit einer Entscheidung des Nachfolgers zusammen.
Friedrich Wilhelm II., ein Neffe des Königs - er selbst war kinderlos geblieben -, entschied am Todestag nach einer Besichtigung der Gruft, dass der Alte Fritz an der Seite seines Vaters in der Garnisonkirche beigesetzt werden solle. Die Gründe dafür waren vor allem protokollarischer Art. Es ging nicht nur um den Begräbnisort, sondern auch um die Art des Begräbnisses.
„Ohne Prunk, ohne Pracht, ohne Pomp?“ - das ging über das Verständnis des der aufklärerischen Philosophie durchaus nicht verbundenen neuen Königs, und so begann er seine Regierung mit der Verweigerung eines Königsbefehls. Als Begründung diente die christliche Moral, das Begräbnis musste den überkommenen Ritualen entsprechen, schließlich war Friedrich auch der oberste Herr der Landeskirche gewesen, obwohl er persönlich nicht dem Glauben anhing.
So wurde er am Todestag gegen 21 Uhr in das Stadtschloss überführt und am nächsten Tag in prächtiger Uniform im Audienzsaal ausgestellt. Am Abend des 18. August erfolgte die Überführung des einfachen Sarges in die Garnisonkirche, Hofstaat und Offizierskorps folgten beim hellen Schein von 800 Wachskerzen. Zwölf Hauptleute trugen den Sarg in die Gruft und setzten ihn an der linken Seite des Vaters bei. Der Eichensarg wurde einige Tage danach in den Sarkophag aus englischem Zinn gesetzt, in dieser Form kennen ihn alle von Abbildungen bis heute.
Am 9. September dann fand das eigentliche Leichenbegängnis mit einem Paradesarg statt; aus der aufwendig geschmückten Garnisonkirche hatte man die einfachen lehnenlosen Holzbänke entfernt. Der Trauerzug von vielen hundert Menschen ging auf einer holzgedeckten Straße vom Stadtschloss in die Garnisonkirche, an den Seiten nahmen Tribünen die Gaffer auf. Die Garde entfaltete alles militärische Paradezeremoniell, trommelte und blies, und ihre Generäle trugen den schwarzen Baldachin über dem Sarg. Die Musik wurde vom Hoforganisten Fasch und Hofkapellmeister Reichardt dargeboten. Geistliche waren anwesend, spielten aber keine Rolle. Sie durften keine Reden halten. Es erklang nur eine Trauerkantate. Nach einem gewaltigen Salut ging die sechshundertköpfige Trauergemeinde zum Festessen. Der Pomp, die Pracht hatten den Staat fast 40 000 Taler gekostet, eine gewaltige Summe.
Von nun an gehörte die Garnisonkirche, die auch als Hofkirche diente, zu den Traditionsstätten des brandenburgisch-preußischen Staates. Hervorgehobene Staatsgäste besuchten die Gruft, so der Zar von Russland und der französische Kaiser Napoleon. Bei der Besichtigung des Stadtschlosses sah er interessante Stücke aus dem Nachlass Friedrichs II. durch, Manuskripte und Noten, und angesichts des kleinen Degens meinte er zu den begleitenden Marschällen: „Wenn dieser, der den Degen getragen hat, noch lebte, stünden wir heute nicht hier.“ Als er am nächsten Tag am Grabe stand, sagte er nach zehnminütigem Schweigen: „Sic transit gloria mundi!“ (So vergeht der Ruhm der Welt.)