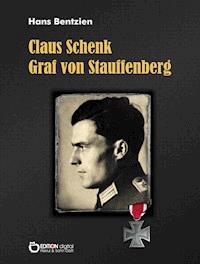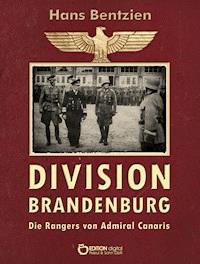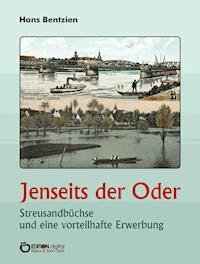Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Neue Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
60 Jahre nach den Ereignissen scheint alles zum Thema gesagt. Reflexhaft wird wiederholt: Ein Volksaufstand, letztes Aufbegehren der Arbeiter gegen die sowjetische Besatzungsmacht. Doch was geschah wirklich? Hans Bentzien berichtet als Zeitzeuge und Historiker und liefert eine andere, eine besonnene und fundierte Analyse der Ereignisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Impressum
ISBN eBook 978-3-360-51011-2
ISBN Print 978-3-360-01843-4
überarbeitete und ergänzte Auflage
© 2013 (2003) edition ost im Verlag Das Neue Berlin, Berlin
Umschlaggestaltung: Peperoni Werbeagentur, Berlin
Foto: Archiv edition ost
Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH
Neue Grünstraße 18, 10179 Berlin
Die Bücher der edition ost und des Verlags Das Neue Berlin
erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.edition-ost.de
Hans Bentzien
Was geschah am 17. Juni?
Vorgeschichte, Verlauf, Hintergründe
Die Vorgeschichte
Man kann zu bestimmten Jahrestagen darauf warten, dass die Wellen der gewünschten Erinnerungen mit aller Wucht an die Ufer des politischen Tagesgeschehens rollen werden und die Meinungsbildner in der konzertierten Aktion mitspielen: die Presse, Rundfunkstationen, Buchverlage und natürlich auch die gelehrten Gesellschaften. Das wird auch 60 Jahre nach den »Ereignissen vom 17. Juni« der Fall sein. Wir werden wieder die tausendmal gedruckten Bilder sehen, wie sich der spontane Volkszorn Bahn bricht und einige Jugendliche von Westberlin aus Steine auf sowjetische T34 werfen. Dann kommen die Kommentare, in denen mit allen Ettikettierungen – von Streik über Volksaufstand bis Revolution – den Unruhen vom 17. Juni 1953 auf den Leib gerückt werden soll.
Doch inzwischen sind die Floskeln erstarrt, niemand glaubt mehr an einen faschistischen Putschversuch oder an einen Volksaufstand. Sie werden wie Kampfbegriffe benutzt, immer wieder, obwohl dieser Tag bereits am 4. August 1953 zu einem nationalen Feiertag erklärt wurde, selbstverständlich nur im Westen, der Osten wurde vom Gedenken möglichst ferngehalten. Während sich die Festredner alle Mühe geben, über die Geschehnisse originell zu sprechen, um Betroffenheit zu erzeugen, fragen sich diejenigen, die aus Altersgründen noch gar keine Erinnerung haben können, was damals wirklich in der DDR vor sich gegangen ist an diesem Tag X.
Während der Veranstaltungen zum 50. Jahrestag der Unruhen standen die Jugendlichen meistens abseits. In einer Veranstaltung für die oberen Gymnasialklassen in der vorpommerschen Stadt Pasewalk konnte man beobachten, dass eine zweistündige Lektion über die Ursachen, welche zum Aufruhr führten, bei den meisten Schülern auf völlig unbestellten Boden fiel. Mit einigen Ausnahmen hörten sie gespannt zu, während die Geschichtslehrer vor dem Beginn Befürchtungen über mangelnde Konzentration äußerten. Der problematische Punkt war das Verständnis für die unterschiedliche Politik in zwei deutschen Staaten. Gymnasiasten, im 13. Jahr der deutschen Einheit, haben daran keinerlei Erinnerungen, und die Erzählungen der Eltern und Großeltern fallen dabei höchst widersprüchlich aus, je nach Anteilnahme und Kenntnissen, wobei in Rechnung gestellt werden muss, dass ihre Eltern zum Zeitpunkt noch gar nicht geboren waren. Auch sie können, wenn überhaupt, ihre Kenntnisse nur von ihren Eltern haben.
Auf diese Generationsumstände wurde bei den Gedenkfeiern keinerlei Rücksicht genommen. Ältere Damen und Herren variierten noch einmal die altbekannten Thesen aus den Reden zum 1953 eingeführten »Tag der deutschen Einheit«, der mit der vollzogenen Einheit sofort abgeschafft wurde. Eine besondere Konjunktur bekamen jene Zeitzeugen, die zu den Vorgängen ausführliche Beschreibungen gaben und dabei nicht selten in Beklemmungen kamen, stellte sich doch heraus, dass es meistens um sekundäre Beobachtungen oder um Hörensagen ging. Während der damals 10-jährige Rainer Eppelmann, Vorsitzender der Stiftung zur Aufarbeitung der DDR, in einer Pankower Straße die sowjetischen Panzer einrücken sieht und bestimmt aussagt, dass sie geschossen hätten, erinnert sich die damals 5-jährige Marianne Birthler »mit sehr deutlichen Eindrücken« an die lebhaften Diskussionen in ihrer Familie. Die »Berliner Zeitung« bringt unter starker Kritik ihrer Leserschaft eine ganze diesem Tag gewidmete Nummer mit Zeitzeugenberichten, unter denen der einer Frau Klara Kolpin, damals 21 Jahre alt, besonders hervorsticht. Sie beklagt, dass sie tagelang mit ihren beiden Kindern nur Butterkremtorte essen musste, weil sie wegen der russischen Panzer nicht zum Bäcker durfte. Die Torte hatte sie zum 7. Geburtstag ihres Sohnes gebacken und wollte sie bei der Feier mit ihm und ihrer 10jährigen Tochter genießen. Sind denn alle Redakteure, die etwas rechnen können, entlassen worden?
Auf der Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung meldete sich ein Mann zu Wort, der in Frankreich lebt, und outete sich als der Junge, welcher auf dem wohl bekanntesten Bild vom Potsdamer Platz Steine auf den sowjetischen Panzer wirft. Bei diesen Worten gibt er auch bekannt, dass er auf einen Panzer gesprungen ist und Steine in die offenen Luken geworfen hat. Als er von dort verscheucht wurde, ging er zum Columbushaus und steckte es in Brand. Dieser Junge hatte Europa an den Rand eines Krieges gebracht, und statt dass ihm das jemand erklärt, wird er als Opfer gefeiert und zum Helden gemacht – jedenfalls fühlte er sich so.
Berichte dieser Art las man bis zum Überdruss in fast allen Zeitungen, sogar das »Neue Deutschland« brachte eine Sonderbeilage, in der es versichert, dass es sich auch der Meinung anschließt, es habe sich um einen spontanen Arbeiteraufstand gehandelt.
Die Zeitungen und Fernsehsender stützen sich in ihren oftmals langen Beiträgen auf die These, dass es sich um einen Aufstand gehandelt habe, der sich quasi über Nacht explosionsartig ausgebreitet hatte. Wie es dazu gekommen ist, wird weiter unten noch behandelt werden. Aber das spontane Element, das zweifellos eine bedeutende Rolle gespielt hat, wird weit überschätzt. Man merkt die Absicht und ist verstimmt, denn mit der Überbetonung der Spontaneität soll von anderen, meist äußeren Einflüssen auf das Land im Herzen Europas abgelenkt werden. Diese Methode gehört zum hartnäckigen Versuch, die Deutungshoheit über die Geschichte auch für die Zeit der Spaltung zu erringen, und was käme da gelegener als eine Empörung der Arbeiter gegen ihre Arbeiter-und-Bauern-Regierung.
Es kommt also gar nicht auf eine noch detailliertere Beschreibung der Vorgänge an, darüber gibt es genügend Material, sondern auf die Beantwortung der Frage, welche unterschiedlichen Strömungen in diesen Tag X mündeten. Wie ein politischer Seismograph hat der vorausahnende Dichter Bertolt Brecht den historischen Ausgangspunkt nach der Gründung der beiden deutschen Staaten beschrieben:
Zwei Gesellschaftsordnungen
Wenn sich durch besondere Umstände in einem Teil eines Landes eine neue Gesellschaftsordnung bildet, während der andere in der alten verharrt, muss eine scharfe Feindschaft dieser beiden Teile des Landes erwartet werden. Beide werden sich bedroht fühlen, und sie werden sich einander barbarisch nennen.
Im Osten Deutschlands hat sich nach einem schrecklichen Krieg ein Arbeiter- und Bauernstaat gebildet, der Politik und Wirtschaft nach völlig neuen Grundsätzen behandelt. Eigentums- und Produktionsverhältnisse sind gründlich geändert worden und die öffentlichen Geschäfte sowie die Meinungsbildung der Bevölkerung folgen bisher unerhörten Methoden. Wie man weiß, hat das Unerhörte keinen guten Klang, was noch nie gehört wurde, gilt als ungehörig. So bedürfen die neuen Grundsätze und Methoden der Erläuterung, während die alten für selbstverständlich gehalten werden.
Der Westen Deutschlands ist unter der Herrschaft der großen bürgerlichen Eigentümer und damit der bürgerlichen Ideen geblieben. Es gibt Arbeitsgeber und Arbeitsnehmer, und die einen können völlig frei Arbeit geben oder nicht geben, die anderen Arbeit nehmen oder nicht nehmen. Allerdings verhungern die Arbeitsgeber nicht, wenn sie Arbeit nicht geben, während die Arbeitsnehmer verhungern, wenn sie nicht Arbeit nehmen.
(1951, Brecht, Werke, Frankfurt/Main, Bd. 20, S. 317)
Der Dichter führt die fundamentalen Unterschiede zwischen Ost und West auf die gründliche Änderung der Eigentumsverhältnisse zurück.
Um die Weiterführung dieses Prozesses im Osten oder um die Restauration der alten Verhältnisse ging es acht Jahre nach dem Kriegsende. Wenn man die unerhörten Verwandlungen von Konzernbetrieben in volkseigene Betriebe noch aufhalten wollte, dann musste man es bald machen, solange der Staat noch nicht gefestigt war, seine Fehler ausnutzen, seine unsichere internationale Stellung zwischen den beiden Blöcken mit feinen diplomatischen Ränken weiter in der Schwebe lassen oder ignorieren, was da mit wachsendem Selbstbewusstsein sich zu Worte meldete.
Liest man die kargen Unterlagen und Berichte über die Vorbereitungen der deutschen Emigranten in Moskau auf die ersten Schritte zum Aufbau des zerstörten Heimatlandes, die im Jahre 1944 begannen, so fällt auf, dass kein genaues Bild der Lage vorhanden war, nicht vorhanden sein konnte. Neben den drei ersten Gruppen – Ulbricht für Berlin und Brandenburg, Ackermann für Sachsen und Sobottka für Mecklenburg – beschäftigten sich auch spezielle Arbeitsgruppen mit dem Aufbau der Verwaltungen und deren Zielstellungen, so für Wirtschaft, Landwirtschaft, Volksbildung und Kultur.
Die Großbourgeoisie im Lande aber bereitete sich seit eben diesem Zeitpunkt mit genauen Kenntnissen über die innerdeutsche Situation, etwaige Reserven und das vorhandene Führungspersonal mit gründlichen Untersuchungen vor, mit denen vor allem der spätere Vater der sozialen Marktwirtschaft, des Wirtschaftswunders und Nachfolger des ersten Bundeskanzlers Adenauer, Ludwig Erhard, an der Wirtschaftshochschule in Nürnberg beschäftigt war. Diese Arbeiten kreisten um die Frage, wie der Wirtschaftsaufbau erfolgen müsse, ohne die Besitzverhältnisse grundsätzlich zu ändern. Dass die Industrie belastet war und mit dem großen Landadel zusammen Hitler benutzt hatte und mit ihm reich geworden war, stand außer Frage. Dieser Zusammenhang ist später versteckt und in die allgemeine Verantwortung der Deutschen für Auschwitz umgeformt worden. Die Einzeluntersuchungen über die IG Farben kamen erst von einer neuen Generation von Historikern, nachdem die Wehrwirtschaftsführer abgetreten waren. Und die schamlose Ausbeutung bis zum Tod der Arbeitssklaven aus dem Osten hält die Verantwortlichen auch heute noch nicht ab, um ein paar Taler mit dem Staat zu feilschen. Sie haben gute Juristen, welche die Auszahlung einer »Entschädigung« abzulehnen oder hinauszuzögern verstehen.
Gewiss, Forderungen nach Verstaatlichung der Grundstoffindustrien und Banken regten sich auch in den Westzonen und drangen sogar in die Programme bürgerlicher Parteien ein, aber mit dem zunehmenden »Wirtschaftswunder« verschwanden sie leise wieder aus der aktuellen Zielstellung. Mit dem formalen Verfahren der Entnazifizierung war die Kampagne gegen die Clique um Hitler erledigt, und man ging zur Tagesordnung über. Nur wenige Schuldige schieden aus dem öffentlichen Leben aus und verschwanden meistens bei ihren Freunden in den Unternehmen, wo sie angeblich als Fachkräfte unentbehrlich waren. Sie sorgten dafür, dass der Antifaschismus als Grundlage für einen Neuanfang schnell aus der Diskussion kam. Wo würde das hinführen?
Die maßgebenden Wirtschaftsführer und Politiker der Bourgeoisie, ob belastet oder nicht, waren längst in den Westzonen, als im Osten, Sachsen voran, die ersten Betriebe der Kriegsverbrecher und -gewinnler enteignet wurden. Wer vom technischen Personal noch da war, wurde mit der Betriebsführung beauftragt, aber hatte mit den klassenbewussten Arbeitern aus den Parteien und Gewerkschaften eine misstrauische Kontrolle an seiner Seite. Wo niemand mehr da war, der zur alten Betriebsführung gehörte und sich loyal verhielt, wurde versucht, mit gutwilligen, aber meistens überforderten Arbeiterfunktionären die Lücken zu schließen.
Zur Führung eines Staates gehören sachkundige Funktionäre, vor allem, wenn er den Anspruch erhebt, die großen Betriebe selbst zu leiten. Die bürgerlichen Parteien, bald nach den beiden Arbeiterparteien zugelassen, verfügten meistens über Mitglieder aus dem alten Bildungsbürgertum, Lehrer, Anwälte, Kleinindustrielle und Händler. Sie arbeiteten in den Volksvertretungen mit, aber nur wenige standen an den Brennpunkten des Wirtschaftsaufbaus. Außerdem hatten sie tiefsitzende Vorbehalte gegen eine führende Rolle der Arbeiterschaft, der sie sachgerechte Entscheidungen gar nicht zutrauten.
Die Bauernschaft war wie neu entstanden, da viele bisherige Landarbeiter von den ostelbischen Gütern durch die Bodenreform ein Stück Land bekommen hatten, das sie mehr schlecht als recht bewirtschaften konnten. Unter ihnen waren viele Umsiedler, die erst in der neuen Umgebung heimisch werden mussten. Dennoch befanden sich hier die natürlichen Verbündeten, und zu Anfang erhielt die antifaschistische Politik von ihnen die meiste Unterstützung. Dennoch hemmten viele objektive Umstände eine schnelle Entwicklung. Die Ackerflächen waren zu klein, um eine größere Anzahl von Tieren, besonders Großvieh, zu halten, das Ablieferungssoll war hoch und wurde mit Nachdruck verlangt, Ställe und Wohngebäude mussten mühsam, unter Materialmangel und mit wenig technischem Gerät erbaut werden, Maschinen fehlten zu Anfang völlig, wurden aber dann konzentriert importiert und nach und nach selbst gebaut. Ihr Einsatz erfolgte über Ausleihstationen, die zugleich auch politische Zentren waren.
Der größte Verbündete der Antifaschisten war die Jugend. Der Krieg, aus dem die jungen Männer nach und nach zurückkamen, hatte auch die jungen Mädchen und Frauen nicht verschont, sie waren oftmals zwangsverpflichtet worden und berufsfremd eingesetzt. Nunmehr erhielten sie die gleichen politischen Grundrechte wie die Erwachsenen, praktisch unbegrenzte Bildungschancen und gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Wer sich ein neues Leben aufbauen wollte, erhielt Vertrauen und Unterstützung, auch wenn er in der Hitlerzeit erzogen worden und der Hitler-Ideologie verfallen gewesen war. Überall fehlte es an Arbeitskräften, überall an Kursen für Umschulungen in Berufe, die jetzt gebraucht wurden. Das betraf besonders die Frauen, unter denen viele allein standen, die ohne den Mann, der gefallen war oder noch in der Gefangenschaft wartete, für die vaterlose Familie sorgen mussten. In dem Lehrerkollegium, in dem ich nach dem Krieg unterrichtete, gab es außer dem Rektor und einem schwerkriegsbeschädigten Kollegen nur noch mich aus der männlichen Abteilung, alle anderen Lehrkräfte waren Frauen, darunter mehrere Offizierswitwen, mit Abitur und einem Neulehrerkurs.
Die Grundhaltung für den Unterricht war antifaschistische Gesinnung, die sehr wohl angenommen wurde, da der Krieg mit seinen Ungeheuerlichkeiten tief in den Seelen saß. Es wurde verstanden, dass die aktive oder passive Unterstützung des Faschismus die Schuld der meisten Deutschen war, von der sie sich reinigen mussten. Geschah das oberflächlich, opportunistisch, hängte man den Mantel wieder einmal nach dem Wind, konnte man den Eindruck haben, dass der Antifaschismus verordnet worden war. In der Wirklichkeit aber war die Sache weit komplizierter. Die aus den Zuchthäusern oder der Emigration zurückgekehrten Hitlergegner standen an den Schaltstellen der Kommunen, Länder und der Republik, und je nach Erlebnissen und Erfahrungen, nach Können und Charakter formten sie die Umwelt neu. Mancher von ihnen war misstrauisch und sah überall verkappte Nazis, und so mancher ehrliche, aufbauwillige Mensch wurde von ihnen vor den Kopf gestoßen. Erst langsam verbesserte sich das Klima des Umgangs miteinander, der Nebel in den Hirnen lichtete sich und der zweifelnde Bürger fand seinen festen Platz in der antifaschistisch-demokratischen Gesellschaft, zu der man ein uneingeschränktes Bekenntnis forderte.
Die politischen Köpfe mit Erfahrungen aus der Zeit vor dem Faschismus hatten die zwölf Jahre der braunen Diktatur entweder im gesellschaftlichen Abseits oder in den Zuchthäusern und Konzentrationslagern oder im Exil verbringen müssen. Sie waren unter den schwierigen, meist unmenschlichen Verhältnissen hart geworden und tief enttäuscht von der Mehrheit ihres Volkes, das Hitler gefolgt war. Dazu kam eine Unterbrechung der bisher gekannten politischen Arbeit über ein Jahrzehnt lang, und auch daraus erklärt sich so manche falsch verstandene Aufgabenstellung, dogmatische Interpretation oberflächlich verstandener Losungen, die unbedingte Durchsetzung ohne Rücksicht auf menschliche Schwächen und Bedürfnisse und legitime persönliche Interessen. So war von Anfang an das Bündnis immer in Gefahr zu zerreißen. Dabei spielten die alten Bindungen in den anderen Teil Deutschlands, die familiär oder aus alter Bekanntschaft nach wie vor weiter bestanden, eine besondere Rolle. Im Westen forderte man keinerlei Erklärungen oder Demonstrationen für die ständig wechselnden Losungen, dort wurden keine überlebensgroßen Porträts an die Häuser gehängt, eine Mode, die aus dem russischen Nachbarreich in den Ostteil des Landes kam. Man übertrug einfach die Methode, die führenden Männer zu zeigen, damit jedermann sich ein Bild von den Regierenden in der Hauptstadt Moskau machen konnte in der unübersehbaren Zahl der abgelegenen Städte und Dörfer, was manchmal religiöse, ikonenhafte Züge bekam. Und überall tauchte jetzt Stalin auf, dem wahre Wunderfähigkeiten zugeschrieben wurden.
Die praktischen Schritte wurden täglich auf die Erkenntnisse und Weisheiten von Marx, Engels, Lenin und Stalin zurückgeführt und alle Diskussion beeinflusst mit den Zitaten aus ihren Werken: »Genosse Stalin hat gesagt …« Das kannte man in Deutschland nur aus der kirchlichen Predigt, wo ein Bibelwort das Alpha und Omega war.
Die demokratischen Traditionen waren zwar verschüttet gewesen, aber nicht völlig vergessen. Bereits 1948 musste man sich mit den Problemen der bürgerlichen Revolution beschäftigen und auf die Forderungen der Liberalen theoretisch eingehen. Zwar wurde der revolutionär-demokratische Teil der 48er besonders hervorgehoben, aber das stärkte die selbstbewussten Kräfte. Man lernte, dass Marx aus dem liberalen Bürgertum kam und Engels gar ein Fabrikant gewesen war, der nach dem Gesetz des Kapitals produzierte. Die Zeit war widerspruchsvoll und schwierig, einfache Antworten fand niemand, er musste sich seine Überzeugung selber suchen. Die heutigen, oft maulflinken Antworten geben das Bild von der Nachkriegszeit nicht richtig wieder, manches erinnert sogar an die Situation von damals, an die Schwierigkeiten, sich durch den Dschungel der falschen Prophetien den eigenen Weg zu bahnen. Die Jugend fasste die Aufgaben unbekümmert an, aber in einer Beziehung hatte sie es leichter als die heutige junge Generation, sie kannte die zynische Frage nicht, die neulich in der Zeitung stand: »Gehst du noch zur Schule, oder bist du schon arbeitslos?«
Besatzer als Freunde?
Seit dem Einmarsch der Sowjetarmee in den östlichen Teil unseres Landes überließ sie nichts dem Zufall, wie die westlichen Besatzungsmächte übrigens auch nicht. Obwohl Exzesse gegenüber der Zivilbevölkerung bald abgestellt wurden, trug die Rote Armee im Gegensatz zu den amerikanischen und englischen Truppen doch den Ruch mit sich, sie hätte Millionen von Einwohnern aus den Ostgebieten bis zur Oder aus deren Heimat vertrieben, auf die Flucht geschickt. Niemand wollte sich daran erinnern, dass der Befehl von Himmler ausgegeben worden war, dass die deutschen Armeen die Politik der verbrannten Erde praktiziert hatten, dass die Brücken und Kirchtürme nicht von der Roten Armee gesprengt worden waren. Jedes Pferd, jede Kuh sollte nach dem Westen getrieben werden, alle Männer zwischen 16 und 60 wurden in den Volkssturm gepresst, Frauen an der Panzerfaust ausgebildet. Dieses Bild erhielten die Fronttruppen von den Deutschen. Mit wenigen Ausnahmen kapitulierten die Städte nicht, sondern leisteten bis in die Ruinen von Berlin erbitterten Widerstand, in der Hoffnung auf eine der versprochenen Wunderwaffen. Als das Ende unausbleiblich war, machte sich in Not und Elend tiefe Verzweiflung breit. Doch die überall eingesetzten Stadtkommandanten waren angewiesen, schnelle und wirksame Maßnahmen zur Normalisierung einzuleiten. An ihnen lag es, welche deutschen Partner sie suchten und einsetzten. So gewöhnte sich die Bevölkerung daran, dass die Anordnungen der Besatzungsmacht immer als Befehle veröffentlicht wurden und dadurch den Charakter von Zwangsmaßnahmen bekamen, den sie meistens gar nicht hatten. Waffen mussten natürlich abgeliefert werden, aber auch Radiogeräte. Die großen Naziführer waren wie vom Erdboden verschluckt, so hielt man sich an die kleinen. Besonders streng verhielt man sich gegen die »Wehrwölfe«, eine von der Hitlerjugend geplante, aber nicht mehr wirkungsvoll umgesetzte Partisaneneinheit. Den sowjetischen Truppen fiel die Liste mit den Namen der Kandidaten in die Hände, und so wurden die jungen Leute, die oft gar nichts von den Plänen wussten, in Zwangslager gesteckt, in die ehemaligen KZ oder andere schnell aufgebaute Gefängnisanstalten. Mit ihnen wurden die Blockleiter, untergeordnete Vertrauensleute in den Wohnbezirken, eingesperrt. Wer schuldig war, kam vor die Militärgerichte, später auch vor die neue Justiz. Heute werden sie oftmals als »Opfer des NKWD« (Narodny kommissariat wnutrennich djel – Volkskommissariat des Innern) hingestellt.
Die Besatzung verfuhr also nach einer Doppeltaktik. Sie entfernte wirkliche oder vermeintliche Nazianhänger aus dem öffentlichen Leben – so wurden alle Lehrer, die in der NSDAP Mitglied gewesen waren, aus dem Schuldienst entfernt –, und sie organisierte die antifaschistischen Kräfte zur Belebung der gesellschaftlichen Funktionen. Man hört heute, dass es um den Aufbau eines sozialistischen Systems nach sowjetischem Vorbild gegangen sei, aber das ist nicht richtig. Im »Aufruf der KPD« vom Juni 1945 steht davon unter den anderen Aufgaben, die mit der Beseitigung des Faschismus und dem Aufbau demokratischer Verhältnisse zusammenhingen, kein Wort. Dieser Aufruf musste Stalin in Moskau vorgelegt werden. Die Kommunisten Fred Oelßner, der Vertrauens- und Verbindungsmann Stalins in der KPD-Führung in Moskau, und Paul Wandel waren bei Wilhelm Pieck als redaktionelle Hilfen. In einem Gespräch, das ich mit Paul Wandel, damals schon hoch betagt, geführt habe, bestätigte er, dass Stalin persönlich in den von der KPD ausgearbeiteten Entwurf folgende Ergänzung eingearbeitet habe:
»Wir sind der Auffassung, dass der Weg, Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen, falsch wäre, denn dieser Weg entspricht nicht den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen in Deutschland. Wir sind vielmehr der Auffassung, dass die entscheidenden Interessen des deutschen Volkes in der gegenwärtigen Lage für Deutschland einen anderen Weg vorschreiben, und zwar den Weg der Errichtung eines antifaschistisch-demokratischen Regimes, einer parlamentarisch-demokratischen Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk.«
Die Zielstellung einer Republik mit parlamentarischer Demokratie war sicherlich richtig, auch deren antifaschistische Grundlage, aber weder die sowjetische Besatzungsmacht noch die Masse des deutschen Volkes hatte ein solches Regime persönlich erlebt. Welcher sowjetische Offizier konnte schon sagen, wie diese Republik zu funktionieren hätte? So blieb es von Anfang an beim Kommandosystem gegenüber den deutschen Interessen und deren Vertretern. Die polemischen Attacken gegen die »Steigbügelhalter Moskaus in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) u.ä.« sind lediglich bösartig, den Kern des Verhältnisses treffen sie nicht. Die Entscheidungen wesentlicher Art fielen ausnahmslos in Moskau und wurden von der Militärverwaltung, der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) mitgeteilt. Danach konnten vielleicht noch diese oder jene sekundären Änderungen angebracht werden, am Charakter änderte das nichts.
Dazu kam ein System von Beratern aus der SMAD, das sich nach Gründung der DDR in die Sowjetische Kontrollkommission umwandelte. In Karlshorst, dem Berliner Stadtteil, in dem die SKK ihren Sitz genommen hatte, arbeiteten über 700 Spezialisten, entsprechend den Sektoren des öffentlichen Lebens. Die Entscheidungen lagen bei den Militärs, vertreten durch die Marschälle Shukow, Sokolowski und, als dessen Nachfolger, Tschuikow, den Sieger von Stalingrad. Der Aufbau der Polizei erfolgte unter ihrer unmittelbaren Anleitung. In der politischen Abteilung arbeiteten die Kulturoffiziere, meistens Germanistik- oder Philosophieprofessoren, die über eine gründliche Bildung in deutscher Sprache und Dichtung verfügten und viele Deutsche dadurch verblüfften, dass sie Goethe und Heine fehlerfrei vortragen konnten. Der Leiter dieser Abteilung war Oberst Tulpanow, zugleich der Parteivertreter der KPdSU.
Einen entscheidenden Einfluss hatten die als Berater bezeichneten, in Wirklichkeit aber sehr einflussreichen Funktionäre mit ausgezeichneten Kenntnissen auf ihren Gebieten, vor allem der Wirtschaft und Landwirtschaft. Sie alle waren immer durch ihre deutschen Vertrauensleute bis in die Einzelheiten genau informiert und reagierten meistens mit detailreichen Vorschlägen an ihre deutschen Partner. Der für unsere Betrachtung entscheidende Mann ist der Diplomat Wladimir Semjonowitsch Semjonow, außerordentlich begabt, elegant und wendig in seinem Auftreten. Als er 1945 die Aufgabe in Deutschland übernahm, war er ein junger Mann von 34 Jahren. Er wirkte zehn Jahre lang in der DDR und wurde abberufen, um im Jahre 1955 die Position eines stellvertretenden Außenministers zu übernehmen. Ihm oblag es, die Verbindung zu den Partei- und Staatsstellen in jeder Phase der Entwicklung zu halten, stets genauestens informiert zu sein und direkten Einfluss auf die Durchsetzung der sowjetischen Interessen zu nehmen. Er nahm an den Sitzungen des Politbüros der SED teil und verhandelte häufig auch mit einzelnen Politikern, die er direkt zu sich bestellte. Auf seine Informationen stützten sich in Moskau das Zentralkomitee der KPdSU und das Außenministerium. Sein Einfluss erstreckte sich auch auf Verbindungen in den Westen.
Aus der Struktur der sowjetischen Verwaltung ergibt sich bereits, dass der Einfluss der Besatzungsmacht überhaupt nicht zu überschätzen ist. Die Ereignisse um den 17. Juni 1953 werden das noch zeigen.
Planwirtschaft
Unter der Leitung der SMAD begannen im Osten tiefgreifende Veränderungen der Besitzverhältnisse. Der Boden der großen Güter über 100ha wurde aufgeteilt. Die Neubauern erhielten das ihnen zugeteilte Land als erblichen Besitz, also entschädigungslos. Darauf ließ sich bauen. Die Großbetriebe der Rüstungskonzerne in den östlichen Ländern und die Unternehmen der Kriegsgewinnler, die von den Aufträgen der Wehrmacht gelebt hatten, wurden enteignet. Ein Volksbegehren in Sachsen, dem sich die anderen Länder anschlossen, brachte eine eindeutige Zustimmung der Bevölkerung, die darin eine Bestrafung der Schuldigen sah. Etwa 100 der großen Betriebe und Konzerne der Chemie, der Grundstoffindustrie, des Maschinenbaus, des Bergbaus, darunter die Urangruben in Sachsen und Thüringen wurden nicht der deutschen Verwaltung in Gestalt der Deutschen Wirtschaftskommission (DWK) unterstellt, sondern gingen in das Eigentum einer Sowjetischen Aktiengesellschaft (SAG) über als ein Teil der Reparationen, der Entschädigungen für die angerichteten Zerstörungen in der Sowjetunion. Diese Betriebe wurden durch einen sowjetischen Generaldirektor geleitet, der die deutsche Betriebsleitung anweisen konnte.
Aus diesem Grunde wussten die deutschen Planungsorgane der DWK niemals genau, welche Produkte für den Aufbau in der Ostzone zur Verfügung stehen konnten. Aber auf der Planung beruhten die Berechnungen für die Perspektiven. Allerdings beschränkten sich die Reparationsleistungen nicht auf diese Betriebe, auch andere wurden dazu herangezogen. Ein weiteres Problem, das den Aufbau hemmte, waren die willkürliche Beschlagnahme und als Reparationszahlung erklärte Abbauten funktionierender Betriebe oder Betriebsteile durch örtliche Kommandanten. Hier wurde eine Kleinbahn, dort die Turbine eines Wasserkraftwerkes verpackt und abtransportiert. Diese unkontrollierten Maßnahmen brachten der Sowjetunion keinen Gewinn, denn sie konnten nicht irgendwo aufgebaut werden und wurden oftmals gar nicht eingesetzt. Ende der 50er Jahre wurden die Turbinen eines Wasserkraftwerkes aus dem Harz bei Leningrad entdeckt, sie lagen noch verpackt wie beim Abbau auf einem Lagerplatz, wurden zurückgegeben und wieder eingebaut.
Das Hauptproblem des industriellen Aufbaus in der DDR aber war das Fehlen nennenswerter Kapazitäten von Eisen und Stahl. Um diesen Mangel zu überwinden, wurde das Eisenhüttenkombinat Ost (EKO) bei Fürstenberg an der Oder geplant. Nach verschiedenen Konzeptionen, die auf Steinkohle aus dem Ruhrbergbau und Erz aus Schweden basierten, entwickelte Fritz Selbmann, verantwortlicher Minister für Grundstoffindustrie, eine andere Lösung, die störungsfrei funktionieren konnte. Er plante mit polnischer Steinkohle und ukrainischem Erz. Es war ihm von vornherein klar, dass dazu die Genehmigung Stalins persönlich erforderlich war.
Mit seinem Genossen aus der zwölfjährigen Haft in Zuchthäusern und Konzentrationslagern, Fritz Grosse, dem letzten Vorsitzenden des Kommunistischen Jugendverbandes und langjährigen Mitarbeiter der Kommunistischen Internationale, entwickelte er die Einzelheiten, um die Zustimmung zu bekommen. Grosse war gleich nach 1945 der Vertreter der SED in Moskau geworden und hatte dort seine alten Freunde aus der Zeit vor dem Faschismus aufgesucht. Einer von ihnen saß als Referent im Vorzimmer Stalins. Über diesen Mann wurde der detaillierte Plan auf den Schreibtisch des mächtigsten Mannes der sozialistischen Welt gelegt. Auf den Rat des Mitarbeiters hatten Selbmann und Grosse am Ende ihrer Pläne den Vorschlag gemacht, Werk und Wohnstadt den Namen Stalins zu geben und um dessen Zustimmung ersucht. Ob diese Schmeichelei nun den Ausschlag gegeben hat, weiß niemand mehr zu sagen, aber der eigenmächtige Plan, von dem außer den beiden niemand etwas wusste, wurde ohne Beanstandungen genehmigt. So wurde als wichtigste Maßnahme der 50er Jahre das riesige Kombinat und die erste neue Stadt mit erheblichen Wohnqualitäten unter großen Anstrengungen gebaut.
Da die Autorität Stalins dahinter stand, wurde natürlich alles getan, um den Erfolg zu garantieren, aber die Eigenmächtigkeit Selbmanns, eines Mannes mit selbständigem Denken und Tatkraft, wurde ihm beinahe zum Verhängnis. In den Jahren der Jagd auf Agenten des Imperialismus in den eigenen Reihen, der fingierten Prozesse, um die Theorie des sich ständig verschärfenden Klassenkampfes im Inneren des sozialistischen Lagers zu stützen, dem die höchsten Funktionäre in Bulgarien, Ungarn und der Tschechoslowakei zum Opfer fielen, wurde auch nach Verbindungen zu dem angeblichen Agenten der USA Noel Field gesucht. Da man diese schwerlich bei Leuten nachweisen konnte, die während der ganzen Hitlerzeit im Zuchthaus gesessen hatten, wurden andere Wege gefunden, dem selbstbewussten Selbmann, der es gewagt hatte, direkt mit Stalin Verbindung aufzunehmen, Versagen vorzuwerfen.
Die üblichen Anlaufschwierigkeiten beim Bau des Hochofens wurden auf das subjektive Versagen der leitenden Männer zurückgeführt. Der Hauptverantwortliche dafür war der Minister Fritz Selbmann. Er und einige andere seiner Mitarbeiter erhielten Parteistrafen, der Werkleiter wurde abberufen und Selbmann zusätzlich zu seinem Ministeramt mit der Leitung des Werkes beauftragt, eine einmalige Konstruktion. Der Minister für Staatssicherheit, Wilhelm Zaisser, auf der Suche nach Material für Agentenprozesse, fand unter den Häftlingen des Zuchthauses Brandenburg einen seit 1945 einsitzenden Gießereitechniker, Hubert Hermanns. Für seine Entlassung erhielt er von Zaisser den Auftrag, ein Gutachten über die Planung, Projektierung und den Aufbau des EKO anzufertigen. Dieses »Gutachten« wurde den Ausarbeitungen der bisher an diesen Aufgaben arbeitenden Leiter entgegengesetzt. Über diese Männer wurden gleichzeitig Dossiers angefertigt und diese Walter Ulbricht vorgelegt.
Ulbricht hatte sich im Februar 1952 persönlich von der Lage im EKO überzeugt und war beunruhigt. Da kam eine Anklageschrift gerade recht. Drei Polizisten hatten 16 Seiten einer Schrift eingereicht mit dem Titel »Verdacht der bewussten Störung bei Projektierung und Aufbau des Eisenhüttenkombinates Ost in Fürstenberg«. In dieser Denunziation wurde Minister Selbmann verantwortungsloses Verhalten gegenüber einer Verschwörung von Technikern und Ingenieuren vorgeworfen. Sollte hier eine Neuauflage des Industrieprozesses von 1929 in der Sowjetunion gestartet werden? Ein Hinweis aus der »Spitze der SKK« deutet darauf hin, man müsse dem Selbmann eins auf den Kopf geben. Hatte Ulbricht den Hinweis verstanden?
Die Sache ging jedoch ganz anders aus. Zwei sowjetische Ingenieure, auf Bitten Ulbrichts zur Begutachtung gekommen, erteilten ausschließlich Lob für »die Grundkonstruktion des Ofens«, die auftretenden Probleme seien der Unerfahrenheit deutscher, zweifellos gutwilliger Kollegen geschuldet. Es fehlte eine Sinteranlage, die war aber gerade von Ulbricht als entbehrlich gestrichen worden. Wer hatte nun Recht? Zur Unterstreichung der Rolle Ulbrichts verfasste der junge Dichter Bernhard Seeger das Gedicht »Spitzbartkraulen«, in dessen letzter Strophe es heißt:
»Und zwischen Stubben und Schienen –
der Sand ist noch pulvrig und hart –
steht Walter Ulbricht und lächelt
und krault sich sinnend den Bart.«
Selbmann erhielt, wie erwähnt, seine Parteistrafe, und der Spitzbart von Ulbricht sollte am 17. Juni des folgenden Jahres noch eine Rolle in den Losungen spielen, ebenso wie die Tatkraft des Kommunisten Fritz Selbmann. Hermanns erhielt 1000 Mark Lohn und wurde in den Westen abgeschoben.
Der 17. Juni ist nicht vom Himmel gefallen
Schwierigkeiten beim Aufbau der Wirtschaft in der DDR waren also durchaus nicht alle objektiver Natur. Das Misstrauen schlich sich auch in anderen Bereichen ein. In der Landwirtschaft gab es Schwierigkeiten mit den Großbauern, die mit den Pflichtabgaben, die ihnen fast nichts von ihrer Produktion für den freien Verkauf ließen, mit dem sie höhere Preise erzielen konnten, nicht einverstanden waren. Gegen sie wurde mit administrativen Maßnahmen verschiedener Art, mit Steuererhöhungen, Geld- und Haftstrafen vorgegangen. Anstatt das Bündnis mit den am meisten erfahrenen Landwirten zu pflegen, brachte man sie gegen sich auf. Die bald entstehenden Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften konnten den Ernteverlust und das Minderaufkommen aus der Viehzucht noch nicht ausgleichen, in den Dörfern staute sich der Unwille nun auch der Mittelbauern, die sich ebenfalls benachteiligt fühlten.
Vergleichbare Vorgänge konnte man auch unter der Intelligenz beobachten. In der Kunst kam die Theorie auf, die alle modernen Strömungen als Formalismus bezeichnete, weil die Ansichten und Praktiken der Künstler über die richtige Form des Ausdrucks ihrer Empfindungen seit dem Anfang des Jahrhunderts sich von dem bis dahin herrschenden Naturalismus erheblich unterschieden. Anfang der 50er Jahre begann eine vom Zaune gebrochene Diskussion über »Realismus und Formalismus in der Kunst«, ausgelöst durch einen Artikel in der »Täglichen Rundschau«, dem Blatt der SKK, angefertigt ebendort, natürlich unter einem Pseudonym. In diesem Artikel und den nachfolgenden Äußerungen wurden bedeutende Strömungen deutscher Kunst angegriffen und Käthe Kollwitz und Ernst Barlach als dekadent klassifiziert. Ähnliche Angriffe mussten auch Brecht und Eisler hinnehmen, an ihren Werken wurde herumgekrittelt, sogar das Politbüro befasste sich damit. Wer von da ab in irgendeiner Weise Anstoß erregte oder Neues schuf, das nicht gleich angenommen wurde, musste sich einen »Formalisten« schimpfen lassen. Natürlich hatte das auch Folgen für die Veröffentlichung seiner Werke und mit diesen Einschränkungen auch für seine materielle Lage.
Diese Vorgänge waren nicht zufällig, sie folgten der Bekämpfung der Intelligenz in der Sowjetunion und dem Muster, wie große Meister vom Range eines Schostakowitsch oder Prokofjew gemaßregelt wurden und auf die Maßstäbe subalterner Geister zurückgestutzt werden sollten. In Deutschland waren die Künstler aus dem Exil mit wenigen Ausnahmen in die DDR zurückgekehrt und fanden hier gute Arbeitsmöglichkeiten vor, vor allem konnten sie einen wesentlichen Beitrag bei der Umerziehung der Bevölkerung leisten und eine neue humanistische Haltung aufbauen. Der offiziellen Erklärung wurde nunmehr eine rigide Praxis entgegengestellt. Niemand verstand das. Die meisten Künstler standen traditionell links, viele waren Mitglied der Arbeiterparteien und in der Weimarer Republik Mitglied der sozialistischen Künstlervereinigungen gewesen, sie hatten gleich nach Kriegsende die neuen Berufsverbände gegründet, nun wehrten sie sich gegen eine neue Bevormundung und Zensur.
Ähnlich sah die Lage bei den Pädagogen aus. Die Schulreform in der DDR war eine bedeutende Leistung, die auf den Erkenntnissen aus der Weimarer Republik fußte. In der Pädagogik gaben damals die Schulreformer mit einem entschiedenen Flügel, den radikalen Schulreformern, den Ton an. Die Nazis beendeten diesen Prozess, die Schule lebensverbunden zu gestalten, und schickten die Schulreformer in die Wüste.
Nun, nach dem Ende dieser Tyrannei, konzipierten führende Schulreformer die neue Schule als Einheitsschule, die allen Schülern die gleichen Bildungschancen einräumten. Die einklassige Dorfschule wurde von der achtklassigen Grundschule mit Fachunterricht abgelöst, ihr folgte die vierklassige Oberschule, die zum Abitur führte. Privatschulen für Reiche gab es nicht. Die Lehrpläne waren in allen Schulen gleich, und bald erhöhte sich das Lehr- und Lernniveau der Schulen. Eine neue Lehrergeneration führte das Werk der Schulreformer, in deren Geist sie ausgebildet war, sicher fort.
Wie in der Kunst wurden auch hier plötzlich Ansprüche erhoben, die Sowjetpädagogik zum höchsten Maßstab zu erheben. Jedermann fragte sich, was Besonderes an dieser Sowjetpädagogik sei. Die allgemeinen Grundzüge waren ähnlich der Erziehung in allen Schulsystemen, die Lehrbücher sammelten Meinungen von den Klassikern des Marxismus, meistens von weit hergeholt, wo sie sich aus gegebenem Anlass in dieser oder jener Form, jedoch niemals systematisch mit der Erziehung beschäftigt hatten. Blieb noch der Hinweis auf die originellen Erziehungsmethoden des Pädagogen Makarenko, aber er war ein Sonderfall. Seine Verdienste bestanden darin, dass er für die vielen herumstreunenden Jugendlichen, die in den Wirren der Oktoberrevolution eine kriminelle Gefahr geworden waren, eine Internatserziehung mit Arbeitsaufgaben eingeführt hatte. Dagegen war nichts zu sagen, aber diese Situation traf bei uns nicht zu, seine Bücher wurden gelesen wie Nachrichten aus einem anderen Land.
An meiner Universität gab es eine starke Pädagogik, angeführt von Professor Peter Petersen, der in Jena eine Versuchsschule zur Einführung wissenschaftlich begründeter Methodik für verschiedene Fächer leitete, die der Friedrich-Schiller-Universität unterstand. Für die Studenten waren Hospitationen bei diesen Lehrern anregend und interessant in verschiedener Hinsicht. Alles drehte sich darum, aus ganz durchschnittlichen Schülern mit normaler Begabung leistungsstarke Persönlichkeiten zu bilden. Plötzlich war diese Schule zu einer elitären Anstalt erklärt worden, die in einem modernen Schulwesen nichts zu suchen hätte. Die wissenschaftlich ausgearbeiteten Experimente wurden auf Weisung des Thüringer Volksbildungsministeriums abgebrochen, der verdiente Petersen ins Abseits gestellt. Sein »Jena-Plan« hatte eigentlich eine sozialistische Zielstellung gehabt, er diente dem Prinzip der Gemeinschaft als Mittel und Ziel der Erziehung. In den Jahren von 1923, seit dem Aufschwung der Schulreformbewegung, bis 1950, fast dreißig Jahre lang, hatte er an seinem dreibändigen Werk »Der Große Jena-Plan« gearbeitet, das nun nichts mehr wert sein sollte. Man sagte, er sei an Gram gestorben.
Kaum hatte die Orientierung auf eine antifaschistisch-demokratische Ordnung erste Erfolge gezeigt, wurde die günstige Entwicklung unterbrochen, sogar versucht, sie abzubrechen und die sie tragenden Persönlichkeiten herabzusetzen, zu behindern, zu verunsichern. Der erste große Schaden für den Neuaufbau war eingetreten, die neue Idee diskreditiert. Der 17. Juni hat eine Vorgeschichte, er ist nicht vom Himmel gefallen. Der Hauptvorwurf gegen die DDR bestand darin, dass eine freiheitliche Entwicklung des Einzelnen nicht garantiert sei. Noch bis in die 90er Jahre bekämpfte man die DDR mit dem Slogan »Freiheit statt Sozialismus«. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass die Behauptung, es hätte in der DDR keine Freiheiten gegeben, in der allgemeinen Form nicht zutrifft.
Richtig ist, dass es nicht selten willkürliche Entscheidungen gab, die von oben verordnet wurden, wie überhaupt der Eindruck erweckt wurde, der Einzelne könne glücklich werden, wenn er die weisen Entscheidungen der Leitenden akzeptierte. Die reformerische Entwicklung in den 40er und 50er Jahren ähnelte sehr einer Revolution von oben, so wie sie in Deutschland nicht zum ersten Mal vorkam, auch die Stein-Hardenbergschen Reformen gehören dazu, die erste preußische Verfassung wurde von Friedrich Wilhelm IV. erlassen, und auch die in der Revolution 1918 erkämpften Rechte wurden immer wieder durch konterrevolutionäre Entwicklungen in Frage gestellt, bis dann der Faschismus alle Freiheiten zugrunde richtete. Wir jungen Leute verstanden damals unter Freiheit etwas ganz Konkretes, nämlich die Teilhabe und Mitwirkung an den großen Veränderungen, die realiter auf allen Gebieten vor sich gingen. Wir halfen den Neubauern, das Baumaterial zu bergen, das sie für ihre Wohnungen und Ställe benötigten. Wir brachen die hohen Mauern der Gutshöfe und Parks ab, die Besitzer hatten ihr Dorf im Stich gelassen, und die Flüchtlinge und Umsiedler, die jetzt in den Gutshäusern Unterkunft bekommen hatten, brauchten keine Mauern. Freiheit – das war für uns zu jenen Zeiten die Forderung des Tages.
Es wird dem heutigen Leser schwer fallen zu verstehen, warum die neuen Ansätze des gesellschaftlichen Lebens auf allen Gebieten infrage gestellt oder gar abgebrochen wurden. Die Antwort ist nicht mit ein paar Worten zu geben, man wird sie an verschiedenen Stellen dieses Buches finden. Hier nur wenige allgemeine Hinweise: Schon im Jahre 1947 wurde in vielen Städten der SBZ die »Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion« gegründet. Sie sollte einen geistigen Beitrag dazu leisten, das belastete Verhältnis zwischen den Ländern zu verbessern und Informationen über die Sowjetunion zu vermitteln. Dabei kamen viele Tendenzen in die SBZ und später in die DDR, in denen auch Fehlentwicklungen in der Sowjetunion vermittelt wurden, so zum Beispiel in der Genetik oder in der Literatur- und Kunstauffassung. Alle diese für uns neuen Informationen wurden ausnahmslos unkritisch diskutiert. Obwohl wir oft zweifelten, gab es doch keine souveräne Diskussion.
Weiterhin ist zu beachten, dass es durchaus starke Kräfte in Moskau gab, die mit dem sogenannten besonderen deutschen Weg zum Sozialismus nicht einverstanden waren. Mit der Ablehnung dieses Versuches, der auf Stalins Einfügung in den KPD-Aufruf zurückging, wurde das Sowjetmodell nach und nach durchgesetzt, da es in jedem Fall als maßgeblich und vorbildlich hingestellt wurde. Die Gesellschaft zum Studium wurde bereits zwei Jahre später in die »Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft« umgewandelt. Das allgemeine Studium wurde beendet, was die selbstlose Verwendung vorbildlicher Erfahrungen einschloss, und stattdessen der stärker werdende Stalin-Kult propagiert. Die Anhänger eines zu Recht anzustrebenden freundschaftlichen Verhältnisses zur Sowjetunion wurden durch massenhafte Werbung für die Gesellschaft vermehrt, so dass bald jeder Werktätige dort seinen geringen Mitgliedsbeitrag bezahlte. Damit war er ein »Freund«.
Im Westen nichts Neues?
Auch im westlichen Deutschland waren die Erwartungen an die Neugestaltung aller Lebensgebiete groß. Besonders die Arbeiter hatten gehofft, es würde sich grundsätzlich etwas ändern, stattdessen sahen sie, dass die alten Krähen alle wieder auf denselben Ästen saßen. Bereits 1946 kam es zu den ersten Streikaktionen gegen die Hungerpolitik, für die sie die alten Kräfte verantwortlich machten. Im Frühjahr 1947 veränderten sich dann die Streikforderungen. Sie lauteten durchaus politisch: Demokratische Bodenreform, Kontrollausschüsse zur Sicherung der Ernährung, Säuberung der Verwaltung und Wirtschaft von faschistischen Elementen, Verstaatlichung der Bergbaubetriebe und Überführung der Schlüsselindustrien in die öffentliche Hand bei entschädigungsloser Enteignung der Kriegsverbrecher und Naziaktivisten.
Die Proteststreiks und Demonstrationen mussten von den Besatzungsmächten genehmigt werden und wurden von den Bergarbeitern des Ruhrgebietes angeführt. Den Höhepunkt erreichten sie, als 300000 Bergarbeiter an der Ruhr, unterstützt von 12000 Arbeitern des Aachener Reviers, die Arbeit niederlegten. Sie erhoben neben den bekannten Forderungen auch erstmals die nach gleichberechtigter Mitbestimmung der Gewerkschaften und nach Erhöhung der Hungerlöhne. Ein Jahr später, 1948, ergriff ein Generalstreik die Bizone, an dem 9 Millionen Werktätige einen Tag lang ihre Entschlossenheit zeigten. Die beiden Arbeiterparteien beurteilten die Bewegung unterschiedlich, und es zeigten sich erstmals Risse in der Parteienlandschaft des Westens.
Doch die Restauration der alten Besitzverhältnisse ging weiter. Statt einer wirklichen Enteignung der Schlüsselbetriebe wurde eine sogenannte Konzernentflechtung durchgeführt, die einige Teile ausgliederte und verselbständigte. Sie erhielten einen neuen Namen, die Kapitalverflechtung aber blieb unerkannt bestehen, und die Zusammenarbeit der Besitzer funktionierte wie gehabt. Das entsprach nicht den Wünschen der Bevölkerung, die alle Kriegslasten zu tragen hatte, sie glaubte nicht an Entflechtung und forderte die Entmachtung der Großindustriellen als Hauptschuldige am Kriege. Gewiss, die Besatzungsmächte hatten einige Exponenten eingesperrt und verurteilt, die meisten aber als Mitläufer entnazifiziert. Die Verurteilten kamen bald wieder frei und erhielten ihr Vermögen in der Regel zurück. Oftmals behaupteten sie, heimlich Widerstand geleistet zu haben. Aus dieser Zeit stammt das ironische Wort, sie hätten alle einen Juden im Schrank versteckt. Die Wirklichkeit aber sah anders aus. Alle, mit wenigen Ausnahmen, hatten mitgemacht und Hitler unterstützt und sich an der Rüstung goldene Nasen verdient. So besaßen sie die Kapitalien, den Aufbau starten zu können. Sie lieferten die alten Fließbänder und Einrichtungen als Reparationen ab und produzierten neue Produktionsmittel, modern, auf höherem Niveau, effektiver.
Die Herren hatten aber aus den Streikbewegungen und den programmatischen Forderungen nach Enteignung auch ihre Schlussfolgerungen gezogen. Sie erfüllten die ökonomischen Forderungen von nun ab meistens bereits im Vorfeld der Streikbewegung, schufen aus eigener Überlegung betriebliche Vergünstigungen wie zusätzliches Monatsgehalt, Weihnachts- und Urlaubsgeld usw. Sie waren gut durch den Krieg gekommen, waren dabei, neue Produkte zu entwickeln, der Markt war unersättlich, alles wurde abgesetzt, die Gewinne stiegen und stiegen. Ihre Theoretiker entwickelten neue Lehren, die auf einen Volkskapitalismus hinausliefen. Vor allem die als gemeinsame Verantwortung deklarierte »Sozialpartnerschaft«, die auf eine Verwischung der Interessen von Kapital und Arbeit hinauslief, erweckte den Anschein, als sei der Hauptwiderspruch des Kapitalismus nunmehr gelöst und der Kampf der Klassen überholt.
Im Sommer 1948 unternahmen die Westzonen eine separate Währungsreform. Damit war Deutschland von einem Tag auf den anderen gespalten und die Beschlüsse von Potsdam mit Unterstützung der westlichen Siegermächte außer Kraft gesetzt, nur drei Jahre nach ihrer Beschlussfassung, nach der Deutschland als einheitliches Ganzes zu behandeln sei. Anstelle der Reichsmark trat nun die D-Mark. Während der kleine Sparer 90% seines Guthabens verlor, betrug der Verlust der Aktiengesellschaften nur 16%. Sie behielten fast alle Kriegs- und Nachkriegsgewinne.
Fast zeitgleich unterzeichneten die drei westlichen Militärgouverneure in Paris die Konvention über den »Marshallplan«. Als ihr Berater fungierte der deutsche Bankier Otto Schniewind. Wie andere kriegsgeschädigte Länder erhielt auch die Bundesrepublik noch vor ihrer Gründung eine beträchtliche Wirtschaftshilfe. Von 1948 bis 1952 flossen ihr 1,4 Milliarden Dollar zu, das waren 5,6 Milliarden DM. Der geringere Teil der Mittel wird als Finanzkredit zur Verfügung gestellt, für eine halbe Milliarde Dollar werden Nahrungsmittel importiert, für fast die gleiche Summe Roh- und Treibstoffe und für 40 Millionen Dollar maschinelle Ausrüstungen und Transportmittel. Die Importe erfolgen in der Regel aus den USA und beleben auch dort die Wirtschaft.
Mit der harten D-Mark, die in der westlichen Welt frei konvertierbar war, konnten die alten Konzerne wieder ohne Begrenzungen produzieren, neue Techniken, die durch den Krieg nicht zur Wirkung gekommen waren, anwenden und mit jedermann Handel treiben. Bald war die DM sehr begehrt. Der Kapitalismus hatte sich nach dem Krieg wieder gefangen und neue Gebiete erschlossen. Die Produktion lief bald auf vollen Touren, es fehlten überall Arbeitskräfte, vor allem gut ausgebildete Facharbeiter. Frauen füllten die Lücken aus, die der Krieg gerissen hatte, und die Fachleute aus der DDR, die früher in den Konzernbetrieben, die jetzt wieder im Westen in Schwung waren, gearbeitet hatten. Sie wurden oftmals gezielt mit hohen Versprechungen abgeworben. Da die Grenze offen war, bedeutete es keine Schwierigkeiten, plötzlich umzusiedeln. Im Zeisswerk in Jena, das noch unter den Demontagen litt, fehlten am Wochenanfang oft ein Dutzend Arbeitskräfte hoher Qualifikation. Ihnen versprach man im Westen den vollen Ersatz ihrer Verluste, die dadurch entstanden waren, dass sie ihren Besitz nicht mitnehmen konnten. Dieses System wurde perfektioniert, die im Westen Angekommenen berichteten von den besseren Verhältnissen, die dort angetroffen wurden, und das verleitete manchen Ingenieur oder Meister nachzuziehen. Der Volksmund sagte: »Er ist nach dem Westen gegangen«, was hieß, er hat seine Arbeit, seine Kollegen und das Aufbauwerk im Stich gelassen und sich bei den Kapitalisten verdingt.
Aber auch die Westzonen mussten die Umwälzungen in der Ostzone berücksichtigen. Sie gingen ab von den früheren Methoden der Ausbeutung und verstanden, dass die Arbeiter vor allem die privaten Verluste durch den Krieg ausgleichen wollten. Daher entwickelte Ludwig Erhard die Theorie der sozialen Marktwirtschaft. Diese beiden Worte sind, bis heute in vielen Formen abgewandelt, die Kurzform für seine Auffassung, dass die Marktwirtschaft (der Kapitalismus) durchaus mit den sozialen Ansprüchen der Arbeitnehmer zu vereinbaren ist. Kapitalisten und Arbeiter hätten keine getrennten Ziele, beide seien am Erfolg des Unternehmens gleich interessiert.
Diese Theorie hörte ich zum erstenmal bei einer Vorlesung des Philosophen Hans Leisegang 1948 in Jena. Er legte dar, dass man sich den Arbeiter als Pferd, den Kapitalisten als Reiter vorstellen müsse. Ohne Reiter könne das Pferd keine Richtung halten, der Reiter aber ohne Pferd sich nicht fortbewegen. Einer sei auf den anderen angewiesen. Diese Vorlesung löste bei den fortschrittlichen Studenten offene Empörung aus, und man stimmte im Volkshaus Jena darüber ab, ob man solche Theorien gelehrt haben wolle. Wer dafür war, ging durch die eine Tür, wer dagegen stimmte, durch die andere (Hammelsprung). Die meisten waren dafür, dass die Freiheit der Lehre den Vorrang habe. Nur wenige stimmten gegen Leisegang.
Obwohl er durch die Mehrheit rehabilitiert war, ging auch er, schon nicht mehr jung, an die Freie Universität in Westberlin.
Als Direktor der Wirtschaftsverwaltung der westlichen Besatzungszonen regierte Erhard entschlossen nach seiner neuen Theorie. Gegen den Widerstand der Besatzungsmächte hob er mit dem Tag der Währungsreform die Zwangsbewirtschaftung, die aus den Kriegszeiten stammte, auf und überließ alles dem freien Markt. Und siehe da, plötzlich füllten sich die Schaufenster mit den lang entbehrten Waren. Das Geld war knapp, aber das Angebot reizte zu Überstunden und der Zustimmung zu Akkordlöhnen. Vergessen die alte Arbeiterlosung »Akkord ist Mord«. Diese Politik führte zum sogenannten Wirtschaftswunder in der BRD, zu einem hohen Lebensstandard, zu früher nie gekannten Urlaubsreisen in den Süden, zum eigenen Auto und zum Reihenhaus. Die ernsten Konflikte mit den Gewerkschaften blieben aus, die junge Generation der Gewerkschaftsführer verstand sich als Manager der Arbeitnehmer, der Streikführer verschwand fast völlig aus dem betrieblichen Blickfeld.