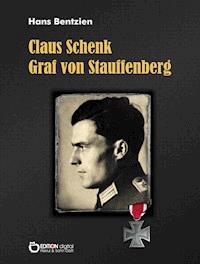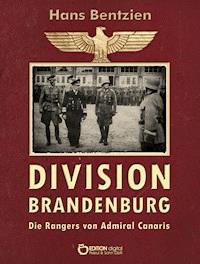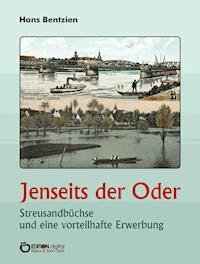8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist nicht nur eine Chronik eines bedeutenden Tages in der deutschen Nachkriegsgeschichte, sondern auch eine Analyse der komplexen sozialen und politischen Dynamiken, die zu diesem historischen Moment geführt haben. Bentzien, sowohl ein renommierter Historiker als auch ein Zeitzeuge der Ereignisse, zeichnet ein fesselndes und nuanciertes Bild von den Vorfällen, die sowohl Deutschland als auch die Welt für immer verändert haben. In diesem Buch entdecken Sie die wahre Geschichte des 17. Juni 1953, weit über die gängigen Interpretationen hinaus. Bentzien führt Sie durch die Straßen von Berlin, Dresden, Gera und anderen Städten und entfaltet eine Erzählung, die von leidenschaftlichen Aufständen, politischen Machenschaften und den alltäglichen Kämpfen der Menschen in dieser Zeit geprägt ist. Ergänzt durch eine Vielzahl von Originaldokumenten im Anhang, ist das Buch eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die deutsche Geschichte, den Kalten Krieg und die menschlichen Geschichten hinter historischen Ereignissen interessieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Hans Bentzien
Was geschah am 17. Juni?
Vorgeschichte, Verlauf, Hintergründe
ISBN 978-3-96521-838-3 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 2003 in der Edition Ost Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2023 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Die Vorgeschichte
Man kann zu bestimmten Jahrestagen darauf warten, dass die Wellen der gewünschten Erinnerungen mit aller Wucht an die Ufer des politischen Tagesgeschehens rollen werden und die Meinungsbildner in der konzertierten Aktion mitspielen: die Presse, Rundfunkstationen, Buchverlage und natürlich auch die gelehrten Gesellschaften. Das wird auch 60 Jahre nach den „Ereignissen vom 17. Juni“ der Fall sein. Wir werden wieder die tausendmal gedruckten Bilder sehen, wie sich der spontane Volkszorn Bahn bricht und einige Jugendliche von Westberlin aus Steine auf sowjetische T34 werfen. Dann kommen die Kommentare, in denen mit allen Ettikettierungen – von Streik über Volksaufstand bis Revolution – den Unruhen vom 17. Juni 1953 auf den Leib gerückt werden soll.
Doch inzwischen sind die Floskeln erstarrt, niemand glaubt mehr an einen faschistischen Putschversuch oder an einen Volksaufstand. Sie werden wie Kampfbegriffe benutzt, immer wieder, obwohl dieser Tag bereits am 4. August 1953 zu einem nationalen Feiertag erklärt wurde, selbstverständlich nur im Westen, der Osten wurde vom Gedenken möglichst ferngehalten. Während sich die Festredner alle Mühe geben, über die Geschehnisse originell zu sprechen, um Betroffenheit zu erzeugen, fragen sich diejenigen, die aus Altersgründen noch gar keine Erinnerung haben können, was damals wirklich in der DDR vor sich gegangen ist an diesem Tag X.
Während der Veranstaltungen zum 50. Jahrestag der Unruhen standen die Jugendlichen meistens abseits. In einer Veranstaltung für die oberen Gymnasialklassen in der vorpommerschen Stadt Pasewalk konnte man beobachten, dass eine zweistündige Lektion über die Ursachen, welche zum Aufruhr führten, bei den meisten Schülern auf völlig unbestellten Boden fiel. Mit einigen Ausnahmen hörten sie gespannt zu, während die Geschichtslehrer vor dem Beginn Befürchtungen über mangelnde Konzentration äußerten. Der problematische Punkt war das Verständnis für die unterschiedliche Politik in zwei deutschen Staaten. Gymnasiasten, im 13. Jahr der deutschen Einheit, haben daran keinerlei Erinnerungen, und die Erzählungen der Eltern und Großeltern fallen dabei höchst widersprüchlich aus, je nach Anteilnahme und Kenntnissen, wobei in Rechnung gestellt werden muss, dass ihre Eltern zum Zeitpunkt noch gar nicht geboren waren. Auch sie können, wenn überhaupt, ihre Kenntnisse nur von ihren Eltern haben.
Auf diese Generationsumstände wurde bei den Gedenkfeiern keinerlei Rücksicht genommen. Ältere Damen und Herren variierten noch einmal die altbekannten Thesen aus den Reden zum 1953 eingeführten „Tag der deutschen Einheit“, der mit der vollzogenen Einheit sofort abgeschafft wurde. Eine besondere Konjunktur bekamen jene Zeitzeugen, die zu den Vorgängen ausführliche Beschreibungen gaben und dabei nicht selten in Beklemmungen kamen, stellte sich doch heraus, dass es meistens um sekundäre Beobachtungen oder um Hörensagen ging. Während der damals 10-jährige Rainer Eppelmann, Vorsitzender der Stiftung zur Aufarbeitung der DDR, in einer Pankower Straße die sowjetischen Panzer einrücken sieht und bestimmt aussagt, dass sie geschossen hätten, erinnert sich die damals 5-jährige Marianne Birthler „mit sehr deutlichen Eindrücken“ an die lebhaften Diskussionen in ihrer Familie. Die „Berliner Zeitung“ bringt unter starker Kritik ihrer Leserschaft eine ganze diesem Tag gewidmete Nummer mit Zeitzeugenberichten, unter denen der einer Frau Klara Kolpin, damals 21 Jahre alt, besonders hervorsticht. Sie beklagt, dass sie tagelang mit ihren beiden Kindern nur Butterkremtorte essen musste, weil sie wegen der russischen Panzer nicht zum Bäcker durfte. Die Torte hatte sie zum 7. Geburtstag ihres Sohnes gebacken und wollte sie bei der Feier mit ihm und ihrer 10-jährigen Tochter genießen. Sind denn alle Redakteure, die etwas rechnen können, entlassen worden?
Auf der Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung meldete sich ein Mann zu Wort, der in Frankreich lebt, und outete sich als der Junge, welcher auf dem wohl bekanntesten Bild vom Potsdamer Platz Steine auf den sowjetischen Panzer wirft. Bei diesen Worten gibt er auch bekannt, dass er auf einen Panzer gesprungen ist und Steine in die offenen Luken geworfen hat. Als er von dort verscheucht wurde, ging er zum Columbushaus und steckte es in Brand. Dieser Junge hatte Europa an den Rand eines Krieges gebracht, und statt dass ihm das jemand erklärt, wird er als Opfer gefeiert und zum Helden gemacht – jedenfalls fühlte er sich so.
Berichte dieser Art las man bis zum Überdruss in fast allen Zeitungen, sogar das „Neue Deutschland“ brachte eine Sonderbeilage, in der es versichert, dass es sich auch der Meinung anschließt, es habe sich um einen spontanen Arbeiteraufstand gehandelt.
Die Zeitungen und Fernsehsender stützen sich in ihren oftmals langen Beiträgen auf die These, dass es sich um einen Aufstand gehandelt habe, der sich quasi über Nacht explosionsartig ausgebreitet hatte. Wie es dazu gekommen ist, wird weiter unten noch behandelt werden. Aber das spontane Element, das zweifellos eine bedeutende Rolle gespielt hat, wird weit überschätzt. Man merkt die Absicht und ist verstimmt, denn mit der Überbetonung der Spontaneität soll von anderen, meist äußeren Einflüssen auf das Land im Herzen Europas abgelenkt werden. Diese Methode gehört zum hartnäckigen Versuch, die Deutungshoheit über die Geschichte auch für die Zeit der Spaltung zu erringen, und was käme da gelegener als eine Empörung der Arbeiter gegen ihre Arbeiter-und-Bauern-Regierung.
Es kommt also gar nicht auf eine noch detailliertere Beschreibung der Vorgänge an, darüber gibt es genügend Material, sondern auf die Beantwortung der Frage, welche unterschiedlichen Strömungen in diesen Tag X mündeten. Wie ein politischer Seismograph hat der vorausahnende Dichter Bertolt Brecht den historischen Ausgangspunkt nach der Gründung der beiden deutschen Staaten beschrieben:
Zwei Gesellschaftsordnungen
Wenn sich durch besondere Umstände in einem Teil eines Landes eine neue Gesellschaftsordnung bildet, während der andere in der alten verharrt, muss eine scharfe Feindschaft dieser beiden Teile des Landes erwartet werden. Beide werden sich bedroht fühlen, und sie werden sich einander barbarisch nennen.
Im Osten Deutschlands hat sich nach einem schrecklichen Krieg ein Arbeiter- und Bauernstaat gebildet, der Politik und Wirtschaft nach völlig neuen Grundsätzen behandelt. Eigentums- und Produktionsverhältnisse sind gründlich geändert worden und die öffentlichen Geschäfte sowie die Meinungsbildung der Bevölkerung folgen bisher unerhörten Methoden. Wie man weiß, hat das Unerhörte keinen guten Klang, was noch nie gehört wurde, gilt als ungehörig. So bedürfen die neuen Grundsätze und Methoden der Erläuterung, während die alten für selbstverständlich gehalten werden.
Der Westen Deutschlands ist unter der Herrschaft der großen bürgerlichen Eigentümer und damit der bürgerlichen Ideen geblieben. Es gibt Arbeitsgeber und Arbeitsnehmer, und die einen können völlig frei Arbeit geben oder nicht geben, die anderen Arbeit nehmen oder nicht nehmen. Allerdings verhungern die Arbeitsgeber nicht, wenn sie Arbeit nicht geben, während die Arbeitsnehmer verhungern, wenn sie nicht Arbeit nehmen.
(1951, Brecht, Werke, Frankfurt/Main, Bd. 20, S. 317)
Der Dichter führt die fundamentalen Unterschiede zwischen Ost und West auf die gründliche Änderung der Eigentumsverhältnisse zurück.
Um die Weiterführung dieses Prozesses im Osten oder um die Restauration der alten Verhältnisse ging es acht Jahre nach dem Kriegsende. Wenn man die unerhörten Verwandlungen von Konzernbetrieben in volkseigene Betriebe noch aufhalten wollte, dann musste man es bald machen, solange der Staat noch nicht gefestigt war, seine Fehler ausnutzen, seine unsichere internationale Stellung zwischen den beiden Blöcken mit feinen diplomatischen Ränken weiter in der Schwebe lassen oder ignorieren, was da mit wachsendem Selbstbewusstsein sich zu Worte meldete.
Liest man die kargen Unterlagen und Berichte über die Vorbereitungen der deutschen Emigranten in Moskau auf die ersten Schritte zum Aufbau des zerstörten Heimatlandes, die im Jahre 1944 begannen, so fällt auf, dass kein genaues Bild der Lage vorhanden war, nicht vorhanden sein konnte. Neben den drei ersten Gruppen – Ulbricht für Berlin und Brandenburg, Ackermann für Sachsen und Sobottka für Mecklenburg – beschäftigten sich auch spezielle Arbeitsgruppen mit dem Aufbau der Verwaltungen und deren Zielstellungen, so für Wirtschaft, Landwirtschaft, Volksbildung und Kultur.
Die Großbourgeoisie im Lande aber bereitete sich seit eben diesem Zeitpunkt mit genauen Kenntnissen über die innerdeutsche Situation, etwaige Reserven und das vorhandene Führungspersonal mit gründlichen Untersuchungen vor, mit denen vor allem der spätere Vater der sozialen Marktwirtschaft, des Wirtschaftswunders und Nachfolger des ersten Bundeskanzlers Adenauer, Ludwig Erhard, an der Wirtschaftshochschule in Nürnberg beschäftigt war. Diese Arbeiten kreisten um die Frage, wie der Wirtschaftsaufbau erfolgen müsse, ohne die Besitzverhältnisse grundsätzlich zu ändern. Dass die Industrie belastet war und mit dem großen Landadel zusammen Hitler benutzt hatte und mit ihm reich geworden war, stand außer Frage. Dieser Zusammenhang ist später versteckt und in die allgemeine Verantwortung der Deutschen für Auschwitz umgeformt worden. Die Einzeluntersuchungen über die IG Farben kamen erst von einer neuen Generation von Historikern, nachdem die Wehrwirtschaftsführer abgetreten waren. Und die schamlose Ausbeutung bis zum Tod der Arbeitssklaven aus dem Osten hält die Verantwortlichen auch heute noch nicht ab, um ein paar Taler mit dem Staat zu feilschen. Sie haben gute Juristen, welche die Auszahlung einer „Entschädigung“ abzulehnen oder hinauszuzögern verstehen.
Gewiss, Forderungen nach Verstaatlichung der Grundstoffindustrien und Banken regten sich auch in den Westzonen und drangen sogar in die Programme bürgerlicher Parteien ein, aber mit dem zunehmenden „Wirtschaftswunder“ verschwanden sie leise wieder aus der aktuellen Zielstellung. Mit dem formalen Verfahren der Entnazifizierung war die Kampagne gegen die Clique um Hitler erledigt, und man ging zur Tagesordnung über. Nur wenige Schuldige schieden aus dem öffentlichen Leben aus und verschwanden meistens bei ihren Freunden in den Unternehmen, wo sie angeblich als Fachkräfte unentbehrlich waren. Sie sorgten dafür, dass der Antifaschismus als Grundlage für einen Neuanfang schnell aus der Diskussion kam. Wo würde das hinführen?
Die maßgebenden Wirtschaftsführer und Politiker der Bourgeoisie, ob belastet oder nicht, waren längst in den Westzonen, als im Osten, Sachsen voran, die ersten Betriebe der Kriegsverbrecher und -gewinnler enteignet wurden. Wer vom technischen Personal noch da war, wurde mit der Betriebsführung beauftragt, aber hatte mit den klassenbewussten Arbeitern aus den Parteien und Gewerkschaften eine misstrauische Kontrolle an seiner Seite. Wo niemand mehr da war, der zur alten Betriebsführung gehörte und sich loyal verhielt, wurde versucht, mit gutwilligen, aber meistens überforderten Arbeiterfunktionären die Lücken zu schließen.
Zur Führung eines Staates gehören sachkundige Funktionäre, vor allem, wenn er den Anspruch erhebt, die großen Betriebe selbst zu leiten. Die bürgerlichen Parteien, bald nach den beiden Arbeiterparteien zugelassen, verfügten meistens über Mitglieder aus dem alten Bildungsbürgertum, Lehrer, Anwälte, Kleinindustrielle und Händler. Sie arbeiteten in den Volksvertretungen mit, aber nur wenige standen an den Brennpunkten des Wirtschaftsaufbaus. Außerdem hatten sie tiefsitzende Vorbehalte gegen eine führende Rolle der Arbeiterschaft, der sie sachgerechte Entscheidungen gar nicht zutrauten.
Die Bauernschaft war wie neu entstanden, da viele bisherige Landarbeiter von den ostelbischen Gütern durch die Bodenreform ein Stück Land bekommen hatten, das sie mehr schlecht als recht bewirtschaften konnten. Unter ihnen waren viele Umsiedler, die erst in der neuen Umgebung heimisch werden mussten. Dennoch befanden sich hier die natürlichen Verbündeten, und zu Anfang erhielt die antifaschistische Politik von ihnen die meiste Unterstützung. Dennoch hemmten viele objektive Umstände eine schnelle Entwicklung. Die Ackerflächen waren zu klein, um eine größere Anzahl von Tieren, besonders Großvieh, zu halten, das Ablieferungssoll war hoch und wurde mit Nachdruck verlangt, Ställe und Wohngebäude mussten mühsam, unter Materialmangel und mit wenig technischem Gerät erbaut werden, Maschinen fehlten zu Anfang völlig, wurden aber dann konzentriert importiert und nach und nach selbst gebaut. Ihr Einsatz erfolgte über Ausleihstationen, die zugleich auch politische Zentren waren.
Der größte Verbündete der Antifaschisten war die Jugend. Der Krieg, aus dem die jungen Männer nach und nach zurückkamen, hatte auch die jungen Mädchen und Frauen nicht verschont, sie waren oftmals zwangsverpflichtet worden und berufsfremd eingesetzt. Nunmehr erhielten sie die gleichen politischen Grundrechte wie die Erwachsenen, praktisch unbegrenzte Bildungschancen und gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Wer sich ein neues Leben aufbauen wollte, erhielt Vertrauen und Unterstützung, auch wenn er in der Hitlerzeit erzogen worden und der Hitler-Ideologie verfallen gewesen war. Überall fehlte es an Arbeitskräften, überall an Kursen für Umschulungen in Berufe, die jetzt gebraucht wurden. Das betraf besonders die Frauen, unter denen viele allein standen, die ohne den Mann, der gefallen war oder noch in der Gefangenschaft wartete, für die vaterlose Familie sorgen mussten. In dem Lehrerkollegium, in dem ich nach dem Krieg unterrichtete, gab es außer dem Rektor und einem schwerkriegsbeschädigten Kollegen nur noch mich aus der männlichen Abteilung, alle anderen Lehrkräfte waren Frauen, darunter mehrere Offizierswitwen, mit Abitur und einem Neulehrerkurs.
Die Grundhaltung für den Unterricht war antifaschistische Gesinnung, die sehr wohl angenommen wurde, da der Krieg mit seinen Ungeheuerlichkeiten tief in den Seelen saß. Es wurde verstanden, dass die aktive oder passive Unterstützung des Faschismus die Schuld der meisten Deutschen war, von der sie sich reinigen mussten. Geschah das oberflächlich, opportunistisch, hängte man den Mantel wieder einmal nach dem Wind, konnte man den Eindruck haben, dass der Antifaschismus verordnet worden war. In der Wirklichkeit aber war die Sache weit komplizierter. Die aus den Zuchthäusern oder der Emigration zurückgekehrten Hitlergegner standen an den Schaltstellen der Kommunen, Länder und der Republik, und je nach Erlebnissen und Erfahrungen, nach Können und Charakter formten sie die Umwelt neu. Mancher von ihnen war misstrauisch und sah überall verkappte Nazis, und so mancher ehrliche, aufbauwillige Mensch wurde von ihnen vor den Kopf gestoßen. Erst langsam verbesserte sich das Klima des Umgangs miteinander, der Nebel in den Hirnen lichtete sich und der zweifelnde Bürger fand seinen festen Platz in der antifaschistisch-demokratischen Gesellschaft, zu der man ein uneingeschränktes Bekenntnis forderte.
Die politischen Köpfe mit Erfahrungen aus der Zeit vor dem Faschismus hatten die zwölf Jahre der braunen Diktatur entweder im gesellschaftlichen Abseits oder in den Zuchthäusern und Konzentrationslagern oder im Exil verbringen müssen. Sie waren unter den schwierigen, meist unmenschlichen Verhältnissen hart geworden und tief enttäuscht von der Mehrheit ihres Volkes, das Hitler gefolgt war. Dazu kam eine Unterbrechung der bisher gekannten politischen Arbeit über ein Jahrzehnt lang, und auch daraus erklärt sich so manche falsch verstandene Aufgabenstellung, dogmatische Interpretation oberflächlich verstandener Losungen, die unbedingte Durchsetzung ohne Rücksicht auf menschliche Schwächen und Bedürfnisse und legitime persönliche Interessen. So war von Anfang an das Bündnis immer in Gefahr zu zerreißen. Dabei spielten die alten Bindungen in den anderen Teil Deutschlands, die familiär oder aus alter Bekanntschaft nach wie vor weiter bestanden, eine besondere Rolle. Im Westen forderte man keinerlei Erklärungen oder Demonstrationen für die ständig wechselnden Losungen, dort wurden keine überlebensgroßen Porträts an die Häuser gehängt, eine Mode, die aus dem russischen Nachbarreich in den Ostteil des Landes kam. Man übertrug einfach die Methode, die führenden Männer zu zeigen, damit jedermann sich ein Bild von den Regierenden in der Hauptstadt Moskau machen konnte in der unübersehbaren Zahl der abgelegenen Städte und Dörfer, was manchmal religiöse, ikonenhafte Züge bekam. Und überall tauchte jetzt Stalin auf, dem wahre Wunderfähigkeiten zugeschrieben wurden.
Die praktischen Schritte wurden täglich auf die Erkenntnisse und Weisheiten von Marx, Engels, Lenin und Stalin zurückgeführt und alle Diskussion beeinflusst mit den Zitaten aus ihren Werken: „Genosse Stalin hat gesagt …“ Das kannte man in Deutschland nur aus der kirchlichen Predigt, wo ein Bibelwort das Alpha und Omega war.
Die demokratischen Traditionen waren zwar verschüttet gewesen, aber nicht völlig vergessen. Bereits 1948 musste man sich mit den Problemen der bürgerlichen Revolution beschäftigen und auf die Forderungen der Liberalen theoretisch eingehen. Zwar wurde der revolutionär-demokratische Teil der 48er besonders hervorgehoben, aber das stärkte die selbstbewussten Kräfte. Man lernte, dass Marx aus dem liberalen Bürgertum kam und Engels gar ein Fabrikant gewesen war, der nach dem Gesetz des Kapitals produzierte. Die Zeit war widerspruchsvoll und schwierig, einfache Antworten fand niemand, er musste sich seine Überzeugung selber suchen. Die heutigen, oft maulflinken Antworten geben das Bild von der Nachkriegszeit nicht richtig wieder, manches erinnert sogar an die Situation von damals, an die Schwierigkeiten, sich durch den Dschungel der falschen Prophetien den eigenen Weg zu bahnen. Die Jugend fasste die Aufgaben unbekümmert an, aber in einer Beziehung hatte sie es leichter als die heutige junge Generation, sie kannte die zynische Frage nicht, die neulich in der Zeitung stand: „Gehst du noch zur Schule, oder bist du schon arbeitslos?“
Besatzer als Freunde?
Seit dem Einmarsch der Sowjetarmee in den östlichen Teil unseres Landes überließ sie nichts dem Zufall, wie die westlichen Besatzungsmächte übrigens auch nicht. Obwohl Exzesse gegenüber der Zivilbevölkerung bald abgestellt wurden, trug die Rote Armee im Gegensatz zu den amerikanischen und englischen Truppen doch den Ruch mit sich, sie hätte Millionen von Einwohnern aus den Ostgebieten bis zur Oder aus deren Heimat vertrieben, auf die Flucht geschickt. Niemand wollte sich daran erinnern, dass der Befehl von Himmler ausgegeben worden war, dass die deutschen Armeen die Politik der verbrannten Erde praktiziert hatten, dass die Brücken und Kirchtürme nicht von der Roten Armee gesprengt worden waren. Jedes Pferd, jede Kuh sollte nach dem Westen getrieben werden, alle Männer zwischen 16 und 60 wurden in den Volkssturm gepresst, Frauen an der Panzerfaust ausgebildet. Dieses Bild erhielten die Fronttruppen von den Deutschen. Mit wenigen Ausnahmen kapitulierten die Städte nicht, sondern leisteten bis in die Ruinen von Berlin erbitterten Widerstand, in der Hoffnung auf eine der versprochenen Wunderwaffen. Als das Ende unausbleiblich war, machte sich in Not und Elend tiefe Verzweiflung breit. Doch die überall eingesetzten Stadtkommandanten waren angewiesen, schnelle und wirksame Maßnahmen zur Normalisierung einzuleiten. An ihnen lag es, welche deutschen Partner sie suchten und einsetzten. So gewöhnte sich die Bevölkerung daran, dass die Anordnungen der Besatzungsmacht immer als Befehle veröffentlicht wurden und dadurch den Charakter von Zwangsmaßnahmen bekamen, den sie meistens gar nicht hatten. Waffen mussten natürlich abgeliefert werden, aber auch Radiogeräte. Die großen Naziführer waren wie vom Erdboden verschluckt, so hielt man sich an die kleinen. Besonders streng verhielt man sich gegen die „Wehrwölfe“, eine von der Hitlerjugend geplante, aber nicht mehr wirkungsvoll umgesetzte Partisaneneinheit. Den sowjetischen Truppen fiel die Liste mit den Namen der Kandidaten in die Hände, und so wurden die jungen Leute, die oft gar nichts von den Plänen wussten, in Zwangslager gesteckt, in die ehemaligen KZ oder andere schnell aufgebaute Gefängnisanstalten. Mit ihnen wurden die Blockleiter, untergeordnete Vertrauensleute in den Wohnbezirken, eingesperrt. Wer schuldig war, kam vor die Militärgerichte, später auch vor die neue Justiz. Heute werden sie oftmals als „Opfer des NKWD“ (Narodny kommissariat wnutrennich djel – Volkskommissariat des Innern) hingestellt.
Die Besatzung verfuhr also nach einer Doppeltaktik. Sie entfernte wirkliche oder vermeintliche Nazianhänger aus dem öffentlichen Leben – so wurden alle Lehrer, die in der NSDAP Mitglied gewesen waren, aus dem Schuldienst entfernt –, und sie organisierte die antifaschistischen Kräfte zur Belebung der gesellschaftlichen Funktionen. Man hört heute, dass es um den Aufbau eines sozialistischen Systems nach sowjetischem Vorbild gegangen sei, aber das ist nicht richtig. Im „Aufruf der KPD“ vom Juni 1945 steht davon unter den anderen Aufgaben, die mit der Beseitigung des Faschismus und dem Aufbau demokratischer Verhältnisse zusammenhingen, kein Wort. Dieser Aufruf musste Stalin in Moskau vorgelegt werden. Die Kommunisten Fred Oelßner, der Vertrauens- und Verbindungsmann Stalins in der KPD-Führung in Moskau, und Paul Wandel waren bei Wilhelm Pieck als redaktionelle Hilfen. In einem Gespräch, das ich mit Paul Wandel, damals schon hoch betagt, geführt habe, bestätigte er, dass Stalin persönlich in den von der KPD ausgearbeiteten Entwurf folgende Ergänzung eingearbeitet habe:
„Wir sind der Auffassung, dass der Weg, Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen, falsch wäre, denn dieser Weg entspricht nicht den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen in Deutschland. Wir sind vielmehr der Auffassung, dass die entscheidenden Interessen des deutschen Volkes in der gegenwärtigen Lage für Deutschland einen anderen Weg vorschreiben, und zwar den Weg der Errichtung eines antifaschistisch-demokratischen Regimes, einer parlamentarisch-demokratischen Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk.“
Die Zielstellung einer Republik mit parlamentarischer Demokratie war sicherlich richtig, auch deren antifaschistische Grundlage, aber weder die sowjetische Besatzungsmacht noch die Masse des deutschen Volkes hatte ein solches Regime persönlich erlebt. Welcher sowjetische Offizier konnte schon sagen, wie diese Republik zu funktionieren hätte? So blieb es von Anfang an beim Kommandosystem gegenüber den deutschen Interessen und deren Vertretern. Die polemischen Attacken gegen die „Steigbügelhalter Moskaus in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) u.ä.“ sind lediglich bösartig, den Kern des Verhältnisses treffen sie nicht. Die Entscheidungen wesentlicher Art fielen ausnahmslos in Moskau und wurden von der Militärverwaltung, der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) mitgeteilt. Danach konnten vielleicht noch diese oder jene sekundären Änderungen angebracht werden, am Charakter änderte das nichts.
Dazu kam ein System von Beratern aus der SMAD, das sich nach Gründung der DDR in die Sowjetische Kontrollkommission umwandelte. In Karlshorst, dem Berliner Stadtteil, in dem die SKK ihren Sitz genommen hatte, arbeiteten über 700 Spezialisten, entsprechend den Sektoren des öffentlichen Lebens. Die Entscheidungen lagen bei den Militärs, vertreten durch die Marschälle Shukow, Sokolowski und, als dessen Nachfolger, Tschuikow, den Sieger von Stalingrad. Der Aufbau der Polizei erfolgte unter ihrer unmittelbaren Anleitung. In der politischen Abteilung arbeiteten die Kulturoffiziere, meistens Germanistik- oder Philosophieprofessoren, die über eine gründliche Bildung in deutscher Sprache und Dichtung verfügten und viele Deutsche dadurch verblüfften, dass sie Goethe und Heine fehlerfrei vortragen konnten. Der Leiter dieser Abteilung war Oberst Tulpanow, zugleich der Parteivertreter der KPdSU.
Einen entscheidenden Einfluss hatten die als Berater bezeichneten, in Wirklichkeit aber sehr einflussreichen Funktionäre mit ausgezeichneten Kenntnissen auf ihren Gebieten, vor allem der Wirtschaft und Landwirtschaft. Sie alle waren immer durch ihre deutschen Vertrauensleute bis in die Einzelheiten genau informiert und reagierten meistens mit detailreichen Vorschlägen an ihre deutschen Partner. Der für unsere Betrachtung entscheidende Mann ist der Diplomat Wladimir Semjonowitsch Semjonow, außerordentlich begabt, elegant und wendig in seinem Auftreten. Als er 1945 die Aufgabe in Deutschland übernahm, war er ein junger Mann von 34 Jahren. Er wirkte zehn Jahre lang in der DDR und wurde abberufen, um im Jahre 1955 die Position eines stellvertretenden Außenministers zu übernehmen. Ihm oblag es, die Verbindung zu den Partei- und Staatsstellen in jeder Phase der Entwicklung zu halten, stets genauestens informiert zu sein und direkten Einfluss auf die Durchsetzung der sowjetischen Interessen zu nehmen. Er nahm an den Sitzungen des Politbüros der SED teil und verhandelte häufig auch mit einzelnen Politikern, die er direkt zu sich bestellte. Auf seine Informationen stützten sich in Moskau das Zentralkomitee der KPdSU und das Außenministerium. Sein Einfluss erstreckte sich auch auf Verbindungen in den Westen.
Aus der Struktur der sowjetischen Verwaltung ergibt sich bereits, dass der Einfluss der Besatzungsmacht überhaupt nicht zu überschätzen ist. Die Ereignisse um den 17. Juni 1953 werden das noch zeigen.
Planwirtschaft
Unter der Leitung der SMAD begannen im Osten tiefgreifende Veränderungen der Besitzverhältnisse. Der Boden der großen Güter über 100 Hektar wurde aufgeteilt. Die Neubauern erhielten das ihnen zugeteilte Land als erblichen Besitz, also entschädigungslos. Darauf ließ sich bauen. Die Großbetriebe der Rüstungskonzerne in den östlichen Ländern und die Unternehmen der Kriegsgewinnler, die von den Aufträgen der Wehrmacht gelebt hatten, wurden enteignet. Ein Volksbegehren in Sachsen, dem sich die anderen Länder anschlossen, brachte eine eindeutige Zustimmung der Bevölkerung, die darin eine Bestrafung der Schuldigen sah. Etwa 100 der großen Betriebe und Konzerne der Chemie, der Grundstoffindustrie, des Maschinenbaus, des Bergbaus, darunter die Urangruben in Sachsen und Thüringen wurden nicht der deutschen Verwaltung in Gestalt der Deutschen Wirtschaftskommission (DWK) unterstellt, sondern gingen in das Eigentum einer Sowjetischen Aktiengesellschaft (SAG) über als ein Teil der Reparationen, der Entschädigungen für die angerichteten Zerstörungen in der Sowjetunion. Diese Betriebe wurden durch einen sowjetischen Generaldirektor geleitet, der die deutsche Betriebsleitung anweisen konnte.
Aus diesem Grunde wussten die deutschen Planungsorgane der DWK niemals genau, welche Produkte für den Aufbau in der Ostzone zur Verfügung stehen konnten. Aber auf der Planung beruhten die Berechnungen für die Perspektiven. Allerdings beschränkten sich die Reparationsleistungen nicht auf diese Betriebe, auch andere wurden dazu herangezogen. Ein weiteres Problem, das den Aufbau hemmte, waren die willkürliche Beschlagnahme und als Reparationszahlung erklärte Abbauten funktionierender Betriebe oder Betriebsteile durch örtliche Kommandanten. Hier wurde eine Kleinbahn, dort die Turbine eines Wasserkraftwerkes verpackt und abtransportiert. Diese unkontrollierten Maßnahmen brachten der Sowjetunion keinen Gewinn, denn sie konnten nicht irgendwo aufgebaut werden und wurden oftmals gar nicht eingesetzt. Ende der 50er Jahre wurden die Turbinen eines Wasserkraftwerkes aus dem Harz bei Leningrad entdeckt, sie lagen noch verpackt wie beim Abbau auf einem Lagerplatz, wurden zurückgegeben und wieder eingebaut.
Das Hauptproblem des industriellen Aufbaus in der DDR aber war das Fehlen nennenswerter Kapazitäten von Eisen und Stahl. Um diesen Mangel zu überwinden, wurde das Eisenhüttenkombinat Ost (EKO) bei Fürstenberg an der Oder geplant. Nach verschiedenen Konzeptionen, die auf Steinkohle aus dem Ruhrbergbau und Erz aus Schweden basierten, entwickelte Fritz Selbmann, verantwortlicher Minister für Grundstoffindustrie, eine andere Lösung, die störungsfrei funktionieren konnte. Er plante mit polnischer Steinkohle und ukrainischem Erz. Es war ihm von vornherein klar, dass dazu die Genehmigung Stalins persönlich erforderlich war.
Mit seinem Genossen aus der zwölfjährigen Haft in Zuchthäusern und Konzentrationslagern, Fritz Grosse, dem letzten Vorsitzenden des Kommunistischen Jugendverbandes und langjährigen Mitarbeiter der Kommunistischen Internationale, entwickelte er die Einzelheiten, um die Zustimmung zu bekommen. Grosse war gleich nach 1945 der Vertreter der SED in Moskau geworden und hatte dort seine alten Freunde aus der Zeit vor dem Faschismus aufgesucht. Einer von ihnen saß als Referent im Vorzimmer Stalins. Über diesen Mann wurde der detaillierte Plan auf den Schreibtisch des mächtigsten Mannes der sozialistischen Welt gelegt. Auf den Rat des Mitarbeiters hatten Selbmann und Grosse am Ende ihrer Pläne den Vorschlag gemacht, Werk und Wohnstadt den Namen Stalins zu geben und um dessen Zustimmung ersucht. Ob diese Schmeichelei nun den Ausschlag gegeben hat, weiß niemand mehr zu sagen, aber der eigenmächtige Plan, von dem außer den beiden niemand etwas wusste, wurde ohne Beanstandungen genehmigt. So wurde als wichtigste Maßnahme der 50er Jahre das riesige Kombinat und die erste neue Stadt mit erheblichen Wohnqualitäten unter großen Anstrengungen gebaut.
Da die Autorität Stalins dahinter stand, wurde natürlich alles getan, um den Erfolg zu garantieren, aber die Eigenmächtigkeit Selbmanns, eines Mannes mit selbstständigem Denken und Tatkraft, wurde ihm beinahe zum Verhängnis. In den Jahren der Jagd auf Agenten des Imperialismus in den eigenen Reihen, der fingierten Prozesse, um die Theorie des sich ständig verschärfenden Klassenkampfes im Inneren des sozialistischen Lagers zu stützen, dem die höchsten Funktionäre in Bulgarien, Ungarn und der Tschechoslowakei zum Opfer fielen, wurde auch nach Verbindungen zu dem angeblichen Agenten der USA Noel Field gesucht. Da man diese schwerlich bei Leuten nachweisen konnte, die während der ganzen Hitlerzeit im Zuchthaus gesessen hatten, wurden andere Wege gefunden, dem selbstbewussten Selbmann, der es gewagt hatte, direkt mit Stalin Verbindung aufzunehmen, Versagen vorzuwerfen.
Die üblichen Anlaufschwierigkeiten beim Bau des Hochofens wurden auf das subjektive Versagen der leitenden Männer zurückgeführt. Der Hauptverantwortliche dafür war der Minister Fritz Selbmann. Er und einige andere seiner Mitarbeiter erhielten Parteistrafen, der Werkleiter wurde abberufen und Selbmann zusätzlich zu seinem Ministeramt mit der Leitung des Werkes beauftragt, eine einmalige Konstruktion. Der Minister für Staatssicherheit, Wilhelm Zaisser, auf der Suche nach Material für Agentenprozesse, fand unter den Häftlingen des Zuchthauses Brandenburg einen seit 1945 einsitzenden Gießereitechniker, Hubert Hermanns. Für seine Entlassung erhielt er von Zaisser den Auftrag, ein Gutachten über die Planung, Projektierung und den Aufbau des EKO anzufertigen. Dieses „Gutachten“ wurde den Ausarbeitungen der bisher an diesen Aufgaben arbeitenden Leiter entgegengesetzt. Über diese Männer wurden gleichzeitig Dossiers angefertigt und diese Walter Ulbricht vorgelegt.
Ulbricht hatte sich im Februar 1952 persönlich von der Lage im EKO überzeugt und war beunruhigt. Da kam eine Anklageschrift gerade recht. Drei Polizisten hatten 16 Seiten einer Schrift eingereicht mit dem Titel „Verdacht der bewussten Störung bei Projektierung und Aufbau des Eisenhüttenkombinates Ost in Fürstenberg“. In dieser Denunziation wurde Minister Selbmann verantwortungsloses Verhalten gegenüber einer Verschwörung von Technikern und Ingenieuren vorgeworfen. Sollte hier eine Neuauflage des Industrieprozesses von 1929 in der Sowjetunion gestartet werden? Ein Hinweis aus der „Spitze der SKK“ deutet darauf hin, man müsse dem Selbmann eins auf den Kopf geben. Hatte Ulbricht den Hinweis verstanden?
Die Sache ging jedoch ganz anders aus. Zwei sowjetische Ingenieure, auf Bitten Ulbrichts zur Begutachtung gekommen, erteilten ausschließlich Lob für „die Grundkonstruktion des Ofens“, die auftretenden Probleme seien der Unerfahrenheit deutscher, zweifellos gutwilliger Kollegen geschuldet. Es fehlte eine Sinteranlage, die war aber gerade von Ulbricht als entbehrlich gestrichen worden. Wer hatte nun Recht? Zur Unterstreichung der Rolle Ulbrichts verfasste der junge Dichter Bernhard Seeger das Gedicht „Spitzbartkraulen“, in dessen letzter Strophe es heißt:
„Und zwischen Stubben und Schienen – der Sand ist noch pulvrig und hart – steht Walter Ulbricht und lächelt und krault sich sinnend den Bart.“
Selbmann erhielt, wie erwähnt, seine Parteistrafe, und der Spitzbart von Ulbricht sollte am 17. Juni des folgenden Jahres noch eine Rolle in den Losungen spielen, ebenso wie die Tatkraft des Kommunisten Fritz Selbmann. Hermanns erhielt 1000 Mark Lohn und wurde in den Westen abgeschoben.
Der 17. Juni ist nicht vom Himmel gefallen
Schwierigkeiten beim Aufbau der Wirtschaft in der DDR waren also durchaus nicht alle objektiver Natur. Das Misstrauen schlich sich auch in anderen Bereichen ein. In der Landwirtschaft gab es Schwierigkeiten mit den Großbauern, die mit den Pflichtabgaben, die ihnen fast nichts von ihrer Produktion für den freien Verkauf ließen, mit dem sie höhere Preise erzielen konnten, nicht einverstanden waren. Gegen sie wurde mit administrativen Maßnahmen verschiedener Art, mit Steuererhöhungen, Geld- und Haftstrafen vorgegangen. Anstatt das Bündnis mit den am meisten erfahrenen Landwirten zu pflegen, brachte man sie gegen sich auf. Die bald entstehenden Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften konnten den Ernteverlust und das Minderaufkommen aus der Viehzucht noch nicht ausgleichen, in den Dörfern staute sich der Unwille nun auch der Mittelbauern, die sich ebenfalls benachteiligt fühlten.
Vergleichbare Vorgänge konnte man auch unter der Intelligenz beobachten. In der Kunst kam die Theorie auf, die alle modernen Strömungen als Formalismus bezeichnete, weil die Ansichten und Praktiken der Künstler über die richtige Form des Ausdrucks ihrer Empfindungen seit dem Anfang des Jahrhunderts sich von dem bis dahin herrschenden Naturalismus erheblich unterschieden. Anfang der 50er Jahre begann eine vom Zaune gebrochene Diskussion über „Realismus und Formalismus in der Kunst“, ausgelöst durch einen Artikel in der „Täglichen Rundschau“, dem Blatt der SKK, angefertigt ebendort, natürlich unter einem Pseudonym. In diesem Artikel und den nachfolgenden Äußerungen wurden bedeutende Strömungen deutscher Kunst angegriffen und Käthe Kollwitz und Ernst Barlach als dekadent klassifiziert. Ähnliche Angriffe mussten auch Brecht und Eisler hinnehmen, an ihren Werken wurde herumgekrittelt, sogar das Politbüro befasste sich damit. Wer von da ab in irgendeiner Weise Anstoß erregte oder Neues schuf, das nicht gleich angenommen wurde, musste sich einen „Formalisten“ schimpfen lassen. Natürlich hatte das auch Folgen für die Veröffentlichung seiner Werke und mit diesen Einschränkungen auch für seine materielle Lage.
Diese Vorgänge waren nicht zufällig, sie folgten der Bekämpfung der Intelligenz in der Sowjetunion und dem Muster, wie große Meister vom Range eines Schostakowitsch oder Prokofjew gemaßregelt wurden und auf die Maßstäbe subalterner Geister zurückgestutzt werden sollten. In Deutschland waren die Künstler aus dem Exil mit wenigen Ausnahmen in die DDR zurückgekehrt und fanden hier gute Arbeitsmöglichkeiten vor, vor allem konnten sie einen wesentlichen Beitrag bei der Umerziehung der Bevölkerung leisten und eine neue humanistische Haltung aufbauen. Der offiziellen Erklärung wurde nunmehr eine rigide Praxis entgegengestellt. Niemand verstand das. Die meisten Künstler standen traditionell links, viele waren Mitglied der Arbeiterparteien und in der Weimarer Republik Mitglied der sozialistischen Künstlervereinigungen gewesen, sie hatten gleich nach Kriegsende die neuen Berufsverbände gegründet, nun wehrten sie sich gegen eine neue Bevormundung und Zensur.
Ähnlich sah die Lage bei den Pädagogen aus. Die Schulreform in der DDR war eine bedeutende Leistung, die auf den Erkenntnissen aus der Weimarer Republik fußte. In der Pädagogik gaben damals die Schulreformer mit einem entschiedenen Flügel, den radikalen Schulreformern, den Ton an. Die Nazis beendeten diesen Prozess, die Schule lebensverbunden zu gestalten, und schickten die Schulreformer in die Wüste.
Nun, nach dem Ende dieser Tyrannei, konzipierten führende Schulreformer die neue Schule als Einheitsschule, die allen Schülern die gleichen Bildungschancen einräumten. Die einklassige Dorfschule wurde von der achtklassigen Grundschule mit Fachunterricht abgelöst, ihr folgte die vierklassige Oberschule, die zum Abitur führte. Privatschulen für Reiche gab es nicht. Die Lehrpläne waren in allen Schulen gleich, und bald erhöhte sich das Lehr- und Lernniveau der Schulen. Eine neue Lehrergeneration führte das Werk der Schulreformer, in deren Geist sie ausgebildet war, sicher fort.
Wie in der Kunst wurden auch hier plötzlich Ansprüche erhoben, die Sowjetpädagogik zum höchsten Maßstab zu erheben. Jedermann fragte sich, was Besonderes an dieser Sowjetpädagogik sei. Die allgemeinen Grundzüge waren ähnlich der Erziehung in allen Schulsystemen, die Lehrbücher sammelten Meinungen von den Klassikern des Marxismus, meistens von weit hergeholt, wo sie sich aus gegebenem Anlass in dieser oder jener Form, jedoch niemals systematisch mit der Erziehung beschäftigt hatten. Blieb noch der Hinweis auf die originellen Erziehungsmethoden des Pädagogen Makarenko, aber er war ein Sonderfall. Seine Verdienste bestanden darin, dass er für die vielen herumstreunenden Jugendlichen, die in den Wirren der Oktoberrevolution eine kriminelle Gefahr geworden waren, eine Internatserziehung mit Arbeitsaufgaben eingeführt hatte. Dagegen war nichts zu sagen, aber diese Situation traf bei uns nicht zu, seine Bücher wurden gelesen wie Nachrichten aus einem anderen Land.
An meiner Universität gab es eine starke Pädagogik, angeführt von Professor Peter Petersen, der in Jena eine Versuchsschule zur Einführung wissenschaftlich begründeter Methodik für verschiedene Fächer leitete, die der Friedrich-Schiller-Universität unterstand. Für die Studenten waren Hospitationen bei diesen Lehrern anregend und interessant in verschiedener Hinsicht. Alles drehte sich darum, aus ganz durchschnittlichen Schülern mit normaler Begabung leistungsstarke Persönlichkeiten zu bilden. Plötzlich war diese Schule zu einer elitären Anstalt erklärt worden, die in einem modernen Schulwesen nichts zu suchen hätte. Die wissenschaftlich ausgearbeiteten Experimente wurden auf Weisung des Thüringer Volksbildungsministeriums abgebrochen, der verdiente Petersen ins Abseits gestellt. Sein „Jena-Plan“ hatte eigentlich eine sozialistische Zielstellung gehabt, er diente dem Prinzip der Gemeinschaft als Mittel und Ziel der Erziehung. In den Jahren von 1923, seit dem Aufschwung der Schulreformbewegung, bis 1950, fast dreißig Jahre lang, hatte er an seinem dreibändigen Werk „Der Große Jena-Plan“ gearbeitet, das nun nichts mehr wert sein sollte. Man sagte, er sei an Gram gestorben.
Kaum hatte die Orientierung auf eine antifaschistisch-demokratische Ordnung erste Erfolge gezeigt, wurde die günstige Entwicklung unterbrochen, sogar versucht, sie abzubrechen und die sie tragenden Persönlichkeiten herabzusetzen, zu behindern, zu verunsichern. Der erste große Schaden für den Neuaufbau war eingetreten, die neue Idee diskreditiert. Der 17. Juni hat eine Vorgeschichte, er ist nicht vom Himmel gefallen. Der Hauptvorwurf gegen die DDR bestand darin, dass eine freiheitliche Entwicklung des Einzelnen nicht garantiert sei. Noch bis in die 90er Jahre bekämpfte man die DDR mit dem Slogan „Freiheit statt Sozialismus“. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass die Behauptung, es hätte in der DDR keine Freiheiten gegeben, in der allgemeinen Form nicht zutrifft.
Richtig ist, dass es nicht selten willkürliche Entscheidungen gab, die von oben verordnet wurden, wie überhaupt der Eindruck erweckt wurde, der Einzelne könne glücklich werden, wenn er die weisen Entscheidungen der Leitenden akzeptierte. Die reformerische Entwicklung in den 40er und 50er Jahren ähnelte sehr einer Revolution von oben, so wie sie in Deutschland nicht zum ersten Mal vorkam, auch die Stein-Hardenbergschen Reformen gehören dazu, die erste preußische Verfassung wurde von Friedrich Wilhelm IV. erlassen, und auch die in der Revolution 1918 erkämpften Rechte wurden immer wieder durch konterrevolutionäre Entwicklungen in Frage gestellt, bis dann der Faschismus alle Freiheiten zugrunderichtete. Wir jungen Leute verstanden damals unter Freiheit etwas ganz Konkretes, nämlich die Teilhabe und Mitwirkung an den großen Veränderungen, die realiter auf allen Gebieten vor sich gingen. Wir halfen den Neubauern, das Baumaterial zu bergen, das sie für ihre Wohnungen und Ställe benötigten. Wir brachen die hohen Mauern der Gutshöfe und Parks ab, die Besitzer hatten ihr Dorf im Stich gelassen, und die Flüchtlinge und Umsiedler, die jetzt in den Gutshäusern Unterkunft bekommen hatten, brauchten keine Mauern. Freiheit – das war für uns zu jenen Zeiten die Forderung des Tages.
Es wird dem heutigen Leser schwerfallen zu verstehen, warum die neuen Ansätze des gesellschaftlichen Lebens auf allen Gebieten infrage gestellt oder gar abgebrochen wurden. Die Antwort ist nicht mit ein paar Worten zu geben, man wird sie an verschiedenen Stellen dieses Buches finden. Hier nur wenige allgemeine Hinweise: Schon im Jahre 1947 wurde in vielen Städten der SBZ die „Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion“ gegründet. Sie sollte einen geistigen Beitrag dazu leisten, das belastete Verhältnis zwischen den Ländern zu verbessern und Informationen über die Sowjetunion zu vermitteln. Dabei kamen viele Tendenzen in die SBZ und später in die DDR, in denen auch Fehlentwicklungen in der Sowjetunion vermittelt wurden, so zum Beispiel in der Genetik oder in der Literatur- und Kunstauffassung. Alle diese für uns neuen Informationen wurden ausnahmslos unkritisch diskutiert. Obwohl wir oft zweifelten, gab es doch keine souveräne Diskussion.
Weiterhin ist zu beachten, dass es durchaus starke Kräfte in Moskau gab, die mit dem sogenannten besonderen deutschen Weg zum Sozialismus nicht einverstanden waren. Mit der Ablehnung dieses Versuches, der auf Stalins Einfügung in den KPD-Aufruf zurückging, wurde das Sowjetmodell nach und nach durchgesetzt, da es in jedem Fall als maßgeblich und vorbildlich hingestellt wurde. Die Gesellschaft zum Studium wurde bereits zwei Jahre später in die „Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft“ umgewandelt. Das allgemeine Studium wurde beendet, was die selbstlose Verwendung vorbildlicher Erfahrungen einschloss, und stattdessen der stärker werdende Stalin-Kult propagiert. Die Anhänger eines zu Recht anzustrebenden freundschaftlichen Verhältnisses zur Sowjetunion wurden durch massenhafte Werbung für die Gesellschaft vermehrt, so dass bald jeder Werktätige dort seinen geringen Mitgliedsbeitrag bezahlte. Damit war er ein „Freund“.
*** Ende der Demo-Version, siehe auch http://www.edition-digital.de/Bentzien/17Juni/ ***
Hans Bentzien
Geboren 1927 in Greifswald. Volksschule, Lehrerausbildung (LBA). Studium zum Dipl.rer.pol. in Jena und Moskau.
Verschiedene kulturpolitische Funktionen. Kulturminister 1961 - 1966.
Verleger. Rundfunk- und Fernsehmitarbeiter (Leitender Redakteur für Geschichtspublikationen). Zuletzt Generalintendant des Deutschen Fernsehfunks.
Autor von Fernsehfilmen, Theaterstücken, Biografien (Elisabeth von Thüringen, Martin Luther, Thomas Müntzer, Friedrich II. von Preußen, Carl August von Hardenberg, Claus Schenk Graf von Stauffenberg) und Sachbüchern zu Fragen der Zeitgeschichte und der Geschichte Brandenburgs. Autobiografie.
Wohnhaft in Bad Saarow. Verheiratet, drei Kinder. Er verstarb am 18. Mai 2015.
Bibliografie (Auswahl):
Wie Robinson kann man nicht leben, Der Kinderbuchverlag, Berlin 1974
Ein Buch vom Kommunismus. Für junge Leute, Der Kinderbuchverlag, Berlin 1976
Meister, Meister, zeig uns Arbeit!, Der Kinderbuchverlag, Berlin 1979
Wohin die Reise geht, Der Kinderbuchverlag, Berlin 1980
Bruder Martinus, Der Kinderbuchverlag, Berlin 1983
Jagdzauber und Totemtier, Der Kinderbuchverlag, Berlin 1984
Festung vor dem Strom, Militärverlag der DDR, Berlin 1986
Im Zeichen des Regenbogens. Aus dem Leben Thomas Müntzers, Der Kinderbuchverlag, Berlin 1989
Elisabeth. Das irdische Leben einer Heiligen. Biografie, Verlag Neues Leben, Berlin 1990
Die Heimkehr der Preußenkönige, Verlag Volk und Welt, Berlin 1991
Unterm Roten und Schwarzen Adler, Verlag Volk und Welt, Berlin 1992
Meine Sekretäre und ich, Verlag Neues Leben, Berlin 1995
Meine Amsel singt in Tamsel, Westkreuz Verlag, Berlin 1996
Damm und Deich – Fruchtbar und reich, Westkreuz Verlag, Berlin 1997
Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Zwischen Soldateneid und Tyrannenmord, Fackelträger-Verlag, Köln 1997
Zauberhaftes Saarow, Westkreuz Verlag, Berlin 1999
Nur in Rheinsberg bin ich glücklich gewesen: Kronprinz Friedrich in Küstrin, Ruppin und Rheinsberg, Westkreuz Verlag, Berlin 2001
Die Irrfahrt der Könige, Westkreuz Verlag, Berlin 2000
Das ungleiche Königspaar, Westkreuz Verlag, Berlin 2001
Ich, Friedrich II, Verlag Volk und Welt, Berlin 1991
Jenseits der Oder, Westkreuz Verlag, Berlin 1998
Überhaupt zeige man Charakter!, Westkreuz Verlag, Berlin 2002
Fragen an die DDR, Edition Ost, Berlin 2003
Was geschah am 17. Juni?, Edition Ost, Berlin 2003
Division Brandenburg, Edition Ost, Berlin 2004
Warum noch über die DDR reden?, Verlag Das Neue Berlin, Berlin 2009
E-Books von Hans Bentzien
Festung vor dem Strom
Der Zufall fügte es, dass Hans Bentzien während seines Studiums in Moskau das Zimmer mit einem Mann teilte, der in der Sowjetunion großes Ansehen genießt, dessen Tat in die Annalen der Stalingrader Schlacht eingegangen ist: Jakow Fedorowitsch Pawlow.
Unter dem Kommando des ehemaligen Sergeanten verteidigte eine Handvoll Soldaten 58 Tage lang ein strategisch wichtiges Gebäude bis zum Äußersten. Gestützt auf die Erlebnisberichte seines Studiengefährten ist Hans Bentzien den Spuren der Verteidiger gefolgt. In seinem fesselnden Tatsachenbericht schildert er das Kampfgeschehen detailliert - auch auf Seiten der deutschen 6. Armee - und lässt den Leser mit den Verteidigern vertraut werden.
Die enge persönliche Bindung des Autors zu Jascha Pawlow verleiht dem Buch einen besonderen Reiz, Unmittelbarkeit und Frische.
Das spannende Buch wurde erstmals 1986 beim Militärverlag der DDR veröffentlicht.
Ein Buch vom Kommunismus. Für junge Leute
Das erste Kapitel des 1976 erschienen Buches, das der Autor in den Beginn des 21. Jahrhunderts gelegt hat, erscheint wie ein utopischer Roman, denn wir alle haben diese Zeit anders erlebt. Der „real existierende Sozialismus“ in der DDR, in der nicht mehr existierenden Sowjetunion und in den anderen östlichen Ländern wurde wieder vom Kapitalismus verdrängt. Warum wurde also dieses Buch erneut veröffentlicht?
Weil es der kürzlich verstorbene Autor für bewahrenswert hielt? Weil es noch, wenn auch wenig, Mitglieder kommunistischer Parteien gibt? Weil nach wie vor das sozialistische Kuba existiert, das sich anschickt, sich aus der erzwungenen Isolierung zu lösen?
Das Buch beschreibt fundiert, jeweils eingebettet in die Geschichte seiner Zeit, den Weg von den utopischen Sozialisten über die Anfänge der sozialdemokratischen Bewegung bis hin zur Oktoberrevolution und der Entwicklung in der DDR.
Insbesondere der euphorischen Beschreibung des DDR-Sozialismus wird der heutige Leser nicht mehr zustimmen wollen. Doch bei der Beschreibung des Kapitalismus im 19. und 20. Jahrhundert, einschließlich Arbeitslosigkeit und dem Drang nach neuen Absatzmärkten und Rohstoffquellen, der dabei auch vor Kriegen nicht zurückschreckt, wird er Vergleiche zur aktuellen Situation in Deutschland herstellen. Es ist sicher auch interessant, die revolutionären Wurzeln der deutschen Sozialdemokratie zu studieren.
Wer sich ohne Vorurteile kritisch diesem Thema stellt, für den ist dieses Buch eine Fundgrube. Das Buch wurde ursprünglich für Kinder ab 12 Jahre geschrieben und beschreibt deshalb die geschichtlichen Epochen knapp und präzise als Ergänzung zum Schulunterricht. Wer eine DDR-Schule besucht hat erinnert sich an vieles und kann es nun mit seinem heutigen Wissens- und Erfahrungsstand einordnen.
Das Wissen um die Entstehung der Theorie des Kommunismus darf nicht verschwiegen werden. Nach wie vor träumt die Menschheit von einer Welt des Friedens, der Arbeit, der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit, frei von Ausbeutung und Unterdrückung, in der jeder seine Fähigkeiten und Talente voll entfalten kann.
Bruder Martinus
„Ich bin ein Bauernsohn, der Urgroßvater, mein Großvater, der Vater sind richtige Bauern gewesen. Ich hätte eigentlich, wie jener sagte, ein Vorsteher, ein Schultheiß und was sie sonst im Dorf haben, irgendein oberer Knecht über die anderen werden müssen. Danach ist mein Vater nach Mansfeld gezogen und dort ein Berghäuer geworden. Dorther bin ich.“
So erzählt Martin Luther von seiner Herkunft. Wie aus dem Sohn eines Bauern und Berghäuers der Mönch Bruder Martinus wurde, der es wagte, der allmächtigen und unermesslich reichen römisch-katholischen Kirche den Kampf anzusagen, davon berichtet Hans Bentzien in diesem Buch. Zeitgenossen Martin Luthers kommen zu Wort - Freunde und Feinde -, es entsteht das Bild einer kraftvollen, mitreißenden und unbestechlichen Persönlichkeit voller Leidenschaft und Charakter, Vielseitigkeit und Gelehrsamkeit.
Luther war einer von ihnen. Als er gegen die mächtigste Feudalmacht und gegen die höchste kirchliche Autorität, den Papst, antrat und eine Reform der Kirche forderte, gab er - in seiner Tragweite ihm selbst nicht bewusst — das Signal zu einer breiten antifeudalen Bewegung, zu Reformation und Bauernkrieg: zur ersten bürgerlichen Revolution in Deutschland. Auch die höchste weltliche Autorität, der Kaiser, stellte sich gegen ihn, und obwohl Luther wusste, dass sein Leben in Gefahr war, setzte er mit Mut und Standhaftigkeit seinen Kampf fort und wurde zu einem über Jahrhunderte unvergessenen Vorbild all jener, die für Freiheit und gesellschaftlichen Fortschritt streiten.
Das Buch erschien erstmals 1983 in Der Kinderbuchverlag Berlin.
Im Zeichen des Regenbogens. Aus dem Leben Thomas Müntzers
Am 13.Juli 1524 sitzen der sächsische Herzog Johann und sein Sohn in der Kapelle des Allstedter Schlosses. Sie wollen Thomas Müntzer predigen hören, um herauszufinden, wie gefährlich er ist für sie. Thomas weiß, dass von dieser Predigt sein weiteres Schicksal abhängt.
Um den Fürsten seine Gedanken klarzumachen, hat er für die Predigt einen Abschnitt aus der Bibel, aus dem Buch Daniel gewählt. Er erzählt von König Nebukadnezar, den einmal ein schwerer Traum gequält hatte. Die besten Denker seines Landes sollten den Traum deuten. Doch der König konnte ihnen nicht sagen, was ihm im Schlaf erschienen war. Nur Daniel besaß soviel Weisheit, den Wunsch des Königs zu erfüllen. Er sprach zu Nebukadnezar: »Du König, hattest einen Traum, und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton.«
Plötzlich wäre ein Stein vom Himmel gefallen, erzählte Daniel weiter, und er hätte die tönernen Füße des Standbildes zerschlagen. Dieser Stein von großer Kraft wuchs und wuchs und bedeckte bald die ganze Erde. »Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte.«
Werden die Fürsten verstehen, dass mit dem Koloss auf tönernen Füßen ihr eigenes Reich gemeint war? Das Gold bezeichnet den Adel, das Silber die reichen Patrizier und Bankiers, das Kupfer die Handwerker, das Eisen die Lohnarbeiter und der Ton die Bauern. Werden sie erkennen, wie alles kommen wird in der Zukunft? Thomas sagt es ihnen, sollen sie ihr Handeln darauf einrichten: Ergreift den Hammer und zerschlagt den Koloss, diese ungerechte Welt, in der alles auf den Schultern der Bauern ruht! Wenn ihr jedoch die euch gegebene Macht missbraucht, dann wird auch euer Reich zerschlagen. Dann wird euch das Schwert genommen und dem Volk gegeben.
Als Thomas seine Predigt beendet hat, verlassen die Herren ohne ein Wort die Kapelle. Ihr Urteil steht fest.
Ein knappes Jahr später, nach der Schlacht bei Frankenhausen, wird Thomas Müntzer, der Feldprediger des geschlagenen Bauernheeres, enthauptet. Sein Kopf wird aufgespießt und als Mahnung zur Schau gestellt.
Hans Bentzien erzählt in dem erstmals 1990 im Kinderbuchverlag Berlin erschienenen Buch vom Leben und Sterben Thomas Müntzers, der in den armen Leuten aus Stadt und Land die Hoffnung auf ein besseres Leben erweckte und ihr Führer wurde im Großen Deutschen Bauernkrieg.
Der Kinderbuchverlag Berlin
Elisabeth Landgräfin von Thüringen. Das irdische Leben einer Heiligen
Wenn man die Wartburg besucht, gelangt man durch einen Laubengang in die Kemenate der heiligen Elisabeth. Sie ist geschmückt mit den berühmten Fresken Moritz von Schwinds, die an das Leben dieser Frau erinnern.
Wer war Elisabeth, Landgräfin von Thüringen, die 1231, nur vierundzwanzigjährig, starb und nach ihrem Tod heiliggesprochen wurde?
Als vierjähriges Mädchen kam sie, eine ungarische Königstochter, an den Hof von Eisenach. Sie war mit dem elfjährigen Sohn des Landgrafen verlobt worden. Auf der Wartburg wird sie erzogen wie die Fürstenkinder auch. Früh zeigen sich ungewöhnliche Charakterzüge. Sie will, dass es gerecht zugeht, und es entwickelt sich bei ihr eine Frömmigkeit, die zu einer sozialen Haltung wird.
Als ihr Verlobter stirbt, wird sie mit dessen Bruder, Ludwig IV., verheiratet. Zwischen beiden entsteht eine echte Liebe — für die auf Verträgen beruhende Heiratspolitik keine Selbstverständlichkeit. Als Landgräfin schärft sich ihr Blick für das Wohlleben bei Hofe und die Not der Bauern. In einer der vielen Hungersnöte, als sie den Landgrafen zu vertreten hat, öffnet sie die Speicher, verteilt auch ihre persönliche Habe, ihren Schmuck. Elisabeth greift die Lehren des Franz von Assisi auf und lebt nach den Geboten der freiwilligen Armut.
Als ihr Mann auf einem Kreuzzug einer Seuche zum Opfer fällt, wird die dem Hofe und Klerus unliebsame Landgräfin abgesetzt und entmündigt. Sie soll sich jetzt dem Willen ihres Beichtvaters unterwerfen. Doch Elisabeth macht nicht ihren Frieden, sondern vertritt weiter konsequent ihre Ansichten. Von ihrem Witwenteil finanziert sie ein Hospital in Marbach. Hier hilft sie täglich den Armen und Kranken. Konrad, ihr Beichtvater, erlegt ihr nun lange Fastenzeiten und Exerzitien auf, um ihren Willen zu brechen. Schließlich prügelt er sie sogar, bis sie es nicht mehr ertragen kann: In der Nacht vom 16. zum 17. November 1231 stirbt sie. Nach ihrem Tode entstehen im Volk viele Legenden um ihr Leben. Das reale Leben tritt immer mehr in den Hintergrund. Hans Bentzien versucht in dem erstmals 1990 im Verlag Neues Leben Berlin veröffentlichten Buch, das wirkliche Leben der Elisabeth nachzuzeichnen, die Motive ihres Handelns, den Zusammenhang mit den sozialen und geistigen Widersprüchen jener Zeit zu ergründen und darzustellen.
Die Heimkehr der Preußenkönige
Die preußischen Könige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. wurden in der Gruft der Potsdamer Garnisonskirche beigesetzt. Vor den heranrückenden sowjetischen Truppen werden zum Ende des 2. Weltkrieges die beiden Sarkophage in einen Kalistollen ausgelagert und letztendlich zur Hohenzollernburg gebracht. Was schon in den letzten Jahren der DDR angedacht wurde, wurde 1991 ausgeführt: Beide Sarkophage gelangen nach Potsdam zurück. Das bisher nicht beachtete Testament Friedrichs II. spielt dabei ebenso eine Rolle. Das E-Book beschreibt die Irrwege der beiden Sarkophage und das Für und Wider der Rückführung. Es ist gleichzeitig ein kurzer Abriss der preußischen Geschichte unter beiden Herrschern und eine Bekenntnis dazu.
Unterm Roten und Schwarzen Adler
Geschichte Brandenburg-Preußens für jedermann
Unter dem roten Adler Brandenburgs und dem preußischen schwarzen wurde Geschichte gemacht: provinzielle, deutsche, europäische.
Heute, da Brandenburg wieder ein deutsches Bundesland geworden ist, muss seine tausendjährige Vergangenheit neu und dringend befragt werden.
Hans Bentzien hat die Tatsachen möglichst selbst sprechen lassen: Überschaubar wird die aufsteigende Linie von der Markgrafenschaft über das Kurfürstentum und Königreich bis hin zum Kaiserreich und der Weimarer Republik. Die wichtigsten Gestalten Brandenburg-Preußens gewinnen Profil: der Große Kurfürst, Friedrich II., Gneisenau, Hardenberg oder Bismarck. Dennoch wird nirgends unterstellt, die preußische Geschichte sei die selbstherrliche Leistung einzelner überragender Menschen. Vielmehr erzählt Bentzien von zumeist dramatischen Konflikten: Jahrhundertelang musste sich das Herrscherhaus mit dem Adel und dem Bürgertum arrangieren. Oft floss Blut, manchmal wurden glänzende politische Vergleiche geschlossen. Fast immer hatten die Bauern die Zeche zu zahlen. Zwar fanden sie unter den Reformern der Napoleonischen Zeit, in den Freiherren Hardenberg und Stein zumal, leidenschaftliche und wirkungsvolle Anwälte, aber der Gegensatz zwischen Arm und Reich blieb, ja er verschärfte sich noch durch die Industrialisierung seit dem 19. Jahrhundert.
Als Land der europäischen Mitte, zudem ehrgeizig auf Erweiterung bedacht, musste Preußen immer wieder Kriege führen, fast schicksalhafte wie den Dreißigjährigen oder solche um Territorialgewinn wie unter Friedrich II. Schließlich wurde zweimal die Brandfackel über die Welt geschleudert: 1914 und 1939. Obwohl dieser Wahnsinn längst nicht mehr im Namen Preußens geschah, war nicht zuletzt sein Ende der Preis dafür.
Meine Sekretäre und ich
Hans Bentzien ist auf verschiedene Weise mit den führenden Sekretären der SED auf seinem Lebensweg zusammengetroffen, von einer rührenden Begegnung mit Wilhelm Pieck bis in die jüngste Gegenwart. Sein Schicksal wird von allen Sekretären direkt oder indirekt berührt, sogar bestimmt; und er war selbst Sekretär in voller Funktion.
Der Autor kennt sich also aus und ist befugt, seine Geschichte mit der des Landes zu verknüpfen. Bekanntes wird sachkundig erörtert, Unbekanntes hervorgebracht. Ein Menschenschicksal, Zeitgeschichte, Geschichte und Geschichten.
Vorangestellt sind Geheimdokumente über die Vorgänge um den Film „Geschlossene Gesellschaft", in die der Autor verstrickt war.
Meine Amsel singt in Tamsel
Das Buch ist bekannten und weniger bekannten Persönlichkeiten gewidmet, deren Leben die Geschichte Brandenburgs und seine Bewohner mitgeprägt haben. Der Leser lernt Carl August von Hardenberg, Johann Friedrich Adolf von der Marwitz, Sophie Charlotte, Königin von Preußen, und andere geschichtsträchtige Persönlichkeiten näher kennen. Aber auch zu Unrecht vergessene Menschen, wie den Fleischermeister Cassel aus Potsdam, den Erfinder des so gern gegessenen Kasslers, ruft Hans Bentzien wieder ins Gedächtnis.
Damm und Deich – Fruchtbar und reich
Am Beginn unserer Betrachtungen zum Jubiläumsjahr 1997, in dem vor 250 Jahren der Plan gefasst und sogleich umgesetzt wurde, das Oderbruch zu regulieren, mag eine Zwischenbilanz Friedrichs II. stehen, der in seinem Politischen Testament von 1752 detaillierte Angaben zur Situation an der Oder macht:
„Längs der Oder und Netze, einem kleinen Fluss in der Neumark, zog sich ein Streifen unangebauten, wilden und unzugänglichen Sumpflandes. Ich begann damit, die Sümpfe von Damm bei Stettin zu entwässern. Durch einen Deich wurde die Oder eingedämmt und das neue Land an die Erbauer der dort angelegten Dörfer verteilt. Dieses Werk wird im nächsten Jahre vollendet und das Land mit ungefähr 4000 Seelen besiedelt sein.
Zwischen Freienwalde und Küstrin überschwemmte die Oder die schönsten Wiesen und setzte unaufhörlich ein herrliches Gebiet unter Wasser, das dadurch unbrauchbar wurde. Zunächst erhielt die Oder ein neues Bett durch einen Kanal, der die Windungen abschneidet und die Schifffahrt um vier Meilen verkürzt. Der Kanal wird im kommenden Jahr fertig. Durch die Eindämmung des Flusses wird ein Gebiet gewonnen, wo 6000 Seelen ihre Nahrung, Ackerland und Viehweiden finden. Wenn ich am Leben bleibe, wird die ganze Besiedelung im Jahr 1756 beendet sein.“ (Zwischenbilanz Friedrichs II. von 1752.
Seine Planung beschränkte sich nicht nur auf das Oderbruch, wie so mancher hier annimmt, sondern war ein Teil seiner merkantilistischen Handelspolitik. Was bedeutet, dass die Wirtschaftsbilanz immer ausgeglichen sein musste. Schulden, Negativbilanzen und andere Misswirtschaft versuchte er immer, selbst im Krieg, zu vermeiden. In den Grundsätzen seiner Staatsverwaltung heißt es, dass „zwei Sachen zur Aufnahme und zum wahren Besten eines Landes gereichen: 1. aus fremden Landen Geld hereinzuziehen und 2. zu verhindern, dass das Geld nicht unnötigerweise aus dem Lande gehen müsse“.
Der Handel war für den ersten Punkt, das Gewerbe für den zweiten Punkt verantwortlich. In diesem Zusammenhang also müssen wir die Anstrengungen Preußens für eine gesunde Volkswirtschaft sehen und die einzelnen Aspekte der Arbeiten im Oderbruch betrachten, einer umfangreichen Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur, wie wir heute sagen würden.
Daher ist es wohl gerechtfertigt, wenn wir - auch angesichts der heutigen desolaten Lage dieses Landstrichs - in diesem Jahr (1997) etwas genauer in die schöne Gegend an der Oder schauen.
Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Zwischen Soldateneid und Tyrannenmord
Am 20. Juli 1944,12.40 Uhr, detoniert in Hitlers Hauptquartier an der Ostfront eine Bombe. Der Attentäter, Oberst Stauffenberg, ist bereits auf dem Wege zum Flughafen. Sein Ziel ist Berlin. Dort will er den Staatsstreich gegen Hitler, der den Anschlag leicht verletzt überlebte, koordinieren.
Gegen Mitternacht wird Stauffenberg hingerichtet.
Das ist bekannt. Wie aber wurde gerade er zum Attentäter, zur Symbolfigur des militärischen Widerstandes gegen Hitler?
Claus Schenk Graf von Stauffenberg - Jahrgang 1907, jüngster Sohn des württembergisehen 0berhofmarschalls, aufgewachsen im Stuttgarter Königsschloss, Schwarmgeist, Schüler, im George-Kreis, Kavallerieoffizier der Reichswehr; Generalstabsoffizier in Hitlers Wehrmacht: Hans Bentzien erzählt diese Biografie spannend, neu und kenntnisreich; er entwirft ein umfassendes Bild des Täters und seiner Zeit.
Das Buch erschien erstmals 2004 im Verlag Das Neue Berlin.
Nur in Rheinsberg bin ich glücklich gewesen. Kronprinz Friedrich in Küstrin, Ruppin und Rheinsberg
In vielen Veröffentlichungen über Friedrich II. von Preußen wird die Rheinsberger Zeit, vom Kauf des Schlosses 1734 bis zur Thronbesteigung 1740, als freiheitliches Idyll im ansonsten plagenreichen Leben Friedrichs dargestellt. Kurz vor seinem Tod sprach er den bekannten Satz: „Das Unglück hat mich immer verfolgt. Ich bin nur in Rheinsberg glücklich gewesen.“
Überschaut man sein hartes Leben, immer im Widerspruch, immer im Streit mit seiner Umwelt oder sie mit ihm, immer gezwungen, listenreich bis zur Selbstaufgabe sich schließlich behaupten zu müssen, ohne glückliches Familienleben, geplagt von schweren Krankheiten, dann leuchten die Rheinsberger Jahre in der Tat als eine fröhliche und unbeschwerte Zeit hervor. Doch wie erklären sich die Jahre der „Rheinsberger Republik“, wie sie ein französischer Historiker längst vor der erneuten Preußendebatte unserer Jahre nennt. Eine Republik mitten im Absolutismus?
Das ungleiche Königspaar. Der schiefe Fritz und die allerschönste Prinzessin
Die sechzehnjährige Prinzessin Sophie Charlotte heiratete im Jahr 1684 den brandenburgischen Kronprinzen Friedrich; eine der üblichen politischen Eheverbindungen. Die Hannoverschen Welfen wollten nun auch die Beziehungen zum Osten aufnehmen.
Die ersten Kinderjahre verbrachte Sophie Charlotte im Hochstift Iburg (bei Osnabrück), bis die Familie in das Schloss Osnabrück zog. Manchmal wird sie schon auf Reisen mitgenommen, sieht den Rhein, als sie nach Holland mitfahren darf. Als Neunjährige erhält sie die Oberhofmeisterin von Harling als Erzieherin, eine Vertraute ihrer Mutter. Ebenso nachhaltig auf die Formung des Charakters mag der Aufenthalt bei ihrer Cousine Liselotte von der Pfalz am französischen Hof gewesen sein, die sich schon Gedanken machte, wie sie am besten verheiratet werden könne.
Bildungsreisen sind das eine, der direkte Einfluss von Persönlichkeiten das andere wichtige Element der Erziehung. Es war ein Glücksfall, dass Gottfried Wilhelm Leibniz, der letzte Universalgelehrte in die Dienste des Herzoghauses von Braunschweig trat. Dieser Hof war durchaus nicht kleinstaatlich in seiner Lebenshaltung beschränkt. Der Herzog kannte sich aus im Gesellschaftsleben, selbst im ausschweifenden Venedig. Obgleich Katholik, stand er den religiösen Strömungen nicht borniert gegenüber und gab der Musik und dem Theater Raum. Allerlei höfisches Maskeradenspiel, eben das anspruchsvolle Plaisier, waren in Hannover gang und gäbe. Damit wuchs das Mädchen auf.
Der brandenburgische Hof war calvinistisch-nüchtern geprägt, die Unterhaltung sehr beschränkt, denn aus prinzipiellen, religiösen Gründen galt die Welt als Jammertal, daher Theater, Ballett, Oper, lockere Belustigungen als verwerflich, wenn nicht gar als obszön. In diesem Sinn wurde Sophie Charlottes zukünftiger Mann erzogen, der allerdings keineswegs von seinem Vater Friedrich Wilhelm in seinen Neigungen ernst genommen wurde. Er war ja nur der Zweitgeborene. Sein älterer Bruder Karl Emil wurde auf die Thronfolge vorbereitet. Zwar wachsen die Brüder, Söhne aus der Ehe des Kurfürsten mit Louise Henriette, zusammen auf, doch Friedrich ist kränklich und hat einen Buckel. Seine Amme hatte in einer Kutsche nicht genug Obacht gegeben, der kleine Friedrich war vom Sitz gefallen und hatte sich einen Wirbelsäulenschaden, der nicht behandelt werden konnte, zugezogen. Er wurde von den frechen Berlinern daher der „schiefe Fritz“ genannt. Seine Behinderung beeinflusste ständig seine Stellung zur Umgebung, immer musste er sie kaschieren, immer war er in Gefahr, verspottet zu werden. Daher kam seine übertriebene Geltungs- und Prunksucht.
Ich, Friedrich II
Das Leben des großen Preußenkönigs nacherzählt
Überhaupt zeige man Charakter!
Leben und Werk des preußischen Staatskanzlers und Reformers KARL AUGUST FÜRST VON HARDENBERG
Division Brandenburg. Die Rangers von Admiral Canaris
Die Rangers von Canaris: Ihr Name stammt von ihrem Ausbildungsort. Ihr Auftrag war der heimtückische Überfall, Sabotage, Diversion, Mord. Gegründet wurde die Einheit als lockerer Söldnerhaufen Deutschstämmiger aus den Ländern auf Hitlers Überfallplan. Trainiert für Tarnung und Täuschung, unterstanden sie der Abwehr von Canaris, verdienten sich erste Sporen beim Einmarsch in Polen, wurden bald Regiment, später Division, am Ende kamen sie zur SS.
Hans Bentzien erzählt die wahre Geschichte der wenig bekannten »Eliteeinheit«, folgt ihrer blutigen Spur durch Europa, Asien, Afrika und untersucht ihre zweifelhaften Tugenden, die heute weltweit wieder hoch im Kurs stehen.
Jenseits der Oder. Streusandbüchse und eine vorteilhafte Erwerbung
Hans Bentzien hat sich mit seinen historischen Skizzen absichtlich den Gebieten jenseits der Oder zugewendet, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu Polen gehören, die durch die Herrschaft der Nationalsozialisten und den angezettelten Zweiten Weltkrieg verspielt worden sind.
Jenseits der Oder spielte sich aber bis zu dem Zeitpunkt deutsche Geschichte ab. Auch dort lebten bedeutende Geistesgrößen und entwickelte sich in diesen damaligen Landesteilen ein bedeutender Kern des deutschen Widerstands gegen Hitler. Bis zur Wende in Osteuropa und in der damaligen DDR war das Thema der deutschen Geschichte in der Neumark, in Ostpreußen und Schlesien gewissermaßen ein Tabu. In den Schulen wurde die Geschichte vor 1945 totgeschwiegen oder einfach gefälscht. In Polen wurde mit der Diskussion über die Deutschen vor 1945 meist „Revanchismus“postuliert. Den Heranwachsenden in der DDR wurde suggeriert, dass die von Polen nach dem Krieg besiedelten Gebiete immer polnisch gewesen seien, und nach 1945 der Rechtsanspruch Polens auf diese Regionen erfüllt worden sei. Kein Wort erfuhr man über die Vertreibung und Umsiedlung aus der Ukraine in die entvölkerten Gebiete östlich der Oder.
Das Interesse an der Geschichte jenseits der Oder erwies sich als ungebrochen, als mit der Wende 1989 die Fakten der Geschichte offengelegt wurden. Auch die polnische Bevölkerung zeigte danach ein wachsendes Interesse an der deutschen Vorgeschichte, sie wollte nicht auf geschichtslosem Boden leben.
Jakow Lenzman: Wie das Christentum entstand
Die Quellen zur Geschichte des frühen Christentums Das Römische Reich im 1. Jahrhundert und die sozialökonomischen Voraussetzungen des Christentums
Die ideologischen Wurzeln des Christentums
Vom Entstehen des Christentums
Die christlichen Gemeinden in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts
Das Christentum in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts
Aus dem Russischen übersetzt von Hans Bentzien
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Die Vorgeschichte
Besatzer als Freunde?
Planwirtschaft
Der 17. Juni ist nicht vom Himmel gefallen
Hans Bentzien
E-Books von Hans Bentzien