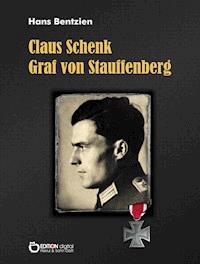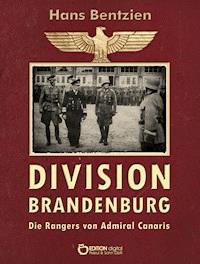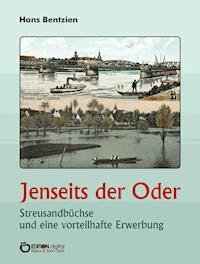8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn man die Wartburg besucht, gelangt man durch einen Laubengang in die Kemenate der heiligen Elisabeth. Sie ist geschmückt mit den berühmten Fresken Moritz von Schwinds, die an das Leben dieser Frau erinnern. Wer war Elisabeth, Landgräfin von Thüringen, die 1231, nur vierundzwanzigjährig, starb und nach ihrem Tod heiliggesprochen wurde? Als vierjähriges Mädchen kam sie, eine ungarische Königstochter, an den Hof von Eisenach. Sie war mit dem elfjährigen Sohn des Landgrafen verlobt worden. Auf der Wartburg wird sie erzogen wie die Fürstenkinder auch. Früh zeigen sich ungewöhnliche Charakterzüge. Sie will, dass es gerecht zugeht, und es entwickelt sich bei ihr eine Frömmigkeit, die zu einer sozialen Haltung wird. Als ihr Verlobter stirbt, wird sie mit dessen Bruder, Ludwig IV., verheiratet. Zwischen beiden entsteht eine echte Liebe — für die auf Verträgen beruhende Heiratspolitik keine Selbstverständlichkeit. Als Landgräfin schärft sich ihr Blick für das Wohlleben bei Hofe und die Not der Bauern. In einer der vielen Hungersnöte, als sie den Landgrafen zu vertreten hat, öffnet sie die Speicher, verteilt auch ihre persönliche Habe, ihren Schmuck. Elisabeth greift die Lehren des Franz von Assisi auf und lebt nach den Geboten der freiwilligen Armut. Als ihr Mann auf einem Kreuzzug einer Seuche zum Opfer fällt, wird die dem Hofe und Klerus unliebsame Landgräfin abgesetzt und entmündigt. Sie soll sich jetzt dem Willen ihres Beichtvaters unterwerfen. Doch Elisabeth macht nicht ihren Frieden, sondern vertritt weiter konsequent ihre Ansichten. Von ihrem Witwenteil finanziert sie ein Hospital in Marbach. Hier hilft sie täglich den Armen und Kranken. Konrad, ihr Beichtvater, erlegt ihr nun lange Fastenzeiten und Exerzitien auf, um ihren Willen zu brechen. Schließlich prügelt er sie sogar, bis sie es nicht mehr ertragen kann: In der Nacht vom 16. zum 17. November 1231 stirbt sie. Nach ihrem Tode entstehen im Volk viele Legenden um ihr Leben. Das reale Leben tritt immer mehr in den Hintergrund. Hans Bentzien versucht in dem erstmals 1990 veröffentlichten Buch, das wirkliche Leben der Elisabeth nachzuzeichnen, die Motive ihres Handelns, den Zusammenhang mit den sozialen und geistigen Widersprüchen jener Zeit zu ergründen und darzustellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Hans Bentzien
Elisabeth – Landgräfin von Thüringen
Das irdische Leben einer Heiligen
ISBN 978-3-95655-469-8 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1990 im Verlag Neues Leben, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung des Bildes „Die Barmherzigkeit der hl. Elisabeth von Thüringen“ von Edmund Blair Leighton
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Die Erhebung
In der Nacht zum 27. April des Jahres 1236 versammelte Ulrich von Dürn, der Vorsteher des Marburger Hospitals, sieben seiner Mitbrüder und machte sich auf den Weg in die kleine, erst kürzlich erbaute steinerne Kirche. Nachdem die Tür von innen abgesperrt worden war, ließ er eine Fackel anzünden, sprach ein Gebet, und dann begannen die Mönche ihr heimliches Werk. Behutsam legten sie das Grab Elisabeths frei. Erst vor vier Jahren hatte die Umbettung aus der kleinen Holzkirche des Hospitals in diese neu erbaute stattgefunden, da die vielen Besucher ihres Grabes das Kirchlein fast gesprengt hatten. Aber auch jetzt erwies sich der Andrang als zu groß, und der bevorstehende Staatsakt, so stand zu befürchten, würde alles bisher Gewohnte in den Schatten stellen.
Ihr Leichnam schien den Männern frisch und unversehrt, sogar von Wohlgeruch umgeben. Nachdem der Schädel vom Körper abgetrennt war, befreiten sie das Gebein von Muskeln und Haut und reinigten die Knochen, danach begruben sie die verweslichen Überreste. Das Skelett wurde in ein kostbares Purpurtuch gehüllt. Der neue Sarg schien für die Ewigkeit angefertigt, so schwer trugen an dem kostbaren Blei die acht Männer. Ein Chronist behauptete sogar, der Sarg sei aus purem Gold gewesen. Die Heilige, neu gebettet, war würdig anzuschauen, als der neue Sarg in das alte, offene Grab gesenkt wurde. Eine Steinplatte schloss es nur provisorisch ab. Die nachfolgende Arbeit ging schnell von der Hand. Die geschickten Mönche verstärkten das Gestell des kleinen Altars und richteten ihn für das Fest her. Gegen Morgen verstummten die Hammerschläge, und ein Gebet schloss im heraufdämmernden Tag das fromme Werk ab.
Die Franziskaner hatten sich daran gewöhnt, ständig viele Besucher zu empfangen und an das Grab Elisabeths zu führen. Seit ein paar Tagen aber beunruhigte sie die Nachricht, dass sich der Kaiser angesagt hatte und mit ihm die Fürsten des Reiches, die weltlichen und die geistlichen. Wer Rang und Namen hatte im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und in erreichbarer Nähe war, würde anwesend sein und Elisabeth, der früh verstorbenen Landgräfin von Thüringen, die Ehre geben. Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen unterbrach die Vorbereitung eines Feldzuges gegen die Lombardei, in der er ein Kernland seines Reiches sah, das er dauerhaft besitzen wollte. Eine Vorhut von fünfhundert Rittern war bereits nach Verona unterwegs, nun konnte er sich für einen Tag frei machen, um an der Translation, der Übertragung der Gebeine seiner Verwandten, die als Reliquien galten, teilzunehmen. Seine Anwesenheit sollte als Zeichen seiner Verehrung gelten, doch sie war zugleich auch eine wichtige politische Geste für die Fürsten und das Volk. Seitdem Elisabeth vor knapp einem Jahr heiliggesprochen wurde, stieg ihre Beliebtheit im Volke ständig, und ihre Verehrung hatte gewiss den Höhepunkt noch nicht erreicht. Zahlreiche Legenden berichteten von ihrem Leben und Sterben, Wunder geschahen an ihrem Grabe seit ihrem Todestag. Das alles musste der Kaiser bedacht und sich gewiss daran erinnert haben, dass sie von ihm zur Frau erwählt worden wäre, hätte sie nur zugestimmt.
Der Kaiser war persönlich gekommen, der Papst hatte eine ansehnliche Delegation seiner Bischöfe entsandt, die bei der Zeremonie die vorderen Plätze einnehmen und ihn vertreten sollten. Neben Konrad von Hildesheim, für Marburg zuständiger Bischof und oberster Ketzerrichter Deutschlands, war auch Dietrich von Trier erschienen und ebenfalls, zum Erstaunen aller, Siegfried III. von Mainz. Zwischen den Mainzer Bischöfen und den Thüringer Landgrafen hatte es unaufhörliche Fehden gegeben, die, mit Krieg und Brand geführt, bis zu diesem Tage nicht geendet hatten. Doch Siegfried war der erste der deutschen Bischöfe, der Erzkanzler, und damit wichtigster Mann des Papstes, und so war es wohl nicht Sympathie, sondern hohe Pflicht, die ihn den Weg antreten ließ. Zudem hatte der Papst die drei Kirchenfürsten entsandt, weil sie durchaus unterschiedliche Meinungen über die Geschicke der Kirche und ihre richtige Politik vertraten und sich darin sogar befehdeten. Hier am Grabe der dienenden Fürstin aber sollten sie die Zerwürfnisse zurückstellen und demonstrieren, dass es Höheres gab als Zank wegen taktischer Probleme.
Die Gründe des Kaisers für sein Kommen waren nicht weniger bedeutend als die des Papstes. Die Heilige stammte aus einem europäischen Königshaus und hatte in ihrem Leben und mit ihrem Sterben einem wichtigen Reichsfürsten und seinem Hof, dem Thüringer Landgrafengeschlecht, zu neuem Ansehen verholfen. Seit die Thüringer nach Elisabeths Tode den Deutschen Orden unterstützten, jedenfalls weit mehr als vorher, entstand hier eine bemerkenswerte politische Kraft, die der Kaiser nutzen wollte. Die Deutschritter wirkten bisher vorwiegend im Süden, nun aber wandten sie sich verstärkt dem Osten zu. Sollte es ihnen gelingen, das Reich nach Osten zu erweitern, könnte der Kaiser nur einverstanden sein. Und außerdem - an diesem 1. Mai 1236 strömte eine ansehnliche Menge in Marburg zusammen, die Berichte sprechen von zwölftausend Menschen. Sie alle würden sehen, dass sie einen frommen Kaiser hatten. Kürzlich erst hatte er als guter Sohn der Kirche den Feuertod für Ketzer, die immer dreister und zahlreicher wurden, angeordnet. Nun wandte sich seine Aufmerksamkeit einer Heiligen zu, die dazu noch Königstochter war.
Im Morgengrauen des ersten Maientages begann die würdige Handlung. Der Kaiser schritt im einfachen Gewand des Büßers an der Seite der prächtig gekleideten Bischöfe an die Gruft. Als die steinerne Platte von den Franziskanern entfernt wurde, griff er selbst mit zu. Dann war der Sarg aufgehoben worden, es geleiteten ihn die Bischöfe an seinen neuen Platz, den Altar, wo er, für alle Augen sichtbar, stehen sollte. Hier war der rechte Ort, die nunmehr kostbar gewandeten Gebeine, durch die Heiligsprechung zu Reliquien geworden, anzubeten, zu verehren. Jetzt hatte jedermann Zugang zu ihr, deren Wunderkraft schon weit berühmt war.
Als die Handlung mit dem Segen endete, griff zur Überraschung der Bischöfe der Kaiser noch einmal in den kirchlichen Ablauf ein. Er hob den Schädel der Heiligen aus dem Sarg und setzte ihm eine goldene Krone auf. Die kaiserliche Geste war wohl berechnet, durch sie erklärte er den Schädel mit der Krone zur wichtigsten Reliquie und hob ihn dadurch besonders hervor. Mit feierlichem Wort versprach er deutlich, noch einen schweren goldenen Becher aus seinem Schatz zu stiften und von einem Meister zu einer kunstvollen Kopfstütze umarbeiten zu lassen, was später auch geschah.
Für die Bischöfe bedeutete dieser Akt eine doppelte Ehrung. Doch es rief ihren Widerspruch hervor, dass der Kaiser sich in ihre Amtsbefugnisse drängte. Obwohl er in der grauen Kutte als einfacher Christ am Sarge stand. Die Bischöfe erkannten sofort, dass hier in einer umstrittenen Frage Tatsachen geschaffen werden sollten. Ihr verbaler Protest erwies sich nicht nur als Enttäuschung oder Beleidigung, sondern durchaus als prinzipieller Widerspruch, der allerdings nichts mehr zurücknehmen konnte, sollte nicht die gesamte Veranstaltung infrage gestellt werden.
Die Zuschauer waren Zeugen eines Konflikts geworden, der zu den Streitigkeiten zwischen Papsttum und Kaisermacht, die das ganze Mittelalter durchzogen, gehörte und auch hier in Marburg ausgetragen wurde, und zwar in einer ganz speziellen Form. Die Aufzeichnungen Friedrichs II. belegen, dass er beabsichtigte, in den Franziskanerorden, der im Franziskaner-Hospital damals das Werk Elisabeths verwaltete, einzutreten. Dieses Ansinnen des höchsten weltlichen Herrschers war einigermaßen erstaunlich, denn Franziskus verstand sich als der Anwalt der Armen und Niederen, die Brüder wurden überall Minderbrüder genannt, und nun unter ihnen der Kaiser? Wollte er etwa auf sein Amt und Reich verzichten und Elisabeth nacheifern?
Es ging ihm um anderes. Er war entgegen Franziskus der Meinung, dass Adligen und auch Mitgliedern von Königshäusern eine durchaus bevorzugte Stellung im kirchlichen Leben zustünde. In seinem Brief an den Generalminister des Franziskanerordens, Elias von Cortona, erklärte er den Zweck seiner Reise damit. Er sei nach Marburg gegangen, um die im franziskanischen Geist dienende Elisabeth zu ehren und die königliche Herkunft der Heiligen zu betonen. Sie sei seinem Stande nahe und gehöre in die Reihe der besonders hervorgehobenen Heiligen. Elisabeth, die alles Gold der Welt den Armen gegeben habe, wird dadurch von dem Verdacht, sie sei eine der Ketzerei nahestehende Franziskanerin, gereinigt und in den Himmel der gekrönten Häupter gehoben. Sie solle als Heilige, nun im Tode, wieder Fürstin sein, befreit von den Irrungen der irdischen Realität, rein und unantastbar.
Der Kaiser, nachdem er in eine aktuelle Diskussion unter Christen eingegriffen hatte, stand nun weiter nicht mehr zur Verfügung. Er verabschiedete sich von den Fürsten und den Angehörigen der Thüringer Familie und reiste weiter nach Wetzlar, und dann ging es nach Koblenz, Frankfurt und schließlich nach Augsburg. Dort, auf dem nahe gelegenen Lechfeld, sammelte er sein Heer für den italienischen Feldzug. Sollten sich die Bischöfe nur ärgern.
Waren die Bischöfe und Erzbischöfe nicht sehr glücklich nach diesem Fest, die Thüringer Landgrafenfamilie und die Vertreter des Deutschen Ordens durften es durchaus sein. Die außerordentliche Veranstaltung hatte sie hochgeehrt und ihre Bedeutung hervorgehoben. Alle waren sie anwesend: Schwiegermutter Sophie, das älteste Mitglied der Familie, geleitete den Sohn Elisabeths, Hermann II., an das Grab seiner Mutter. Ihnen folgten die beiden Schwäger der Toten, die jetzigen Landgrafen, Verwalter des Erbes, bis Hermann II. volljährig war. Die Familie mütterlicherseits war ebenfalls vertreten durch den aus dem Hause Andechs-Meran stammenden Fürstbischof Ekbert von Bamberg, einen Bruder ihrer bereits früh verstorbenen Mutter. Neben der Familie fehlten die wichtigsten Thüringer Adelsgeschlechter nicht, anwesend waren auch die Äbte und Priore des Thüringer und hessischen Raumes und Hermann von Salza, der Hochmeister des Deutschen Ordens.
Der Deutsche Orden zählte sich mit den Thüringern zu den Gewinnern der Translation, er fühlte sich bestätigt in der Absicht, seine Besitzungen in Thüringen und speziell in Marburg auszubauen. Hermann von Salza hatte noch einen besonderen Grund, mit dem Thüringer Hof Verbindungen einzugehen, war er doch ein ehemaliger Ministeriale der Landgrafen. Der kluge Politiker erkannte, dass eines vor allem die Bedeutung des Tages in die Zeiten tragen würde: der Beschluss, mit dem Bau einer mächtigen Wallfahrtskirche für die Heilige zu beginnen. Die Verhandlungen verliefen knapp und erfolgreich, Erzbischof Dietrich von Trier bestätigte in einem Gespräch mit den Landgrafen, dass die Liebfrauenkirche in Trier eindrucksvoll errichtet würde und man bei dem vor zwei Jahren begonnenen Bau bereits die besten Erfahrungen mit der modernen Architektur gemacht hätte. Er zögerte nicht, sein Einverständnis zu erklären, dieselben Baupläne auch in Marburg für die Elisabethkirche zu nutzen, sie würde sich sehen lassen können und, den französischen Kathedralen ähnlich, von der Macht der Kirche und dem Ansehen ihrer Namenspatronin Elisabeth künden.
So verschmelzen bei allen politischen Kräften des Reiches und des Landes die verschiedenen Interessen anlässlich der Feierlichkeit. Elisabeth, die bescheidene Dienerin an den Armen, war an diesem Tage zu einem Schnittpunkt vieler Kräfte geworden. Sie wäre erstaunt gewesen, hätte sie es erleben können.
Geehrt und gescholten
Die Meinungen über Elisabeth gehen auseinander, wir wollen Widersprüche nicht umgehen. Schlägt man heute eines der zahlreichen Bücher über Heilige auf, rangiert sie durchaus nicht unter den wichtigsten, dazu war sie zu weltlich. Versucht man, sich ihrer Leistung als Landgräfin zu nähern, findet man die wirkliche gesellschaftliche Bedeutung von nachträglich erfundenen Heiligenlegenden verstellt. An dem Platze, wo bei der Translation der Sarg gestanden hat, liegt ihr würdiges Grab, über dem man einen Baldachin errichtete. Auf ihm wird sie „Gloria Teuthonie“ genannt, der Ruhm Deutschlands. Die lateinische Inschrift läuft an den Kanten um und lautet in der Übersetzung: „Ruhm Deutschlands, Edelstein der Tugenden, Quelle der Weisheit, Zierde der Kirche, Blume des Glaubens, Vorbild der Jugend, Mutter der Dürftigen, Heilmittel der Krankheit, Hoffnung der Schuldigen ...“, und dann folgt die Bitte, sie möge ihr Herz den Wünschen ihrer Anbeter zuneigen.
Kann ein Mensch, sei es auch ein bedeutender, alle diese großen Eigenschaften in sich vereinen, was hat er getan, um so ungewöhnlich geehrt zu werden?
Seit hundertfünfzig Jahren ist man jeder Spur von ihr nachgegangen und hat sich bemüht, sie zu sichern und zu beschreiben. Obwohl einiges für immer verschwunden ist, weiß man doch aus der Zeit vor achthundert Jahren durch gründliche historische Forschung sehr vieles über die damalige Zeit, die Geschichte und die damit zusammenhängenden Ereignisse.
Es ist sicher, dass die meisten Legenden nach ihrem Tode entstanden sind, als Elisabeth schon heiliggesprochen war, um so ihren Ruhm zu vergrößern. Darum sind sie für uns aber nicht wertlos, steckt in ihnen doch mehr als fromme Verehrung, vielleicht das zeitgenössische Urteil einfacher Menschen und die Sehnsüchte des Volkes, wenn man dies auch in vielerlei Gestalt aufspüren muss.
Nicht immer wurde die Erinnerung an Elisabeth gleich stark wachgehalten. In der Reformationszeit und den darauffolgenden Jahrhunderten wurde sie fast vergessen. Doch vor gut einhundertdreißig Jahren suchte das entstehende Zweite Deutsche Reich seine historische Legitimation und schuf eine eigene Ahnengalerie, die bis ins Mittelalter reichte. Im Zusammenhang mit den Plänen, die Wartburg zu einer Stätte der deutschen Geschichte auszubauen, erwachte erneut das Interesse an den Persönlichkeiten, die auf der Burg gewirkt haben, und damit natürlich an der Gestalt Elisabeths. Mit der Restaurierung der Wartburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde ihr Bild durch die Fresken Moritz von Schwinds und etwas später in den opulenten Mosaiken der ihr zugeschriebenen Elisabethkemenate geprägt.
Hand in Hand mit der Neuentdeckung ihres Lebenswerkes beginnen eine gründliche Quellenuntersuchung und die Herausgabe der überkommenen Schriften und Zeugnisse. Bis dahin überwog der Wunderglaube an die Heilige, nun entsteht ein von manchen frommen Zusätzen gereinigtes Elisabethbild. Trotzdem bleibt sie Ahnfrau mancherlei heutiger gesellschaftlicher Bestrebung, so wie sie damals, neben der Jungfrau Maria, zur Heiligen und Schirmherrin des Deutschritterordens im 13. Jahrhundert erklärt wurde. Die kirchliche Sozialorganisation Caritas beruft sich auf sie als historisches Symbol, und die Elisabethschwestern weihen ihre selbstlose Arbeit der großen Namensgeberin.
Einen Teil der volkstümlichen Geschichtsüberlieferung stellten die Legenden dar, die Quelle der Kenntnisse über Elisabeth im Volk. Als Beispiel mag eine Erzählung über Elisabeths entfernte Verwandte, die gleichnamige portugiesische Königin, dienen, die ganz selbstverständlich der Thüringer Landgräfin zugeschrieben wird, obwohl sie schon längst tot war, als die Legende vom Rosenwunder entstand.So erzählt man sich heute noch in Thüringen, die Landgräfin habe mit ihren Dienerinnen die Burg auf dem Wartberg verlassen und sei in das am Fuße des Burgbergs gelegene, von ihr gegründete Hospital gegangen, um den Kranken Lebensmittel zu bringen, die sie unter ihrem weiten Fürstenmantel verborgen hielt. Elisabeth hätte die Nahrung unter ihrem Mantel verstecken müssen, weil sie den Speichern der Burg entnommen gewesen sei, ohne dass die Gräfin die Genehmigung dazu erbeten hätte. Da sei der Landgraf auf seinem Pferd aufgetaucht. War es Absicht oder Zufall? Jedenfalls hätte er seine Frau nach ihrem Ziel gefragt, und sie berichtete, die drei hätten Rosen, die am Wege standen, gepflückt und wollten sie den Kranken bringen. Ludwig glaubte der Geschichte nicht so recht und bat sie, den Mantel zurückzuschlagen. Als sie es mit Herzklopfen tat, sei das Wunder geschehen. Rosen seien zum Vorschein gekommen. Beschämt habe sich der Landgraf wegen seines Misstrauens entschuldigt, und die Frauen konnten ihren Weg zur Speisung der Kranken fortsetzen.
Auch in dieser Legende stecken eine Reihe von logischen Widersprüchen, was ihr aber nicht schadet. Landgraf Ludwig IV. galt als ein Mann, der seine Frau aufrichtig liebte und ihr ohne Weiteres erlaubt hatte, ein Hospital zu bauen und zu unterhalten. Was sollte er gegen ein Brotgeschenk für die Kranken und Elenden haben, wenn der Hof durch Elisabeth die Versorgung übernommen hatte? Der Fürst billigte die karitative Tätigkeit seiner Frau und würde sie deshalb nicht gerügt haben, weshalb also sollte sie ihn belügen? Das Hospital war eines der wenigen in dieser Zeit, eine öffentliche Einrichtung, bei der sich jeder Bedürftige melden konnte, und er erhielt Hilfe, bestehend aus Nahrung und Krankenpflege.
Allerdings war es noch lange nach ihrem beispielhaften Leben für andere Fürstinnen undenkbar, die beschwerlichen Dienste zu verrichten, die nun einmal mit der Pflege kranker und hilfloser Personen verbunden sind. Elisabeth erledigte die notwendigen Arbeiten oder beaufsichtigte sie ohne Scheu und vermochte es, sich auch gegen Warnungen und Widerstände aus ihrer Umgebung durchzusetzen. Ludwig schützte sie vor Angriffen mit seiner Autorität als Herrscher, niemals hätte er sie wegen einiger Brote getadelt, sie ihn deshalb niemals belogen.
Bis dahin kannte man das zur Formalität erstarrte Almosengeben, von nun an aber die Anteil nehmende Hilfe durch eine Fürstin. Dieser Gedanke wird auf der Wartburg gleich zweimal bildhaft ausgedrückt. Zum ersten Mal erfahren wir durch Moritz von Schwind von der hilfsbereiten Frau, die ihrem Mann selbstbewusst gegenübersteht. In der Elisabethkemenate aber, prächtig mit farbigen Mosaiken ausgeschmückt im offiziellen Geschmack des beginnenden 20. Jahrhunderts, verblasst ihre Persönlichkeit schnell hinter allem ausgestreuten Prunk. Auf den Fresken Moritz von Schwinds wird zurückhaltend zuerst von der dienenden Fürstin, danach von der durch ihre Umwelt verstoßenen Frau berichtet, Elisabeth erscheint ihrem Wesen nach richtig als helfende Schwester. Die Gründerzeit mit ihrem Fürstenkult hatte für die ungewöhnliche Landgräfin jedoch keinen inneren Platz, und wir sehen in den Mosaiken auf den wenigen Quadratmetern wieder das Dilemma ihres Lebens, die mangelnde Fähigkeit der Herrschenden, die beiden Seiten der überkommenen Botschaft Elisabeths zu verstehen.
Bis heute taten sich alle Zeiten schwer damit. Viele Schriften stellten sie so dar, als hätte sie schlafwandlerisch sicher, schon als Kind immer das Richtige getan. Das war durchaus nicht so; alle Entscheidungen, vor denen wir heute Hochachtung empfinden, wurden ihr schwer gemacht und waren umstritten. Sie lebte in einer aufregenden Epoche. Die feudale Ordnung hatte sich in Hunderten von Jahren herausgebildet, das Mittelalter hatte seinen Höhepunkt erreicht, die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kräfte versuchten, Staat und Kirche neu zu ordnen, Altes wurde von Neuem angegriffen, Machtkonstellationen änderten sich, in einigen Fällen weithin sichtbar, in anderen fast unbemerkt.
Das Thüringer Landgrafenhaus spielte um die Wende des 12. zum 13. Jahrhundert eine wichtige Rolle, und es schien sogar so, als würde es, im Herzen Deutschlands gelegen, von entscheidender Bedeutung werden. Die Ludowinger betrieben eine weitreichende Politik, und Elisabeth wurde in diesem Spiel zu einem wichtigen Stein. Wie wichtig sie war, das wollten viele Forscher herausbekommen. Besonders in unserem Jahrhundert wurden alle Quellen ihres Lebens und Wirkens wieder und wieder angesehen und beurteilt, jeder Mauerrest untersucht, Kongresse besprachen Entdeckungen und Vermutungen. Und es ist der Beharrlichkeit der Historiker gelungen, dem vorherrschenden Legendenbild ein Porträt der Landgräfin entgegenzustellen, das sie uns in einem realistischen Bild zeigt.
Zu den mageren Quellen gesellt sich das Problem, Wahrheit und Legende deutlich zu unterscheiden, was sich manchmal als unmöglich erweist, will man nicht überhaupt die Legenden in den Bereich der Erfindung verweisen. Aber ist die Gestalt Elisabeths ohne die Kenntnis und ernsthafte Betrachtung der Legenden überhaupt zu begreifen? Zum Beispiel ohne die Sage vom Zauberer Klingsor aus Ungarn, der in Eisenach ihre Geburt weissagte?
Elisabeth ist eine Trägerin von Sympathien und war doch durchaus keine Idealgestalt. Sie lebte am Landgrafenhof, verwaltete ihn sogar zeitweise und legte dennoch ihr Gespür für die Bedrängnisse der Menschen nicht ab, was ihr soziales Gewissen schärfte und ihre ungewöhnlich feinen Empfindungen für die Umwelt ausprägte. Sie besaß gute Gaben und zeitweise Macht. Diese Macht setzte sie, wenn auch unbewusst, auch gegen die Interessen der feudalen Klasse, der sie entstammte und verpflichtet war, ein. Dafür wurde sie verfolgt, und daran zerbrach sie schließlich. Sie konnte nicht erreichen, was niemand bisher vermochte: Sie konnte nicht Fürstin und Dienerin zugleich sein. Doch ihr Ruhm beweist, dass sie auch nicht gescheitert ist.
Elisabeths Herkunft und der Sängerkrieg auf der Wartburg
Elisabeths Wiege stand in Ungarn, wo sie im Jahre 1207, wahrscheinlich am 7. Juli, als Tochter des ungarischen Königs Andreas II. geboren wurde. Die Mutter, Gertrud von Andechs-Meran, entstammte einem Fürstengeschlecht, dessen Ländereien sich etwa im heutigen Bayern, Österreich und Oberitalien befanden. An der Ostgrenze gelegen, war Ungarn schon aus diesem Grunde von geografischem und politischem Interesse und nahm in den machtpolitischen Bestrebungen der deutschen Fürsten einen wichtigen Platz ein. Das Reitervolk der Magyaren drang Anfang des 10. Jahrhunderts, aus den Weiten des Ostens kommend, in die Länder ein, welche heute Ungarn, Österreich und Deutschland bilden. Dort versuchten sie, die Herrschaft über die deutschen Stämme zu errichten, waren bereits 919 zurückgedrängt worden, aber erst im Jahre 955 auf dem Lechfeld bei Augsburg durch König Otto I., genannt der Große (912-973), vernichtend geschlagen worden. Als Ergebnis dieser Kämpfe siedelten sie sich im Raum des heutigen Ungarn an.
In der nun beginnenden staatlichen Formierung der Magyaren setzte sich das Fürstengeschlecht der Arpaden durch. Es unterlag allerdings der Lehnspflicht gegenüber den deutschen Königen, woraus sich auch die Pflicht zur Heerfolge ergab. Wurden sie zu einem Kriegszug gerufen, hatten sie mit einem Kontingent an Kriegern Folge zu leisten, ebenso wie ihre Nachbarn, die Böhmen und Polen, woraus sich gemeinsame Interessen dieser Länder ergaben. Eine ungarische Heiratspolitik musste also darauf gerichtet sein, die Stellung der Arpaden im Reich zu verbessern, und dabei spielte Thüringen, ein im Aufstieg begriffenes Land, im Zentrum des Reiches gelegen, eine Schlüsselrolle.
In den Jahren um die Geburt Elisabeths taucht in der Sagenwelt eine sonderbare Gestalt auf, Wolfram von Eschenbach erwähnt in seinem „Parzifal“ einen Kastraten Clinschor, von dem er mitteilt, er habe ein verzaubertes Schloss besessen. In der Sage vom Sängerkrieg verwandelt sich diese Gestalt eines Dichters in einen Zauberer aus Ungarn. Bei einem Sängerwettstreit vor dem Landgrafen Hermann I. und seiner Frau Sophie und vielen Gästen weissagt er die Geburt der Königstochter Elisabeth als ein Ergebnis, das sich in allernächster Zeit am ungarischen Hofe vollziehen würde. Aus dem Zauberer wird in der Sage ein Magister der sieben freien Künste, also ein gebildeter, angesehener Mann, in den Geisteswissenschaften und Künsten wohlbeschlagen, welterfahren und daher urteilsfähig.
Für solche Männer boten die Höfe der Fürsten verschiedene Möglichkeiten, um ihre Kenntnisse nutzbringend zu verwenden. Sie wirkten als Lehrer, Berater, Schreiber und wohl auch als Diplomaten, unabhängig von Kirchenfürsten und Höfen, gewissermaßen die weltliche Entsprechung gelehrter Mönche. Von ihrem Wissen konnten sie nur leben, wenn sie einen vermögenden Herrn fanden, der sie gebrauchen konnte, einen Mäzen. Ein solcher Mann aus Ungarn mit dem Namen Klingsor erscheint am Thüringer Hof, wahrscheinlich im Auftrage seines Herrn Andreas II. Stellt man Beziehungen zur Sage her, obwohl die Ereignisse, von denen sie berichtet, nicht gesichert sind, ergibt sich eine reizvolle Version der Vorgänge, die mit dem Auftreten Klingsors in Eisenach verbunden sein könnten.
Als Klingsor im Jahre 1208, von Westen kommend, die Stadt Eisenach erreichte, sah er eine größere Ansiedlung, durch Mauern und Türme geschützt. Im Schutz der Burg hatten sich besonders seit dem 11. Jahrhundert Handwerker und Händler angesiedelt. Da der Burgherr auch zugleich Stadtherr war, residierte er sowohl oben als auch unten im Schloss, und die Bürger erwarteten und erhielten von ihm den Schutz für ihre Gewerbe und den Markt. Das Wirtschafts- und Handelszentrum war zugleich auch Herrschaftszentrum. Unmerklich hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr das Geld durchgesetzt, und in Eisenach, das an einem Knotenpunkt der Straßen lag, sah man manchen Handelswagen, der zwischen Mainz und Leipzig unterwegs war.
Der Landgraf bot den Kaufleuten durch seine Kriegsleute Schutz und Begleitung und erhob dafür Steuern und Zölle, Wegegeld, versorgte sie mit Lebensmitteln und Getränken. Die Abgaben waren in Geld zu entrichten, der Amtmann, der sie kassierte, stand im Dienste des Landgrafen. Bei diesem Fernhandel blieb auch manches begehrte Stück Tuch, manches orientalische Gewürz in der Stadt und erregte neue Wünsche, die aber immer nur mit Geld zu befriedigen waren.
Mittwochs und sonnabends fanden sich die Bauern aus der Umgebung auf den Märkten vor den Kirchen St. Nikolai und St. Georg ein, sie boten ihre Tiere und verschiedene Nahrungsmittel zum Verkauf, ließen ihre kleinen Wagen reparieren und ihre Pferde beschlagen, wenn sie diese Handwerksarbeiten bezahlen konnten. Nach den Geschäften leisteten sich die etwas begüterten unter ihnen einen Umtrunk in den Gasthöfen. Eisenach war eine für damalige Verhältnisse weitläufig angelegte Stadt. In ihrem Zentrum residierte der landgräfliche Anhang im Steinhof, um ihn gruppierten sich die Häuser der Einwohner, und die ganze Ansiedlung war durch Wälle und Gräben geschützt, zwanzig Wehrtürme versetzten sie in einen verteidigungsbereiten Stand. In ihrem Schutz konnten Handel und Wandel blühen.
Die Eisenacher waren bereits recht selbstbewusst, sie hatten sich eine eigene Vertretung gewählt. Der Schultheiß sorgte, unterstützt von zwei Kämmerern und zehn Stadträten, für einen geordneten Ablauf des städtischen Lebens, und dazu gehörte auch die Betonung der eigenen Rechte vor dem Landgrafen. Er schützte sie, sie waren ihm dafür steuerpflichtig, jeder hatte seine Aufgaben und Rechte.
Am Georgentor wurde der Reisende mit dem verbreiteten „Halt! Wer da?“ nach dem Woher und Wohin gefragt. Die Wache ließ nur Reisende in die Stadt, die ein glaubwürdiges Anliegen vorbringen konnten. Zu groß war die Zahl der Bettler, der Armen und Entwurzelten, dazu gesellten sich die Ausgestoßenen, mit zahlreichen, oft unheilbaren Krankheiten infizierten Menschen.
Die Reisenden aber stiegen zuerst einmal ab, der Gasthof des Heinrich Hellegraf bot Unterkunft für Menschen und Pferde, und während man Verbindung mit der angesteuerten Adresse aufnahm, ruhte man etwas von den Strapazen des Rittes oder der Fahrt in der harten Reisekutsche aus. Klingsor hatte sich allerdings geweigert, dem Offizier der Torwache sein genaues Begehr zu sagen, was diesen zuerst dazu veranlasste, die Anmeldung beim landgräflichen Hof zu verweigern. Doch der erfahrene Hellegraf, der immer mit der Torwache zusammenarbeitete, verwies auf seine Menschenkenntnis. Dieser Mann habe etwas Wichtiges zu übermitteln, es sei kein üblicher Bittsteller. Das gab den Ausschlag, und bald erfuhr die Mission aus dem fernen Ungarn, dass man sie gern am Hofe empfangen würde.
Bei der Begegnung des Landgrafen mit der Gesandtschaft in der Eisenacher Residenz wurde den Thüringern sogleich die weittragende Bedeutung des Besuches klar. Der ungarische König schlug die Heirat seiner Tochter Elisabeth mit dem erstgeborenen Sohn des Landgrafen Hermann I. und seiner Gemahlin Sophie vor. Man war überrascht, etwas geschmeichelt und bat die Gäste, ein paar Tage Gast am Hofe zu sein, man würde sich beraten, vieles musste bedacht werden. Das entsprach den üblichen Spielregeln bei der Anbahnung politischer Verbindungen, denn um nichts anderes handelte es sich bei der Heiratspolitik.
Die Absicht der Ungarn, eine friedliche Verbindung zur Landgrafenschaft Thüringen im Herzen Deutschlands aufzubauen, könnte weittragende Folgen nach sich ziehen. Bisher gab es keinerlei direkte Beziehungen. Der Landgraf und seine Berater prüften die Absichten der Ungarn. Gewiss, der böhmische Hof war den Ungarn durch Heirat verbunden, aber die Böhmen wären selbst gekommen, wenn sie etwaige Pläne verfolgen wollten. Wenn nun der Babenberger aus Wien dahinterstand? Hatte er der Königin Gertrud vielleicht empfohlen, den Einfluss der deutschen Länder in Ungarn zu verstärken? Das wäre denkbar, denn Gertrud stammte aus dem Hause Andechs-Meran, das wiederum mit dem Wiener Herzogtum vielfältig verbunden war, ein Nachbar sozusagen. Die Begleitung des Klingsor, ein gewisser Heinrich von Ofterdingen, aus dem Württembergischen stammend und im Dienste des Wiener Hofes, deutete darauf hin, dass er vielleicht die Verbindung zwischen Wien und Ungarn geknüpft hatte und nun seine Mission mit dieser Reise vollenden wollte. Der Herzog von Österreich war einflussreich und voller Pläne, seinen Einfluss zu verstärken.
Ofterdingen war in seiner Eigenschaft als Sänger dabei, also doppelt willkommen am Thüringer Hof. Man würde ihn bitten, von seinem Herrn und seinen Reiseeindrücken zu erzählen und zu singen, und sicherlich war auch er auf ein Zusammentreffen mit den Sängern des Hofes und den immer auf der Creuzburg und der Neuenburg anwesenden Gästen gespannt. Ein Abend mit Gesängen und gemeinsamer Tafel würde der Höhepunkt des Besuches sein, die Gesandten sollten die besten Erinnerungen aus Thüringen in ihre fernen Länder mitnehmen.
Die Delegation war über Nürnberg und Bamberg gereist, daher war es nur wahrscheinlich, dass sie in Bamberg mit Ekbert, dem Fürstbischof, gesprochen hatte. Ekbert, ebenfalls aus dem Hause Andechs-Meran, ein Bruder der Königin Gertrud, spielte in der Diplomatie oft eine vermittelnde Rolle. Seine Stimme und sein Urteil über den Thüringer Hof waren nicht nur erwünscht, sondern gewiss auch maßgebend zu berücksichtigen, zumal er sich in der Reichspolitik gut auskannte. Also hatte auch er eine Verbindung mit Thüringen befürwortet, eine schmeichelhafte Angelegenheit für den Eisenacher Hof und eine Bestätigung für die wachsende Rolle der Landgrafen in der Reichspolitik. Rückten sie damit nicht in die unmittelbare Nähe des politischen Zentrums, des Königs? Gewiss, ihre Stellung als dem deutschen König direkt unterstellte Reichsfürsten hatte sie auch bisher schon ausgezeichnet, nun aber sollten sie mit einem Königshaus verwandt werden!
Die Sage vom Sängerkrieg fasste diese historische Situation in ein poetisches Bild. Da die Heirat zustande gekommen war, muss sie auch angebahnt worden sein. Verhandlungsdelegationen wickelten diese diplomatischen Vorgänge nach einem bestimmten Ritus ab. Sie waren mit würdigen Männern besetzt, wurden würdig behandelt. Die gegenseitige Höflichkeit wurde vom gegenseitigen Interesse diktiert. So wird diese Geschichte durchaus einen wahren Kern haben, den wir finden, wenn wir sie unvoreingenommen untersuchen.
Wo taucht sie zum ersten Mal auf?
Die eigentliche Sage vom Sängerwettstreit erzählt als erster ein Mönch aus dem Hauskloster der Thüringer Landgrafen in Reinhardsbrunn, wo auch die Chronik des Hauses geführt wurde. Wir wissen nicht, wann er die Begebenheit aufgeschrieben hat, weil sein Bericht nur in einer Handschrift aus dem Jahre 1338 erhalten ist. Sie ist gleichlautend mit dem Bericht des Schriftstellers Johannes Rothe, der um die Wende des 13. zum 14. Jahrhundert lebte und eine „Thüringische Chronik“ verfasste. Er stammte aus Creuzburg an der Werra, lebte als Priester, Stadtschreiber und Domherr, später auch als Lehrer in Eisenach und musste in diesen Tätigkeiten schon als verantwortungsbewusster Chronist Wert auf Genauigkeit legen. Er wusste, was er schrieb, wenn er auch nicht dabei gewesen war. Auf jeden Fall waren ihm die Berichte der vorhergehenden Generationen bekannt. So teilte er mit, was die Leute darüber erzählten. Seither gibt es unzählige Fassungen der Sage, in ihnen verschmelzen oftmals mehrere Geschichten. Sie handeln von dem unheimlichen Zauberer Klingsor, von der Weissagung der Geburt Elisabeths, vom Sieg der Thüringer Sänger über den Wiener Heinrich von Ofterdingen, seiner drohenden Hinrichtung und der schützenden Landgräfin Sophie, Rätselspiele mischten sich hinein und die Figuren des Wolfram von Eschenbach, Parzifal und Lohengrin. Entkleidet man die Sage der wundersamen Elemente, so wird folgendes berichtet: Landgraf Hermann I. und seine Gemahlin Sophie hatten zu einem Liederabend eingeladen, wahrscheinlich zu Ehren der ungarischen Delegation. Gebeten waren die am Hofe anwesenden Sänger Heinrich der Burgschreiber, Walther von der Vogelweide - einige Forscher nehmen an, er käme aus der Gegend von Meran -, Wolfram von Eschenbach, ständiger Gast des Landgrafen, und Reinmar von Zweter, dessen Lieder seinerzeit von der Hofgesellschaft gern gesungen wurden. Auch Biterolf, wahrscheinlich aus dem Gefolge des Landgrafen, war anwesend. Diese Personen sind als historische Gestalten bekannt und nachgewiesen. Umstritten sind lediglich die Gäste aus Ungarn, nämlich Klingsor und Heinrich von Ofterdingen. Dieser wird als Begleitperson Klingsors genannt und war wahrscheinlich ein Verbindungsmann des Wiener Hofes zum ungarischen Hof, hatte die Anregung zu einer Verbindung der Häuser von seinem Herrn, dem Babenberger, überbracht und war von Klingsor der Einfachheit und Wichtigkeit halber als Zeuge für die Ernsthaftigkeit des Vorschlages gleich mitgebracht worden. Wir dürfen es daraus schließen, dass er, als es zum Fürstenlob kam, nicht Hermann von Thüringen pries, wie alle andern es taten, sondern seinen Herrn, den Wiener Fürsten. Leopold VI. (1198-1230) wurde der Glorreiche genannt, und ebendieser hatte Heinrich von Ofterdingen „mit Briefen und Verpflegung“, wie es heißt, nach Ungarn geschickt.
Der Streitpunkt, wenn es denn überhaupt einer war. bestand in dem Vergleich. Hermann I. wurde von seinen Sängern mit dem Tage verglichen, doch Ofterdingen trumpfte auf und verglich seinen österreichischen Herrn mit der Sonne, Das brachte ihm sofort den Widerstand und die wütende Ablehnung seiner Kollegen ein, die ihm sogar mit dem Henkerstrick gedroht haben sollen. Diese Ausschmückungen sind nachträgliche Dramatisierungen, aber es mag schon eine peinliche Überraschung gewesen sein, als er ansetzte, jedermann ein besonderes Lob des Gastgebers erwartete und stattdessen ein anderer Fürst gefeiert wurde. Wenn schon ein Streit über diesen ungewöhnlichen Vorgang entbrannt sein soll, so hat sich Klingsor dabei als geschickter Diplomat bewährt. Er griff ein und stellte den natürlichen Zusammenhang von Tag und Sonne her, setzte niemanden ins Unrecht und glättete die Wogen. Auf dem berühmten Bild von Moritz von Schwind im „Sängersaal“ der Wartburg muss Ofterdingen sogar in den Schutz der Landgräfin fliehen, die ihn aber gnädig aufnimmt, sodass er auch in dieser Variante nicht zu Schaden kommt.
Es ist als realer Kern der Sage anzunehmen, dass auf diesem festlichen Abend das Ergebnis der Verhandlungen verkündet und mit besonderem Aufwand gefeiert wurde. Beide Seiten waren zufrieden, was sich darin ausdrückt, dass Klingsor in allen Ehren entlassen wurde, „sie schenkten ihm viele Kleinodien“. Er war solche Ehrungen gewiss gewöhnt, er wird als reich und gut besoldet bezeichnet, was wohl stimmen muss, wenn der ungarische König ihm „in jedem Jahr dreitausend Mark Silber als Lohn“ gezahlt hat. Damit hätte er eine Hofhaltung repräsentiert „wie ein großer Bischof“.
Die Sage schreibt ihm prophetische Eigenschaften zu. Er habe geweissagt, dem ungarischen König würde eine Tochter geboren, die eines Tages heiliggesprochen würde. Von dieser Behauptung Rothes jedoch sollten wir absehen, hier sind ihm wohl seine alttestamentarischen Kenntnisse unterlaufen, sodass er annahm, zu jedem großen Ereignis gehöre auch eine große Prophezeiung. Für das besondere Ereignis aber hatte er das richtige Gespür.
Hermann I., geb.?, gest. 25. 4. 1237, Landgraf
verheiratet in zweiter Ehe mit
Sophie, Tochter des Herzogs Otto I. von Bayern
Deren Kinder, die Schwäger und Halbschwäger Elisabeths:
Jutta, Halbschwester Ludwigs, geb. 1183, gest. 6.8.1235, Markgräfin von Meißen
Hedwig, Halbschwester Ludwigs, geb. 1197, gest. 1247, Gräfin von Orlamünde
Hermann, älterer Bruder Ludwigs, geb. vor 1200(?), gest. 31.12.1216
Heinrich Raspe, Bruder Ludwigs, geb.1202, gest. 16. 2. 1247, Landgraf, Deutscher König
Konrad, Bruder Ludwigs, geb. 1206 (?), gest. 24. 7. 1240, Landgraf, Hochmeister des Deutschen Ordens
Agnes, Schwester Ludwigs, geb. 1205 (?), gest. 24. 7. 1247, 1. Herzogin von Österreich, 2. Herzogin von Sachsen
Die Kinder Ludwigs und Elisabeths
HermannII., geb. 28. 3. 1222, gest. 3. 1. 1241, Landgraf
Sophie, geb. 20. 3. 1224, gest 29. 5. 1284, Herzogin von Brabant
Gertrud, geb. 29. 9. 1227, gest.13. 8.1297, Äbtissin im Kloster Altenberg
Politik durch Heirat
Der Vertrag, in Eisenach über das kleine, gerade geborene Mädchen geschlossen, war nach damaligen Maßstäben ein völlig normaler Vorgang. Es gab nur zwei übliche Wege, die Macht eines Feudalherrn zu vergrößern. Der erste, häufig anzutreffende, war die Erweiterung des Landbesitzes durch Krieg. Man überfiel den Nachbarn unter einem der schnell gefundenen Vorwände und vernichtete sein Heer, damit gleichzeitig den Kern der Ritterschaft, führte neue Lehnsverhältnisse herbei und erweiterte Besitz und Einfluss. Wir kennen aus dem Mittelalter lange Fehden, die die Länder der Gegner verwüsteten und ihre wirtschaftliche Entwicklung nicht nur zurückwarfen, sondern auch für lange Zeit stagnieren ließen. So erscheint uns das Mittelalter als historische Periode, in der die Kriege nicht aufhörten, ständig neu entflammten. Sie hemmten die Entwicklung der landwirtschaftlichen und handwerklichen Produktion, zerstörten ganze Landstriche auf Jahre und Jahrzehnte. Die Bauern ertrugen sie wie Naturkatastrophen.
Doch diese Art, seine Macht zu stärken, war riskant. Schnell konnte eine Entscheidungsschlacht zugunsten des für schwächer gehaltenen Gegners ausgehen, und dann war der eigene Machttraum beendet, und der Verursacher des Streits kam selbst in neue schwere Abhängigkeitsverhältnisse. Er musste dann seinem Besieger den Lehnseid leisten.
„Deine Feinde sind meine Feinde, deine Freunde sind meine Freunde. Ich will dir allzeit treu, hold und gegenwärtig sein.“ So ähnlich wie dieser Schwur französischer Edelleute an ihren König haben im 12. Jahrhundert alle ihrem Lehnsherrn geschworen. Damit waren die Abhängigkeitsverhältnisse klar, jeder kannte seinen Herrn und wusste, dass er ihm bedingungslos zu dienen hatte.
Die andere, friedliche Methode, seinen Einfluss zu stärken, war die Heiratspolitik, auch sie nicht wenig riskant. Da die Heiratsverträge, wie auch in unserem Fall, in frühester Jugend geschlossen wurden, konnte bis zum Inkrafttreten mancherlei geschehen, was den ursprünglichen Sinn in sein Gegenteil verkehrte. Dennoch gab es in einem solchen Fall immer diplomatische Methoden und im äußersten Fall den Krieg, um falsche Verbindungen wieder zu lösen.
Von einer Fürstin wurde vor allem verlangt, dass sie das Ansehen des Hauses, in das sie durch die Heirat eintrat, durch gesunden Kindernachwuchs stärkte. Viele Kinder, das bedeutete auch viele Beziehungsmöglichkeiten. Außerdem kamen für die Heiratspolitik auch die jungen Witwen infrage. Die häufigen kriegerischen Unternehmungen, die lebensbedrohenden Handlungen in den erbittert ausgefochtenen Ritterturnieren, unbekannte Krankheiten in fremden Ländern senkten die Lebenserwartung der Männer, schnell wurde eine junge Frau zur Witwe, und manche wurde zwei- oder dreimal verheiratet.
Die Eltern Elisabeths, Andreas II. aus dem Königsgeschlecht der Arpaden und seine Gemahlin Gertrud aus dem Herzogsgeschlecht von Andechs-Meran, hatten allen Grund, das Ansehen ihres Hauses zu erhöhen. Sie wussten aber auch, dass nicht nur sie die Suchenden waren, sondern dass ihre Lage in Mitteleuropa ein durchaus interessanter Faktor für alle Seiten war.
Der erste Grund war familiärer Natur. Andreas war nicht der rechtmäßige Nachfolger, als er den Anspruch auf die ungarische Krone erhob. Als sein Vater, Bela III., verstarb, wäre sein älterer Bruder Emmerich an der Reihe gewesen. Für Andreas kam nur das Herzogtum Slavonien infrage, wäre es rechtmäßig zugegangen. Doch Andreas dachte nicht daran, sich mit dem Hinterstübchen zu begnügen, und machte seinem Bruder, der seit 1196 regierte, die Regentschaft mit Waffengewalt streitig. Der Herzog von Andechs-Meran, Berthold, sieht diesen Zwist nicht ungern und bahnt die Ehe seiner Tochter mit Andreas an. Für diesen kommt unter den ungeklärten Umständen des Thronstreites sowieso keine bessere Partie, etwa eine Königstochter, in Betracht, und so macht er das Gescheiteste, was er in seiner Lage tun kann. Er schafft sich einen Verbündeten im Westen seines Anspruchsgebietes, nimmt das Angebot des Herzogs von Andechs-Meran an, und am Anfang des 13. Jahrhunderts, wahrscheinlich 1203, heiraten Andreas und Gertrud.
Nun lenkt im Bruderstreit Emmerich, der Andreas gestärkt an seiner Westflanke sieht, zuerst ein. Neben Slavonien übergibt er Andreas auch noch die Provinzen Kroatien, Dalmatien und Rama, doch das versteht der beschenkte Bruder falsch, er legt es als Schwäche Emmerichs aus. So beginnt er in dem stark vergrößerten Einflussbereich, die Ritter mit Versprechungen an sich zu binden. Nach seiner Thronbesteigung, so lockt er, würden alle reich belohnt werden, wenn sie ihn in seinem Anspruch unterstützten. Das beschleunigte die Aufstellung eines großen Heeres, und bald standen sich die beiden Brüder bewaffnet, zur Schlacht bereit, gegenüber. Diese ganze Verwicklung ist für uns nur aus einem Grunde interessant: Es kam nicht zum Kampf. Emmerich praktizierte eine ungewöhnliche Methode. Als alle sein Zeichen zum Angriff erwarten, stößt er sein Schwert in die Scheide, löst sich von seinem Heer und schreitet, für alle sichtbar, auf die Kriegsscharen Andreas’ zu. Während er durch eine Gasse bewaffneter Feinde auf seinen Bruder zugeht, zieht niemand auch nur einen Dolch gegen ihn. So unterstützt, fordert Emmerich seinen Bruder auf, mit ihm in sein Lager zu kommen. Als Andreas spürt, seine Ritter respektieren Emmerich als ihren König, ist er gezwungen mitzugehen. Im Lager Emmerichs wird er zum Gefangenen des Königs erklärt und bleibt es zwei Jahre lang.
Seine Zeit wird kommen, das weiß er genau. Schon 1204 stirbt Emmerich plötzlich, und auf seinen unerwarteten Tod folgt, nur ein Jahr später, auch das Ableben seines fünfjährigen Sohnes Ladislaus, des ungarischen Thronerben. Nun ist der Weg für Andreas frei, er ist der rechtmäßige König von Ungarn. Was macht es, dass Gerüchte nicht verstummen wollen, die beiden seien nicht eines natürlichen Todes gestorben, soll es doch jemand wagen, öffentlich Anklage zu erheben!
Diese Ereignisse im fernen Ungarn sind durchaus nicht nur ein Familienkrach, die eingeweihten Männer um den neuen König wissen, dass die große Politik sich ändern wird. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts hatte Kaiser Friedrich I., Barbarossa genannt, große Anstrengungen unternommen, das Reich zu einen. Nach vielen Kämpfen und diplomatischen Verhandlungen war ein Bund der italienischen Städte zustande gekommen, die sich mit dem Kaiser in der Ablehnung der Papstvorherrschaft einig wussten. Die Städte der Lombardei, einer fruchtbaren Landschaft in Oberitalien, erkannten schließlich die Lehnshoheit des Kaisers Friedrich I. an (1183). Und als sein Sohn Heinrich bald darauf noch die Erbin des Königreiches Sizilien, Konstanze, heiratete, dehnte sich der Einfluss des Kaisers noch weiter aus.
Doch der Papst gab seinen Anspruch nicht so leicht auf. Er verlangte vom Kaiser die Aufstellung eines Kreuzzugsheeres, mit dem er das Grab Christi befreien solle, und als guter Christ stellte sich Barbarossa selbst an die Spitze seiner Ritter. Bei dieser Unternehmung trifft ihn ein Unglück, der hochbetagte Mann traute es sich noch zu, bei brennender Hitze im eiskalten, reißenden Gebirgsbach Saleph ein erfrischendes Bad zu nehmen, doch dabei machte sein müdes Herz nicht mehr mit. Er versank am 10. Juni 1190 in den Fluten.
So tritt ein starker Herrscher ab, und die mühsam erreichten Schritte zur Festigung des Reiches werden wieder infrage gestellt. Der Papst bestreitet die Zugehörigkeit des Königreiches Sizilien zum Reich. Zwar wehrt sich der Thronerbe, Heinrich VI., dagegen, vermag es auch, sich durchzusetzen, doch nach nur sieben Jahren Regierungszeit stirbt auch er, und die Rivalitäten zwischen Papsttum und Kaisertum brechen erneut auf. Sie nehmen bis dahin unbekannte Formen an, erfassen das ganze Europa.
Nach dem Tode Heinrichs VI. nutzten die örtlichen Gewalten in Italien die Schwäche des Reiches aus und verbündeten sich gegen die deutschen Fremdlinge, unterstützt durch die römische Kurie. Der dreijährige König war für lange Zeit kein starker Herrscher, daran konnten auch die eingesetzten Regenten nichts ändern, man konnte das Kind auf dem Thron nicht gebrauchen, zwar war es rechtmäßig gewählt, aber das musste korrigiert werden.
Dabei brachen im Jahre 1198 die alten Gegensätze unter den deutschen Fürsten wieder auf und führten zum verhängnisvollen Doppelkönigtum. Die staufische Partei kürte den Herzog Philipp von Schwaben, den jüngsten Bruder Heinrichs VI., zum deutschen König und - zum ersten Mal in der deutschen Geschichte - auch zum Kaiser. Sie sah das als ein wirksames Mittel gegen die päpstlichen Ansprüche an, der Papst sollte sich fernerhin nicht mehr in die Reichsbelange einmischen.
Die zweite Partei, die welfische, wählte Otto von Braunschweig zum König, den jüngeren Sohn Heinrichs des Löwen. Diese Welfenpartei, angeführt vom Kölner Erzbischof, hatte mit Otto VI. einen Günstling des englischen Königs ausgesucht, was die Doppelwahl zu einer europäischen Angelegenheit machte, denn Philipp von Schwaben wurde vom französischen König unterstützt. Notgedrungen mussten sich alle anderen europäischen Fürsten nun auf die eine oder die andere Seite schlagen.
Der Papst war der lachende Dritte. Innozenz III., ein diplomatisches Talent, teilte sich die Schiedsrichterrolle zu und unterstützte Otto IV., denn Philipp hätte ihm die Vergabe der Kaiserkrone bestritten, dieses Recht stünde allein dem Papst zu. Es ist ein Argument, das die staufische Partei mit einer ihrer Regeln schlug. Otto musste für die Anerkennung als deutscher König etwas leisten, er verzichtete auf die Reichsrechte in Mittelitalien.
Auch in Ungarn wirkte sich diese Spaltung Unheil bringend aus. Hier kämpften die zwei rivalisierenden Brüder um die Vorherrschaft, wie wir schon gesehen haben. Andreas unterstützte dabei Philipp von Schwaben, also die staufische Partei, denn er ist mit Andechs-Meran verbündet, und Emmerich sucht beim Papst Unterstützung und befürwortet daher Otto von Braunschweig, also die römische Partei.
Vor diesem Hintergrund wird klar, warum die Gesandtschaft nach Thüringen geschickt wurde. Der Herzog von Babenberg in Wien, ein Parteigänger des Papstes, der auch mit Böhmen verbündet ist, das ebenfalls die römische Partei unterstützt, will nunmehr die Ungarn, auch Andreas, ganz für diesen Kurs gewinnen. Kämen die Thüringer dazu, wäre die Brücke zu den Welfen nach Braunschweig geschlagen, das im Norden an Thüringen grenzt, die Nachbarn wären Verbündete und damit König Otto IV. und mit ihm der Papst gestärkt.
Die neue Verbindung hebt das Selbstbewusstsein der ungarischen Ritter. Ein starker König bedeutet gleichzeitig auch ein starkes Reich. Entsprechend gestaltet sich auch die weitere Heiratspolitik des ungarischen Hofes. Elisabeth ist die Zweitgeborene. Ihr älterer Bruder, nach dem Großvater Bela genannt, bleibt der Thronerbe, sie wird mit dem Sohn des Thüringer Landgrafen verheiratet. Ihr jüngerer Bruder Koloman heiratet Salome von Krakau, und ein weiterer Bruder, nach dem Vater Andreas genannt, wird mit Maria von Smolensk vermählt. Schließlich hat sie noch eine Schwester, Maria, die dazu bestimmt ist, die Frau des südöstlichen Nachbarn, des bulgarischen Zaren Asen II., zu werden. Diese Heiratsabkommen erweitern die durch frühere Generationen der Arpaden bereits angeknüpften Bindungen in die wichtigsten Herrscherhäuser Europas.
Von dem üblichen Leben der ungarischen Ritter hat die kleine Elisabeth keine Eindrücke erhalten. Auch sie wird von Burg zu Burg mitgezogen sein. Ihr Geburtsort ist unbekannt, es wird angenommen, sie sei auf der Burg Sarospatak zur Welt gekommen. Gewiss ist das nicht, es wäre auch nicht entscheidend für ihren weiteren Weg. Ihr Vater wird sich wenig um das Kind gekümmert haben, das war Frauensache. Er führte das übliche Leben eines hohen Ritters, und er fühlte sich als König seinen ungarischen Rittern verpflichtet. Gegenüber seinen Gefolgsleuten hatte er nach Emmerichs Tod die Versprechungen eingelöst und sie mit größeren Ländereien belehnt. Er selber lebte auf großem Fuße, wie alle mittelalterlichen Herrscher. Macht und Einfluss wurden durch reiche Hofhaltung bei allen nur möglichen Gelegenheiten demonstriert, dazu gehörten lärmende Feste ebenso wie reiche Geschenke an Land und Wertgegenständen. Die Fürsten hielten Hof nach dem Grundsatz: Das Maß der königlichen Geschenke ist die Maßlosigkeit, mit der sie verteilt werden.
Elisabeths Mutter zog viele landarme deutsche Ritter nach Ungarn, die sie an den Hof und in ihre Gefolgschaft nahm. Diese Männer suchten Ruhm und Land und gehorchten ihrer Herrin aufs Wort. Das beschwor eine gespannte Situation im Lande herauf, denn die ungarischen Ritter fühlten sich von ihrer Königin benachteiligt und zurückgesetzt, als rohe Gesellen disqualifiziert. Gertruds Eigenmächtigkeit in der Politik sollte dem Land und ihr noch manche Schwierigkeit, ja persönliches Unglück schaffen. Aber daran war jetzt, am Ende des ersten Jahrzehnts des 13. Jahrhunderts, noch nicht zu denken, jetzt war alles noch im Aufbruch.
Getrud von Andechs–Meran, gest. 28.11.1213
verheiratet mit
Andreas II. aus dem Haus der Arpaten, geb.1176 oder 1177, gest. 26.10.1235
Ihre Kinder:
Bela IV., geb.1206, gest.1270, König von Ungarn (1235 -1270)
Elisabeth, geb.1207, gest.17. 11.1231, Landgräfin von Thüringen
Koloman, geb.1208, gest.1231, Herzog von Kroatien
Andreas, geb.?. gest.1234
Maria, geb.?, gest.1237, Zarin von Bulgarien
Elisabeth auf der Reise nach Thüringen
Noch nie war ein Frühjahr so heiß ersehnt worden wie das im Jahre 1211. Besonders in Thüringen hatte der lange, eiskalte Winter verheerende Schäden angerichtet. Die erbärmlich frierenden Menschen sehnten sich nach den ersten Sonnenstrahlen. Als der Schnee zu schmelzen begann, war das Ausmaß der Schäden offenbar. Obstbäume und Weinstöcke waren erfroren und mussten abgeschlagen werden.
Ein solcher Winter war für damalige Zeiten eine Naturkatastrophe mit lang nachwirkenden Folgen. Die Vorräte waren verzehrt, manchmal sogar das Saatgut. Ging es dem Land schlecht, musste auch mancher Städter zum Bettelstab greifen.