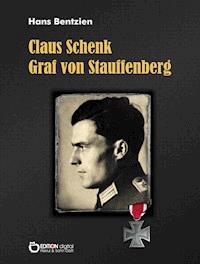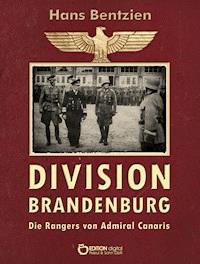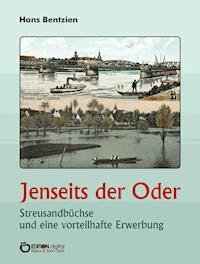7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Zufall fügte es, dass Hans Bentzien während seines Studiums in Moskau das Zimmer mit einem Mann teilte, der in der Sowjetunion großes Ansehen genießt, dessen Tat in die Annalen der Stalingrader Schlacht eingegangen ist: Jakow Fedorowitsch Pawlow. Unter dem Kommando des ehemaligen Sergeanten verteidigte eine Handvoll Soldaten 58 Tage lang ein strategisch wichtiges Gebäude bis zum Äußersten. Gestützt auf die Erlebnisberichte seines Studiengefährten ist Hans Bentzien den Spuren der Verteidiger gefolgt. In seinem fesselnden Tatsachenbericht schildert er das Kampfgeschehen detailliert - auch auf Seiten der deutschen 6. Armee - und lässt den Leser mit den Verteidigern vertraut werden. Die enge persönliche Bindung des Autors zu Jascha Pawlow verleiht dem Buch einen besonderen Reiz, Unmittelbarkeit und Frische. Das spannende Buch wurde erstmals 1986 beim Militärverlag der DDR veröffentlicht. INHALT: Wie ich Jascha kennen lernte "Sind Sie nicht der Pawlow?" Jaschas Bericht von schweren Tagen Stalingrad in Gefahr Der 12. September Die Einnahme des G-förmigen Gebäudes Im Rücken des Gegners Der Angriff auf die Hauptfähre Die Suche nach der Meldetasche Das Haus am Platz des 9.Januar Kommandant Unsere "Garnison" Wirtschaftliche Sorgen Der Verbindungsgang Pawlow-Haus Ziel Industrieviertel Der 15. Oktober Feiertag Der Gegenschlag Eingekreist Sei gegrüßt, Jascha Nach dem Kriege
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Hans Bentzien
Festung vor dem Strom
Ereignisse, Tatsachen, Zusammenhänge der Stalingrader Schlacht
ISBN 978-3-86394-699-9 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1986 beim Militärverlag der DDR
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Wie ich Jascha kennen lernte
Der Name Pawlow ist in der Sowjetunion so verbreitet wie bei uns die Namen Schulz oder Lehmann; Pawlows gibt es in jedem Dorfe. So war es nicht verwunderlich, dass auch unsere Gruppe von DDR-Studenten, die in den fünfziger Jahren die Parteihochschule in Moskau besuchte, einem Genossen Pawlow begegnete. Jascha - die übliche Koseform von Jakow - kam etwas später als wir an. Er hatte es auch näher, stammte er doch aus dem Waldaigebiet, während wir gut zwei Tage mit der Bahn gefahren waren.
Wie auf einer internationalen Schule üblich, lebten die Landsleute nicht zusammen. Jeder von uns erhielt einen Platz in einem Zweierzimmer. Ich zog ein, legte die Hemden in den Schrank und die Bücher aufs Brett und wartete auf meinen Mitbewohner. Als Jascha eintrat, begrüßte er mich wie jemanden, der nur kurz mal weggegangen war. Mit ein paar Sätzen legte er sein Bündel auf das zweite Bett und ging wieder, um seine Moskauer Freunde zu besuchen. Am Abend erschien er mit Lehrbüchern in seinem Einkaufsnetz, daneben lagen Brot, Zwiebeln und ein Stück Wurst. Er breitete alles auf dem Tisch aus und machte eine einladende Bewegung: Wollen wir nicht zu Abend essen?
Doch bevor es dazu kam, holte er unsere Wassergläser, goss aus einer Flasche - wo hatte er sie nur gehabt? - reichlich Wodka ein, hob sein Glas und sagte: "Auf gute drei Jahre mit uns beiden!" - Ich antwortete etwas, was geklungen haben muss wie: "Meiner Meinung nach auch gut" oder so ähnlich. Wir hatten zwar die russische Grammatik einschließlich der Gerundien und eineinhalbtausend Vokabeln gelernt, doch schon beim ersten Einkauf gemerkt, dass uns die Verkäuferinnen nicht verstanden. War unser Schulrussisch vielleicht doch nicht so handhabbar wie nötig?
Jascha stutzte zum ersten Mal und fragte, woher ich sei. Als er verstanden hatte, dass ich DDR-Bürger war, erklärte er mir, dass er Deutschland und die Deutschen kenne. Er sei ein paar Jahre in Weimar gewesen, gleich nach dem Krieg, und auch später habe er einige Deutsche kennen gelernt. Das musste um die Zeit gewesen sein, als ich in Jena studierte. Und obgleich er diese thüringische Stadt auch kannte, wie er mir mitteilte, kam zwischen uns kein Gespräch zustande. Ich führte das natürlich auf mein barbarisches Russisch zurück. Die Flasche wurde nicht weiter geleert. Jascha gähnte, er sei von der Reise müde, und mit einem kurzen "Gute Nacht" zogen wir uns die Decke über den Kopf.
An den nächsten Tagen wiederholte sich das gleiche. Jascha stand recht früh auf, ging schnell in die Kantine, um zu frühstücken, und ließ sich bis zum späten Abend nicht mehr sehen, obwohl der Unterricht am frühen Nachmittag beendet war. Warum lernte er nie in unserem Zimmer? Wo erledigte er seine Studienaufgaben? In der Bibliothek? Bei Freunden in der Stadt? Unsere Unterhaltung war denkbar eintönig und beschränkte sich auf "Guten Morgen" und "Gute Nacht". Ich war einigermaßen ratlos, denn meine Genossen hatten längst Freundschaft mit ihren Zimmergenossen geschlossen, und besser als ich beherrschten sie die russische Sprache doch auch noch nicht. Hatte ich ihn gekränkt? Absichtlich auf keinen Fall. Eigentlich war das gar nicht möglich gewesen, wir hatten ja kaum miteinander gesprochen.
Am 7. November rüsteten wir zur Demonstration, zogen unsere guten Anzüge an, putzten die Schuhe und banden Schlipse um. Jascha legte einen Orden an, den kleinen, goldblitzenden Stern eines Helden der Sowjetunion.
Es war ziemlich kalt an diesem Tag, und als wir von der Demonstration nach Hause kamen, forderte mich Jascha auf, mit ihm in die Sauna zu gehen. Dazu müsse man zu zweit sein, vor allem, um sich gegenseitig die Haut mit Birkenreisern zu reizen, denn das mache erst den eigentlichen Genuss des Saunabades aus. Mir sollte es recht sein. Ich kannte Saunabaden noch nicht und vor allem war ich froh, dass Jascha endlich einmal einen längeren Satz an mich gerichtet hatte.
Sein Vorschlag war wirklich gut. Seit jenem Tage weiß ich die Sauna zu schätzen und getraue mich auch, mit den Birkenreisern kräftig zuzuschlagen, denn Jascha bemängelte anfangs mein zahmes Streicheln. Weit wichtiger aber war, dass er mich wieder zum Abendbrot einlud und mir dabei eine erstaunliche Geschichte offenbarte, die auch enthüllte, warum wir uns so lange fremd geblieben waren.
Als er an unserem ersten Abend erfuhr, dass er einen deutschen Mitbewohner hatte, beschloss er, in ein anderes Zimmer zu ziehen. Doch der Hausverwalter sah keinen Grund für einen Umzug. Der Raum sei in Ordnung, eigentlich überdurchschnittlich komfortabel eingerichtet. Auch der Verwaltungsdirektor war nicht bereit, ihm die Genehmigung zu geben. Man vermutete, er spekuliere auf ein Einzelzimmer, aber das stand nur den Genossen zu, die sich auf das Staatsexamen vorbereiteten. Schließlich wandte er sich an den Parteisekretär der Schule und fragte ihn, warum ausgerechnet er drei Jahre lang mit einem Deutschen zusammen wohnen solle.
Der Parteisekretär hörte zwar ruhig zu, zeigte aber keine Bereitschaft, auf Jaschas Wunsch einzugehen. Ob der Deutsche an einer ansteckenden Krankheit leide? Das nicht. Dann muss es ernst geworden sein bei diesem Gespräch. Ich war nicht dabei, und Jascha hat keine Einzelheiten erzählt. Doch die beiden trennten sich erst, nachdem Jascha versprochen hatte, mit mir offen darüber zu reden, warum er meine Freundschaft nicht gesucht oder gefördert hatte.
Ich kam nun in eine ungemütliche Situation. Wer hat schon das Recht, von einem Mann, der vermutlich vom ersten Tage des Krieges an gegen die faschistischen Eindringlinge gekämpft hatte, so etwas wie Rechenschaft darüber zu verlangen, warum er die Deutschen nicht mochte? Ich konnte es mir denken. Sicher hatte auch Jascha Erlebnisse gehabt, die noch nicht überwunden waren und vielleicht auch nie überwunden werden konnten. Mit meinem unbeholfenen Russisch versuchte ich ihm klarzumachen, dass ich verstünde, wie schwer es ihm fallen müsse, nicht in jedem Deutschen einen Faschisten zu sehen.
Aber meine Kommilitonen und ich seien ja gerade hierher gekommen, um weiter zu lernen, wie man ein neues Deutschland aufbauen könne. Auch solle er bedenken, dass es inzwischen zwei deutsche Staaten gäbe. Einen sozialistischen und einen, in dem sich die alten Kräfte wieder konstituierten. Wenn die Regierung der BRD auch gezwungen sei, mit der Sowjetunion staatliche Beziehungen herzustellen, wie die derzeitige Reise Adenauers beweise, dürfe man trotzdem den Unterschied nicht aus den Augen lassen. Es gäbe Deutsche und Deutsche. Wir wollten Freundschaft säen und müssten deshalb auch Freunde werden.
"Du redest wie mein Parteisekretär", erwiderte Jascha und bot mir wieder einen Wodka an.
Dann begann er zu erzählen. Dabei sprach er nie von sich, sondern von seinen Genossen, mit denen er gekämpft hatte. Es fielen Namen, mit denen sich Episoden verbanden, wie der eine dem anderen geholfen hatte, das Leben zu bewahren. Die Namen konnte ich mir so schnell nicht merken. Die Geschichten waren knapp und eindringlich erzählt, damit ich Russisch-Anfänger folgen konnte. Ab und zu fragte er, ob ich alles verstanden hätte. Ich nickte, auch wenn das nicht der Fall war, denn viele Ausdrücke stammten - wie ich heute weiß - aus der Soldatensprache. Die hatte man uns im Unterricht nicht beigebracht. Unsere Übungstexte handelten von Straßen und Straßenpassanten und Straßenbahnen und ähnlichem. In Jaschas Bericht tauchten Städtenamen auf, die ich verstand: Tula, Stalingrad, Engels, Stettin, Berlin, Weimar.
Mein Zimmergefährte erzählte, bis er - und auch ich - müde und die Flasche leer geworden war. Er war froh, denn der Parteisekretär hatte ihn für den nächsten Tag zu sich gebeten, um ihn zu fragen, ob er die Sache in die Hand genommen hätte. Nun konnte er ehrlichen Herzens mit Ja antworten. Jascha begriff wohl auch, dass ich mich im Kriege nicht in der Sowjetunion aufgehalten hatte, und das beruhigte ihn mehr, als ich damals ahnte. Unser Abend am 7. November hatte noch ein anderes Ergebnis, von dem wiederum er nichts wusste. Ich nahm mir fest vor, intensiv Russisch zu lernen. Wie sollte man sich sonst gut verstehen? Als sich die Gelegenheit bot, wechselte ich in eine Seminargruppe über, in der vorwiegend sowjetische Genossen studierten. So wird man ganz von allein veranlasst, sich gründlich vorzubereiten und Hemmungen zu überwinden, in einer fremden Sprache frei zu reden.
Zwischen uns beiden ging es von nun an besser. Eines Tages forderte er von mir, ich solle ihm zusätzlich Unterricht erteilen. Als er mein fragendes Gesicht sah, erklärte er mir, er habe einen Deutschkursus belegt. Dabei holte er das Lehrbuch hervor und zeigte auf einen Text, der dem Kommunistischen Manifest entnommen war: "Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.
Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen."
"Du bist Lehrer von Beruf, da musst du mir das doch beibringen können."
Also unsere Sprache wollte er lernen. "Einverstanden, fangen wir an! Nehmen wir uns einen Zettel und schreiben wir:
Geschichte: ... Gesellschaft: ... Klassenkampf: ... Unterdrücker: ... Unterdrückte: ... Gegensatz: ... Kampf: ... revolutionär: ... Umgestaltung: ... Untergang: ..."
Bei der zehnten Vokabel stoppte Jascha unsere Arbeit. Er schnitt sich den Zettel auf ein kleines Format zurecht und steckte ihn in die Brieftasche. Am nächsten Morgen sah ich ihn am Spiegel kleben. Jascha kontrollierte seine Vokabelkenntnisse beim Rasieren - eine Methode, die ich empfehlen kann. Ich wurde also zu seinem Sprachhelfer, er zu meinem. Er korrigierte vor allem meine Aussprache und die Konjugation der vielen unregelmäßigen Verben. Ich glaubte damals, die Ausnahmen erfassten die Hälfte aller Tätigkeitswörter. Doch bei ständiger Übung kam man hinter die Feinheiten, und wir übten jetzt viel; einfach, weil wir viel miteinander sprachen.
"Sind Sie nicht der Pawlow?"
Eines Tages fragte mich Jascha, ob wir uns "Schwanensee" ansehen wollten. Natürlich gern, aber es sei so schwer, in Moskau Karten zu bekommen. "Für mich nicht", meinte er, und ich scherzte, sicher habe er ein Verhältnis mit der Primaballerina am Großen Theater.
Wir gingen los - ohne Karten, ohne Vorbestellung. Ich fragte mich, wie wir in die Vorstellung gelangen sollten. In der Vorhalle hieß mich Jascha warten und verschwand hinter einer Tür mit der Aufschrift "Administrator". Er kam bald wieder, begleitet von einem würdigen Herrn, der ihn achtungsvoll behandelte, sich mit Händedruck und einer Verbeugung verabschiedete und der Schließerin einen Wink gab. Die Frau begrüßte ihn mit einem Satz, in dem die Worte "Viel Vergnügen, Genosse Pawlow" vorkamen. Man kannte ihn im Großen Theater?
In der Pause kauten wir Weißbrotschnitten mit Kaviar. Jascha verlangte die mit roten Kaviareiern; seine Erklärung war knapp: Der so genannte Bauernkaviar sei von Bauern früher zwar nie gegessen worden, die Bezeichnung käme von hochmütigen Aristokraten, aber er sei schmackhafter als der schwarze, und mit Sekt sei der leicht salzige Nachgeschmack gut zu überwinden. So ging ich zum Büfett und besorgte das Nass zur Bekämpfung des Nachgeschmacks. "Siehst du", ulkte Jascha, "so sollten wir Bauern immer leben. Aber leider geht das vorläufig nur, wenn wir uns das deutsche Märchen 'Schwanensee' ansehen."
Ich kannte kein deutsches Märchen "Schwanensee". Jascha zog den Programmzettel aus der Tasche und zeigte mir die betreffende Angabe. Obgleich das Märchen aus Deutschland kam, fand ich keinen besonderen Geschmack daran. Das gestand ich meinem Begleiter auch. Überhaupt war ich völlig ungeschult, was die Ballettkunst anging, und ich muss gestehen, auch heute noch gehe ich nicht ohne zwingenden Grund in getanzte Geschichten, obwohl ich die brillante Artistik der Tänzer im Großen Theater bewundernd anerkannte. Die enthusiastischen Beifallskundgebungen, in die auch Jascha einfiel, hielt ich für übertrieben.
Als wir hinausgingen, sagte er mir, er habe die Uljanowa schon mindestens zehnmal gesehen, fast immer in "Schwanensee".
Wie das? Wie kommt ein Kreissekretär so oft von Waldai nach Moskau? "Wohl in Ballettfilmen?"
"Nein", entgegnete er, "nicht im Kino, sondern hier im Bolschoi."
Schließlich fuhren wir, weil es sich so ergab, im Taxi nach Hause. Jascha setzte sich neben den Fahrer, der ihn eindringlich musterte und ihn dann zu vertraulich - wie ich meinte - mit Jakow Fedotowitsch ansprach. Als es ans Bezahlen ging, wollte er kein Geld nehmen. Wortreich und gestikulierend wehrte er Jaschas Versuche ab, ihm die Scheine in die Hand zu drücken. Schließlich fuhr er grüßend davon. Was war denn da los?
"Ach, mir passiert das nicht das erste Mal", sagte Jascha verlegen.
Das Thema war ihm unangenehm, er mochte sich nicht dazu äußern, und so bekam ich auf meine naive Frage "du bist wohl ziemlich bekannt?" nur die knappe Antwort: "Ja, leider."
Wir gingen oft ins Theater, und überall spielte sich das gleiche ab: Ein Gang ins Zimmer des Administrators - freundliche Behandlung - sehr gute Plätze, meist in der Loge oder auf den Sesseln der Intendanten.
Als Jascha an einem Sonntag nicht mitgehen konnte, rief er beim "Kleinen Theater" an und bat, zwei Karten zu reservieren. Zu mir sagte er: "Erkläre einfach, dass du die Karten für Pawlow abholen willst. Nimm dir einen Kumpel mit. Ihr werdet sehen, alles geht glatt."
Damit hatte er allerdings nicht ganz Recht. Der Genosse in der Verwaltung hielt mich für Jascha. Nach ein paar Minuten des Gespräches fragte er, ob ich denn aus einer der baltischen Republiken stamme, mein Akzent klinge so. Ich gab mich nicht zu erkennen, so dass der gute Mann wahrscheinlich heute noch glaubt, er hätte Pawlow die Hand gedrückt.
Als mich Jascha fragte: "Na, war alles in Ordnung?", erzählte ich ihm von dem Missverständnis mit seinem Namen. Aber er lachte nur und meinte: "Die Generalprobe hat geklappt, nun können wir weiter so verfahren. Ich mache mir nämlich gar nicht soviel aus Theater."
Nun ist es vielleicht an der Zeit zu beichten, dass die für Pawlow reservierten Plätze immer häufiger von zwei deutschen Genossen in Anspruch genommen wurden, die sich glücklich preisen können, dadurch fast alle begehrten, bedeutenden Aufführungen des Theater- und Konzertlebens im Moskau der Jahre 1955 bis 1958 gesehen zu haben. Doch ich habe mich nie mit falschem Namen vorgestellt. Das wurde auch gar nicht erwartet, denn Pawlow brauchte sich nicht vorzustellen; jedermann in der Sowjetunion kannte ihn. Er steht in jedem Geschichtsbuch über den Großen Vaterländischen Krieg.
Dabei war er der einfachste Mensch, den man sich denken kann. Sprach man über ihn und seine Verdienste, dann blickte er immer etwas erstaunt, woher der Redner das wissen konnte, er hatte es ihm doch gar nicht gesagt.
Sobald er erkannt wurde, begrüßte man ihn. Als wir eines Tages im eng besetzten Trolleybus durch die Gorkistraße fuhren, fragte ihn ein älterer Mann, augenscheinlich ein Offizier im Ruhestand: "Sind Sie nicht der Stalingrader Pawlow?"
Jascha antwortete: "Eigentlich bin ich nicht aus Stalingrad."
"Aber ist es nicht Ihr Haus am Platz des 9. Januar?"
"Nein, es gehört der Kommunalen Wohnungsverwaltung."
Während dieses nicht ganz ernsten Dialogs drehten sich alle im Bus zu Jascha um. Rufe und Feststellungen kreuzten sich: "Ja, er ist es." - "Wir erkennen Sie, Ihr Bild war in unserem Schulbuch." - "Wie geht es Ihnen, was machen Sie?" -"Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute", verabschiedeten sich Passanten, die wahrscheinlich schon ein paar Stationen vorher hatten aussteigen wollen.
Der alte Offizier fuhr weiter mit, und es entwickelte sich eine Unterhaltung, wie ich viele mit Jascha erlebt habe: "Weißt du, ich lag im Nebenabschnitt..."
Auch heute glaube ich noch, dass Pawlow diese Gespräche nicht mochte, obwohl er immer freundlich, wenn auch wortkarg war. Sie rissen alte Wunden auf. Später hat er mir einmal gesagt, dass er hoffte, bei Soldatenbegegnungen ein paar Anhaltspunkte über seine Kameraden zu erfahren, von denen er während der Kriegsereignisse getrennt worden war. Viel war allerdings noch nicht dabei herausgekommen, doch man durfte zehn Jahre nach dem Kriege die Hoffnung nicht aufgeben. Afanasjew hatte sich gemeldet, warum sollten andere nicht auch überlebt haben? Welche Schicksale hatte das Land gesehen! Jeden Tag kamen noch Menschen zu ihren Familien zurück.
So nahm er immer wieder Einladungen zu Foren und Vorträgen an, obwohl es ihm unmöglich war, den Wünschen auch nur annähernd nachzukommen.
Jascha studierte angespannt in den Nachmittagsstunden, doch ein paar Mal in der Woche zog er abends los in eine der Moskauer Schulen oder Hochschulen oder zu einer Militäreinheit, um von den Kämpfen des Jahres 1942 zu berichten.
Einmal bat ich ihn, er möge mich mitnehmen. Ich würde mich ganz still hinten in die letzte Reihe setzen. Ganz recht schien ihm mein Anliegen nicht zu sein, aber schließlich willigte er ein. "Ich denke, jeder Genosse hat die Pflicht, als Propagandist zu wirken. Zwar bin ich kein Theoretiker, aber ich kann der Jugend etwas erzählen. Die Partei erwartet es auch von mir", fügte er, gleichsam sich entschuldigend, hinzu.
Wir zogen los. Jascha wurde bereits an der Tür des Institutes von der Leitung der Komsomolgruppe erwartet. Die jungen Leute führten uns in den überfüllten Saal. Jascha wurde herzlich begrüßt und gebeten, im Präsidium Platz zu nehmen. Der Sekretär stellte ihn vor und bat ihn dann, mit seinen Ausführungen zu beginnen.
Pawlow sprach ruhig und langsam: "Euer Genosse hat mich einen heldenmütigen Menschen genannt. Wenn ich an meinen Weg denke, den ich den Krieg über hinter mich gebracht habe, an alle Kämpfe und Prüfungen, dann sehe ich nichts Außergewöhnliches in ihnen.
Meine Feuertaufe erhielt ich eigentlich erst an der Wolga, in der Division des Generals Rodimzew. Nachdem wir unter dem Feuer des Gegners auf das rechte Ufer der Wolga übergesetzt waren, ging die Division sofort in den Kampf. Sie kam den Verteidigern Stalingrads in höchster Not zu Hilfe."
Danach schilderte er die wichtigsten Stationen seines 58-tägigen Kampfes in der Stadt an der Wolga, bezeichnete sein Handeln schlicht als Befehlsausübung und stellte seine Leistung bescheiden hinter die seiner Genossen zurück. Die Losung aller sei gewesen, hinter der Wolga gäbe es für sie kein Land mehr. "Wir schworen uns, eher zu sterben, als das Haus dem Feind zu überlassen."
Dann kamen die Fragen der Studenten. "Wie alt waren die Kämpfer?"
"So alt wie ihr etwa. Die meisten waren zwanzig bis fünfundzwanzig. Woronow zum Beispiel bat in unserem Kommandeurszimmer um Aufnahme in den Komsomol. Eine Ausnahme bildete Gluschtschenko. Er hätte unser Vater sein können, und als solchen betrachteten wir ihn auch. Mit ihm konnte man über alles sprechen. Er wirkte immer beruhigend auf uns."
"Wie war Ihre Bewaffnung?"
"Auf welchem Wege erhielten Sie Nachschub?"
"Wann begann die Gegenoffensive?"
"Wie war die Taktik des Gegners?"
"Wie verhielten sich die Zivilisten im Haus?"
"Wann wurden Sie verwundet?"
"Was haben Sie nach dem Kriege gemacht?"
Auf die letzte Frage antwortete Pawlow nur kurz. Persönliches war ihm nicht wichtig. "Nach dem Kriege kehrte ich in meine Heimatstadt Waldai zurück. Meine Landsleute wählten mich zum Abgeordneten des Obersten Sowjets der RSFSR, die Kommunisten der Kreisparteiorganisation wählten mich zum Sekretär der Kreisleitung. Und jetzt setze ich mein Studium fort.
Neulich machte mich die Geschichtsdozentin auf eine interessante Episode aufmerksam. Vor vielen hundert Jahren wurde Rom durch die benachbarten Etrusker bedrängt, und es gelang ihnen, die Stadt zu besetzen. Ein römischer Krieger schlich sich in das etruskische Lager und versuchte, ihren König zu töten. Doch der Versuch misslang, und er wurde festgenommen. Der König fragte den Gefangenen aus, wie die wirkliche Lage im besetzten Rom wäre. Der Gefangene schwieg, und so wurde die Folter vorbereitet. In das Königszelt wurde eine Schale mit glühenden Kohlen gebracht. Der Henker ergriff die Zange, um die Kohlen auf den Körper des Soldaten zu drücken. Der Gefangene hatte schweigend den Henker beobachtet, und als der auf ihn zukam, legte er selbst seine rechte Hand ins Feuer. Das Fleisch verbrannte. Der Gefangene zeigte unter den Augen der Feinde keinen Schmerz und zuckte mit keinem Muskel seines Gesichtes.
Der Etruskerkönig verstand, dass ein solcher Mann unter keinen Umständen ein Geheimnis verraten würde. Er fragt ihn, ob es unter den Römern mehr solcher Männer gäbe. Der Gefangene antwortete stolz: 'Jeder würde an meiner Stelle so handelnd!'
Der Name des Kriegers war Mucius Scaevola. Er ging in die Geschichte ein, man kennt ihn noch nach Jahrhunderten. Er war ein wirklicher Held. Heute sind viele Namen von Verteidigern Stalingrads hinzugekommen. An einen möchte ich euch erinnern.
Faschistische Panzer rollten auf die Schützengräben der Marineinfanterie zu. Ein Panzer näherte sich dem Graben, in dem Michail Panikacha lag. Er besaß keine Munition mehr, nur noch zwei Brandflaschen. Als der Panzer nahe genug herangekommen war, nahm Michail eine Flasche, um sie auf ihn zu werfen, doch eine verirrte Kugel zerschlug sie. Die brennende Flüssigkeit erfasste den Soldaten, und er selbst wurde zu einer Fackel. In diesem Moment ergriff er die zweite Flasche und sprang auf den Panzer zu, zerschlug die Flasche auf der Luke zum Motorblock und warf sie hinein. Der Panzer stand sofort in Flammen.
Alles ging in wenigen Minuten vor sich. Augenzeugen berichten, dass die nachfolgenden Panzer daraufhin umdrehten und zurückfuhren. Menschen wie Michail Panikacha ist es zu verdanken, dass unsere Wolga ein sowjetischer Fluss blieb."
Wie immer hatte Pawlow von anderen gesprochen, hatte die Geschichte bemüht, und seine jungen Zuhörer verstanden, was er ihnen zu sagen hatte: In großen historischen Stunden finden sich immer auch Menschen, die selbstlos für ihr Vaterland eintreten. Jascha ging still vom Podium und setzte sich in die Stuhlreihe. Die Zuhörer verließen schweigend den Saal, mancher drückte Jascha die Hand.
Als wir dann in unserem Zimmer saßen, fragte er plötzlich, ob ich glaube, dass in diesen Vorträgen eine ständige Aufgabe für ihn läge. Obwohl er mich ansah, hatte er wohl mehr sich selbst als mich gefragt. Ich antwortete ihm, sein Vortrag sei plastisch gewesen, ich hätte alles verstanden, was er sagen wollte, und die sowjetischen Zuhörer allemal. Skeptisch sah er mich an. Er könne doch nicht jeden Tag seine Vergangenheit beschwören. Ein Historiker täte das ja auch, gab ich ihm zu bedenken.
Ein paar Tage später kam er nachdenklich ins Zimmer; die Entscheidung über seinen Einsatz war gefallen.
"Wenn es denn schon sein soll, dann bist du mein erstes Publikum." Mit diesen Worten begann er seinen Bericht, den er von nun an zwei- oder dreimal in der Woche hielt, wobei er oft bei dem Wörtchen "ich" stolperte. Er musste erst lernen, von sich, von seinen Gefühlen und Gedanken, von seinen Taten und von seiner Vergangenheit zu sprechen.
Jaschas Bericht von schweren Tagen
Es war nie mein Wunsch, Infanterist zu sein. Als ich in meinem Heimatdorf Krestowaja - es liegt im Waldaigebiet - als vierzehnjähriger Junge einen meiner ersten Filme sah, ich glaube, er war noch stumm, kam darin ein Pilot vor, der mit seiner Maschine gewagte Figuren drehte. Alles erschien mir so leicht, so mühelos. Seitdem wollte ich unbedingt Flieger werden. Oft blickte ich zum Himmel, um ein Flugzeug zu erspähen - aber über unser Dorf zog niemals eines seine Bahn, bis heute nicht. Wem ich auch meinen Berufswunsch anvertraute - jeder lachte darüber. Nur mein Vater hörte mich an und sagte nachdenklich: "Als wir hier den Kolchos gründeten, haben wir nicht geahnt, dass Jungen aus unserem Dorf einmal in den Himmel steigen möchten. Vielleicht wird so etwas später möglich sein. Für diesen Beruf muss man einiges mehr wissen, als du hier lernen kannst." Damit hatte er Recht, denn das Bildungsniveau in unseren Dorfschulen war Anfang der dreißiger Jahre noch nicht besonders hoch. So blieb ich zu Hause und arbeitete im Kolchos.
Meine Militärzeit kam heran. Ich wollte es noch einmal versuchen und trug der Musterungskommission meinen Wunsch vor. Ein älterer Offizier unterhielt sich mit mir und kam zu dem Schluss, dass ich für das fliegende Personal nicht geeignet sei. Dazu wären meine Wissenslücken zu groß. Doch er schlug mir vor, beim Bodenpersonal zu dienen. Dort benötige man ebenfalls tüchtige Leute. Ich stimmte zu. In der Nähe von Flugzeugen zu arbeiten war doch auch schon etwas.
Meine Grundausbildung begann im Herbst 1939. Marschieren, schießen, kriechen, Nahkampf; außer den Kragenspiegeln von der Fliegerei keine Spur. Nach einem guten halben Jahr wurde ich zu einem Flugplatz abkommandiert. Im Wirtschaftszug habe ich alles gemacht, was zu tun war: in der Küche geholfen, Material und Ersatzteile verwaltet, Maschinen betankt. An qualifizierte Arbeiten kam ich nicht heran, ihr wisst ja, meine mangelhafte Bildung.
So leistete ich meinen Wehrdienst und war ganz zufrieden dabei. Es war zwar nicht die Erfüllung meiner Träume, doch war der Dienst nicht uninteressant, jedenfalls für einen Jungen vom Dorf wie mich.
Auf einem Flugplatz in der Ukraine erfuhr ich am 22. Juni 1941, dass uns die faschistische deutsche Wehrmacht überfallen hatte. Wir waren alle wie vor den Kopf geschlagen und begriffen nichts. Krieg mit Deutschland? Undenkbar! Mit Deutschland hatten wir doch keinen Streit, es war sogar ein Nichtangriffspakt geschlossen worden. Und nun dieser Wortbruch! Niemand wusste eine Antwort. Waren wir zu leichtgläubig gewesen, zu sehr mit unserem Aufbau beschäftigt?
Jetzt war keine Zeit, darüber nachzudenken; es war Krieg, und wir mussten uns verteidigen. Die Maschinen wurden repariert und überprüft, betankt und startklar gemacht. Die Angreifer sollten uns kennen lernen! Allerdings, das muss ich heute auch sagen, wusste ich wenig von der Stärke der deutschen Militärmaschinerie, umso bestürzter war ich nach den Meldungen vom Vormarsch der Deutschen.
Unsere Maschinen stiegen auf und stellten sich dem Gegner in der Luft. Einige kehrten aus dem Kampf nicht zurück. Andere landeten, durch die Luftkämpfe zum Teil schwer beschädigt. Der kleine unversehrte Rest wurde auf einen anderen Flugplatz verlegt. Wir blieben am Ort und versuchten, die zerschossenen Flugzeuge zu reparieren.
Eines Tages beobachteten wir, wie in einiger Entfernung gegnerische Fallschirmjäger absprangen. Vermutlich sollten sie den Flugplatz besetzen. Hauptmann Trofimow versammelte das Bodenpersonal um sich und befahl unserer kleinen Gruppe, die Angreifer zu vernichten. Mit drei, vier anderen Jungen bekam ich den Auftrag, ein von starkem Unterholz bewachsenes Waldstück abzusuchen.
Als wir uns dem Wald näherten, begannen die Kugeln zu pfeifen. Ein sehr unangenehmes Gefühl, denn es waren die ersten Kugeln, die mir um die Ohren flogen, und wir lagen nicht gut getarnt. Aber man lernt alles, wenn es ums Leben geht. Ich rollte mich in eine tiefere Furche und schoss aus meiner MPi auf die Büsche am Waldrand. Auch meine Nachbarn hatten sich gefasst. Sie übernahmen die anderen Abschnitte.
Als wir die Magazine wechselten, merkten wir, dass kein Feuer mehr zurückkam. Wir krochen näher, und ich fand einen toten Fallschirmjäger. Es war der erste Deutsche, den ich überhaupt gesehen habe. Obgleich der Anblick schrecklich war, überkam mich doch ein Gefühl der Überlegenheit. Wir haben dann den Wald durchkämmt.
Trofimow war ganz zufrieden. Er meinte aber, wir hätten nicht alle vernichtet, müssten also auf der Hut sein.
Ein paar Wochen später räumten wir den Flugplatz, und seitdem, seit Herbst 1941, gehörte ich zur Division von General Rodimzew. Er leitete zu Kriegsbeginn die 5. Luftlandebrigade des 3. Luftlandekorps, das im Militärbezirk Odessa lag. Die Luftlandetruppen haben ganz schön mitgemischt. Sie verteidigten sich geschickt und gingen mehrmals zu Angriffen über. Dann wurden sie in die 87. Schützendivision umgebildet, und zu ihr gehörten nun auch wir. Jetzt ging es nicht mehr nur um die Verteidigung von Feldflugplätzen, sondern wir vollzogen die verschiedensten Manöver, übten, den Gegner zu umgehen und ihn einzukreisen. Im Dezember befreiten wir auf diese Art die Stadt Tim; sie liegt in der Ukraine. Wir müssen uns wohl ganz gut geschlagen haben, denn wir wurden im Januar 1942 in 13. Gardeschützendivision umbenannt, und sogar den Leninorden hat man uns verliehen.
Die Verteidigungskämpfe gingen weiter, und natürlich merkten wir, dass der Gegner zum Don vorstoßen wollte. Wir wandten eine neue Taktik an: Wir schoben uns zwischen die Panzerspitzen der 6.deutschen Armee, und unsere Schützen griffen die Infanterie und die Nachschubeinheiten an, so dass die vorauseilenden Panzer oft ohne Treibstoff liegen blieben und für uns ein gutes Ziel abgaben. So verliefen viele Kämpfe in den Frühlings- und Frühsommerwochen 1942. Aber es gelang uns nicht, den Gegner zum Stehen zu bringen. Oftmals, wenn wir in Dörfer kamen, deren Bewohner evakuiert oder geflüchtet waren, dachten wir traurig: Wer wird die Ernte in diesem Jahr einbringen? Wir oder sie?
Der Krieg hat mich geprägt, meine ganze Generation. Ich wache nicht selten nachts auf, weil mir immer noch eine Frage durch den Kopf geht: Konnten wir den Feind nicht eher stoppen? Diese Verwüstungen! Fast alles war erst unter der Sowjetmacht aufgebaut worden. Und wie viel hatten wir noch vor! Wir fingen ja erst an. Vielleicht wollten die Faschisten gerade deshalb die Sowjetmacht zerschlagen, Weizen, Erz und Öl stehlen und die Bevölkerung versklaven?
Hitler und seine Anhänger hatten vor, unser Heimatland in einem Blitzkrieg zu erobern. Sie redeten den deutschen Soldaten ein, der Feldzug dauere nicht lange. Den Bauernsöhnen versprach man einen Hof in Russland oder in der Ukraine, den Städtern einen einträglichen Posten in der Industrie oder Verwaltung.
Ja, eigentlich wollten die faschistischen Truppen im Sommer 1942 längst wieder zu Hause sein. Ihre Taktik der Umgehungsoperationen hatte sie gegen Ende des Jahres 1941, nach einem halben Kriegsjahr, vor die beiden größten Städte unseres Landes geführt. Sie standen vor Moskau und Leningrad. Ihre Artilleriebeobachter konnten durch die Scherenfernrohre bereits die Spitzen der Kremltürme ausmachen; Leningrad lag unter Beschuss und war lediglich durch eine Wasserstraße mit dem Hinterland verbunden. Für die sieggewohnten Soldaten mit dem Hakenkreuz an der Mütze schien es nur noch eine Frage der Zeit, wann die Siegesparaden stattfinden würden. Die Einladungen dazu waren bereits gedruckt; als Termin war der 7. November angegeben worden, der Tag des Sieges der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. Die Musiker ihres Militärorchesters übten schon die Parademärsche.
Aber entgegen allen Voraussagen in ihrem Rundfunk, den Zeitungen und Wochenschauen ereignete sich etwas Unvorhergesehenes. Leningrad verteidigte sich hart und unerbittlich; unser Sperrriegel aus Soldaten und Zivilisten war nicht zu brechen. Modernstes Kriegsmaterial wurde eingesetzt, Granaten der größten Kaliber überschütteten die Häuser und Kampfstellungen - doch das ganze Land kämpfte mit der Stadt Lenins und schickte, was es nur entbehren konnte. Die schöne Stadt an der Newa war zu einer Festung geworden, die bis zum Sieg, nach 900 Tagen Belagerung, nicht eingenommen werden konnte.