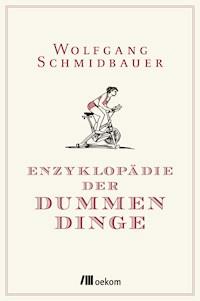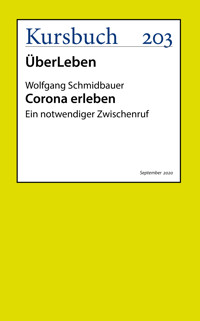9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Wolfgang Schmidbauer hat als Psychoanalytiker und Gruppentherapeut täglich mit dem Thema «sexuelle Außenbeziehung» zu tun. Bei weitem die meisten Klientinnen und Klienten kommen zur Therapie, weil sie Beziehungsprobleme haben. Und Beziehungsprobleme nehmen ganz überwiegend die Form von realen oder phantasierten Liebesverhältnissen neben der legitimierten Liebe in Ehe oder Partnerschaft an. Hier tut sich das Schlachtfeld des Lebens auf. Obwohl das sexuelle Tabu an Macht verloren hat, werden auch heute noch viele Liebesbeziehungen geheim gehalten. Warum? Klatsch, Intrigen, Spionage, Detektive kommen ins Spiel. Oder umgekehrt: Das Geheimnis wird verraten. Warum? Wer verfolgt welche Ziele durch seinen Verrat? Die verheimlichte Liebe gehorcht bestimmten Spielregeln, die in diesem Buch transparent gemacht werden. Schmidbauer plädiert für eine «gefühlsfreundliche Vernunft», die etwas ganz anderes ist als Zweckmäßigkeit, Kontrolle, Triebfeindlichkeit oder Konsequenz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Ähnliche
Wolfgang Schmidbauer
Die heimliche Liebe
Ausrutscher, Seitensprung, Doppelleben
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Einleitung
Kein Feuer, keine Kohle
Kann brennen so heiß
Als heimliche Liebe,
Von der niemand nichts weiß.
Das Volkslied ist mir, wie vielen anderen, die es einmal gehört haben, im Gedächtnis geblieben. Näher betrachtet ist es jedoch gar nicht einfach, zu verstehen, was hier mit heimlicher Liebe gemeint ist. Handelt es sich um ein Gefühl, das noch nicht einmal dem genau bekannt und bewusst ist, der es in sich trägt, noch viel weniger irgendeinem Zweiten? Das sich nun den Weg nach außen frei brennt und dabei auch den nicht schont, der es in sich trägt?
Der Beginn solcher heimlichen Schwärmereien liegt in der Pubertät und Adoleszenz. Die heimliche Liebe ist sozusagen eine Probeliebe, ein Versuch, in der Phantasie mit Bindungen und Loslösungen zu spielen. Vielleicht hängt das Volkslied auch mit einem Aberglauben zusammen, der gebietet, Liebesglück vor dem Neid Dritter zu verbergen. Im Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach steht ein Lied:
Willst du dein Herz mir schenken,
So fang es heimlich an,
Dass unser beider Denken
Kein Mensch erraten kann.
Dieses Gebot erinnert an die Sitte, von Kindern niemals zu sagen, dass sie schön und gesund sind, weil dadurch der Neid von Hexen ausgelöst wird, die dafür sorgen, dass die so Gerühmten erkranken und sterben. Die Verheimlichung bietet eine Möglichkeit, den bösen Blick abzuwehren. Wenn sich Liebende kennenlernen und anziehend finden, unternehmen sie Anstrengungen, sich zurückzuziehen: aus der erleuchteten Diskothek in die Dunkelheit, aus der Cocktailparty in eine intime Bar, aus dem Hörsaal in die Studentenbude. Menschen, die im Dunkeln keine sexuellen Hemmungen spüren, fühlen sich im Licht unfähig zur physischen (das heißt auch: wahrnehmbaren) Liebe.
Liebende sind gewissermaßen gezeichnet, Eros und nur Eros ist es, der sie verbindet. Wenn sie sich nicht als Kollegen, Sportskameraden oder in anderer harmloser Beziehung tarnen können, müssen sie sich verbergen. In der Öffentlichkeit des bisherigen Freundeskreises oder der Familie fürchten sie, beschämt oder gar ihres Glücks beraubt zu werden.
Solche Bedenken können unrealistisch sein. Es drohen gar keine wirklichen Gefahren, die Vorgesetzten, Arbeitskollegen oder Nachbarn haben nichts gegen das sexuelle Verhältnis. Niemand würde die Liebenden kränken oder berauben, und doch fürchten sie sich davor. Das liegt daran, dass unsere soziale Umwelt fast immer Eltern-Projektionen trägt. Frischbekannte Liebespaare warten häufig eine gewisse Festigkeit und Verlässlichkeit der Bindung ab, ehe sie sich den Gleichaltrigen vorstellen. Bei den Eltern dauert es oft noch weit länger, ehe sie von einer erotischen Beziehung ihrer Söhne oder Töchter erfahren.
Sehr häufig sind die Verheimlichungsgründe aber durchaus realistisch. Bereits gebundene Liebende fürchten um ihren Ruf, haben Angst, von ihrem Partner kritisiert oder durch Liebesentzug bestraft zu werden. Nach wie vor ist die ungeordnete Sexualität neben Korruption und Sucht der zentrale Vorwurf, mit dem Prominente zu rechnen haben. Ein Politiker, der Präsident werden möchte, muss zumindest in den USA nicht lange darauf warten, dass seine Fähigkeiten, Liebschaften zu verheimlichen, einer harten Probe unterzogen werden.
Stellen wir uns vor, dass Flugreisen geheim gehalten werden und die geräuschlosen Maschinen nur nachts verkehren. In dieser Situation erfahren wir von solchen Reisen nur dann, wenn wir selbst in einem Flugzeug sitzen oder wenn wir davon erfahren, dass eines abgestürzt ist. Diese Metapher hat ihren Zweck erfüllt, wenn sie anschaulich macht, dass sehr viel an heimlicher Liebe ohne jede Auffälligkeit abläuft. Wenn eine heimliche Liebe bekannt wird, ist sie bereits aus dem Geheimnis herausgefallen. Jede Öffentlichkeit nimmt der heimlichen Liebe den Reiz der symbiotischen Zelle, der Überlebenskapsel von Sehnsucht und Grenzenlosigkeit im Alltag. Wohlwollende und begrenzte Mini-Öffentlichkeiten einer Beratungssituation werden oft verdächtigt, sich wenig von bösartigen Formen wie Tratsch in der Nachbarschaft, unter den Kollegen oder (bei Prominenten) in den Medien zu unterscheiden.
1Lust im Verborgenen
Erotische Lust ist nicht nur eine der mächtigsten Befriedigungsquellen aus dem eigenen Körper. Sie bezieht sich bei den meisten Menschen auf ein Gegenüber. Diesen Lustmöglichkeiten entspricht eine starke Bindung an Menschen, welche mit dieser Lust verknüpft werden. Im Orgasmus entgleitet dem bewussten Ich für einige bedeutungsvolle Augenblicke die Kontrolle. Diese Empfindung ist ebenso fesselnd wie im Grunde ängstigend. Die Selbstvergessenheit lässt einen Verlust der Selbstkontrolle fürchten. Sie führt dazu, dass viele Menschen den Orgasmus durch hektische Anstrengungen haben wollen, bevor er sie hat.
Abhängig zu sein von einem autonomen, seelisch-körperlichen Erregungsprozess verknüpft sich mit der Abhängigkeit von den Partnerinnen und Partnern der Intimität. Der Partner kann die Sexualität vertiefen, vielleicht sogar erst erlauben; er kann sie aber auch lähmen und abtöten. Im ersten Fall ist ein erotisierender Regelkreis in Gang gekommen: die Enthemmungs- und Lustzulassungsschritte des einen Teils stoßen analoge Schritte beim anderen an, welche zurückwirken und so die Erlebnisintensität steigern. In einem positiven Entwicklungsprozess bestätigen sich die Partner in ihrem erotischen Selbstbewusstsein. Sie vertiefen den Glauben an die eigene Potenz, ein Gegenüber zufrieden zu stellen und in diesem Prozess auch selbst befriedigt zu werden.
Diese Interaktion kann aber auch ganz anders ausgehen. Ein Partner fühlt sich nicht bestätigt, sondern entwertet. Der primär Leidenschaftlichere, an einer Steigerung der sexuellen Intensität Interessierte steht dann vor einem Scheideweg. Seine Wahl entscheidet oft über das erotische Schicksal der Beziehung. Er kann, wenn ihn das Zögern des Gegenübers entmutigt und sein eigenes erotisches Selbstvertrauen gering ist, sich wie ein Bittsteller fühlen, die Rolle des Verweigernden höher schätzen als die des Begehrenden und anfangen, seinerseits weniger Wünsche zu haben, um nicht das erleiden zu müssen, was er als Blamage und Absage an seine Anziehungskraft erlebt. Oder aber er kann auf seinen Wünschen bestehen, um sie werben, und so ein zögerndes und unsicheres Gegenüber vielleicht doch noch an einer gemeinsamen Entwicklung interessieren.
Der zweite Fall beschäftigt den Ehetherapeuten kaum, der erste jedoch häufig. Er lernt nicht selten seine Spätstadien kennen, wenn die sexuelle Beziehung eines Paares schon seit Jahren scheinbar unbemerkt eingeschlafen ist und nur noch durch starke Reize – wie einen Seitensprung, eine Trennungsabsicht oder einen Kinderwunsch – aufgeweckt wird. Er sieht auch manchmal chronisch in einem Zustand der Unzufriedenheit und projizierter Schuldzuschreibung lebende Paare, die nie über die sexuellen Themen sprechen, sondern diesen Konflikt indirekt austragen. Beispiel: Die Frau leidet unter der Nörgelei des Mannes an ihrer Haushaltsführung oder Kindererziehung. Der Mann leidet an ihrer Zurückweisung. Er führt seine Nörgelei auf ihr erotisches Desinteresse zurück; sie erklärt ihr Desinteresse durch seine Nörgelei.
Fast alle Liebenden der Moderne suchen mehr in ihren Partnerschaften als sexuelle Befriedigung und wirtschaftliche Hilfe («Bauer und Bäuerin»). Es geht auch um Elternersatz, um narzisstische Bestätigung, Geborgenheit, Sicherheit. Man kann im Einzelfall oft genau erkennen, wie die sexuelle Befriedigung der Sicherheit geopfert wird, wie Eltern-Kind-Elemente, wechselseitig genommen und gegeben, die leidenschaftlichen Elemente aus dem Feld verdrängt haben. Wenn Kinder heranwachsen sollen, schleicht sich nicht selten nach einigen Jahren auch in den Anredeformen diese Dominanz ein: Die Frau sagt nun «Vater» zu ihrem Mann; der Mann erwidert mit «Mutter», so wissen die Kinder, wer gemeint ist.
Nicht zu unterschätzende Probleme entstehen durch die Zwänge der modernen Liebe, Werte zu teilen, um sich abzugrenzen. Paare entwickeln hier grobe oder subtile Strategien – die einen werden zu Feinschmeckern, die Zweiten sind sportlich, die Dritten gehen zu Kunstauktionen und legen gemeinsam oder im Wettbewerb eine Sammlung an, die Vierten konzentrieren sich auf den Garten, andere auf Fernreisen oder eine religiöse Sekte. Und immer, wenn die alten Freunde eingeladen werden, findet das alternde Paar nach dem Besuch ein Stück Aufwertung darin, dass die Gäste sozusagen stehen geblieben sind, immer noch nicht das Geringste von französischen Rotweinen, turkmenischen Teppichen, altem Porzellan oder Rosenzucht verstehen.
Solche Wertgemeinschaften sind aber nicht nur ein befreiendes und abgrenzendes Entwicklungsfeld. Sie können zu einer drückenden Enge führen, wenn einer der Partner sich darin unterlegen fühlt, ohne aber genügend Distanz und Durchsetzungskraft zu haben, diese Unterlegenheit offen auszutragen.
Eine typische Sozialgenese solcher latenten Konflikte ist die Aufsteigerehe. Ich skizziere eine Entwicklung, die solche Paare in eine Krise führt. Nehmen wir an, ein Mann aus einer Arbeiter- oder Bauernfamilie hat in eine gebildete Schicht eingeheiratet. In den Anfangszeiten der Beziehung ist für den beruflich erfolgreichen und ehrgeizigen Aufsteiger alles in schönster Ordnung. Die Felder des Berufs, der Freizeit und der Erotik beherrscht er so gut wie seine Partnerin.
Wird aber ein gemeinsamer Haushalt aufgebaut, sollen Kinder erzogen werden, dann hat es der Mann oft sehr schwer standzuhalten. Er findet viele der Dinge, an die seine Frau ihr Herz hängt, eher nebensächlich und nicht selten reine Zeitverschwendung.
Das Aufwachsen der gemeinsamen Kinder reizt ihn zu ständigen Vergleichen mit der eigenen Kindheit. Er kann weder mit den – so scheint es ihm – verwöhnten Ansprüchen der Kinder zurechtkommen noch akzeptieren, dass seine Frau nicht nur nichts tut, um sich gegen diese abzugrenzen, sondern sie auch noch fördert.
Ballettkurse, Klavierstunden, Reitunterricht, er hat das nicht gebraucht, wozu soll es gut sein? Nicht selten bildet sich dann eine Einheit aus der Mutter und den Kindern; die Freizeitgestaltung von einst – der Sport etwa – ist durch die Verpflichtungen der Kindererziehung ohnehin erschwert.
Der Vater zieht sich auf das Feld zurück, in dem er immer seine größte Bestätigung fand: die Berufsarbeit. Die Mutter nimmt mit leisem Groll zur Kenntnis, dass Elternabende und Kinderarztbesuche ihr zufallen. Aber sie tut ihre Pflicht, auch wenn ihr Mann findet, dass sie ihre Fürsorge übertreibt. Von ihm mehr getadelt als bestätigt, nähert sie sich oft wieder ihrer Ursprungsfamilie, ihrem eigenen Vater oder einer vertrauten Freundin, die ihre Wertvorstellungen mehr teilen als ihr bisher so wichtiger Partner. Sie findet es anstrengender, ihren Partner für solche Aktivitäten zu motivieren, als sie ihm abzunehmen. So entfremden sich die Eheleute. Wenn unter diesen Bedingungen auch die gemeinsame Erotik leidet, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass sich der Mann beim nächsten Betriebsausflug oder auf der nächsten Messe von einer unverheirateten Kollegin ungleich mehr bestätigt und angezogen fühlt als von seiner Frau.
Die Geburt eines Kindes, die das Verhältnis von Bauer und Bäuerin stabilisierte, ist eine charakteristische Krisenquelle in den modernen, individualisierten Beziehungen. Sie belastet fast immer die Fähigkeiten eines Paares, den gewohnten Austausch an Zärtlichkeit, Lust, Bestätigung aufrechtzuerhalten. Das Kind schreit Bedürfnisse unabweisbar hinaus, auf deren Befriedigung ein Erwachsener stumm zu warten pflegt und die er nicht einmal sich selbst eingesteht. Es liegt wie ein Magnet im Zimmer, der an sich reißt, was bisher zwischen den Erwachsenen hin und her floss.
In jeder Liebesbeziehung begegnet der Mensch paradoxen Situationen, die der Mathematik des Rechts spotten. Die eigene Eifersucht ist quälend und schreit nach Rücksicht; die Eifersucht des anderen ist lästig und sollte verschwinden. Ich will gerne meinen Partner immer haben, wenn ich ihn brauche – aber weshalb belästigt er mich schon wieder mit seinen Ansprüchen? Ich bin schüchtern und ängstlich, ich würde so gerne erobert und verführt werden – wieso kapiert meine Partnerin nicht, was sie da tun müsste, andere Frauen erraten doch auch die Wünsche der Männer! Ich hätte gern einen Mann, der weiß, was er will, und nicht einen Flunsch zieht, wenn ich wieder nicht die Initiative ergreife …
Die Ursachen solcher Widersprüche liegen in dem instabilen Gemisch, aus dem die Liebe der Erwachsenen gemacht ist. Ihre Elemente sind unter anderem die Bindung des Kindes an die Eltern, die Lustquellen der Erotik und eine soziale Norm, die versucht, eine Kultur funktionsfähig zu erhalten und widersprüchliche Interessen auszugleichen. Aus diesen Elementen schafft die Liebe eine Synthese, wie ein Maler aus Pigmenten, Öl und Leinwand ein Bild, ein Kunstwerk eigener, unwiederholbarer Art.
Die kindlichen Ansprüche an den idealisierten, den absolut vertrauenswürdigen Partner, der es verdient, dass zu ihm aufgeschaut wird (der Mann, der’s wert ist, die Frau mit Klasse …), sind dabei viel schwerer zu erkennen und zu berücksichtigen als die sexuellen Wünsche. Sie haben auch eine schlechtere Presse, sie werden nicht als das gehandelt, was sie sind: Emotionen, Affekte, Leidenschaften, Irrationales, sondern als Normen, als Verhalten, das sich gehört oder ungehörig ist, als moralische Integrität oder Verwerflichkeit. Aber die winzigen Kleinigkeiten, aus denen wütende Beziehungskämpfe erwachsen, verraten die hochgespannte Idealisierung einer Beziehung, die wie ein Luftballon bereits durch den winzigsten Defekt ihre Form verlieren kann.
Die gegenwärtigen Beziehungsprobleme hängen sehr oft damit zusammen, dass sich eine persönliche, emotionale Sicht mit einem normierenden Diskurs schier untrennbar vermengt. Wenn ein eifersüchtiger Mann seine Frau als Hure und Ehebrecherin beschimpft, regrediert er auf die traditionelle Moral und einen vorindividualisierten Zustand der Beziehungen. Er versucht, durch sozialen Druck (alle werden die Ehebrecherin ächten; in den härteren patriarchalischen Traditionen werden doch solche Frauen gesteinigt) die Partnerin zu sich zurückzuzwingen oder aber sich wenigstens dafür zu rächen, dass es ihm nicht gelingt, am wahrscheinlichsten – eben weil die Eifersucht das Liebes-Konglomerat spiegelt – alles zugleich und miteinander. Ich hasse sie so, dass es unerträglich wäre, sie zu verlieren. Denn dann muss ich jede Hoffnung aufgeben, dass es ihr gelingt, aus mir, diesem Bündel aus kindlicher Anklammerung und Hass, wieder den tollen Partner zu machen, der zu sein ich ihr versprochen habe. Sie muss das können, sie muss grandios sein, übermächtig, eine Hexe, nein: eine gute Fee, die mich zurück in die Verliebtheit zaubert, die einmal da war und die sie jetzt – ich glaube ihr kein Wort, wenn sie sagt, es sei nicht so – einem anderen, ganz Unwürdigen schenkt.
Die Frau wird diese widersprüchlichen Wünsche erraten, sich aber auch über sie ärgern, sie zurückweisen und sich schämen oder schuldig fühlen. Je mehr der moralische Druck steigt, desto stärker werden wohl auch ihre Wünsche, heimlich oder offen andere Erfahrungen mit anderen Männern zu machen.
Wenn Partner diese Situation klären wollen, muss mindestens einer von ihnen eindeutig sein, das heißt, nur noch in einem semantischen System operieren. In dem traditionellen muss der Mann sich von einer Frau trennen, die er moralisch entwertet, oder ihre Seitensprünge großmütig übersehen. In dem individualisierenden Modell muss er nicht mehr über Moral, sondern über seine Ängste, seine Sehnsüchte, seine Wünsche sprechen und seiner Partnerin zeigen, wie viel von ihrem Verhalten er ertragen kann und wo seine Belastungsgrenze überschritten ist.
Dieses Verhalten ist erheblich schwieriger, weil es den eigenen Bedürfnissen nach Sicherheit, nach Selbst-Idealisierung, nach Aufwertung der eigenen so in Frage gestellten Männlichkeit krass widerspricht. Aber es ist auch aussichtsreicher, weil es die Basis der Beziehung festigt, nicht einen längst brüchig gewordenen Überbau. Und es verhindert den destruktivsten Prozess in Beziehungen: die Entwertung des Partners, um den eigenen Wert zu retten, der aber auf diese Weise so unterminiert wird, dass am Ende – wie in Edward Albees Stück «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» – gerade die Entwertung, die gnadenlose narzisstische Kränkung ein Paar zusammenschweißt und die Hölle, die sie sich gegenseitig bereiten, unentrinnbar macht.
Die Kunst der Tarnung ist ein Teil der Kriegskunst, die Lüge eine Kriegslist. Daher haben sich in literarischen Darstellungen der heimlichen Liebe oft Metaphern erhalten, in denen auch die Beziehung zwischen Mann und Frau Qualitäten eines Kampfes hat. Der Triumph der Heimlichkeit ist kein Triumph, solange zum Triumph gehört, dass er öffentlich ausgekostet werden kann. Diese Situation schafft jene merkwürdige Nähe der Heimlichkeit zur Liebe, deren innige Qualitäten in ihrer Veröffentlichung zugrunde gehen. Ausdruck und Zurückhaltung haben ihre eigenen Ambivalenzen. Wer seine Liebe ganz ausdrückt, hat das Gefühl, sie wegzugeben und nichts mehr von ihr zu behalten. Wer sie zurückhält, muss fürchten, übersehen und nicht beachtet zu werden.
Auf viele Liebende übt gerade die Zurückhaltung der Partnerin oder des Partners großen Reiz aus. Wer alles gibt, hat nichts mehr zuzusetzen; wer etwas zurückhält, wirkt reich und geheimnisvoll. Es ist nie alles gewesen. In einer Zeit, in der ein Gefühlsausdruck nirgends besser «rüberkommen» muss als im Werbefernsehen, schützt uns das von vielen Menschen als Hemmung verabscheute Zögern, ohne Stocken «Ich liebe dich» zu sagen, vor Banalität. Je schwerer solche Worte über die Lippen kommen, desto kostbarer sind sie – sind sie nicht dann am kostbarsten, wenn sie nie gesagt werden, nur insgeheim gedacht?
Eine weitere Paradoxie ist die von Vereinzelung und Bindung. Liebende, so will es die Hoffnung der Menschen, die sich einsam fühlen, sind niemals allein. Aber gerade die Personen, welche an eine Liebesbeziehung solche Erwartungen richten, beschwören geradezu das herauf, was sie um jeden Preis vermeiden wollen. Ich erinnere mich an eine achtunddreißigjährige, sehr schöne und kluge Akademikerin, die – während sie mit dem einen Freund versuchte, ein Kind zu empfangen – auf Heiratsanzeigen antwortete und mit erbärmlich schlechtem Gewissen andere Männer traf, weil sie fürchtete, nicht schwanger zu werden, und weiter fürchtete, dass der gegenwärtige Freund ihre Kinderlosigkeit nicht ertragen könnte, sich von ihr trennen würde, sodass sie mit dreiundvierzig Jahren einsam wäre; dann wären ihre Chancen, einen neuen Mann kennenzulernen, dermaßen schlechter geworden, dass sie unbedingt jetzt alles daransetzen müsste, den Mann zu finden, mit dem sie alt werden könnte.
Es ist einzusehen, dass diese Frau durch ihre Unsicherheit, ob sie gut genug für einen Mann sei, höchste Ansprüche an sich und den potenziellen Partner richtete; so lebte sie in dem Gefühl, ständig von Einsamkeit bedroht zu sein, weil sie selbst – um dieser Gefahr zu entgehen – jederzeit bereit war, sich «für ewig» an den Mann zu binden, dem sie ein solches Gelöbnis glauben könnte. Der kleine Fehler, der das System zuschanden machte, war nun, dass sie keinem Mann glauben konnte, er würde sie nicht – wie sie es doch auch plante – jederzeit wegen einer anderen verlassen, deren Ewigkeitsversprechen glaubhafter wäre. Ihre Klugheit nützte ihr angesichts ihrer Panik nur sehr wenig; sie war in den letzten Monaten nicht schwanger geworden und fürchtete jetzt schon, dass ihr das nie gelingen würde.
Liebeswünsche, die früher spirituell befriedigt wurden (Jesus Christus, dem sich eine Nonne vermählt), sind heute verweltlicht. Darüber hinaus ist die Paarbeziehung durch die Tatsache überfordert, dass sie auf Entscheidungen beruht. In der traditionellen Welt suchten die Eltern Partner für ihre Kinder. Heute ist es eigentlich am einfachsten, wenn die Intensität einer sexuellen Beziehung zu einer Schwangerschaft führt und danach das reale Kind die Auseinandersetzung des Paares mit den Fähigkeiten zur Elternschaft einleitet. Vorher abwägend zu entscheiden, ob es der/die Richtige ist, mit dem sich da ein Anfang entspinnt, ist Heldenwerk und passt geradeso gut zu Sisyphus wie zu Herkules.
Die Partner – und am schlimmsten sind natürlich Pädagogen, Psychologen, Ärzte und andere Berufe, die sich über die zahllosen Möglichkeiten kundig gemacht haben, wie Elternschaft scheitern kann – nehmen sich vor, alle Fehler zu vermeiden. Sie wollen die Frage ihrer Elternwürdigkeit klären, ehe sie sich auf das Unternehmen Kind einlassen. Dadurch wird die ohnehin vorhandene Neigung verstärkt, im Partner Elternersatz zu suchen. Ein gesundes Baby, wie es mit hoher Wahrscheinlichkeit geboren würde, hat relativ einfache Ansprüche und wächst recht schnell heran. Was aber Erwachsene an babyhaften Ansprüchen in sich tragen, ist kompliziert und wächst nicht heran.
Daher ist die Zensur der mit dem potenziellen Baby identifizierten Sozialberufler an der eigenen beziehungsweise der Elternkompetenz des Partners gnadenlos und kaum zu befriedigen. Das Paradox geht noch weiter. «Wenn du jetzt, wo wir noch gar kein Kind haben, schon so viel Angst vor dem hast, was da an Forderungen auf dich zukommt – wie willst du es dann jemals schaffen, ein Kind großzuziehen?» So ähnlich formulieren solche Menschen ihre Sorgen. Sie beachten nicht, dass die Angst vor einer imaginären Schwierigkeit immer größer ist als die Furcht vor einer realen Situation. In der angstgeleiteten Phantasie schreit das Baby immer, hat alle möglichen Krankheiten, der Partner dreht durch. In der Realität ist es sehr wahrscheinlich, dass das Baby auch einmal schläft, dass es vielleicht eine Krankheit hat, aber viele andere nicht, und dass der Partner nicht gleichzeitig mit dem Schreien des Babys durchdreht, sondern seine Ansprüche erst anmeldet, wenn dieses zufrieden gestellt ist.
Die beste Voraussetzung für Elternschaft ist eine gute sexuelle Beziehung, die sich nicht viel um die Zukunft schert, aber doch als so tragend erlebt wird, dass man ihr einige Auseinandersetzungen zumuten kann. Mit dieser Stabilität unter sich kann das Paar den Mut gewinnen, das Kind – schließlich ein Produkt dieser sexuellen Intensität – erst einmal in diese einzubeziehen und zu glauben, dass das Kind so gut sein wird wie die gemeinsame Erotik, dass es gewissermaßen erwacht, schreit, sich befriedigt und schläft.
Alles Weitere ergibt sich aus dem, was in diesem Geist mit dem Kind und dem Partner oder der Partnerin ausgehandelt wird. Unter diesen Prämissen ist Elternschaft nicht etwas, das vorhanden sein muss, ehe man wagt, sie zu beanspruchen, sondern etwas, das sich entwickelt und dann da ist, wenn es gebraucht wird. In Beratung und Therapie sehen wir freilich öfter die Paare, bei denen die sexuelle Beziehung bereits dadurch ernsthaft beschädigt wurde, dass sie nur dann stattfinden darf, wenn die Frage, ob die Partner füreinander (und womöglich für alle Zukunft) genügend gute Eltern sind, zufrieden stellend geklärt wurde.
Die charakteristischen Stationen der modernen Ehe sind
das Liebesverhältnis in getrennten Wohnungen,
der gemeinsame Haushalt,
das gemeinsame Kind.
Jede von ihnen muss in vielen Fällen mit einer Abnahme der erotischen Spannung erkauft werden. Nicht selten hört der Therapeut, wie Paare die Frühzeit idealisieren, in der die Liebesbeziehung noch viele Qualitäten der heimlichen Liebe hatte,[1] in der Mann oder Frau sich nachts oder in den Morgenstunden auf den Weg machen musste, um am nächsten Tag in der eigenen Wohnung aufzuwachen. Jeder führte ein Leben, das dem anderen in weiten Bereichen unbekannt war, in das dieser nicht hineinredete und hineinregierte. Wenn ich bei einer Geliebten zu Gast bin, stört es mich nicht, dass das Bad seit Monaten nicht geputzt wurde und in der Küche drei Kartons mit leeren Weinflaschen geduldig darauf warten, dass sie jemand entsorgt. Aber in meinem eigenen Haushalt kann ich Schmutz im Bad und Unordnung in der Küche nicht ertragen.