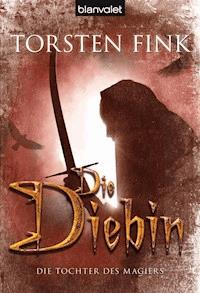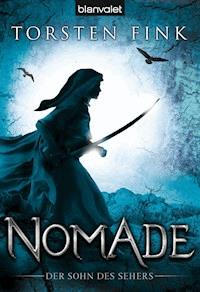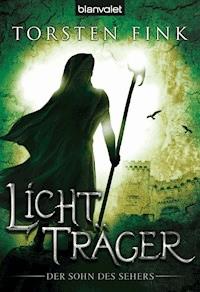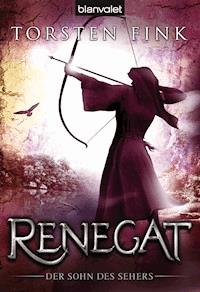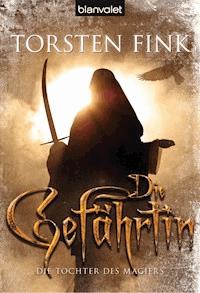7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Abenteuerschmöker mit Gänsehaut-Garantie
Nachdem ihre unstandesgemäße Liaison mit dem jungen Leutnant Henri entdeckt wurde, wird Marguerite 1542 auf einer einsamen Insel vor der Küste Neufundlands ausgesetzt. Gemeinsam mit Henri und ihrer treuen Amme Damienne versucht sie, auf dem angeblich verfluchten Eiland zu überleben. Doch die unheimlichen Gerüchte, die Insel werde von Dämonen beherrscht, scheinen sich zu bewahrheiten, und schon bald ist Marguerite ganz auf sich allein gestellt ...
• Nach einer wahren Begebenheit erzählt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Torsten Fink • Die Insel der Dämonen
Torsten Fink
Die Insel der
Dämonen
cbt – C. Bertelsmann Taschenbuch
Der Taschenbuchverlag für Jugendliche
Verlagsgruppe Random House
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
www.kreutzfeldt.de
1. Auflage
Originalausgabe Juli 2008
© 2008 cbt/cbj Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Leena Flegler
ISBN 978-3-641-01364-6
www.cbj-verlag.de
Eine dichte Nebeldecke lag über dem nachtschwarzen Atlantik. Der Wind war fast eingeschlafen. Es war nahezu vollkommen still, nur ganz selten knarrte irgendwo in der Finsternis ein Tau. Plötzlich erklang ein dünner, blecherner Glockenton, verhallte und eine heisere Männerstimme hob an und sang einige raue Worte in einer seltsamen Sprache. Es mochte ein Kirchenlied sein.
Die Stimme verebbte wieder.
Die Nebel teilten sich und der Bug eines großen Fischerbootes schob sich aus den Schleiern hervor. Es war keine dieser Nussschalen, die sich in Küstennähe hielten, es war gebaut, um monatelang auf hoher See auszuhalten und in fernen Gewässern große Mengen Stockfisch zu fangen. Im Bug kauerten zwei dunkle Gestalten im Schein einer verrußten Lampe und hielten angestrengt Ausschau.
»Das ist nicht natürlich«, sagte der ältere der beiden Fischer und spuckte missmutig in die schwarze See. Der Jüngere nickte. Er war bei Weitem nicht so erfahren wie der alte Antoine, aber in seinen vier Jahren auf See hatte er den Atlantik noch nie so unbewegt erlebt.
Vom Heck schlug erneut die blecherne Glocke und wieder sang eine brüchige Männerstimme ein paar Zeilen.
»Verrückter Baske«, murmelte Antoine, »wenn man wenigstens wüsste, was er da singt ...«
Jacques, der jüngere der beiden Männer im Bug, starrte in die See, die so trügerisch still unter ihrem Boot lag. Die Isabelle machte nicht mehr als ein oder zwei Knoten.
»Warum singt der Baske?«, fragt er den Alten. Er kannte die Antwort, aber er wollte das Gespräch in Gang halten. Die schweigsame See machte ihm Angst.
»Weil er übergeschnappt ist«, brummte der andere. »Er meint, die Engel hören und beschützen ihn und lieben seinen Gesang, aber wenn sie das für Gesang halten, dann müssen sie taub sein.«
Rodrigo, den alle nur »den Basken« nannten, war der Steuermann des Bootes. Er war wirklich ein wenig verrückt, aber er kannte sich aus auf dem Meer und als Steuermann machte ihm niemand etwas vor. Wieder schlug er die Glocke und sang ein paar Worte in einer Sprache, die außer ihm keine Menschenseele verstand. Jacques schwieg und starrte hinaus über das schwarze Wasser.
»Er hat viel gesehen, der Baske, zu viel, könnte man meinen«, fuhr Antoine fort. »Es muss vor zehn Jahren gewesen sein, hier, in denselben Gewässern, da ist sein Schiff untergegangen und mit ihm alle, die an Bord waren – alle außer dem Basken selbst. Muss ein fürchterlicher Sturm gewesen sein – obwohl ... Manche sagen, es war etwas anderes ...« Antoine spuckte erneut in die See.
»Niemand weiß, welche Wesen in diesen endlosen Tiefen hausen. Ich selbst habe schon Kraken gesehen, groß wie Häuser, mit Fangarmen, länger als unser Mast. Und riesige Wale mit Hörnern auf dem Schädel, die jedes Schiff in den Grund bohren könnten.«
»Und du meinst, so ein Ungeheuer hat das Schiff versenkt?«
»Das weiß ich nicht«, sagte Antoine gedehnt, »aber der Kapitän unseres Basken war einer der besten. Der wäre mit jedem Sturm fertig geworden – zumindest mit jedem Sturm, wie die Natur ihn macht. Aber hier, in diesen Gewässern, ist nicht nur die Natur am Werk. Die klugen Leute vom Festland mögen sagen, was sie wollen, aber hier gibt es Dinge, die über den Verstand von uns armen Menschen hinausgehen.«
Wieder klang die blecherne Glocke durch den Nebel und wieder sang Rodrigo ein paar fremde Worte.
»Und der Baske?«, fragte Jacques.
»Hat mit seinen Kameraden gegen den Sturm gekämpft. Allesamt verstanden sie ihr Handwerk, aber diesen Kampf konnten sie nicht gewinnen. Irgendetwas Böses war da am Werk.«
Jacques schauderte. Er hatte das alles schon einige Male von Antoine gehört. Der Alte kannte viele Geschichten, weshalb Jacques sich immer gern die Wache mit ihm teilte. Doch in dieser Nacht beunruhigte ihn die Geschichte des Basken mehr als sonst. Vielleicht lag es an dem dichten Nebel und der so tückisch ruhigen See – Jacques fühlte eine Beklemmung, die nichts mit dem üblichen wohligen Schauer zu tun hatte, den er sonst bei den Erzählungen des Alten empfand.
»Etwas Großes traf ihr Schiff«, fuhr Antoine fort. »Die einen sagen, es war ein großer Brecher, die anderen, es muss der Teufel selbst gewesen sein oder eines seiner Ungeheuer. Vielleicht haben sie es mit ihren Netzen aus einem jahrtausendelangen Schlaf geweckt? Vielleicht sollten die Menschen hier nicht fischen? Wer weiß das schon? Nun, ihr Schiff wurde von der Gewalt zerschlagen, so wie eine Nussschale von einem Hammer zertrümmert wird. Der Baske wurde ins Meer geschleudert, wie alle seine Kameraden – aber er hatte Glück. Er erwischte eine Planke, an die er sich klammern konnte. Und so trieb er, ein Spielball der gewaltigen Wellen, den ganzen Sturm hindurch auf dem endlosen Meer. Er rief nach seinen Kameraden, aber sie antworteten ihm nicht. Sie waren längst am Grund des Atlantiks angekommen – wenn der Atlantik hier überhaupt einen Grund hat und nicht direkt in der Hölle endet.«
Die Glocke läutete erneut, der Baske sang, und wieder spuckte der Alte, wie um seinem Satz Nachdruck zu verleihen, in die See.
»Der Kapitän sagt, da unten gibt es nichts außer Stockfisch und ein paar Walen«, wandte Jacques ein, aber er sagte es mehr, um sich selbst Mut zu machen. Ihm wäre es lieber gewesen, der Alte würde damit aufhören, in die See zu spucken. Wenn dort unten wirklich irgendeines jener riesenhaften Ungeheuer wohnte, dann sollte Antoine es besser nicht reizen.
»Kapitän Marais ist ein kluger Mann«, sagte Antoine gedehnt, »und ich habe allergrößten Respekt vor ihm, aber er hat nicht das gesehen, was ich gesehen habe. Es gibt in diesen Gewässern eine Insel – sie muss ganz hier in der Nähe sein –, von der die Schreie der in der Hölle gefolterten Seelen herüberschallen. Eine Insel, auf der Feuer speiende Dämonen nur darauf warten, dass sich unschuldige Seeleute an ihre Küste verirren. Sie tanzen die ganze Nacht und ihre Schreie mischen sich mit den Rufen der Gemarterten. Diese Insel hat ihre Wurzel in der Hölle.« Er brachte sein zernarbtes Gesicht dicht an Jacques’ Ohr und flüsterte: »Und ich habe sie selbst gesehen!«
Jacques schwieg beunruhigt. Diese Geschichte kannte er noch nicht, und er wunderte sich, dass der Alte sie ihm bislang noch nie erzählt hatte. Er war sich aber auch nicht sicher, ob er sie wirklich hören wollte. Auch dem Alten schien bei dem Gedanken an jene Insel nicht wohl zu sein.
Ein erneuter Schlag der Glocke holte sie zurück zu Rodrigos Schicksal.
»Der Sturm ließ irgendwann nach und unser Baske trieb endlose Tage auf offener See. Waren es drei? Waren es vier? Niemand weiß es. Mit seinem Gürtel band er sich an die Planke, um nicht abzurutschen, und das rettete ihm das Leben – das und sein Gesang.«
»Sein Gesang?«, fragte Jacques wie schon unzählige Male zuvor an dieser Stelle der Geschichte.
»Ja, sein Gesang. Sein Gesang half ihm, in den finsteren Nächten die Angst zu besiegen. Und er sang nicht irgendetwas – er sang alle Kirchenlieder, an die er sich erinnern konnte, und wenn er den Text nicht wusste, sang er nur die Melodie. Vielleicht haben ihn wirklich die Engel erhört und beschützt – wenn es denn an diesem gottverlassenen Ende der Welt Engel geben sollte. Es heißt, die Fischer, die ihn schließlich aus dem Wasser zogen, hätten ihn gehört, lange bevor sie ihn sahen, und der Baske behauptet steif und fest, dass er Glocken gehört habe, als die Rettung nahte. Kirchenglocken, mitten auf dem Meer! Wenn das nicht verrückt ist, dann weiß ich es nicht. Jedenfalls hat er danach all sein Erspartes zusammengenommen und sich eine Glocke schmieden lassen. Ohne die fährt er nicht mehr zur See. Deshalb halten ihn alle für verrückt. Sie sagen, eine Glocke gehört in die Kirche, nicht auf ein Schiff. Aber wenn du mich fragst: Er schlägt sie in jeder nebligen Nacht und er singt in jeder Nacht und geschadet hat es bislang nicht.«
Wieder schlug die Glocke. Antoine und Jacques schwiegen und lauschten der heiseren Stimme des Basken.
Über der Erzählung des Alten hatte es sich aufgehellt. Der neue Tag begann und eine leichte Brise hob an. Bewegung kam in die Nebelschleier und irgendwo dahinter stieg ein roter Lichtpunkt über den Horizont.
Eine Möwe schrie ganz in der Nähe. Jacques runzelte die Stirn. Möwen bedeuteten Nähe von Land.
Auch Antoine horchte auf. Der Baske war verstummt. Wieder ein Schrei. Doch diesmal war es keine Möwe. Es musste ein Vogel sein, den Jacques nicht kannte. Die leichte Brise wurde stärker, und der leichenblasse Nebel verflüchtigte sich so rasch, als hätte es ihn nie gegeben. Der Lichtpunkt der Sonne wurde stärker – aber er befand sich an der falschen Stelle!
»Mutter Gottes«, entfuhr es Antoine, als sich plötzlich, wie aus dem Nichts, der Umriss einer felsigen Insel vor ihnen auftat, und dort, am Ufer dieser Insel, wartete er auf sie: der Dämon, tanzend, Feuer speiend, ein riesenhafter Schatten vor flackerndem Licht, größer als ein Bär, mit vielerlei Farben im Pelz und auf verzerrte Weise menschenähnlich.
Antoine fuhr herum. »Um Gottes willen! Rodrigo! Beidrehen! Beidrehen! Das ist die Insel der Dämonen! Beidrehen! Jacques, Segel setzen! Der Dämon, der Dämon!«
Jacques stolperte zum Mast, um mit Antoine die Segel zu hissen, und Rodrigo warf das Ruder herum. Um sie herum erhob sich plötzlich ein Geschrei wie von tausend gequälten Seelen. Es gab keinen Zweifel, dies war die Insel der Dämonen, und sie mussten sich beeilen, wenn sie ihr Leben und ihre Seelen retten wollten.
I.
Château de Roberval
Der kurze, dicke Finger von Jean-François de La Roque Sieur de Roberval wanderte langsam über die Landkarte. Sie war druckfrisch aus Paris gekommen und ohne Zweifel ein Meisterwerk. Fremdartige Rankengewächse schlängelten sich um den üppigen Rahmen. Gruppen von federgeschmückten Wilden und stolze Soldaten mit der Fahne Frankreichs stützten das Emblem in der rechten unteren Ecke, auf dem in wortreichem Latein das Gezeichnete noch einmal beschrieben war. Drei Windrosen, mit Lilien als Wegweiser gen Norden, waren Ausgangspunkte für ein feines Netz von Linien, das die gesamte Karte überzog. Stattliche Schiffe mit geblähten Segeln kreuzten die Meere, aus denen fantastische fischähnliche Wesen ihre gehörnten Schädel streckten. In den vier Ecken der Karte verkörperten pausbäckige Engel mit Stummelflügeln die Winde und in der Mitte prangte das Wappen des Königs über endloser See.
Die Karte war, wie dem üppigen Emblem zu entnehmen war, eine Arbeit von Meister Jean und natürlich dem König von Frankreich gewidmet. Sie zeigte die nördlichen Gebiete der Neuen Welt. Wunderschön anzusehen war sie, doch bedauerlicherweise weder besonders genau noch sehr informativ. Der Zeichner hatte sich an den Berichten von Cabot, Verrazano und vor allem Cartier orientiert, aber deren Schilderungen waren lückenhaft, denn die Neue Welt war riesig und noch nicht einmal ihre Küsten waren hinreichend erforscht.
Meister Jean schien das wenig gekümmert zu haben. Er hatte einfach jede fehlende Information durch eine Vermutung oder Legende ersetzt und die Küstenlinien, wo sie unbekannt waren, nach Gutdünken gezeichnet oder mit Fabelwesen kaschiert.
De Robervals Zeigefinger wanderte von Frankreich geradewegs nach Westen. Der Zeichner hatte rund um das königliche Wappen einige Inseln über die Weite des Atlantiks verstreut. Brandani, Verde, Friesland, Demons – ob diese Inseln überhaupt existierten? Die namhaften Entdecker erwähnten keine von ihnen und doch gab es so viele Legenden über diese rätselhaften Eilande ... Sie konnten nicht alle erfunden sein!
Wie auch immer, es waren unsichere Orte. Fürchterliche Ungeheuer, feindselige Wilde und alle erdenklichen Ausgeburten der Hölle sollten dort ihr Unwesen treiben.
Der Finger verharrte am ersten glaubwürdig bezeugten Flecken Land der Neuen Welt: die Stockfischinsel, Baccalaos, wie sie die Portugiesen getauft hatten, auf der Karte als Terra Nova bezeichnet. Sie versperrte den Weg zu de Robervals Ziel, dem Sankt-Lorenz-Strom.
Cartier hatte den Fluss fünf Jahre zuvor erforscht. Hier war die Karte dichter, mit einigen angedeuteten Flussläufen und Namen geschmückt – Saguenay, Hochelaga, Stadacona: die Siedlungen oder Länder der Wilden –, und schließlich Saint-Charles, der Stützpunkt Cartiers. Doch je weiter der Finger nach Westen wanderte, umso dünner und unsicherer wurden die Linien. Der Flusslauf wurde durch etwas unterbrochen, was Cartier die Chinesischen Stromschnellen getauft hatte. Dahinter hörten die Namen ganz auf, gab es nur noch Vermutungen, Legenden und Gerüchte. Begann dort vielleicht die Passage zum Pazifik und nach China, wie Cartier glaubte?
De Roberval runzelte die Stirn. Eine Siedlung auf dem Weg nach China wäre von außerordentlichem strategischem Wert für Frankreich – und für ihn.
Vielleicht stimmten auch die Erzählungen der Eingeborenen, die Cartier in seinem Bericht festgehalten hatte. Da war die Rede von Menschen, die niemals aßen, und von goldenen Städten geheimnisvoller Königreiche.
De Roberval war kein Mann mit überbordender Fantasie. Er war ein Mann der Tat, einer, der etwas Handfestes brauchte, woran er sich orientieren konnte. Die prachtvollen Illustrationen auf der Karte ließen ihn kalt. Er suchte nach Hinweisen, nach sicheren Informationen über die Städte aus Gold, und er war enttäuscht, dass er sie nicht fand. Aber immerhin vermittelte ihm die Zeichnung ein ungefähres Gefühl für die Größe der Aufgabe, die vor ihm lag.
Er lehnte sich zurück, seine Hand blieb auf dem Umriss des fernen Landes ruhen. Er saß in einem einfachen Ledersessel in der Bibliothek. Bücher und Manuskripte stapelten sich auf dem Tisch, neben den Aufzeichnungen Cartiers auch Bücher über Bergbau, Viehzucht und Festungswesen. Einige Briefe waren achtlos über den Tisch und sogar auf dem Boden verstreut. In der Mitte des Tischs lag, mit dem Fuß eines massiven silbernen Kerzenleuchters beschwert, ein sorgsam gefaltetes Pergament mit dem königlichen Siegel. Er hatte lange auf diese Nachricht gewartet und jetzt lag sie vor ihm: die Erfüllung all seiner Träume – versprochen auf einem Stückchen Pergament. Zum Greifen nahe. De Roberval sah aus dem Fenster.
Es war Januar, ein trüber, nasskalter Tag. Aus dichten Wolken fiel Schneeregen. Es war zu warm für die Jahreszeit. Das meinten zumindest seine Bauern und murmelten von schlechten Zeichen am Himmel. De Roberval gab nicht viel darauf. Er nannte es »abergläubisches Geschwätz«. Die Bauern sahen in allem Vorboten für Unheil: Jede Wolke kündigte magere Ernten an, jedes Gewitter war ein Zeichen für kommende Dürre oder bevorstehende Überschwemmung. Im Grunde genommen, so seine Überzeugung, suchten sie nur nach Ausreden, um ihre Steuern nicht zahlen zu müssen. Aber sie mussten. Er hatte die Steuer der Region gepachtet, und er war gnadenlos, wenn es darum ging, Schulden einzutreiben. Die Bauern und Handwerker dieser Gegend fürchteten ihn – und das zu Recht.
Er stand auf und trat an das bleiverglaste Fenster, öffnete es und ließ frische Luft herein. Unten im Hof seines Schlosses ging das Gesinde auch an diesem trüben Tag seinen Beschäftigungen nach. De Roberval wusste nicht genau, wie viele Bedienstete er im Schloss beschäftigte; er wusste nur, dass sie ihm die Haare vom Kopf fraßen.
Der Schneeregen war durch einen kalten Regenschauer abgelöst worden. Er wollte das Fenster gerade wieder schließen, als er seine Nichte Marguerite entdeckte. Sie kam aus dem Küchentrakt, hielt ihren Schal wie einen Schirm über dem Kopf und eilte in kurzen Schritten über den schlecht gepflasterten Hof. Gelegentlich sprang sie über eine der vielen kleinen Pfützen, die der tauende Schnee zurückgelassen hatte. Dann tauchte ihr Schatten, Damienne, in der Tür zur Küche auf.
Damienne Lafleur stammte aus einfachen Verhältnissen und war bereits die Amme Marguerites gewesen. Ihre Aufgabe hatte einst darin bestanden, das Kind an seiner Mutter statt zu stillen. Unter normalen Umständen wäre sie nie auch nur in Betracht gezogen worden, ein Kind aus einer der besten Familien Frankreichs zu erziehen. Aber es war anders gekommen als geplant. Sie, die junge Witwe eines Fischhändlers, hatte ihr Kind gleich nach der Geburt verloren. Und da die Mutter der kleinen Marguerite am Kindbettfieber starb, war das Mädchen ohne Mutter und Vater, denn der war bereits ein halbes Jahr zuvor in Antwerpen der Cholera erlegen. Damienne hatte alle Aufgaben der Mutter übernommen und ausgefüllt.
Über de Robervals Gesicht huschte ein Lächeln, als er daran dachte, wie zärtlich diese grobknochige, große Frau aus der Normandie die kleine Marguerite im Arm gehalten hatte. Dann hieß es, die Amme sollte für die ersten Jahre auch die Kinderfrau für Marguerite sein, denn das Mädchen wollte keine andere Kinderfrau dulden. Später wurde Damienne auch noch Gouvernante und nun war sie sogar die Hausdame seiner Nichte. Eine erstaunliche Karriere für eine Frau aus dem einfachen Volk.
Jetzt stand sie in der Tür und schimpfte: »Marguerite! Es regnet! Komm sofort zurück!«
Doch Marguerite hörte nicht.
Auf dem Hof des Château de Roberval herrschte trotz des Regens rege Betriebsamkeit. Große Neuigkeiten lagen in der Luft. Niemand wusste Genaues, aber es gab Gerüchte. Es war die Rede davon, dass der Hausherr an den Hof berufen werden würde. Die einen glaubten, er würde zum General ernannt, um ein Heer nach Italien und gegen die Truppen des Kaisers zu führen. Die Mehrheit indes schloss aus den Büchern, die aus Paris geschickt wurden, dass de Roberval eine Forschungsreise in unbekannte Welten unternehmen sollte. Damit waren sie der Wahrheit schon recht nahe, aber das wussten sie natürlich nicht. Doch niemandem war entgangen, dass Jean-François de La Roque Sieur de Roberval wieder jene Zuversicht und Tatkraft ausstrahlte, die ihm als jungem Mann zu eigen war. Das war nicht immer so gewesen. Sie erinnerten sich nur zu gut der finsteren Zeiten, die erst wenige Jahre zurücklagen, als der Herr verfemt war und seine Güter kurz vor der Enteignung standen, weil de Roberval zum neuen Glauben übergetreten war, ohne Zweifel eine Todsünde, die die Mutter Kirche und auch die Krone Frankreichs hart bestrafen musste! Dunkle Tage waren das gewesen: der Herr in der gottlosen Schweiz und sie selbst jeden Tag in Ungewissheit, was werden würde. Doch diese Zeiten waren vorüber. Der König hatte seinem Jugendfreund die Torheit verziehen und de Roberval war reumütig in den Schoß der wahren Kirche zurückgekehrt. Leicht war ihm das nicht gefallen und er war abwechselnd schwermütig und jähzornig in jenen Monaten. Doch jetzt standen große Dinge bevor. Wenn man nur Genaueres wüsste!
Marguerite, die Nichte des Schlossherrn, wusste nicht mehr als die anderen – und sie wurde fast krank vor Neugier. Sie war dankbar für jede Ablenkung, die sich ihr bot, und eine hatte sie im Stall des Schlosses gefunden.
Sie schüttelte das kalte Wasser aus ihrem Schal. In einer Mischung aus Ärger und Verzweiflung betrachtete sie, wie der Regen durch das Dach drang und über Stroh, Heu und selbst die Pferde rann. »Das ist nicht gut«, sagte sie zu Joseph, dem ältesten der Stallburschen.
Die Pferde standen in ihren kalten Boxen und ließen missmutig die Köpfe hängen.
»Du hast recht, Marguerite«, erwiderte Joseph. Er kannte Marguerite von klein auf und erlaubte sich, wenn der Herr des Hauses nicht anwesend war, sie mit dem vertraulichen Du anzusprechen.
»Ich habe es meinem Onkel gesagt, wieder und wieder«, seufzte Marguerite, »aber er veranstaltet lieber Jagdgesellschaften, anstatt das Geld für die Dächer auszugeben.«
»Ich verstehe nicht, warum dein Onkel diesen Leuten noch immer Jagden ausrichtet. Sicher, es sind vornehme und bedeutende Herrschaften, und ich verstehe nichts von solchen Adelsgeschichten; ich weiß nur, dass es hier hereinregnet, und das ist ein Unglück! Das Heu wird nass, die Pferde werden krank. Und wenn sie erst einmal krank sind, taugen sie nicht mehr für die Jagd. Wenn das so weitergeht, gibt es nächstes Jahr eben keine Jagden! Vielleicht ist dann ein bisschen Geld übrig für die Dinge, die wir brauchen!«
Marguerite fühlte sich nun doch verpflichtet, ihren Onkel zu verteidigen: »Die Boutillacs sind wichtige Leute, Joseph, sehr wichtig. Und mein Onkel schuldet ihnen Geld.«
Joseph brummte missmutig. »Das mag ja sein, aber es ist doch nicht nur der Reitstall! In die große Scheune regnet es auch hinein, das Heu verfault, und wo kriege ich jetzt frisches Heu her?«
»Wir müssen es wohl kaufen«, sagte Marguerite unsicher.
Joseph erlaubte sich ein bitteres Lachen: »Kaufen? Du liebe Güte, wovon denn? Hier leiht uns kein Mensch noch einen Sou. Wenn wir jedem, dem wir Geld schulden, eine Jagd ausrichten, haben wir hier bald jeden Tag eine Gesellschaft am Hals!« Er schüttelte missmutig den Kopf.
Es hatte inzwischen aufgehört zu regnen und die Sonne brach durch die grauen Wolken. Marguerite trat vor die Scheune. Es war ein kalter Tag, der Wind war schneidend, aber die Luft war frisch und rein. Sie atmete tief ein und zog sich den Schal enger um die schmalen Schultern. Auf dem Weg, der vom Dorf zum Schloss heraufführte, bemerkte sie einen Mann, der ein Pferd am Zügel hinter sich herzog. Das Tier lahmte erkennbar. Marguerite runzelte die Stirn und beobachtete den Fremden. Er war nicht sehr groß und in verwaschenes Grau gekleidet.
Er wich auf dem Weg fast ängstlich den zahlreichen Wasserpfützen aus und zog sein Pferd, das ihm nur unwillig zu folgen schien, angestrengt hinter sich her. Der kleine Mann näherte sich zielstrebig dem Schlosshof und hielt, als er Marguerite entdeckte, geradewegs auf sie zu.
»Hol den Schmied, Joseph«, sagte sie.
»Natürlich Marg... Mademoiselle«, erwiderte Joseph und war schon verschwunden.
»Guten Tag, Mademoiselle de Roberval, es ist mir eine Freude, Euch wiederzusehen«, grüßte der Fremde. Er versuchte, freundlich zu lächeln, aber Marguerite konnte sehen, dass ihm darin die Übung fehlte. Er hatte ein blasses, schmales Gesicht und seinen Lippen fehlte alle Farbe. Sein Mantel war durchnässt und sein Hut hatte im Regen jede Form verloren. Marguerite hatte den Mann schon einmal gesehen, aber sie konnte sich nicht an seinen Namen erinnern.
»Verzeiht, wie dumm von mir! Ich kann nicht erwarten, dass Ihr Euch an mich erinnert«, sagte der Fremde mit übertriebener Demut. »Philippe Soubise, Sekretär des Grafen von Boutillac und Euer Diener, Mademoiselle.« Er deutete eine Verbeugung an.
Natürlich! Dieser Sekretär war einmal mit dem Grafen hier im Schloss gewesen, hatte sich aber von der Jagdgesellschaft ferngehalten. Schon damals war ihr seine übertriebene Unterwürfigkeit unangenehm aufgefallen.
»Euer Pferd lahmt«, sagte sie und vergaß darüber, den Fremden willkommen zu heißen.
»Oh ja, das dumme Tier hat heute Morgen ein Hufeisen verloren und sich wohl zu allem Überfluss einen Dorn eingetreten. Ich musste die letzten Meilen laufen.«
Marguerite war fassungslos. Der Mann musste an mehreren Dörfern vorübergekommen sein und in fast jedem Dorf gab es einen Schmied!
»Aber Monsieur, warum habt Ihr das arme Tier nicht in einem der Dörfer neu beschlagen lassen?«
»Oh, Mademoiselle, daran habe ich natürlich auch gedacht, aber die Schmiede in dieser Gegend scheinen mir allesamt darauf aus zu sein, arme Reisende auszuplündern. Stellt Euch vor, im letzten Dorf verlangte der Schmied fünf Sous für das Beschlagen! Ich würde sagen, das ist Raub! Doch kann ich die armen Seelen auch verstehen, denn wie mir scheint, drückt in dieser Gegend die Steuerlast die Handwerker besonders hart.«
Marguerite zuckte zusammen. Ihr Onkel hatte das Steuerrecht für das Departement gepachtet. War dies dem Fremden nicht bewusst oder war es eine geschickt versteckte Boshaftigkeit?
Monsieur Soubise seufzte: »Nun, ich habe das Geld meines Herrn nicht gestohlen. Ich habe die Hoffnung, dass es auf diesem Anwesen einen brauchbaren Schmied gibt, der das Tier versorgt, und vielleicht habt Ihr auch einen trockenen Platz, wo es sich erholen kann?«
Marguerite nickte. Innerlich kochte sie vor Wut. Wie hatte der Fremde so schnell gesehen, dass es ganz erbärmlich in die Ställe hineinregnete? Möglicherweise hatte sie ihn unterschätzt.
Joseph kam mit dem Schmied zurück, der sich des Pferdes annahm und es unter beruhigenden Worten untersuchte. Soubise ließ seinen Blick über die Front des Châteaus wandern. Marguerite folgte seinem Blick. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie dringend der Verputz einer Erneuerung bedurfte.
»Hättet Ihr die Güte, mich dem Herrn dieses ... Schlosses ... zu melden?«, fragte Soubise. Die kleine, kunstvoll abwertende Pause war Marguerite nicht entgangen.
»Joseph, geh, sag meinem Onkel Bescheid, dass ein ... Diener ... des Grafen Boutillac gekommen ist!«
Es war nicht sehr höflich, den Sekretär als Diener zu bezeichnen, aber Marguerite war die Lust vergangen, diesem unverschämten Kerl gegenüber höflich zu sein.
»Ah, Monsieur Soubise«, tönte da die kraftvolle Stimme ihres Onkels über den Hof. Jean-François de La Roque stand im geöffneten Fenster der Bibliothek. Er musste sie beobachtet haben. Ihr Onkel war nicht sehr groß, aber dennoch eine beeindruckende Erscheinung. Alles an ihm schien Kraft auszustrahlen, Kraft und Selbstsicherheit. »Joseph, führe den Herrn herauf! Und du, Marguerite, gehst auf dein Zimmer. Du holst dir sonst noch den Tod!«
»Mademoiselle, es war mir eine Freude, Euch wiederzusehen«, sagte der Sekretär mit einer erneuten Verbeugung, bevor er Joseph folgte.
Marguerite nickte knapp. Sie wäre gern bei den Ställen geblieben, aber es war nicht klug, sich den Anweisungen ihres Onkels zu widersetzen, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit.
Wütend stapfte sie zurück in die Küche. Damienne unterbrach ihren Schwatz mit Marcel, dem Koch: »Mein Schäfchen, komm ans Feuer, du bist ja ganz blau gefroren!«
»Nenn mich nicht so«, fauchte Marguerite, »komm lieber mit!«
Damienne lächelte in sich hinein. Sie kannte das Temperament ihres Schützlings und war vielleicht die Einzige, die mit den Ausbrüchen Marguerites umgehen konnte.
»Wir haben aber wieder mal eine Laune heute«, schmunzelte sie.
»Meine Laune ist ganz hervorragend!«, blaffte Marguerite zurück. »Komm jetzt!«
»Wenn’s unbedingt sein muss«, murrte Damienne und erhob
sich langsam von ihrem Stuhl. »Wir sehen uns später, Marcel. «
Der Koch nickte und brummte etwas, was ein Ja gewesen sein mochte. Er war kein Freund großer Worte, aber ein Meister darin, aus wenigen Zutaten ein hervorragendes Essen zu zaubern – eine Kunst, die im Hause de Roberval in letzter Zeit zunehmend bedeutsam geworden war.
»Nun mach schon«, drängte Marguerite. Sie wartete nicht ab, bis ihre frühere Amme und jetzige Hausdame herangekommen war, sondern lief bereits den Gang zum Treppenhaus entlang.
»Nun hetz mich alte Frau nicht so!«, schimpfte Damienne, lief aber tatsächlich eine Winzigkeit schneller. »Wo soll es denn so eilig hingehen?«
»Onkel Jean hat Besuch.«
»Und der will mich dringend sehen?«, fragte Damienne mit todernster Miene.
»Ach, Unsinn!«, rief Marguerite, bevor sie bemerkte, dass ihre Amme sie wieder einmal auf den Arm nahm.
»Ich bin sicher, es hat etwas mit Onkels großem Auftrag zu tun. Jetzt komm schon, sie sind im Arbeitszimmer.«
Damienne blieb stehen. »Du weißt, dass sich das nicht gehört.«
Marguerite packte Damienne am Arm und zog sie weiter die Treppen hinauf. Der Widerstand der Hausdame war geradezu bedenklich gering.
»Mir erzählt hier ja nie einer etwas! Da muss ich eben sehen, wo ich bleibe.«
Sie hatten den zweiten Stock erreicht.
»Ja, ja, schon recht. Aber es ist Sünde, andere Menschen zu belauschen«, wandte Damienne noch einmal ein.
»Davon steht nichts in der Bibel, jedenfalls habe ich nichts darüber gefunden«, kicherte Marguerite. Sie zog die zögernde Damienne weiter durch den kalten Gang hin zu einem leer stehenden Raum, der direkt über der Bibliothek lag. Die Kamine beider Räume waren am selben Schornstein angeschlossen. Wenn man die Abzugsklappe öffnete, konnte man verstehen, was ein Stockwerk tiefer gesprochen wurde.
»Es wird noch einmal ein schlimmes Ende mit dir nehmen, Marguerite«, murmelte Damienne tadelnd, als sie vor der Tür innehielten.
»Mit uns beiden, Damienne«, scherzte Marguerite mit gedämpfter Stimme, »aber leise jetzt!«
Sie drückte die Klinke – abgeschlossen!
»So ein Mist!«, entfuhr es Damienne. »Ich meine natürlich, Gott sei Dank!«
De Roberval kehrte dem eintretenden Sekretär bewusst den Rücken zu.
»Euer Gnaden«, begann Soubise und verbeugte sich in vollendeter und tausendfach geübter Geste.
Der Gastgeber ließ den Gast warten, was diesem aber nicht das Geringste auszumachen schien.
»Was kann ich für den Grafen de Boutillac tun?«, fragte de Roberval, als er sich endlich doch umdrehte.
»Mein Herr, der Graf, entbietet Euch seine Grüße. Er möchte einer der Ersten sein, die Euch zu Eurer Ernennung beglückwünschen.«
»Hat es sich also schon herumgesprochen? Es ist noch nicht offiziell«, erwiderte de Roberval, ohne sich allzu viel Mühe zu geben, seinen Stolz zu verhehlen.
»Es ist ein offenes Geheimnis, Euer Gnaden. Ganz Paris spricht davon.«
»Ihr seht, das Glück hat sich gewendet. Der König hat sich meiner erinnert.«
»Das freut meinen Herrn sehr. Er sagt, dass der König Euch bei alledem, was in den vergangenen Jahren geschehen ist, gar nicht vergessen konnte.«
De Roberval warf Soubise einen scharfen Blick zu. Er hatte die kunstvoll verkleidete Beleidigung durchaus bemerkt. Es war noch gar nicht lange her, dass er, Jean-François de La Roque Sieur de Roberval, Frankreich bei Nacht und Nebel hatte verlassen müssen.
Er schritt langsam zum Kamin und legte ein Holzscheit ins Feuer, wo es knisternd neue Flammen schlug. Dabei würdigte er den Sekretär keines Blickes.
»Der Graf von Boutillac hat mich beauftragt, seiner Freude Ausdruck zu verleihen und die besten Wünsche für die bevorstehende Aufgabe zu übermitteln. Gleichzeitig möchte er, auch wenn es ihm überaus schwerfällt, an gewisse Verbindlichkeiten erinnern, die Euer Gnaden gegenüber dem Grafen ...«
Wütend unterbrach de Roberval den Sekretär: »Glaubt der Graf, ich sei vergesslich? Ich habe mich schon gewundert, dass ich diesen Monat noch kein Schreiben erhalten habe, das mich an meine Schulden erinnert. Die La Roques stehen zu ihren Schulden!«
»Das ehrt die Familie, deren Ruf in der Tat in dieser Hinsicht unübertroffen ist. Es wäre jedoch für meinen Herrn angenehmer und seiner Bewunderung für die La Roques umso zuträglicher, sie würden zu ihren Schulden nicht nur stehen, sondern sie auch begleichen.«
»Das ist eine Unverschämtheit!«, schäumte de Roberval, durchquerte mit schnellen Schritten den Raum und baute sich drohend vor dem Sekretär auf. Zu seiner Überraschung ließ sich der Sekretär davon nicht im Mindesten einschüchtern, sondern lächelte weiter in aalglatter Unterwürfigkeit.
De Roberval stockte, drehte sich um und machte ein paar schnelle Schritte zum Tisch. In der Mitte lag immer noch das Schreiben mit dem königlichen Siegel.
»Boutillac wird sein Geld bekommen. Ich stehe in der Gunst des Königs.«
»Mein Herr, der Graf, freut sich, dass Ihr bei Hofe wieder in ho‑
hem Ansehen zu stehen scheint. Und er findet, Ihr solltet die Gelegenheit nutzen, um Angelegenheiten aus schlechten, doch zum Glück vergangenen Zeiten zu bereinigen.«
Der Sekretär griff in die Innentasche seines Mantels und zog einen Umschlag hervor.
»Der Graf de Boutillac ist der Meinung, dass Ihr jetzt zumindest die offenen Verbindlichkeiten begleichen solltet, deren Fälligkeit länger als zwölf Monate zurückliegt. Ich habe mir erlaubt, einige Zahlen für Euer Gnaden zusammenzustellen.« Er sprach leise, aber bestimmt und jede Demut war aus seiner Stimme gewichen.
De Roberval drehte sich um und sah dem Sekretär mit gespielter Gelassenheit ins Auge. »Boutillac weiß doch, welche ungeheuren Schätze auf der anderen Seite des Meeres warten. Ich werde bald so reich sein, dass wir über die Summe, die ich ihm heute schulde, lachen werden.«
»Es gibt sicher niemanden, der lieber mit Euch gemeinsam über gewisse Geldbeträge lachen würde als mein Herr. Dennoch weist er darauf hin, dass diese Reichtümer bislang nur Gerüchte sind. Der geschätzte Monsieur Cartier jedenfalls ist bei seinen Reisen in dies ferne Land bislang leider nicht reich geworden, wie es scheint. Der arme Cartier, was wird er wohl sagen, wenn er erfährt, dass die nächste Reise in die Neue Welt nicht unter seinem Kommando steht? Ist es nicht bedauerlich, dass er bei Hofe keine namhaften Gönner, wie zum Beispiel meinen Herrn, den Grafen de Boutillac, hat?«
De Roberval schwieg und starrte in das knisternde Kaminfeuer.
»Aber, wie Euer Gnaden schon sagte, Eure Ernennung ist noch nicht offiziell und das Leben ist voller Überraschungen – guter wie auch anderer. Was wird man bei Hofe denken, wenn der Mann, der den Glanz Frankreichs in die Wildnis tragen soll, vor Gericht gezerrt würde wegen gewisser, wie Ihr selbst sagtet, lächerlicher Summen?«
De Roberval fuhr herum. »Ein Prozess würde sich über Jahre hinziehen«, polterte er, »und am Ende wären beide Seiten ruiniert!«
»Die Geduld der de Boutillacs ist noch größer als ihr Reichtum, wie man sagt. Mein Herr hat mich beauftragt, auf die Zahlung dieser hier aufgelisteten Summen bis zum nächsten Ersten zu bestehen, da er sonst nicht umhinkommt, seine Rechte einzuklagen.« Mit diesen Worten trat der Sekretär zwei Schritte vor und legte die Liste auf den Tisch.
De Roberval nahm sie und studierte die Zahlenkolonnen. »Boutillac weiß, dass ich das Geld nicht habe.«
»Es wird ihn schmerzen, dies zu erfahren, Euer Gnaden. Doch mein Herr sieht keine andere Möglichkeit, als auf die Zahlung dieser Summen zu bestehen, es sei denn ...«
De Roberval drehte sich langsam um: »Ja?«
»Es sei denn, Euer Gnaden könnten sich damit einverstanden erklären, zusätzliche Sicherheiten zu leisten.«
»Ah! Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Was will der Blutsauger noch?«
»Mein Herr, der Graf, hat sich erlaubt, eine kleine Liste von Besitztümern aufzustellen, die ihm für eine Weile als Sicherheit genügen würden.«
Mit diesen Worten zog Soubise ein weiteres Papier aus seinem Mantel, das er mit eleganter Geste auf den Tisch legte.
De Roberval warf einen Blick auf die Liste und lief rot an. »Ich soll das Schloss als Sicherheit geben? Das Château de Roberval ist seit Generationen im Besitz meiner Familie!«
»Man sieht, dass es alt ist«, entgegnete der Sekretär gelassen. De Roberval war die Beleidigung nicht entgangen.
»Geht nicht zu weit, rate ich Euch, Monsieur ... Sous! »Soubise, wenn Euer Gnaden erlauben.«
De Robervals Stimme klang gepresst, als er leise fortfuhr: »Was die Güter in der Picardie angeht, so habe ich darüber keine Verfügungsgewalt. Sie gehören meiner Nichte, wie Ihr wahrscheinlich wisst.«
»Mein Herr ist sich dessen bewusst. Doch sind Euer Gnaden nicht der Vormund der Mademoiselle, bis sie mündig wird? Wie alt ist sie jetzt? Sechzehn? Siebzehn? Mein Herr ist sicher, dass Ihr in der Lage sein werdet, die Verbindlichkeiten bis zum Tag ihrer Volljährigkeit abzutragen.«
»Sie gehen ebenfalls in ihren Besitz über, wenn sie vor diesem Tag heiraten sollte«, murmelte de Roberval.
»Wenn mein Herr, der Graf von Boutillac, richtig informiert ist, dann müssen Euer Gnaden dieser Hochzeit zustimmen. Ist es nicht so?«
De Roberval schwieg, dann streckte er die Hand aus: »Zeigt mir diese Papiere!«
Etwas später, es dämmerte bereits, stieg ein sehr übellauniger Monsieur Soubise in den Sattel seines frisch beschlagenen Pferdes. De Roberval hatte ihm mit nachdrücklichem Bedauern erklärt, dass – leider! – alle Zimmer im Schloss belegt seien, es aber im Nachbardorf einen sehr preiswerten Gasthof gebe.
Noch vor dem Abendessen ließ de Roberval Marguerite in sein Arbeitszimmer rufen. Als sie eintrat, saß er im Sessel und studierte wieder die Karte, die vor ihm auf dem Tisch lag. Er blickte sehr ernst, als seine Nichte eintrat.
»Ich hoffe, du warst nicht zu enttäuscht«, begann er.
»Wovon, Monsieur?«
»Du weißt, wovon ich rede. In letzter Zeit sind mir einige Gerüchte zu Ohren gekommen. Die Dienerschaft flüstert und weiß Dinge, die sie nichts angehen. Dinge, die niemand wissen kann, es sei denn, er lauscht an meiner Tür oder an gewissen offenen Kaminen.«
Marguerite schluckte.
»Offensichtlich ist es mir gelungen, diesem Missstand inzwischen einen Riegel vorzuschieben. Weißt du, was ich mit einem Diener machen würde, den ich beim Lauschen erwische?«
»Nein, Monsieur.«
De Roberval stand auf und trat zum Fenster.
»Die Ohren abzuschneiden wäre eine gerechte Strafe, findest du nicht?«
Marguerite schwieg. Ihr gegenüber war der Onkel niemals grob geworden, aber sie hatte Diener gesehen, denen der Onkel die Haut vom Rücken hatte peitschen lassen, weil sie ihren Dienst nicht ordentlich versehen hatten. Wenn er zornig war, konnte er furchtbar grausam sein.
»Aber es ist meine Schuld«, fuhr de Roberval fort, »ich habe deine Erziehung zu sehr vernachlässigt und dich stattdessen diesem normannischen Weib überlassen.«
»Damienne kann nichts dafür! Es war meine Idee! Sie hat sogar versucht, es zu verhindern.«
»Es scheint, als würdest du ihr allmählich über den Kopf wachsen. Nun, wie auch immer, es sieht so aus, als würde sich in naher Zukunft einiges ändern. Wir werden bald mehr Zeit miteinander verbringen, und dann werden wir sehen, ob es mir nicht doch noch gelingt, eine anständige junge Dame aus dir zu machen.«
De Roberval ging zurück zum Schreibtisch und setzte sich wieder.
Marguerite fühlte sich unbehaglich. Ihr Onkel hatte noch keine Strafe ausgesprochen. Warum ließ er sie nur so lange zappeln? Und was würde sich in Zukunft ändern?
»Weißt du, was das ist, mein Kind?«
»Eine Landkarte, Monsieur.«
»Weißt du auch, was sie darstellt?«
Marguerite trat näher heran. Sie betrachtete die seltsamen Fabelwesen, die geheimnisvollen Inseln und Flüsse und Landschaften mit ihren fremdartigen Namen.
Der Onkel wartete ihre Antwort gar nicht erst ab: »Manche sagen, es sei die Ostküste Asiens, andere glauben, es sei eine ganz neue, unbekannte Welt.«
»Gibt es dort wirklich Einhörner?«, fragte Marguerite, die die Abbildung eines solchen Tieres entdeckt hatte.
»Das weiß niemand mit Bestimmtheit zu sagen, Marguerite. Aber es ist möglich. Es gibt dort riesige Wälder und große Ländereien, in denen nur einige Wilde wohnen.«
»Sind das die Wilden?«, fragte Marguerite und deutete auf die Gruppe unterhalb des Wappens.
»Ja. Es heißt, dass sie ihre Haut rot anmalen.«
»Haben sie keine Kleidung?«
»Oh, soweit ich weiß, schon. Monsieur Cartier hat einen interessanten Bericht für den König verfasst. Du solltest ihn lesen. Zur Vorbereitung.«
Marguerites Augen begannen, in einer Vorahnung zu leuchten. »Vorbereitung? Worauf, Monsieur?«
»Der König hat vor, ein neues Frankreich auf der anderen Seite des Ozeans zu schaffen – und ich bin der Mann, der es gründen wird. Selbstverständlich wird meine Nichte mich begleiten, denn was wäre ein Königreich ohne eine Prinzessin?«
Marguerite war sprachlos – etwas, was sehr selten geschah. Sie starrte ihren Onkel ungläubig an. Er lächelte.
Fontainebleau
Der Winter war noch einmal zurückgekommen, mit viel Schnee und beißendem Frost, und so brach die Gesellschaft in einer weiß verhüllten Winterlandschaft zu ihrer Reise zum Königshof auf. In der Kutsche würde es auf geradem Weg gute drei Tage bis nach Fontainebleau dauern – wenn alles gut ging, kein Rad von der Achse sprang und sich keines der Pferde verletzte. Doch sie brachen bereits fünf Tage vor dem vereinbarten Termin auf, weil de Roberval die Fahrt nutzen wollte, um einige seiner Güter an den Ufern der Oise zu inspizieren. So erklärte er es zumindest. In Wahrheit war es einfach nur viel billiger, auf den eigenen Gütern zu übernachten, als sich in den Gasthäusern entlang des Weges einzuquartieren, und natürlich lagen die Weiler und Höfe der de Robervals nicht auf direktem Wege zum königlichen Schloss, sodass die Reise zwei Tage länger dauern würde.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!