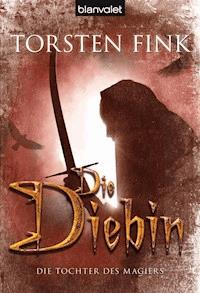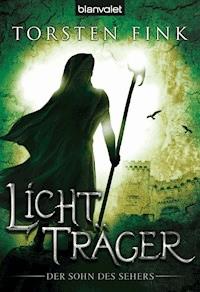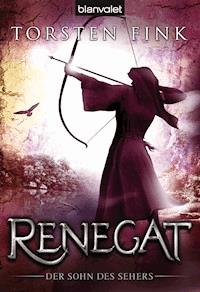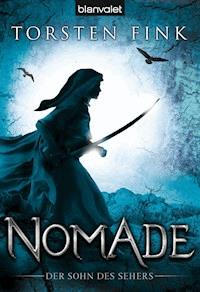
8,99 €
8,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Sohn des Sehers
- Sprache: Deutsch
Die neue All-Age-Trilogie
Der junge Seher Awin kämpft verzweifelt darum, von seinem Volk, den als Wüstennomaden umherziehenden Hakul, als Krieger anerkannt zu werden. Doch sein eifersüchtiger Meister raubt ihm jedes Selbstwertgefühl, obwohl Awin längst der bessere Seher ist. Da wird der Lichtstein geraubt, der größte Schatz der Hakul, und Awin erhält endlich die Möglichkeit, sich zu beweisen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2010
4,5 (28 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
Prolog
Wolfsfährten
Copyright
Für meinen Vater,der ein sehr hellsichtiger Mann war
Prolog
DER JUNGE STARRTE trotzig auf den Boden unter seinen nackten Füßen. Er wusste, dass sein Vater, der mit verschränkten Armen vor ihm stand, Recht hatte, aber das machte es nicht besser. Vorsichtig blickte er auf. Unten im Tal trieben seine Brüder Schafe und Wollziegen mit Pfiffen an der Wasserstelle zusammen. Es wurde Abend, die Sonne war schon hinter den steilen Felswänden verschwunden. Sein Bruder Enyak würde bald kochen, und dann würden sie zusammensitzen und sich Geschichten erzählen.
»Es ist doch nur ein Lamm, Baba. Und du hast es mir geschenkt«, sagte er vorsichtig.
Der Vater nahm die Äußerung seines Jüngsten ohne sichtbare Gefühlsregung zur Kenntnis. »Ich habe es dir geschenkt, mein Sohn, weil ich dachte, dass ich dir das Leben eines Tieres anvertrauen kann. Habe ich mich so in dir getäuscht?«
Der Junge blickte weiter zu Boden. Sie standen in einem kleinen Geröllfeld. Die Steine schnitten ihm in die nackten Fußsohlen, aber das machte ihm nichts aus. Eine grüne Eidechse huschte dicht am Fuß des Jungen vorbei. Für einen Augenblick erwachte der Jagdtrieb in ihm, aber jetzt konnte er dem flinken Tier natürlich nicht nachstellen. »Ich kann es morgen früh suchen, gleich als Erstes«, sagte er und sah hoffnungsvoll zum strengen Gesicht seines Vaters auf.
»Und der Bussard? Und die Gefahren der Nacht? Es ist dein Tier, aber das heißt auch, dass du dafür sorgen musst. Wenn du einmal ein Mann bist und eine eigene Herde hast, dann magst du Lämmer verlieren, so viele du willst, aber nicht, solange ich das Oberhaupt unserer Familie bin!«
»Aber Baba, es ist so weit weg. Ich schaffe es doch nie zurück, bevor es dunkel ist!«
»Dann bleibst du eben über Nacht dort. Vielleicht wird dir das eine Lehre sein!«
Der Junge schluckte. Der Zorn trieb ihm Tränen in die Augen. Wieso schenkte ihm sein Vater ein Lamm, wenn er dann nicht damit machen durfte, was er wollte? »Aber, Baba …«, begann er erneut.
»Lewe!«, unterbrach ihn sein Vater schroff. »Je länger du wartest, desto länger wird es dauern. Also lauf!«
Der Junge hätte gerne noch etwas gesagt, aber er spürte, dass er gleich in Tränen ausbrechen würde. Es war einfach nicht gerecht. Er hatte es doch gut gemeint. Weit hinten in dieser Schlucht gab es eine Wiese mit saftigem Gras. Sie trieben die Tiere sonst nie hinein, weil dort mit Pferden kein Durchkommen war. Er hatte den weiten Fußweg auf sich genommen. Und das war der Dank? Die anderen würden essen, trinken, auf ihren Decken liegen und Geschichten hören. Und er? Wortlos drehte er sich um und stapfte davon. Das Geröll gab unter seinem wütenden Tritt nach. Er spürte die scharfen Kanten der Steine unter den Füßen. Er lief, ohne sich umzudrehen, bis zu dem kleinen Rinnsal, das aus der Schlucht kam. Und irgendwo in dieser Schlucht, die das Wasser in den Fels gefressen hatte, lag die Wiese, auf der er das schwarze Lamm zurückgelassen hatte.
Elwah sah ihm nach. Der Knabe war noch keine acht Winter alt. Verlangte er zu viel von ihm? Er hatte das Tier wohl einfach vergessen. Lewe war genauso verträumt, wie er selbst es als Kind auch gewesen war. Sweru, sein Zweitjüngster, kam herangeritten. Vorsichtig ließ er sein Pferd außerhalb des Geröllfeldes halten. »Willst du ihn wirklich alleine dorthinein schicken, Baba?«, fragte er. Mit zweifelndem Blick musterte er den düsteren Einschnitt im Berg. Über ihm schrie ein Bussard.
»Er schafft das schon«, verkündete Elwah. Er war froh, dass die Mutter des Knaben im Lager des Klans und somit weit entfernt war - sonst hätte er sich einiges anhören dürfen. »Und du, wieso hilfst du deinen Brüdern nicht?«, fragte er Sweru.
Sweru seufzte, wendete sein Pferd, drückte ihm die Fersen in die Flanken und trabte davon. Elwah sah ihm nach. Es waren gute Söhne. Die älteren trieben jetzt seine Tiere unten am Wasser zusammen. Er fragte sich, wie er früher all das ohne sie geschafft hatte. Die Erinnerung ließ ihn lächeln. Als er geheiratet hatte, hatte er genau drei Wollziegen und zwei Schafe besessen. Und nun gab es im Klan niemanden, der mehr Schafe hatte als er. Er stieg auf sein Pferd, das einige Schritte entfernt den kargen Boden nach Gras absuchte, und lenkte es hinab. Das Tal war abgeweidet, und morgen früh würden sie weiterziehen. Er fragte sich wieder, ob er seinen Jüngsten nicht zu hart angefasst hatte. Er war gerade halb so alt wie Sweru, der Zweitjüngste, und seine Mutter hatte den Nachzügler bisher zu sehr verwöhnt. Vielleicht war es doch ein Fehler, den Jungen alleine in diese Schlucht zu schicken. »Hirth wird ihn schon beschützen«, murmelte Elwah.
Plötzlich hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden, und ein paar kleine Steine sprangen hinter ihm die Felsen herab. Er drehte sich um und suchte mit gerunzelter Stirn die steile Wand ab. Aber da war nur der nackte Fels, in den sich hier und dort ein grauer Busch gekrallt hatte. Vielleicht ein Murmeltier? Er zuckte mit den Achseln und folgte seiner Herde hinab in die Talsohle. Noch einmal blickte er zurück, aber sein Jüngster war schon in der dunklen Schlucht verschwunden.
Nach dem Essen lagerten Elwah und seine Söhne unweit der kleinen Wasserstelle am Feuer. Ihre Tiere waren müde und ließen die Köpfe hängen. Sie würden ihnen heute Nacht keine Schwierigkeiten bereiten. Das Wetter war heiß und trocken. Es war beinahe Mittsommer, aber die Nacht versprach Abkühlung. Elwah fand dennoch keine Ruhe.
»Lewe hat es nicht zum Abendessen geschafft, Baba«, sagte Calwah, sein Ältester.
»Ich habe ihm gesagt, dass er dort bleiben soll, wenn es spät wird.«
»In der Schlucht? Allein in der Dunkelheit? Ohne Essen?«, fragte Enyak, der Zweitgeborene.
»Es war klar, dass du zuerst ans Essen denkst«, stichelte Anak, der dritte von Elwahs Söhnen.
Sie lachten über den harmlosen Scherz, aber es war ein sehr verhaltenes Lachen.
»Es ist kalt und dunkel dort, Baba«, meinte Calwah besorgt.
»Die Nacht ist kurz, und der Junge versteht es, mit dem Feuerstein umzugehen«, brummte Elwah, der gerade das Gleiche gedacht hatte. Lewe war kein kleines Kind mehr. Das Leben im Staubland war hart. Die Kinder der Hakul lernten früh, auf sich selbst aufzupassen. Lernten sie es nicht, dann … Elwah dachte den Gedanken lieber nicht zu Ende.
»Aber was, wenn es dort oben Wölfe gibt?«, fragte Sweru.
Elwah runzelte missbilligend die Stirn. »Wölfe? In den Schwarzen Bergen? Hast du hier schon einmal einen Wolf gesehen?«
»Nein, aber es gibt doch überall Wölfe«, entgegnete Sweru.
Elwah seufzte. Sweru war im letzen Winter zum ersten Mal mit auf den Beutezug der Männer gegangen. Unglaublich, wie schnell der Knabe erwachsen geworden war. Aber wusste er so wenig über sein Volk, dass er glaubte, hier gäbe es Wölfe? Er fasste ihn genauer ins Auge und entdeckte die gespannte Erwartung im Blick seines Sohnes. Darum ging es also, er wollte eine Geschichte hören. Elwah beschloss, sich darauf einzulassen. Vielleicht würde ihn das ablenken von den Gedanken, die er sich um seinen Jüngsten machte. »Wisst ihr nicht, warum die Wölfe nicht in dieses Tal und auch in kein anderes der Schwarzen Berge kommen?«, fragte er. Irgendwo im Tal rollten Steine einen Hang hinunter. Elwah lauschte, denn er dachte, es sei vielleicht Lewe mit dem Lamm. Aber dem ersten Steinschlag folgte kein zweiter.
»Nein, Baba«, antworteten seine Söhne im Chor.
Elwah blickte von einem zum anderen. Calwah hatte selbst schon zwei Kinder, er sollte eigentlich wissen, dass ein Vater seine Sprösslinge immer durchschaut. »Nun, meine Söhne, offensichtlich haben eure Mutter und ich vieles versäumt. Sollte es wirklich so sein, dass ihr diese Geschichte - die wichtigste der Hakul - nicht kennt?«
»Welche Geschichte, Baba?«
Also begann Elwah die alte Geschichte zu erzählen. Sie führte sie von ihrem kleinen Feuer weit zurück in die dunkle Vergangenheit, in der die Hakul noch nicht der Schrecken ihrer Nachbarn gewesen waren, sondern schwach und voller Furcht. »Ein armes Volk waren wir, das Schafe über die staubige Ebene trieb«, erzählte Elwah, »und es war schwer zu sagen, ob wir über das Land zogen - oder flohen. Aus dem Norden drängten die Akradai in unser Land. Sie vertrieben uns von unseren angestammten Weiden, errichteten Dörfer und wühlten die Erde für ihre Felder um. Aus dem Südosten kamen die Viramatai, die Männertöterinnen, mit ihren Streitwagen. Sie verschleppten die Männer für ihre Bergwerke und andere Sklavenarbeit. Aus dem Südwesten zogen die Romadh immer wieder über die Wüste Dhaud. Sie raubten unser Vieh, verschleppten die Mädchen und Kinder und machten sie zu Sklaven.
Am fürchterlichsten aber war das Übel, das uns hier im Westen am Rande der Wüste bedrohte - Xlifara Slahan, die gefallene Göttin! Sie schlich im Schutz der verfluchten Winde rastlos um unsere Zelte und raubte Kinder, Frauen, sogar Männer aus unserer Mitte. Ihre Opfer fand man oft weit von den Zelten entfernt, die Gesichter angstverzerrt, in den Adern kein Tropfen Blut mehr, und kein Zauber vermochte den Schrecken zu bannen. Wenn aber einmal keine Bedrohung von außen kam, dann stritten die Sippen und Stämme untereinander, und nie fanden sie Ruhe. Finstere Zeiten waren das, und wer Hakul war, verfluchte die Götter dafür, dass er diesem Volk angehörte.
Genau zu dieser Zeit aber wurde in einem Zelt, unweit der Schwarzen Berge, also gar nicht weit von hier, ein Knabe geboren, Etys genannt. Er war der Sohn eines Schmiedes und wuchs selbst zum besten aller Schmiede heran. Er sah das Elend seines Volkes, und da er ein frommer Mann war, betete er viel zu den Hütern, den vier Erstgeborenen Göttern, doch erhörten sie ihn nicht. Und Etys tadelte die Götter für ihre Untätigkeit. Sein Vater aber mahnte seinen Sohn, sich nicht an ihnen zu versündigen. Etys aber erwiderte: ›Sie hören mich nicht, wenn ich zu ihnen bete, so werden sie mich auch nicht hören, wenn ich sie verfluche. Doch will ich nicht hinnehmen, dass sie sich taub stellen. Ich werde an ihr Nachtlager treten und sehen, ob ich sie nicht doch wecken kann.‹ Etys wusste natürlich, dass die Hüter in tiefem Schlaf liegen, seit der Kriegsgott sie überlistet und die Macht über diese Welt an sich gerissen hat. Und er erklärte, dass er, falls er die Erstgeborenen nicht wecken könne, eben zu Edhil selbst gehen und ihn um Hilfe bitten wolle. Sein Vater erschrak, denn er fürchtete, sein Sohn sei dem Wahnsinn verfallen. Wie könnte ein Hakul es wagen, die Hüter, ja sogar den Schöpfergott selbst anzusprechen, der fern von den Menschen im Sonnenwagen über den Himmel zieht? Er versuchte Etys sein Vorhaben auszureden, doch sein Sohn war von starkem Sinn und ließ sich nicht beirren.«
Elwah stocherte mit einem langen Ast im Feuer, um die Glut anzuheizen, dann fuhr er fort: »Er ging nach Osten, in das hohe Gebirge, hinter dem Edhil des Morgens zu erscheinen pflegt und das wir deshalb das Sonnengebirge nennen. Sieben Jahre stieg Etys durch das Gebirge und suchte jenen höchsten Gipfel, auf dem die Götter ruhen sollen. Und immer wenn er dachte, er habe ihn erreicht, sah er, dass es noch einen anderen gab, der höher war. Also stieg er wieder ins Tal hinab und den nächsten Berg hinauf. Durch dichten Schnee und eine Kälte, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt, kletterte er Tag um Tag, immer auf der Suche nach dem Berg der Götter.«
Elwah legte eine Pause ein und starrte ins Feuer. Etys musste ein ausgesprochen sturer Mann gewesen sein, dachte er für sich. Und er dachte an seinen Jüngsten, der ein Trotzkopf war und der jetzt ganz allein in der Nacht in dieser Schlucht saß und auf den Aufgang der Sonne warten musste. Er war zu hart gewesen, viel zu hart. Gleich im Morgengrauen würde er aufbrechen und nach Lewe suchen. Er seufzte. Seine vier Söhne starrten ihn gebannt an. Seltsam, dass sie diese Geschichte immer wieder hören wollten. »Schließlich, als selbst Etys’ unerschütterlicher Geist beinahe ins Wanken geriet«, fuhr Elwah mit seiner Erzählung fort, »erklomm er einen Berg, dessen Haupt die Wolken durchstieß. Und über den Wolken ragte er noch einmal so hoch auf wie schon unter ihnen. Etys kletterte und stieg immer weiter, denn immer noch war der Gipfel fern. Und als er über den gefrorenen Fels kletterte, da wurde es plötzlich hell um ihn, und eine Stimme sprach: ›Mensch aus dem Staubland, hoch bist du gestiegen. Was suchst du an der Schlafstatt der Götter? Hast du keine Angst vor dem Abgrund, der dich umgibt?‹
Etys schloss geblendet die Augen, denn es war Edhil selbst, der ihn angesprochen hatte! Und der Held nahm all seinen Mut zusammen und erwiderte: ›Ich werde noch höher steigen, denn es scheint, als würden die Götter die Hilfeschreie meines Volkes nicht hören, wenn sie aus der Steppe gen Himmel gerufen werden. Jetzt will ich sehen, ob sie mich auch noch überhören, wenn ich an ihrem Nachtlager stehe.‹
›Aber die Hüter schlafen, Hakul, und du kannst sie nicht wecken‹, beschied ihn der Gott.
›Dann musst eben du meine Klagen hören, Sonnengott‹, antwortete der Held. Und dann schilderte Etys dem Schöpfergott die Not der Hakul. Die Augen hielt er dabei stets geschlossen, denn das Licht des Sonnengottes strahlt zu hell für uns Menschen, und Etys fürchtete, zu erblinden. Und Edhil hielt den Sonnenwagen an und lauschte, denn er erkannte, dass Etys ein reines Herz hatte und seine Absichten edel waren. Als der Held all seine Klagen vorgetragen hatte, erwiderte Edhil: ›Du führst eine große Klage gegen die Götter, Mensch, doch tust du uns Unrecht. Nicht wir sind es, die die Hakul schwach erscheinen lassen. Sieh die wilden Pferde in der Steppe: Sie sind schwächer als ihr, und die Wölfe, die sie jagen, sind zahlreich. Aber anders als die Hakul halten sie zusammen in der Gefahr, und so überleben sie.‹
›Aber die Wölfe werden dennoch satt‹, widersprach Etys dem Gott. ›Sollen wir uns weiter wie die Pferde von unseren Feinden über die Steppe jagen lassen?‹
Edhil lachte und erwiderte: ›Vielleicht sollten sich die Hakul nicht nur untereinander, sondern auch mit ihren Nachbarn, den Pferden, verständigen. Dies ist mein Rat für dich, Mensch, und mehr will ich dir nicht sagen.‹ Dann trieb Edhil die Sonnenpferde mit seinem morgendlichen Ruf an und zog mit dem Wagen davon.
Und plötzlich verstand Etys, was der Gott ihm hatte mitteilen wollen, und er fasste einen kühnen Plan. Doch würden die Hakul ihm folgen? Sie sind eigensinnig und hören selten auf einen Mann, der nicht ihrer Sippe angehört. Er brauchte einen Beweis, dass er wirklich mit Edhil selbst gesprochen hatte. Also öffnete Etys die Augen einen Spalt weit und griff nach dem Wagen, als er an ihm vorüberrollte. Was für ein Schmerz erfasste ihn da! Seine Hand verbrannte, doch gelang es ihm wirklich, ein kleines Stück vom Zierrat des Sonnenwagens abzubrechen. Es loderte golden in seiner Hand, heißer als ein Schmiedefeuer und hell wie die Sonne. Er konnte es mit den Händen nicht halten, also wickelte er es in sein ledernes Hemd und steckte es in seinen Gürtel. Und dann stieg er mit verbrannter Hand und beinahe unbekleidet hinab ins Tal.« Elwah seufzte. Er ließ seinen Söhnen Zeit, sich vorzustellen, wie der Held mit nur einer gesunden Hand und halb nackt den eisigen Berg hinabklettern musste. Ihm half die Geschichte nicht, sich abzulenken. Er musste ständig an Lewe denken. Außerdem war es schon spät, und die Nacht nur wenige Stunden lang. Er beschloss, die Sache abzukürzen: »Ihr wisst, dass es ihm mit Hilfe des Heolins, des Lichtsteins von Edhils Wagen, gelang, die zerstrittenen Stämme zu vereinen, denn der Heolin öffnete allen, die ihn sahen, die Augen. Und ihr wisst, dass es Etys war, der unsere Ahnen lehrte, auf dem Rücken der Pferde zu reiten. Von da an endete die Not der Hakul, und unsere Nachbarn begegnen uns seit dieser Zeit mit mehr Achtung. Ihr wisst aber auch, dass es schon spät ist und uns morgen ein langer Tag bevorsteht.«
»Aber Baba, das ist doch der beste Teil der Geschichte«, widersprach Sweru, »wie die Sippen und Stämme der Hakul hinter Etys vereint über die Steppe galoppierten und die Viramatai besiegten und die Romadh. Und wie sie die Akradai aus den Häusern vertrieben, die sie auf unseren Weiden errichtet hatten.«
Elwah schüttelte den Kopf. »Es ist vor allem ein sehr langer Teil, mein Sohn, und wenn ich ihn erzähle, dann werden wir noch bei Tagesanbruch hier sitzen.«
»Dann erzähle uns wenigstens noch, warum die Wölfe nicht in dieses Tal kommen, Baba«, forderte Sweru hartnäckig.
»Damit hast du angefangen, damit musst du auch aufhören, Baba«, meinte Calwah grinsend.
Elwah seufzte. »Die Wölfe kommen nicht in dieses Tal, weil Etys es ihnen verboten hat. Denn er ruht hier, gar nicht weit von uns entfernt, in jener schmalen Schlucht, die wir die Jüngste Schwester nennen. Wir gehen dort nicht hin und halten auch unsere Tiere von seinem Grab fern, denn wir wollen seinen Schlaf nicht stören.«
»Und warum hören die Wölfe auf ihn, Baba?«, fragte Sweru hartnäckig.
»Weil immer noch der Heolin in seiner verbrannten Hand liegt. Die Wölfe fürchten ihn wie das Feuer, und er hält das Böse von diesen Bergen fern. Es ist heiliger Boden, den kein Daimon oder Alfskrol zu betreten wagt. Ja, selbst Xlifara Slahan, die Menschendiebin, wurde seit jener Zeit nicht mehr bei den Zelten der Hakul gesehen. Und jetzt ist es genug für heute.« Und damit beendete Elwah die Geschichte. Sie ging noch weiter, denn der Stammvater Etys hatte drei Töchter. Ihre Männer taugten nicht viel, und es geschah viel Unrecht und Leid, weil sie sich darum stritten, wer das Volk führen sollte. Sie fochten einen endlosen Krieg um Etys’ Erbe aus, kaum dass er gestorben war. So endete die Einigkeit und Größe der Hakul bereits mit Etys’ Tod. Den Heolin aber hatte der Fürst mit ins Grab genommen, denn die Seher verlangten es. Und seit Etys mit dem Lichtstein im Schoße des Berggottes Kalmon ruhte, war die Menschendiebin nicht mehr bei den Zelten der Hakul gesehen worden. Elwah seufzte, und dann mahnte er Anak, der die erste Wache übernehmen sollte, nicht wieder einzuschlafen.
Anak nickte verdrossen. Er war nur ein einziges Mal auf Wache eingeschlafen, und das war beinahe drei Jahre her, auf seinem allerersten Kriegszug. Würde sein Vater ihm das ewig vorhalten? Er sah zu, wie sich die anderen in ihre Mäntel wickelten und bald in die Arme des Schlafes sanken. Die Sommertage waren lang und schön, aber auch angefüllt mit Arbeit. Vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung saßen sie im Sattel. Er gähnte. Wenn Etys das Böse von ihnen fernhielt, warum musste er dann eigentlich Wache stehen? Er kauerte sich zusammen und schürte das Feuer. Sein Vater hatte ihm eingeschärft, es nur ja nicht ausgehen zu lassen. Falls Lewe es in der Schlucht nicht aushielt, sollte die Flamme ihm den Weg weisen.
Anak stand auf und starrte hinüber zur Felswand. Drei Schluchten gab es dort. In einer war sein Bruder verschwunden. Lewe tat ihm leid, aber er hätte es nie gewagt, die Entscheidung seines Vaters in Frage zu stellen. Vieh war wichtig, und jedes Lamm zählte. Mochten sie auch jetzt noch so viele Lämmer haben - ein einziger strenger Winter konnte das ändern. Er setzte sich wieder und gähnte. Sein Vater hatte nicht verbergen können, dass er sich Sorgen um Lewe machte. Als er die Geschichte von Etys erzählt hatte, schien er oft nicht recht bei der Sache gewesen zu sein. Anak schüttelte den Kopf. Manchmal traf Elwah ziemlich seltsame Entscheidungen, das hatte er schon am eigenen Leib erfahren. Meist war es dann seine Mutter Sigil, die vermittelnd eingriff, aber die war im Lager des Klans, viele Stunden entfernt. Das Feuer brannte langsam herunter, und er schürte es lustlos. Er starrte hinauf zu den Sternen. Die Nacht war ungewöhnlich ruhig. Selbst die nächtlichen Geräusche, die sonst die Schlucht erfüllten, schienen verstummt. Dann war ihm, als würde er ein leichtes Scharren vernehmen, irgendwo im Tal. Er setzte sich halb auf und sah sich um. Aber da war nichts.
Ein leichter Wind kam auf, und die Tiere wurden unruhig. Das war der Wind, den sie Skefer nannten, den Peiniger. Er ließ die Augen tränen, machte den Kopf schwer und Mensch und Tier reizbar. Anak seufzte. Den Wind konnte Etys mit dem Lichtstein also nicht fernhalten. Er zog seinen langen Umhang enger um sich und lauschte auf den schweren Atem seines Vaters. Schon seit einiger Zeit wälzte sich Elwah unruhig hin und her. Vielleicht hatte er einen bösen Traum. Der junge Hakul überlegte kurz, ob er ihn wecken sollte, um ihn von diesem Albdruck zu befreien. Andererseits konnte man nie wissen, was die Träume den Schlafenden sagten. Manchmal waren es Warnungen, die man beherzigen sollte. Das hatte er schon oft gehört. Es war also besser, man ließ den Traum seine Nachricht überbringen. Anak lehnte sich an einen kleinen Felsen und starrte nachdenklich ins Feuer.
Da scharrte wieder etwas in der Dunkelheit. Er hob den Kopf. Das Tal lag verlassen im Sternenlicht. Hier und da warfen Felsbrocken schwarze Schatten. Anak lauschte angestrengt, ob sich das Geräusch noch einmal wiederholte. Aber da war nichts. Und die Wölfe kamen ja nicht in dieses Tal. Mit diesem Gedanken schlief er ein.
Wolfsfährten
DER WIND HATTE gedreht. Awin spürte es im Nacken, und er sah es am Staub, den die Hufe seines Pferdes aufsteigen ließen. Müde hing er im Sattel und starrte auf den Steppenboden. Die vergangene Nacht war sehr kurz gewesen, und er fühlte sich zerschlagen. Er blickte verstohlen hinüber zu Curru, der neben ihm ritt, und fragte sich, aus welchem unverwüstlichen Holz dieser Mann wohl geschnitzt war. Zu spät bemerkte Awin, dass ihn sein Meister musterte.
»Ich werde es dir bestimmt nicht sagen, Awin«, erklärte er jetzt.
Natürlich - die Frage! Curru wartete auf eine Antwort. Awin rang seine Müdigkeit nieder und blickte auf das wilde Durcheinander von Spuren, dem sie seit einer guten Stunde folgten. Er sah die weiten Sprünge der Gazellen, dahinter die sich kreuzenden Wolfsfährten. Awin hielt sein Pferd an. Er versuchte, den dumpfen Kopfschmerz auszublenden, der immer schlimmer wurde, je höher die Sonne stieg, und sah sich um. Curru warf ihm einen humorlosen, prüfenden Blick zu. Wenn es nach Awin gegangen wäre, hätten sie das gerne verschieben können, aber Curru war stur. Ihn kümmerte nicht, dass Ech, der zweite Sohn des Klanoberhaupts, gestern zurückgekehrt war und dass die Männer dieses Ereignis ausgiebig mit dem letzten Fass Brotbier gefeiert hatten. Das Fest war bescheiden gewesen im Vergleich zur großen Hochzeit vor einem Jahr, aber es hatte sich dennoch fast bis zur Dämmerung hingezogen. Da war es doch kein Wunder, dass er sich elend fühlte, seit der Morgen viel zu früh angebrochen war. Aber unter der Müdigkeit lauerte noch etwas anderes. Es lag ihm schon den ganzen Morgen auf dem Gemüt, schwer wie Blei, ein tief sitzendes Unbehagen, für das er keine Erklärung hatte.
Mehr als zwei Stunden Schlaf hatte Awin nicht bekommen, Curru eher noch weniger, und dennoch saß er so gerade auf seinem Ross wie ein Herrscher auf dem Thron. Awin riss sich zusammen. Curru hatte darauf bestanden, dass sie ausgerechnet heute seine Fähigkeiten auf die Probe stellten. Wieder einmal. Awin beugte sich zur Erde hinab. Die Gazellen hätten den Wölfen leicht entkommen müssen, aber sie waren es nicht. Im staubigen Boden waren kleinere Hufabdrücke. Deshalb hatten die Wölfe die Jagd fortgesetzt, obwohl die Gazellen sie frühzeitig gewittert hatten. Awin sah sich um. Das Land zog sich in sanften Wellen dahin. Hier und da ragte ein dürrer Busch oder eine verkümmerte Birke aus dem Boden. Je weiter die niedrigen Hügel entfernt waren, desto grüner und saftiger sahen sie aus. Aber das war eine Täuschung. Es war Sommer, das Gras war vertrocknet, und Srorlendh, das Staubland, machte seinem Namen alle Ehre. Awin suchte den Horizont ab, bis er fand, was er erwartete: Zwei schwarze Punkte kreisten am Himmel.
Er räusperte sich. Seine Stimme klang belegt, als er die Frage schließlich beantwortete: »Die Wölfe haben die Jagd nicht aufgegeben, weil Jungtiere unter den Gazellen waren, Meister Curru. Dort hinten kreisen zwei Geier, also haben die Wölfe bekommen, was sie wollten.« Er fragte sich, wieso es nur zwei waren. Lag vielleicht noch irgendwo anderes Aas?
Curru schüttelte den Kopf. »Mewe sagt, du könntest ein guter Jäger werden, wenn du nicht so ein hoffnungslos schlechter Bogenschütze wärst, Awin, aber ich bin nicht Mewe der Jäger, junger Freund.«
Sah der Alte nicht, wie müde er war? Doch, natürlich sah er das - vermutlich machte es ihm Spaß, ihm in dieser Hitze so zuzusetzen und ihm noch einmal unter die Nase zu reiben, in welchen anderen Feldern er ebenfalls ein Versager war. Awin unterdrückte ein Seufzen und versuchte, sich an den passenden Seherspruch zu erinnern. Curru waren diese Sprüche heilig, und er hatte viel Mühe darauf verwendet, sie ihm beizubringen. Vielleicht hätte Awin sie sich besser merken können, wenn er an sie geglaubt hätte. Er sah sich die Fährten der Wölfe noch einmal an. Sie kreuzten sich - das war kein Wunder, sie waren sich ihrer Beute sicher gewesen. Kreuzende Fährten. Awin sagte: »Wenn die Fährten der Wolfsbrüder sich kreuzen, erwarte die Veränderung schon bald.«
Curru schüttelte den Kopf. »Du hast nicht aufgepasst, Awin. Hast du nicht gesehen, dass einer der Jäger schwarz ist?«
Awin starrte verblüfft auf die Fährten. Wie sollte er an einem Abdruck im Staub sehen, welche Farbe das Tier hatte? Curru wies nach hinten. Die Schwarzen Berge ragten dort steil aus der Ebene auf, scheinbar zum Greifen nahe, aber in Wirklichkeit doch etliche Stunden entfernt. Aber das meinte Curru nicht, er deutete auf einige Dornbüsche unter dem Hügelkamm. Natürlich, die Wölfe waren an dieser Stelle vorbeigekommen, und sicher hatte einer der ihren dort etwas Fell gelassen. Wäre er nicht so schrecklich müde gewesen, hätte er das sicher ebenso bemerkt wie sein Meister, der seinen Sieg sichtlich genoss.
»Nun?«, fragte Curru ungeduldig.
Awin verkrampfte sich, wie immer, wenn sein Ziehvater ihn unter Druck setzte. Er hatte dann immer das Gefühl, dass sein Kopf das Denken einstellte. Er versuchte, sich zu sammeln. Schwarzer Wolf? Fast immer eine ernste Warnung. Aber in Verbindung mit kreuzender Fährte? »Ein Unglück«, stieß Awin schließlich hervor, um überhaupt etwas zu sagen, und er konnte nicht verhindern, dass es wie auf gut Glück geraten klang. Es gab wenigstens zwei Dutzend Sehersprüche, die den Schwarzen Wolf zum Inhalt hatten.
Curru schüttelte wieder missbilligend den Kopf. »Siehst du es wirklich nicht? Der Schwarze Wolf und der kreisende Geier?«
»Erschütterung«, rief Awin. Jetzt war es ihm wieder eingefallen.
»Und wann?«, fragte Curru streng.
Awin zögerte mit der Antwort. Er wartete auf einen weiteren Tadel seines Meisters, aber der kam nicht. Der Zeitpunkt war schwierig zu bestimmen. Das Gras hatte sich gebeugt, der Wind war stärker geworden. Awin blickte zur Sonne. Dann auf den Boden. Für einen Augenblick schien das Gras sich rot zu färben.
Curru wirkte plötzlich geistesabwesend. »Erschütterung«, murmelte er nachdenklich.
Awin dachte fieberhaft nach. Das rote Gras war ein Zeichen, oder? Andererseits hatte die Sonne ihn geblendet. Deshalb hatte er das Gras in einer anderen Farbe gesehen, oder? Das ungute Gefühl, das ihn seit dem Aufstehen begleitet hatte, trat jetzt klar und deutlich hervor. Er hatte plötzlich einen Geschmack von Eisen im Mund, und ihm war elend zumute. »Es ist bereits geschehen, Meister«, sagte er schließlich leise. Für gewöhnlich gab er nicht viel auf die alten Sprüche, die seit Generationen von Seher zu Seher weitergegeben worden waren. Curru hatte hunderte davon im Kopf. Sie waren meist so allgemein gehalten, dass sie auf irgendeine Weise immer eintrafen. Ob der Wolf nun über den Hügel kam oder in der Senke lauerte - was sollte das über den kommenden Winter aussagen? Die Winter waren meist streng, das Vieh im Frühjahr immer zu mager, und ein Unglück vorauszusagen war leicht. Das Leben der Hakul war hart und gefährlich, der Tod ein steter Gast in ihren Zelten und Begleiter auf den Weiden.
Doch der Schauer, der Awin über den Rücken lief, sprach eine andere Sprache. Es war etwas beinahe Greifbares im Wind, im Gras, selbst im Sonnenlicht. Es war etwas geschehen, etwas Furchtbares! Awin drehte sich um. Am Horizont standen unerschütterlich die Schwarzen Berge, die heiligen Berge der Hakul. Der Legende nach hatten ihre Vorfahren dort Zuflucht gefunden, als vor vielen Altern die Welt gewandelt und die Goldenen Städte der Menschen zerstört worden waren. Von dort waren sie ausgezogen in die karge Steppe, die sie seither mit ihren Herden durchwanderten.
Die Geier des Gebirges! Dutzende der Aasfresser nisteten dort und flogen weit über die Steppe, immer auf der Suche nach Aas. Wenn die Wölfe ein Tier erbeutet hatten, dann pflegten sie sich darüber zu sammeln. Aber Awin sah immer noch nicht mehr als die beiden, die dort schon seit längerem ihre Kreise zogen. Er suchte den Himmel ab. Eigentlich sollten sie jetzt von überall herangleiten, denn ihren scharfen Augen entging nie, wenn einer der ihren eine Beute erspäht hatte. Aber es waren weit und breit keine Geier zu sehen.
»In den Bergen«, stieß Awin hervor. »Dort muss etwas geschehen sein.«
Curru schüttelte wieder mürrisch den Kopf. »Du sollt nicht denken wie ein Jäger, auch nicht raten oder vermuten - du sollst sehen!«, schimpfte er.
Awin konnte es nicht ändern, er vertraute eben lieber auf seinen Verstand als auf die alten, ungenauen Sprüche. Er blickte wieder zu den steilen Bergen, die das Staubland hier von der offenen Wüste, der gefürchteten Slahan, trennten. Der Himmel über ihnen war nicht blau, sondern von fahlem Weiß.
»Sag, mein Junge, hattest du in dieser Nacht einen Traum?«, fragte Curru unvermittelt.
Awin runzelte die Stirn. Er hasste diese Frage. Vermutlich stellte sein Ziehvater sie deshalb so oft. Es war etwas geschehen, das spürte er. Aber Curru saß auf seinem Pferd, als ginge ihn das nichts an. Sein Blick ruhte streng auf seinem Schüler.
»Die Nacht war sehr kurz, Meister«, wich Awin aus.
»Das sieht man dir auch an, Junge«, entgegnete Curru trocken, »aber das ist keine Antwort.«
Awin seufzte. Sein Lehrer hatte leider das Recht, von seinen Träumen zu erfahren. Tengwil, die große Schicksalsweberin, sandte den Sehern ihre Botschaften auf viele Weisen. Sie versteckte sie in Wolfsfährten, im Wind, im Gras und manchmal eben auch in Träumen.
»Ich sah ein Mädchen. Sie pflückte Blumen.«
»Wer war das Mädchen? Und welche Farbe hatten die Blüten?«
Awin versuchte sich zu erinnern. Das Mädchen war ihm fremd erschienen. Und er hatte sie nur schemenhaft sehen können: Sie trug schwarz, wie die meisten Hakul seines Stammes. Er versuchte sich genauer zu erinnern, aber es gelang ihm nicht. Wenn die Träume Botschaften der Schicksalsweberin waren, warum verblassten sie dann nur so schnell? »Ich weiß es nicht, ich sah das Mädchen nur aus der Ferne und von hinten. Ich weiß nur, dass sie die Blumen im Schatten einer Mauer pflückte.« Jetzt stand Awin dieser Teil wieder klar vor Augen. »Es war eine hohe und lange graubraune Mauer, vielleicht auch eine Felswand. Und sie wurde unterbrochen von … von einer grünen Höhle … glaube ich.« Das Bild war schon wieder verblasst.
Curru starrte ihn an. »Die Mauer - ein Ort, den du kennst?«
Awin dachte nach, dann schüttelte er den Kopf. »Ich glaube, sie gehört zu einer Stadt. Aber ich war noch nie in einer Stadt. Ich weiß nur noch, dass sie sehr hoch und lang war.«
»Die Blumenpflückerin. Eine Feier«, murmelte Curru, »aber es ist nicht klar, ob aus Freude oder aus Kummer, denn du hast nicht auf die Farbe der Blüten geachtet. Und die Mauer? Nun, das kann vieles bedeuten. Eine grüne Höhle, sagtest du?«
»Ja, Meister.«
»Nun, wir werden darüber nachdenken, was dir die Weberin damit mitteilen wollte. Vielleicht zeigte sie dir auch nur die Mauer, die zwischen dir und deiner Berufung steht, mein Junge, denn wahrlich, ich weiß nicht, warum ich immer noch versuche, dich zu unterrichten.«
Awin lag auf der Zunge, dass ein anderer Seher, nämlich sein Vater, ihm schon bei der Geburt diese Berufung in die Wiege gelegt hatte, aber er schluckte die Bemerkung hinunter. Curru ließ Zweifel an seiner Zunft meist nicht zu, nur bei Awins Vater machte er eine Ausnahme, und er wollte seinem Ziehvater nicht die Gelegenheit geben, wieder einmal über seine richtige Familie zu spotten. Daran, dass er es Curru nicht recht machen konnte, hatte er sich inzwischen beinahe gewöhnt. Er selbst hatte auch nie behauptet, ein geborener Seher zu sein. Sein Vater musste sich geirrt haben. Awin hielt das für das Wahrscheinlichste, wenn er das Schicksal bedachte, das ihn und seinen Klan ereilt hatte.
»Hörst du das?«, fragte Curru.
Awin horchte auf. Im Wind war eine Stimme, und es war nicht das Raunen der Schicksalsweberin, sondern die helle Stimme eines Mädchens. Er wendete sein Pferd. Auf dem Hügel tauchte eine Reiterin auf. Sie hielt kurz an, gab dann ihrem Pferd die Fersen und ließ es den sanften Hang hinabstürmen, dass es nur so staubte. Über Awins Gesicht huschte das erste Lächeln des Tages. Es war Wela, die Tochter des Schmieds. Völlig außer Atem hielt sie an.
»Seid ihr taub, ihr Männer?«, keuchte sie.
»Sei auch du mir gegrüßt, Wela«, antwortete Curru mürrisch. »Weiß dein Vater, in welchem Aufzug du hier durch die Steppe reitest?«, fragte er mit missbilligendem Blick auf die Männerkleider, die sie so gerne trug. »Es ist kein Wunder, dass so selten Bewerber um deine Hand in unserem Lager erscheinen.«
Wela warf Curru einen giftigen Blick zu. »Es kommen immer noch mehr Freier meinetwegen als Ratsuchende deinetwegen, Meister Curru«, erwiderte sie, »aber ich bin nicht gekommen, um mit dir zu streiten. Habt ihr denn das Horn nicht gehört?«
»Der Wind hat gerade erst gedreht«, warf Awin schnell ein, um die üblichen Streitereien zwischen den beiden zu unterbinden. Sobald er in Welas Gesicht blickte, entdeckte er tiefe Besorgnis unter dem oberflächlichen Ärger über Curru.
»Es ist Furchtbares geschehen«, stieß sie schnell hervor, »vielleicht Krieg! Elwahs jüngster Sohn Lewe kam ins Lager, die Kleider voller Blut. Yaman Aryak ruft die Krieger zusammen.«
Awin wurde flau im Magen. Er hatte es gesehen. Das rote Gras. Das Verhängnis war wirklich bereits eingetreten. Er warf einen Seitenblick auf Curru. Dieser nickte grimmig und behauptete: »Siehst du, Junge? Es ist, wie ich sagte, der Schwarze Wolf hat das Unglück angekündigt. Und du hast es nicht gesehen.«
Awin öffnete schon den Mund, um zu widersprechen. Aber er konnte seinem Meister keine Widerworte geben, nicht in Gegenwart anderer.
Wela blickte zweifelnd von einem zum anderen. »Es scheint mir, du hättest den Wolf besser früher gefragt, Meister Curru, vielleicht hätte das Unglück dann verhindert werden können. Aber ich muss weiter. Meister Bale ist mit seiner Herde am Weißen Weiher, und der Yaman will alle Männer sofort im Lager sehen. Ihr solltet euch beeilen.« Damit drückte sie ihrem Pferd die Fersen in die Flanke und stob davon.
»Ich frage mich oft, welche Sünde Tuwin begangen hat, dass er mit einer solchen Tochter gestraft wurde - und wir mit ihm«, brummte Curru.
Awin sah Wela noch eine Weile hinterher. Er mochte sie schon deshalb, weil sie sich von Curru nichts gefallen ließ.
»Träum nicht, Junge, du hast diese Unglücksbotin gehört. Wir müssen zurück.«
Die staubigen Hügel endeten an einem schmalen Bach, der sich durch das Gras in Richtung Westen schlängelte, bis er ein gutes Stück südlich der Schwarzen Berge im Sand der Slahan versickerte. Weit vorher aber floss er durch das Lager Aryaks, und das war ihr Ziel. Sie ritten in scharfem Trab. Schließlich entdeckte Awin eine Staubwolke, die über dem Lager zu stehen schien.
»Ich glaube, sie brechen das Lager ab, Meister«, rief Awin.
Curru warf ihm einen missmutigen Blick zu.
»Dort vorne, der viele Staub«, erklärte Awin.
»Meinst du, das habe ich nicht schon längst gesehen, mein Junge?«, entgegnete Curru. Und er gab seinem Pferd die Fersen und galoppierte davon.
Awin seufzte und folgte ihm. Sie umrundeten ein schütteres Birkenwäldchen, und dann sahen sie die ersten Rundzelte. Das Lager erweckte den Anschein eines einzigen großen Durcheinanders. Frauen und Männer waren dabei, die Zelte abzuschlagen. Pflöcke wurden aus dem Boden gezogen, lange Stangen gebündelt und Lederbahnen zusammengefaltet, Pferde mussten angeschirrt und die leichten Wagen mit den Habseligkeiten beladen werden. Dazwischen versuchten Kinder, die Ziegen zusammenzutreiben. Es war ein vertrauter Anblick, denn so ging es stets, wenn der Klan weiterzog. Deshalb wusste Awin auch, dass diesem scheinbaren Chaos in Wahrheit eine strenge Ordnung zu Grunde lag. Das alles war schon tausendmal geschehen, und jeder Handgriff saß. Nur, dass dieses Mal alles viel schneller zu gehen schien. Und wo war das Gelächter, und wo waren die Spötteleien, die diese lästige Arbeit sonst zu erleichtern pflegten? Selbst die Kinder lachten nicht. Awin folgte Curru bis zu den ersten Zelten und hielt Ausschau nach seiner Schwester.
»Awin, hier!«, rief Gunwa, die ihn zuerst gesehen hatte, und lief ihm entgegen. Sie war ein Jahr jünger als er und hatte die nussbraunen Haare ihrer Mutter.
Er trieb sein Pferd durch eine Gruppe Ziegen zu ihr. »Weißt du, was hier vorgeht?«, fragte er, obwohl er es eigentlich schon wusste.
»Wir müssen fort, hat der Yaman gesagt. Lewe kam vorhin über die Weide. Halbtot vor Angst. Kein Wort kann er sprechen, sagen sie, aber seine Kleider reden für ihn. Sie sind rot von Blut.«
»Und sein Vater und seine Brüder?« Awin dachte an Anak, denn der war nur ein wenig älter als er selbst, und sie waren gut befreundet. Aber seine Schwester wusste nicht mehr, als sie schon gesagt hatte. Sein Falbe schnaubte unwillig, weil Ziegen zwischen seinen Beinen hindurchdrängten.
»Pass doch auf, Großer, du bist im Weg«, rief eine helle Kinderstimme. Awin lenkte sein Pferd zur Seite und sprang aus dem Sattel.
»Gunwa, Gunwa! Wo steckst du?«, rief eine heisere Frauenstimme. »Soll ich das alles hier alleine schleppen?« Im Gewühl der Zeltbahnen tauchte ein grauer Frauenkopf auf.
»Ich komme schon, Mutter Egwa!«, rief Gunwa zurück. Egwa war nicht ihre leibliche Mutter. Sie war die Gefährtin von Curru. Die beiden hatten Awin und seine Schwester nach dem Tod ihrer Mutter an Kindes statt aufgenommen.
»Ah, dein nichtsnutziger Bruder ist auch wieder da. Du wirst im Zelt des Yamans erwartet, Awin, also beeile dich. Und sag es auch Curru, wenn er nicht schon dort ist! Und du, Gunwa? Was ist mit den Seilen? Glaubst du, die rollen sich von selbst auf? Mach schon, Mädchen, denn Eile ist geboten!«
Gunwa seufzte und lief. Es war nicht ratsam, ihrer Ziehmutter nicht zu gehorchen. Awin versuchte, in dem Durcheinander die Übersicht zu behalten. Der vertraute Anblick, den das Lager noch am Morgen geboten hatte, versank gerade in einer Staubwolke. Allein das Zelt des Sippenoberhauptes stand noch unberührt. Awin packte sein Tier am Zügel und zog es hinter sich her. Er sah die drei Söhne des Yamans vor dem Eingang. Ebu und Ech wirkten ernst und gefasst, aber Eri, der jüngste, konnte vor Aufregung nicht still stehen.
»Warum brechen wir nicht endlich auf?«, rief er gerade. »Diese Untat schreit doch nach Rache.«
»Fasse dich in Geduld, kleiner Bruder«, wies ihn Ech sanft zurecht, »wir wissen doch noch gar nicht, was geschehen ist.«
Ein Tuch wurde zur Seite geschlagen, und zwei Frauen erschienen. Sie waren beide leichenblass. Es handelte sich um Sigil, die Frau Elwahs, die sich kaum auf den Beinen halten konnte, und ihre Schwiegertochter Hengil, die sie stützte. Sie warf Eri einen vorwurfsvollen Blick zu, den der Knabe aber nicht verstand. »Wir werden deinen Mann rächen, Sigil, das verspreche ich dir!«, rief er mit heller Stimme. Die Frau zuckte zusammen und wandte sich ab. Ihre Schwiegertochter führte sie eilig davon.
Ech gab Eri einen harten Stoß gegen die Schulter. »Wie kannst du nur! Wir wissen doch gar nicht, ob Elwah tot ist. Willst du Tengwil zwingen, dieses Schicksal über ihn zu verhängen?«
Awin musste Ech zustimmen. Der Teppich des Schicksals bestand aus unzähligen Fäden, aber alle liefen sie durch die Hand der Großen Weberin. Ein unbedacht geäußerter Gedanke konnte zur Gewissheit werden, wenn er Tengwil zu Ohren kam.
»Sieh da, der junge Seher«, rief Ebu. Die Herablassung in seiner Stimme war unüberhörbar. Manchmal dachte Awin, sie sei ihm angeboren und der älteste Sohn Aryaks könne gar nichts dafür. Awin band sein Pferd an einen der Zeltpfosten. Dort stand bereits ein kleiner struppiger Schecke, der, wenn er sich nicht täuschte, Lewe gehörte. Curru war nicht zu sehen. Sicher war er im Zelt. Awin war unschlüssig, ob er ihm folgen sollte. Ech schien seine Unsicherheit zu spüren: »Dein Meister ist bereits drinnen, und du solltest auch hineingehen. Das ist eine Sache für Seher, scheint mir«, sagte er freundlich.
»Und für die, die sich so nennen«, meinte Ebu trocken. Awin mochte Ebu ebenso wenig wie dieser ihn, aber Ebu war der älteste Sohn des Yamans - sein Erbe -, und Awin schuldete ihm Achtung. Also drängte er sich stumm an ihm vorbei. Er brauchte einen Augenblick, um sich an das gedämpfte Licht im Zelt zu gewöhnen.
»Ah, Awin, komm herein«, begrüßte ihn Yaman Aryak, der auf einem dicken Kissen saß. Seine Frau Gregil war dabei, einen Jungen mit warmem Wasser abzuwaschen. Sie nickte ihm aufmunternd zu. Aber auch ihre Freundlichkeit konnte nicht verhindern, dass sich Awin in der Nähe des Klanoberhauptes eingeschüchtert fühlte. Curru kniete vor dem Knaben und starrte ihm ins Gesicht.
»Sieh nur zu, junger Seher, vielleicht vermagst du etwas zu lernen«, sagte Aryak und winkte ihn näher heran.
Awin kannte Lewe als verträumten und etwas dickköpfigen Knaben, doch das, was er da vor sich sah, glich eher einem Gespenst als einem Kind. Seine Augen waren völlig leer, und seine mageren Arme hielt er eng an den Körper gepresst. Awin fragte sich, warum seine Mutter Sigil nicht bei ihm geblieben war.
»Nun?«, fragte Aryak.
Curru seufzte. »Die Dunkelheit hat sich fest um den Knaben geschlossen. Meine alten Augen vermögen sie nicht zu durchdringen. Ich denke aber, wir werden die Antwort auf unsere Fragen in den Schwarzen Bergen finden.«
Der Yaman runzelte die Stirn. »Ich weiß, dass Elwah sein Vieh dort zu weiden pflegt, doch ist dieser Boden heilig. Selbst die Budinier wagen sich nicht in böser Absicht dort hin. Und sicher keine der jungen Hakul, die sich beweisen wollen.«
»Ich war mit meinem Schüler in der offenen Steppe, Aryak, und ich sah die Fährte des Schwarzen Wolfs und den Flug des Geiers. Und sie sprachen beide von den Bergen. War es nicht so, mein Junge?«
Awin nickte. Streng genommen war es nicht ganz so gewesen, aber er durfte seinen Meister natürlich nicht bloßstellen. Außerdem fand er selbst die Lage viel zu ernst, um jetzt über solche Kleinigkeiten zu streiten.
»Und hast du auch sehen können, ob uns ein Angriff bevorsteht, alter Freund?«
»Weder Wolf noch Geier wollten mir Genaueres sagen, Aryak, doch ich denke, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Es war der Schwarze Wolf. Es ist gut, dass du das Lager abbrechen lässt.«
Awin dachte nach. Krieg? Es wäre eine seltsame Zeit für die Budinier, auf Kriegszug zu gehen. Es war Sommer, da waren ihre Männer auf den Feldern beschäftigt. Vielleicht eine der Banden, die aus der nördlichen Einöde gelegentlich bis ins Staubland kamen? Auch das konnte er sich nicht recht vorstellen. Die Slahan war in diesen Wochen ein Glutofen. Wer sich jetzt durch sie hindurchquälte, musste schon einen großen Gewinn erwarten.
Der Yaman nickte. »Wir werden das Lager an die Zwillingsquelle verlegen«, erklärte er und erhob sich. »Kommt, ich sage den Männern, sie sollen sich auf den Kampf vorbereiten.«
Awin folgte den Männern hinaus, aber dann drehte er sich im Ausgang noch einmal zur Frau des Yamans um. Ihm war etwas eingefallen. »Sag, ehrwürdige Gregil - Lewe, er kam doch zu Pferd ins Lager, nicht wahr?«
Gregil war dabei, den Knaben abzutrocknen. Er ließ es immer noch völlig teilnahmslos über sich ergehen. Sie blickte auf, runzelte die Stirn und nickte.
»Es ist das kleine struppige, das an eurem Zelt angebunden ist, oder?«
»Das ist es«, bestätigte die Yamani, »aber warum fragst du, Awin?«
Awin zögerte. Er war sich seiner Sache nicht sicher, aber dann sagte er es doch: »Es sah mir nicht aus, als sei es den ganzen Weg von den Bergen hierher gehetzt worden. Entweder ist unser Feind sehr langsam, oder er hat Lewe nicht verfolgt und vielleicht auch gar nicht vor, uns zu überfallen.«
Gregil musterte ihn scharf, dann sagte sie: »Du bist doch nicht so dumm, wie Curru gerne behauptet, scheint mir. Du solltest es dem Yaman sagen.«
Awin schüttelte den Kopf. »Ich müsste es erst meinem Meister sagen, und … ich weiß nicht, ob ich ihn überzeugen kann«, antwortete er vorsichtig.
»Er meint es gut mit dir, junger Seher«, antwortete Gregil mit einem Lächeln. »Aber du hast Recht. Ich werde meinem Mann berichten, was du mir gesagt hast. Aber jetzt eile, es steht ein Kriegszug bevor, und ich glaube, auch du musst dich darauf vorbereiten.«
Als Awin wieder vor das Zelt trat, hatte sich das Lager bereits beträchtlich verändert. Die Rundzelte waren verschwunden, die Wagen beladen und die Ziegen der verschiedenen Familien zu einer einzigen, großen Herde zusammengetrieben worden. Der Yaman und seine Söhne waren dabei, ihre Pferde zu satteln. Gregil hatte Recht, auch er musste sich rüsten. Er sprang auf sein Pferd und lenkte es dorthin, wo am Morgen noch seine Schlafstatt gewesen war. Curru war dort und sprach mit Egwa, die mit zusammengekniffenem Mund zusah, wie er seine Waffen zusammensuchte.
»Wenn Krieg ist, ist Krieg, Egwa«, sagte der alte Seher gerade, »und ich werde sicher nicht zurückstehen, wenn die Männer in die Schlacht ziehen.«
»Das gefällt euch doch!«, erwiderte Egwa bissig. »Ihr zieht hoch zu Ross in irgendeinen Kampf, und wir Frauen dürfen sehen, wie wir allein zurechtkommen.«
»Sonst beschwerst du dich immer, ich sei dir im Weg«, brummte Curru, der angelegentlich die Federn seiner Pfeile prüfte.
»Bist du auch, und wenn ich es so betrachte, weiß ich gar nicht, warum ich mich aufrege. Ich werde das Zelt schneller aufbauen, wenn du mir nicht hilfst. Denn ich habe ja Gunwa, und die ist viel verständiger als du.«
»Dann ist ja alles in bester Ordnung«, entgegnete Curru mürrisch. Die Pfeile steckte er in den Köcher, der an seinem Sattel baumelte. Jetzt prüfte er mit dem Daumen die Schneide seines Sichelschwertes.
»Deine Sachen sind hier, Bruder«, rief Gunwa Awin entgegen. Sie hielt das Fellbündel im Arm, in dem er seine Waffen aufbewahrte.
»Ach ja, noch so ein Held!«, rief Egwa, bevor sie sich umdrehte und wütend zum Wagen stapfte.
Curru schwang sein Schwert ein paarmal hin und her. »Nun, mein Junge. Niemand erwartet Heldentaten von dir«, begrüßte er Awin, »aber ich denke, es wäre doch an der Zeit, dass du dir endlich deinen Dolch verdienst.«
Awin seufzte. Das war noch so ein wunder Punkt, den sein Ziehvater gerne reizte. Awin war sechzehn und schon zweimal bei den Winterzügen der Sippe dabei gewesen, aber einen Feind hatte er dabei noch nicht töten können.
»Komm, ich helfe dir«, rief Gunwa, als er vom Pferd glitt und missmutig seine Waffen anstarrte.
»Und ich werde mal sehen, ob meine Gefährtin ihrem Manne nicht auch in seine Rüstung helfen will«, brummte Curru und schulterte seinen ledernen Panzer. Egwa tat, als hätte sie irgendetwas Wichtiges an der Ladung des Wagens zu schaffen. Awin grinste. Er konnte sich gar nicht vorstellen, wie lange Curru und Egwa schon zusammenlebten, aber solange er sie kannte, erlebte er diese ständigen Reibereien zwischen ihnen.
»Sie macht sich Sorgen«, sagte Gunwa, als Curru außer Hörweite war.
»Ich weiß«, erwiderte Awin, der versuchte, die Sehne auf seinen Bogen zu ziehen.
»Du hättest ihn besser fetten sollen«, meinte Gunwa.
»Auch das weiß ich«, keuchte Awin. Er stemmte sich mit seinem Gewicht auf den Bogen, aber immer noch fehlte ein Fingerbreit, um die Schlaufe der Sehne über die Spitze zu bringen.
»Für einen Seher bist du manchmal bemerkenswert kurzsichtig«, stichelte Gunwa.
»Du klingst schon wie Egwa«, gab Awin zurück, und mit einer letzten Anstrengung schaffte er es, den Bogen weit genug zu biegen und ihn endlich zu bespannen. »Wolltest du mir nicht eigentlich helfen, liebe Schwester?«, sagte er, als er ihren sorgenvollen Blick sah.
Sie nickte und zog die Bänder der ledernen Armschienen und des tellergroßen ledernen Brustpanzers fest. Dann half sie ihm beim Schwertgurt und mit den Köchern. Awin strich die Federn seiner Pfeile glatt. Er hatte lange versucht, seinen Misserfolg mit dem Bogen auf diese Pfeile zu schieben. Doch sein Freund Anak hatte ihm bewiesen, dass ein anderer sehr gut damit treffen konnte.
Und es war gar kein guter Einfall gewesen, dem Bogen die Schuld zu geben. Tuge, der Bogner des Klans, hatte sich angehört, was Awin stotternd vorbrachte, ihm dann stumm Bogen und Pfeile abgenommen und drei meisterhafte Schüsse auf die Spitze einer Zeltstange abgegeben. Danach hatte er Awin den Bogen wortlos wieder gereicht und war immer noch schweigend in seinem Zelt verschwunden. Anak hatte sich halb totgelacht, weil Awin dann den Besitzer des Zeltes, Tuges Bruder Tuwin, bitten musste, ihm seine Pfeile zurückzugeben. Anak! Awin fiel wieder ein, warum er sich hier auf einen Kampf vorbereitete. Seinem Freund musste etwas zugestoßen sein. Awin wollte aber nicht, dass ihm etwas geschehen war, also schickte er in Gedanken ein Gebet an die Große Weberin, auch wenn er fürchtete, dass der Faden, an dem Anaks Schicksal hing, längst verwoben war.
»Wie sehe ich aus?«, fragte er seine Schwester, als er endlich fertig war.
»Wie ein Kind, das sich als Krieger verkleidet hat«, antwortete Egwa trocken an Stelle seiner Schwester. Sie führte Currus Pferd am Zügel.
»Bist du so weit, mein Junge?«, fragte Curru. Er saß auf seinem Grauschimmel, die Sgerlanze, das Feldzeichen des Klans, stolz aufgerichtet. Ein schwarzer Rossschweif war unter der kostbaren eisernen Spitze angebunden, darunter baumelte eine Bronzescheibe, auf der ein schwarzer, nach unten offener Winkel aufgemalt war. Es war das Sgertan, das Zeichen der Sippe Aryaks, des Klans der Schwarzen Berge.
Awin nickte und sprang auf sein Pferd. Er beugte sich zu seiner Schwester hinab, die ihm seinen Bogen reichte, und streichelte ihr in einer plötzlichen, unbeholfenen Geste über das Gesicht.
»Ich komme wieder, das verspreche ich«, sagte er.
»Davon gehe ich aus, oder willst du los, ohne etwas zu essen einzupacken?«, erwiderte Gunwa bissig. Aber er sah, dass ihr Tränen in den Augen standen.
Egwa lachte heiser. »Das Mädchen hat Recht. Immer eines nach dem anderen, junger Held. Wer nichts isst, kann auch nicht kämpfen!«
Awin seufzte und folgte Curru, der steif und würdevoll, das Kriegszeichen in der Rechten, zur Mitte des Lagers ritt.
Sie wurden bereits erwartet. Der Yaman war dort mit seinen Söhnen, und auch die anderen Männer waren zu Pferd und in Kriegsbewaffnung erschienen. Frauen und Kinder waren ebenfalls dort versammelt oder kamen gerade heran, und das Raunen vieler leiser und besorgter Gespräche erfüllte die Luft. Die Männer rückten noch einmal ihre Rüstungen zurecht oder ließen sich von ihren Frauen dabei helfen. Eri hatte offensichtlich Schwierigkeiten mit dem Gurt für den Bogenköcher, aber er ließ nicht zu, dass seine Mutter ihm half, sondern trieb sein Pferd ein wenig zur Seite. Er war mit fünfzehn Jahren einer der jüngsten Krieger. Bale, der dicke Pferdezüchter, war der Älteste. Er ging inzwischen auf die sechzig zu, und er war der Einzige, der keine Rüstung, sondern immer noch die übliche Hirtenkleidung trug. Und er war alleine erschienen. Yaman Aryak war das nicht entgangen. Er saß auf seinem Pferd, einem kräftigen Fuchs, und musterte die Männer, die sich um ihn scharten. Jetzt wandte er sich an Bale. Er musste laut sprechen, um die allgemeine Unruhe zu übertönen. »Sag, mein Freund, wo ist deine Rüstung, und wo sind dein Sohn und dein Enkel?«
»Sie sind noch bei den Tieren, Yaman. Verzeih, aber die Fohlen haben uns aufgehalten. Ich habe ihnen gesagt, dass sie sich eilen sollen, und bin vorausgeritten, um zu sehen, was es denn überhaupt gibt.«
»Deine Fohlen? Hat Wela dir meine Botschaft nicht überbracht? Dass wir vielleicht kämpfen müssen?«
»Doch, Yaman, das hat sie, doch ist sie nur ein Mädchen, und ich dachte, sie hätte vielleicht etwas nicht recht verstanden. Krieg? Zu dieser Jahreszeit? Welcher vernünftige Mensch kann da in den Krieg ziehen wollen?«
Awin sah sich unwillkürlich nach Wela um, aber er konnte sie nicht sehen. Das war gut für den alten Bale, denn sie hätte ihm diese abfällige Bemerkung sicher nicht so schnell verziehen.
»Meine Tochter kann sich einfache Worte durchaus merken, wenn sie so wichtig sind wie diese, Bale«, meldete sich Tuwin der Schmied an ihrer Stelle zu Wort. Er war empfindlich, was seine Tochter betraf. Die Götter hatten sich entschieden, ihm Söhne vorzuenthalten und ihm nur diese eine Tochter geschenkt. Es hatte sich herausgestellt, dass sie die Begabung für sein wichtiges Handwerk geerbt hatte und dass sie geschickter darin war als alle Jungen der Sippe. Doch konnte ein Mädchen wirklich Schmiedin werden, die Zauberkräfte erlernen, die bis dahin den Männern vorbehalten waren? Nun war Tuwin, wie die meisten Schmiede, auch der Heiler des Klans, und vielleicht hätte man Wela dieses eine Amt überlassen, aber sie wollte beide Künste erlernen. Niemand hatte je gehört, dass so etwas vorgekommen wäre. Tuwin hatte sich viele Abende mit Yaman Aryak und auch mit Curru in dieser Angelegenheit besprochen. Alle Möglichkeiten waren sorgfältig erwogen und von allen Seiten betrachtet worden, bis sie nach mehreren Wochen endlich zu dem Schluss gekommen waren, Wela ihren Wunsch zu erfüllen. Nicht jeder war damit einverstanden. Bale war einer der Unzufriedenen und ließ das auch bei jeder Gelegenheit durchblicken. Er setzte zu einer scharfen Antwort an, wurde aber vom Yaman daran gehindert. »Genug davon«, rief Aryak und hob die Hand. Augenblicklich verstummte das Gemurmel.
»Es ist ein dunkler Tag für unseren Klan«, begann er. »Der Schwarze Wolf ist in der Steppe und hat zu Curru gesprochen, und noch nie war es gut, wenn er sich zeigt. Viele haben gesehen, wie Lewe heute Mittag zu uns in Lager kam, die Kleidung befleckt von Blut, die Augen starr vor Schreck und die Zunge gelähmt. Wir müssen annehmen, dass es das Blut seines Vaters und seiner Brüder ist, das er zu uns brachte. Und wenn fünf unserer Krieger fallen oder verwundet werden, dann muss wirklich ein gefährlicher Feind über sie gekommen sein. Deshalb habe ich entschieden, das Lager abzubrechen und an die Zwillingsquellen zu verlegen. Sollte der Feind uns hier suchen, wird er uns nicht finden.«
Der Yaman richtete sich im Sattel auf. Er ließ seinen Blick über die Runde schweifen, bis jeder in der schweigenden Menge das Gefühl hatte, der Yaman habe ihn gesehen und seine Sorgen verstanden. Dann fuhr er fort: »In einem hat Bale hier Recht. Es ist nicht die Zeit des Krieges. Weder die Budinier noch die Räuber aus dem Ödland ziehen in der Hitze des Sommers durch die Slahan. Auch ich kann nicht glauben, dass ein Feind gegen unser Lager vorrückt. Wenn der Feind Lewe gefolgt wäre, müsste er längst hier sein.«
Awin blickte auf. Seine Meinung war also zum Yaman durchgedrungen. Er fing einen freundlichen Blick der Yamani auf. Aryak wartete, bis die Sippe verstanden hatte, dass die Gefahr vielleicht doch nicht so groß war, wie sie befürchtet hatten. »Dennoch werden wir Krieger nun zu den Schwarzen Bergen reiten und ergründen, was Elwah und seinen Söhnen widerfahren ist. Und sollte ihnen Schlimmes begegnet sein, werden wir nicht ruhen, bis die Schuldigen gefunden und bestraft sind.«
Zustimmendes Gemurmel erhob sich. Awin konnte sehen, dass es dem Yaman gelungen war, die schlimmsten Befürchtungen zu zerstreuen. Allerdings nicht bei allen. Er sah Sigil, Elwahs Frau, und ihre Schwiegertochter, die ihre Pferde am Zaumzeug heranführten. Hatten sie etwa vor, die Krieger zu begleiten?
Curru hatte die Ansprache des Yamans genutzt, um die erforderlichen Opfer vorzubereiten. Die große Bronzeschale stand bereit. Ein Lamm zitterte unter Currus festem Griff. Curru erflehte den Segen Kalmons, des Gottes der Schwarzen Berge und ihres Klans, und opferte ihm das weiße Lamm. Und da ihr Weg sie in die Nähe der Slahan führte, brachte er auch Xlifara Slahan unter stummen Gebeten das Wasseropfer.
»Wo ist Mewe?«, fragte Tuwin der Schmied, als der kurze Ritus beendet war. »Wir werden ihn brauchen.«
Aryak nickte. »Ich habe ihn in die Steppe geschickt. Er soll Lewes Spur aufnehmen und uns warnen, falls unterwegs doch unangenehme Überraschungen auf uns warten.«
Plötzlich war Gunwa bei Awin und hielt ihm einen Trinkschlauch und ein Paket hin. »Hier, Bruderherz, aber iss nicht alles auf einmal«, flüsterte sie.
»Du hast den Yaman gehört, Schwester, wir ziehen nicht in den Krieg«, versuchte Awin sie zu beruhigen. Er hängte sich die Flasche um. »Ich bin auch viel zu sehr bepackt, um in den Kampf zu ziehen.« Es war ein schwacher Scherz, und er verfehlte seine beabsichtigte Wirkung.
»Du musst zurückkommen, Awin, hörst du. Du bist doch der einzige Mensch, den ich noch habe.«
Awin lächelte ihr zu. Er war froh, dass der Yaman endlich das Zeichen zum Aufbruch gab. Auch er machte sich Sorgen. Die Krieger ließen Frauen, Kinder und Alte nahezu schutzlos zurück. Natürlich würde die Yamani die Weißen Federn am Wagen und später auf ihrem Zelt setzen lassen, und natürlich würde kein Hakul von Ehre ein Lager angreifen, das unter dem Schutz dieses Zeichens stand. Aber was, wenn er sich geirrt hatte? Was, wenn da draußen doch Feinde waren, Fremde, vielleicht so zahlreich, dass sie keine Eile nötig hatten? Was, wenn gerade jetzt hunderte von Kriegern über die staubige Ebene ausschwärmten, fest entschlossen, jeden Hakul, gleich ob Mann, Frau oder Kind zu töten? Er versuchte die Gedanken zu verscheuchen, aber es fiel ihm nicht leicht. Er musste wieder an die Wolfsfährten denken. Eine schwere Erschütterung stand ihnen bevor, wenn stimmte, was die Sehersprüche der Alten sagten. Awin hoffte inständig, dass sie sich irrten.
1. Auflage Originalausgabe Mai 2010 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © 2010 by Torsten Fink
Umschlaggestaltung: HildenDesign München
Lektorat: Simone Heller HK · Herstellung: sam
eISBN : 978-3-641-03898-4
www.blanvalet.de
Leseprobe
www.randomhouse.de