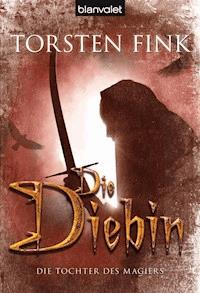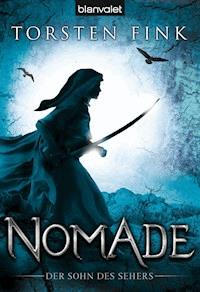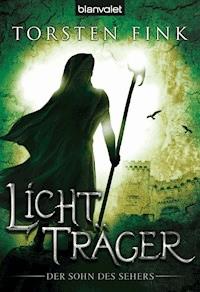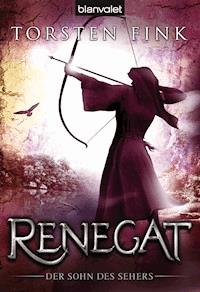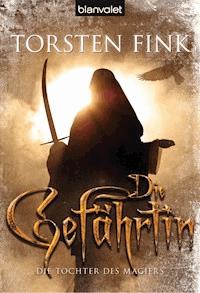Inhaltsverzeichnis
Erster Tag
Bet Schefir
Luban-Etellu
Copyright
Leichte Wellen schlugen gegen den Bug der Garbe. Das Licht der tief stehenden Sonne glitzerte auf den Wellen des Flusses. Fahs war auf ihrer Seite. Er hatte den Südwind geschickt, und der schob sie langsam, aber stetig den Dhanis hinauf. Mehitu blickte zum Himmel. Rosafarbene Wolken schmückten den hohen Abendhimmel. Das Wetter würde sich halten. Unter Deck knarrten die Riemen, die Ruderer legten sich mächtig ins Zeug. Er lauschte auf ihren Takt. Fahs’ Wind mochte helfen, aber es waren immer noch Menschen, die den schweren Teil der Arbeit zu erledigen hatten. Mehitu blickte zurück und sah die Schiffe, die ihnen folgten. Sechs, mit der Garbe sieben. Sie hatten kein einziges verloren. Auch auf den anderen Schiffen tauchten die Männer die Ruderblätter kraftvoll ins Wasser und stemmten sich gegen die Strömung. Es waren gute Leute, sie ruderten gleichmäßig, obwohl die Trommeln schweigen mussten. Es ging langsam voran. Mehitu betrachtete das Ufer. Hinter dem dichten Schilf lag der Treidelpfad. Er seufzte. Es ging ihm gegen den Strich, seine Leute an die Ruder zu setzen, aber Treideln war natürlich nicht möglich. Es war ihr Glück, dass Fahs ihnen den Südwind geschickt hatte, denn so waren sie nicht auf Zugtiere angewiesen. Zugtiere, die sie gar nicht hatten, wie Mehitu in Gedanken ergänzte. Er spuckte schnell über die Schulter ins Wasser. Er war abergläubisch und wollte den Wind nicht beschreien, auch nicht in Gedanken. Sapi, der vorne im Bug Ausschau hielt, ließ einen leisen Pfiff hören und winkte ihn heran. Mehitu trat nach vorne. Da trieb etwas auf sie zu. Es war ein Leichnam, ein Krieger in leichtem Lederpanzer. Er trieb kopfunter in der Strömung.
»Serkesch«, meinte Sapi.
Mehitu nickte. Der Tote konnte noch nicht lange im Fluss sein. Die Echsen hatten ihn noch nicht entdeckt. Er sah dem toten Körper nach, der sich langsam in den Strudeln drehte, die die Ruderer erzeugten. Mehitu runzelte die Stirn. Ihm war, als würden die letzten Segel etwas zurückfallen. Er war nicht nur der Elepu dieses Schiffes, er war der Bel Elepai, der Führer dieser Flotte, und es war seine Aufgabe, die Schiffe zusammenzuhalten. Noch war der Abstand nicht besorgniserregend, doch er wollte ihn im Auge behalten.
»Dem da haben sie die Kehle durchgeschnitten«, sagte Sapi.
Mehitu wusste einen Augenblick nicht, wovon der Mann sprach, dann entdeckte er den zweiten Toten, der durch den Bug der Garbe zur Seite gedrückt wurde und zwischen Rumpf und Ruderblättern flussabwärts trieb. Es schien noch Blut aus der Wunde zu flie ßen. Er konnte wirklich noch nicht lange tot sein. Waren sie zu schnell? Er suchte das Ufer ab. Irgendwo dort im Schilf warteten die Wachposten der Serkesch. Und hinter ihnen schlichen die nackten Füße der Hattu lautlos durchs Schilf. Der Bel Elepai beglückwünschte sich noch einmal zu seinem Einfall, die Krieger an Land zu senden. Bis jetzt schienen sie jeden Posten beseitigt zu haben, bevor er Alarm schlagen konnte. Er blickte noch einmal zum Himmel. Die Sonne war hinter dem Horizont verschwunden. Bald würde die Nacht ihren schützenden Mantel über sie ausbreiten, und spätestens bei Anbruch des Tages würden sie Ulbai erreicht haben - wenn alles glattging. Mehitu seufzte. Das dichte Grün am Ufer versank allmählich im Zwielicht. Der Treidelpfad würde bald enden. Das westliche Ufer des Weißen Dhanis war ein schmaler Streifen Land, der sich vom Meer bis beinahe nach Ulbai hinauf zog. Ein Geschenk der Götter an die Seefahrer, denn wie ein natürlicher Damm sorgte er dafür, dass der Fluss seinen Lauf hielt. Jenseits dieses langen Streifens erstreckte sich nur noch der endlose Sumpf mit seinen ungezählten kleinen Wasserarmen und Tümpeln. Die Akkesch hatten schon vor langer Zeit die Lücken in diesem Damm geschlossen und den Treidelpfad angelegt. Zwei Dörfer lebten davon, dass sie die Ochsen bereit hielten, die in großen Gespannen die schweren Frachtschiffe den Fluss hinaufschleppten. Das Dorf im Süden hatten die Serkesch zu Beginn der Belagerung niedergebrannt und die Ochsen geschlachtet. Das Dorf im Norden hielten sie besetzt. Sie hatten es befestigt und versuchten, von dort aus die Verbindung der Stadt zum Meer abzuschneiden. Mehitu nickte grimmig. Sie mussten dicht an diesem Lager des Feindes vorüber. So fest würden selbst die Serkesch nicht schlafen, dass sieben Schiffe unbemerkt vorbeischlüpfen konnten. Und die Hattu mussten die Seilsperren kappen, die der Feind über den Fluss gespannt hatte. Und Sie durfte sich nicht zeigen. Mehitus hoffnungsvolle Stimmung verflog. Sie waren seit Wochen unterwegs und weit gekommen. Zweimal hatten sie das offene Schlangenmeer überquert, ohne Sturm, ohne Mastbruch, ohne auch nur einen einzigen Mann zu verlieren. Die Bäuche seiner Schiffe waren schwer vom Weizen aus Cautwa, dem gro ßen Hafen des Silberlandes. Die Krieger, die sie angeworben hatten, waren begierig auf den Kampf und, wie sie nun bewiesen, geschickt mit Messer und Schwert. Waren sie erst einmal im sicheren Hafen, würde man ihn wie einen Helden feiern. Aber noch war es ein weiter Weg. Ohne Verluste würde er nicht davonkommen, das wusste er. Die Serkesch hatten zwar keine hölzernen Schiffe, und ihre armseligen, schlecht gebauten Schilfboote waren ihnen unter dem Hintern verfault, aber sie hatten Bögen und Brandpfeile und konnten ihnen auch vom Ufer aus schwer zusetzen. Mehitu nagte an seiner Unterlippe. Saran, der Kahir der Hattu, hatte angeboten, nach dem Kappen der Seilsperren mit einem Teil seiner Männer das Lager des Feindes anzugreifen und Verwirrung zu stiften, aber Mehitu hatte das Angebot abgelehnt. So ein Angriff auf die Übermacht mochte ihnen helfen, aber für die Hattu wäre es glatter Selbstmord. Sapi ließ wieder einen leisen Pfiff hören. Ein Baumstamm kam den Fluss hinunter. Zwei Männer saßen darauf. Mehitu kniff die Augen zusammen. Im Wasser spiegelte sich das Abendrot, und der Stamm mit den beiden Männern steckte wie ein schwarzer Dorn in diesem friedlichen Bild. Als sie näher kamen, erkannte er die beiden als Hattu. Sie lenkten den Stamm geschickt mit den bloßen Händen an die Garbe heran. Sapi warf ihnen ein Seil zu.
»Was gibt es, Krieger der Hattu?«, rief Mehitu sie leise an.
»Die Serkesch sind Narren«, erwiderte der Erste. »Sie schlafen und hatten nur wenige Wachen am Fluss. Und jetzt gar keine mehr. Wir haben drei Seilsperren gefunden und durchtrennt. Der Fluss ist also frei. Saran, unser Kahir, schlägt vor, dass ihr uns oberhalb des Lagers an Bord nehmt. Sollte der Feind doch noch erwachen, werden wir ihn aufhalten.«
»Die Hattu sind unvergleichlich tapfer und geschickt. Übermittelt dem Kahir meinen Dank und meine Bewunderung.«
»Wir sind Krieger«, rief der Hattu und stieß den Baumstamm vom Schiff ab.
»Was sollte denn das jetzt heißen?«, fragte Sapi, als sie außer Hörweite waren.
Mehitu zuckte mit den Achseln. »Wahrscheinlich, dass sie unseren Dank nicht brauchen.«
»Sie kriegen ja auch genug Silber«, brummte Sapi.
»Nur wenn Uo, der Gott des Todes, sie nicht vor Ende dieses Krieges abberuft. Und gerade wagen sie ihr Leben für das deine, Mann«, wies ihn Mehitu zurecht. »Achte lieber auf den Strom. Das geht mir alles zu glatt.«
»Ich gehorche«, antwortete Sapi verdrossen.
Mehitu schickte ein stummes Gebet zu den Hütern. Sie konnten es schaffen, wenn Fahs ihnen den Südwind ließ, wenn die Hattu wirklich alle Sperren gekappt hatten und wenn die Serkesch nicht doch erwachten. Es gab da noch etwas, das nicht geschehen durfte, aber den Gedanken daran verschloss er tief in seinem Inneren. Es verging das Sechstel einer Stunde. Dann noch ein Sechstel. Er konnte Brandgeruch von Lagerfeuern riechen. Sie waren jetzt ganz nah an dem besetzten Dorf. Quälend langsam schoben sich die Schiffe über den Strom. Unter Deck ächzten die Ruderer. Die Dämmerung war endgültig der Dunkelheit gewichen. Am Ufer loderten die verwaisten Wachfeuer der Serkesch. Blieben sie wirklich unbemerkt? Dann konnten sie das Wunder vollbringen. Mehitu spuckte wieder über die Schulter ins Wasser. Er wollte es nicht beschreien. Das Glück war launisch. Dreißig stolze Schiffe hatten noch vor einem Jahr im Hafen von Ulbai gelegen. Und wo waren sie jetzt? Sie waren auf dem Schlangenmeer Stürmen zum Opfer gefallen oder waren im Dhanis auf Grund gelaufen, weil die Schiffsführer aus Angst zu dicht unter dem Ufer gesegelt waren. Allein fünf weitere hatten die Serkesch mit Brandpfeilen angesteckt. Vor einem halben Jahr war Mehitu nur ein einfacher Elepu gewesen, der Schiffsführer der Garbe. Bel Elepai war er nur geworden, weil die älteren Schiffsführer alle tot - gefallen oder ertrunken - waren. Er hatte sie sterben sehen. Jedenfalls die meisten. Auf jeder Reise seit Beginn des Krieges war er dabei gewesen. Das Glück war ihm bislang treu geblieben, aber noch keine Flotte war mit allen Schiffen zurückgekehrt. Er versuchte, diesen düsteren Gedanken abzuschütteln, und starrte ans Ufer. Das Fenn war zu nächtlichem Leben erwacht. Frösche und Unken, Zikaden und Nachtvögel ließen ihre Rufe hören. Kein Zeichen deutete darauf hin, dass dort am Ufer ein lautloser, aber mörderischer Kampf ausgefochten wurde. Einmal glaubte er, im Licht eines Wachfeuers ein paar halbnackte Gestalten durch das Schilf huschen zu sehen, aber sicher war er sich nicht. Die Schiffe glitten langsam weiter stromaufwärts. Mehitu trat neben Sapi an den Bug und suchte das nachtschwarze Wasser ab. Es gurgelte leise und mit weißen Schaumkronen unter dem breiten Rumpf des Schiffes dahin. Wenn die Hattu eine Seilsperre übersehen hatten, war es aus. Dann würde es zum Kampf kommen. Die Ruder knarrten, und das Segel bauschte sich im Wind. Nichts geschah. Langsam schoben sich die Schiffe weiter den Strom hinauf. Das Lager der Serkesch musste nun schon hinter ihnen liegen. Mehitu hatte vor ihrem Aufbruch im Schirqu ein reichhaltiges Opfer gebracht. Für Alwa, die Hüterin der Ströme und Meere, und für Dhanis, den Gott dieses Stromes. Und in Cautwa hatte er den Hütern noch einmal geopfert. Sollte er die Götter wirklich zufrieden gestellt haben? Mehitu spuckte noch einmal aus. Sie waren noch nicht im Hafen. Sie konnten auf Grund laufen. Dhanis liebte es, die Schiffsführer mit seinen wandernden Sandbänken zu prüfen. Von einer Sekunde auf die nächste konnte ihre Reise zu Ende sein. Mehitu schüttelte den Kopf. Sie würden sicher nicht auf Grund laufen. Sandbänke lauerten in Ufernähe, aber er hielt die Flotte in der Mitte des Flusses. Der Strom glitt ruhig dahin. Mehitu fühlte eine starke innere Unruhe aufkommen. Irgendetwas würde geschehen. Irgendetwas musste einfach geschehen. Vielleicht doch eine Sandbank? Oder ein plötzlicher Mastbruch? Irgendwas! Die Serkesch würden erwachen, sie angreifen. Warum war es da am Ufer nur so still? So viel Glück konnte es gar nicht geben. Je länger es anhielt, desto unruhiger wurde er. Schließlich wünschte er sich beinahe einen Kampf, denn alles war besser, als Ihr zu begegnen. Mehitu atmete tief durch. Bis jetzt hatte Sie immer Blutzoll gefordert. Der Bel Elepai blickte zurück. Schemenhaft zeichneten sich die geblähten Segel in der Dunkelheit ab. Eines dieser Schiffe würde Sie sich holen, das war beinahe sicher. Und es gab nichts, was er tun konnte, um es zu verhindern. Im Schilf regte sich etwas. Mehitu starrte hinüber. Viele Schatten lösten sich vom schwarzen Ufer. Die Hattu kehrten zurück, an Baumstämme geklammert. Tief beeindruckt sah Mehitu sie näher kommen. Offenbar kannten sie keine Furcht. Kein Akkesch, Awier oder Kydhier wäre auch nur auf den Gedanken gekommen, den Fluss schwimmend zu durchqueren. Schon allein wegen der Flussechsen. Gab es etwa keine Raubtiere in der Heimat dieser Männer, dem Silberland? Mehitu blickte angestrengt ins Wasser. Da waren keine Echsen. Nur die Köpfe der Schwimmer, die in großer Stille den Schiffen zustrebten. Es war ruhig. Die Unken und die Vögel waren verstummt. Ihm lief ein kalter Schauer über den Rücken. Diese Ruhe war ein schlechtes Zeichen. Er spürte unter seinen Fü ßen ein leichtes Zittern, das durch den Rumpf der Garbe lief. Ihr Kiel scheuerte über ein Hindernis.
»Eine Sandbank?«, fragte Sapi tonlos.
Mehitu nickte schwach. Natürlich, nur eine Sandbank. Dhanis spielte mit ihnen. Dann lief ein Ruck durch das Schiff. Unter Deck fluchten die Ruderer. Waren sie auf Grund gelaufen, hier, mitten im Fluss? Mehitu starrte mit weit aufgerissenen Augen hinab ins Wasser. Tatsächlich. Da war etwas. Dunkler noch als der nächtliche Fluss. Es war groß. Ein Felsen. Mehitu klammerte sich an diesen Gedanken. Aber eine zweite Stimme in ihm lachte ihn verbittert aus. Ein Felsen? Hier? Wie hätten sie den übersehen können, in all den Jahren, die sie den Dhanis schon befuhren? Holz zersplitterte unter den Füßen des verzweifelten Bel Elepai. Der Felsen bewegte sich.
Erster Tag
Bet Schefir
Ich gründete viele Städte und errichtete viele Häuser. Das Haus derSchrift ist nicht das geringste unter ihnen.
Staub wogte auf und verteilte sich im Kerzenschimmer. Jemand nieste.
»Das war die Arbeit vieler Männer«, sagte eine Stimme. Es war schwer zu unterscheiden, ob sie eher entsetzt oder schicksalsergeben klang.
»Es tut mir leid«, antwortete Maru.
»Nicht, dass jemand auch nur ein Stück Kupfer dafür gäbe«, seufzte Temu. Er bückte sich und begann, die über den Boden verteilten Tonscherben einzusammeln.
Maru wollte ihm helfen, aber er hielt sie mit einer Armbewegung davon ab. »Lass nur, Mädchen, lass nur. Du machst es nur noch schlimmer. Und es ist schlimm genug.«
Maru stellte den Korb wieder ab, der ihr eben in der Hand zerrissen war. Es war doch nicht ihre Schuld, dass das Geflecht mürbe geworden war. Sie hatte ja keine Ahnung, wie lange er schon an seinem Platz gestanden hatte. Sie seufzte und betrachtete den schmalen Körper des Schreibers, der zwischen den zum Bersten gefüllten Regalen kniete und Tonstückchen aufsammelte. Er aß zu wenig, auch wenn sie sich alle Mühe gab, das zu ändern.
»Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, Temu, sind dies die Tafeln, die du ohnehin fortschaffen wolltest.«
»Wolltest? Wolltest?« Temu kniete auf dem Boden und sah sie an. Selbst im unsteten Licht der Kerzen sah sie das wütende Funkeln seiner Augen. »Von Wollen kann hier doch keine Rede sein. Sieh dich um! Das Bet Schefir ist zu klein. Und so ist es schon lange. Wie oft habe ich den ehrenwerten Verwalter Gadhyran schon angefleht, diese Hallen endlich zu erweitern! Doch ist dafür auch nur ein Segel Silber da? Nein!«
Maru hätte die letzten Sätze mitsprechen können, so oft hatte sie sie in den vergangenen Wochen schon gehört. Sie kannte auch die nächsten Worte des Schreibers, und sie wusste, dass es nichts fruchtete, ihn zu unterbrechen.
»Für die Tempel haben sie Silber und für ihren albernen Krieg, für den erst recht! Nur für das Bet Schefir nicht. Es ist ja auch nur die Heimat allen Wissens der Akkesch! Seit vielen Monden liege ich dem Verwalter in den Ohren, sage, wir brauchen mehr Platz. Und was antwortet er mir? Was sagt er mir ins Gesicht, dieser kydhische Narr? Ich solle doch einfach die alten Listen fortwerfen. Fortwerfen! Wissen vernichten! Was weise Männer sorgfältig aufgeschrieben haben in alter Zeit, in Ton gedrückt, weil es wichtig war. Und was im Alten Akkesch wichtig war, kann doch im Neuen nicht plötzlich unwichtig sein!«
»Du meinst die Erntelisten, die du in diesem Korb gesammelt hast?«
»Hattest, muss es heißen, hattest! Denn durch deine Ungeschicklichkeit sind sie nun über den Boden verteilt und zerbrochen, und ich werde Tage brauchen, sie wieder zusammenzusetzen.«
»Bevor du sie dann doch fortwirfst?«, fragte Maru sanft. Sie verstand Temu inzwischen ganz gut, und ohne Zweifel hatte er recht, was das Bet Schefir anging. Es platzte aus allen Nähten. Die Körbe mit den Schrifttafeln füllten die Regale bis an die Decke und zwischen den hölzernen Gestellen waren die engen Gänge mit weiteren Weidenkörben zugestellt. Sie verstand aber auch, dass die Verwalter von Ulbai zurzeit andere Sorgen hatten.
Temu stand auf und hielt Maru ein Tontäfelchen vor die Nase. »Schau, Mädchen, siehst du das?«
Maru hatte in den vergangenen Wochen viel Zeit mit Temu verbracht. Mit einem Lächeln erinnerte sie sich daran, wie schroff und abweisend der Schreiber am Anfang gewesen war. Ein Mädchen aus der Fremde, das weder lesen noch schreiben konnte? Ein undenkbares Ding zwischen all den kostbaren Schrifttafeln, von denen jede einzelne Temu heilig zu sein schien. Aber Maru war beharrlich, neugierig und nahm Anteil an den Sorgen des Schreibers. Und aus abweisendem Misstrauen war allmählich eine zurückhaltende Freundschaft geworden. Inzwischen konnte Maru einige der Zeichen lesen, die die Akkesch verwendeten. Genauer gesagt etwa drei Dutzend. Die Schrift der Akkesch bestand aber aus deren sechshundert, wenn stimmte, was Temu sagte. Immerhin konnte Maru erkennen, dass es sich bei dem Täfelchen tatsächlich nur um eine Ernteliste handelte. Da waren Zahlzeichen und die Symbole für Gerste und Datteln, die sie wiedererkannte.
Temu räusperte sich: »Hier steht, dass die Stadt Aqit dreihundert Sack Gerste lieferte. So geschehen im Feigenmond des Jahres, in welchem Stadthalter Scherrumschar der Göttin Eperu eine Statue im Tempel errichtete. Und wenn du nur ein wenig über die Listen des Alten Akkesch wüsstest, würdest du jetzt hellhörig werden und fragen, wieso die Stadt Aqit so wenig Getreide lieferte, wo es doch sonst mehr als das Doppelte war. Und du würdest in einer weiteren Liste die Namen der Jahre abgleichen und feststellen, dass dies geschah, nur drei Jahre bevor die Akkesch zu ihrem gro ßen Marsch aufbrachen. Du würdest also erkennen, dass in jenem Jahr der Niedergang schon eingesetzt hatte.«
»Die Akkesch haben ihre Stadt aufgegeben, weil eine andere Stadt dreihundert Sack Gerste geliefert hat?«, fragte Maru mit mildem Spott.
Temu funkelte sie wütend an. Er war ein ernster junger Mann, der Spott nicht verdient hatte, dem aber andererseits ein wenig mehr Heiterkeit nicht geschadet hätte. Er war zu ernst und wirkte viel älter, als er war. Jetzt schüttelte er traurig den Kopf und ließ das Täfelchen fallen. Es zerschellte auf dem steinernen Boden. »Du hast recht, Mädchen. Niemand will noch wissen, was einst geschah«, seufzte er. »Oder wenn, dann reden sie über die Taten der Herren, nicht über Gerste und Korn.«
»Ich könnte dir helfen, hier aufzuräumen«, bot Maru an.
»Ach, lass nur. Es wird bald Tag, und ich glaube, ich sollte doch noch ein wenig schlafen. Aber hier liegt noch so viel Arbeit.« Der Schreiber seufzte und breitete in einer Geste der Verzweiflung die dünnen Arme aus.
Maru schrak auf. Tatsächlich, durch die schmalen Fensterschlitze drangen die ersten Vorboten der Dämmerung in das Bet Schefir.
»Schon so spät?«, rief sie. »Dann muss ich fort, auch wenn ich dich wirklich nicht gern in dem Scherbenhaufen zurücklasse, den ich angerichtet habe.«
»Ach, es war nicht deine Schuld, nicht nur, jedenfalls. Und du kannst nicht lesen. Also wärst du mir ohnehin keine große Hilfe.«
Er meinte das nicht böse, das wusste Maru, ihm fehlte nur manchmal einfach das Gespür dafür, was Menschen als kränkend empfinden konnten. Und er hatte recht, sie konnte nicht lesen, ein Umstand, den sie mehr und mehr verfluchte. Temu war hilfsbereit, das konnte sie nicht anders sagen, aber er war so langsam und so leicht abzulenken. Jede Tontafel, die er in die Hand nahm, erzählte ihm eine Geschichte, die er sofort begeistert weitergeben musste, auch wenn sie niemand hören wollte. Soweit sie das beurteilen konnte, war sie ohnehin die Einzige, die ihm zuhörte. Ja, sie war überhaupt der einzige Mensch, der noch ins Bet Schefir kam. Sie strich den Staub von ihrem Gewand. »Denkst du an das, worum ich dich gebeten habe?«, fragte sie.
Temu sah sie an. Er war mit seinen Gedanken gerade wieder weit fort, vermutlich in der Stadt Aqit und in dem Tempel, in dem ein vergessener Stadthalter der Erntegöttin eine Statue weihte. Er blickte sie zerstreut an, dann nickte er. »Ja, natürlich. Ich habe es nicht vergessen. Aber du weißt nicht zufällig noch eine Jahreszahl, oder einen weiteren Namen? Das würde es mir ein wenig leichter machen.«
»Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß, Temu. Es ist auf dem Großen Marsch geschehen. Es wird doch immer wieder erzählt. Ich habe die Geschichte selbst hier in der Stadt schon mehr als einmal gehört. Und du weißt, dass ich dir keinen Namen sagen kann.« So war es wirklich. Sie konnte nicht über Utukku sprechen, nicht einmal seinen Namen nennen. Der Daimon musste sie mit einem Bann belegt haben. Nur unter großer Mühe war es ihr überhaupt gelungen, dem Schreiber begreiflich zu machen, was sie suchte: Wissen über den Daimon, den der legendäre Etellu-Kaidhan vor über hundert Jahren besiegt und seiner Macht beraubt hatte.
»Ja, der Marsch, natürlich, Etellu der Große, das sagtest du. Aber dort wurde kaum etwas aufgeschrieben. Ich habe das Jahr durch. Keine Listen.«
»Aber alle reden doch darüber.«
»Mündliche Überlieferung«, meinte Temu mit einem Kopfschütteln. »Sehr unzuverlässig. Ich muss jetzt vielleicht alle Berichte Etellus durchgehen. Ein bewundernswerter Mann. Wortreich und zeichenmächtig. Er hat viel hinterlassen.«
Maru seufzte. Genau das war die Schwierigkeit. Dieses Bet Schefir drohte an Ernte-, Geburts- und Sterbelisten zu ersticken. Nur die wirklich wichtigen Sachen, die waren nicht zu finden. »Er hat einen Daimon gebannt«, sagte sie, wie schon so oft. »Gibt es denn keine Liste über Etellus Heldentaten? Dort müsste doch so etwas verzeichnet sein.«
»Oh, seine Heldentaten sind zahlreich. Und natürlich gibt es Listen, lange Listen, denn er war ein großer Herrscher, der erste Kaidhan in Ulbai. Aber was diesen Daimon betrifft, da ist er seltsam ungenau. Mehr als diese zwei oder drei Sätze habe ich nicht gefunden.«
Maru starrte den Schreiber an. »Welche Sätze?«
»Habe ich das nicht erwähnt? Ich habe die Tafel doch eigens für dich zur Seite gelegt. Wo ist sie nur?«
Temu schlurfte durch den Gang zu einem Tisch, der sich unter der Last vieler Tontafeln bog. Das war sein bevorzugter Arbeitsplatz, und er stand im hintersten Winkel des großen Saals. Maru folgte ihm ungeduldig durch die mit Körben zugestellten Regalreihen. Draußen wurde es hell, sie musste sich beeilen. Aber es war sinnlos, Temu zu drängen. Er erreichte endlich den Tisch und begann murmelnd Tafeln hin und her zu schieben. Die eine oder andere nahm er in die Hand und prüfte sie.
»Ah, sieh nur, im ersten Jahr der Herrschaft von Namad-Etellu haben die Fischer im Schwarzen Dhanis mehr gefangen als je zuvor. Ein Glück verheißendes Zeichen.«
»Temu!«, mahnte sie.
Er warf ihr einen tadelnden Blick zu, offensichtlich enttäuscht über ihren Mangel an Begeisterung, und legte die Tafel zur Seite. Dann hob er eine andere auf. »Ah, hier ist es. Etellus Bericht vom Langen Marsch der Akkesch. Dritte Tafel. Soll ich es vorlesen? Gut. Hier steht: ›Im Gebirge Imuledh sprach Etellu mit den Zauberern der Imricier. Er versprach ihnen edles Erz für ihre Hilfe, und gemeinsam webten sie einen Bannfluch, der das Böse fortan von ihnen fernhielt. Die Imricier verlangten nun Gold für ihre Hilfe, Etellu aber gab ihnen Silber, denn etwas anderes hatte er nicht versprochen.‹« Temu senkte die Tafel und sah sie erwartungsvoll an.
»Das ist alles?«, fragte Maru enttäuscht.
»Ja, Etellu ist hier sehr bescheiden. Geradezu seltsam bescheiden, wenn man den Rest seiner Berichte kennt. Aber du kennst sie ja nicht. Hier zum Beispiel, da schildert er eine Schlacht im Silberland, wo er selbst …«
»Temu!«, unterbrach ihn Maru. »Wenn ich Zeit hätte, würde ich dir stundenlang zuhören, doch der Tag bricht an, und mein Onkel erwartet mich. Versuch doch bitte, mehr über diesen Bannfluch herauszufinden, wenn du die Zeit aufbringen kannst.«
»Wenn es dir so wichtig ist, natürlich, doch verstehe ich nicht …«
»Ich werde es dir gerne noch einmal erklären, doch nicht jetzt. Ich muss fort.«
Als Maru durch die Tür trat, holte sie erst einmal tief Luft. Sie mochte den Schreiber, aber er trieb sie manchmal auch zur Verzweiflung. Sie wollte gar nicht wissen, wie lange er die Tafel schon auf seinem Tisch liegen hatte. Die ganze Nacht hatte sie ihm geholfen, Listen zu ordnen, und sich geduldig alles Mögliche vorlesen lassen. Aber diese eine Tafel, auf die es ihr ankam, die hatte er einfach vergessen. Sie seufzte. Im Grunde genommen hatten diese kargen Sätze ihr nur bestätigt, was sie schon wusste. In jeder Kaschemme erzählte man sich diese Geschichte, mal in einer längeren, mal in einer kürzeren Fassung. Und immer war Etellu ein strahlender Held - mit Zaubermacht, von der die armseligen Berg-Maghai nur träumen konnten. Und wenn Maru nachfragte, warum er sie denn dann überhaupt um Hilfe gebeten habe, hatte sie bestenfalls finstere Blicke zur Antwort erhalten. Etellu war der Erste Kaidhan, der größte Herrscher, der je auf Erden gewandelt war. Das musste als Antwort genügen. Und kein dahergelaufenes Mädchen aus der Fremde hatte das Recht, seine Heldentaten zu hinterfragen. Maru hatte es inzwischen aufgegeben, denn ganz offensichtlich wussten diese Erzähler einfach nicht mehr über die Sache. Sie atmete noch einmal tief durch. Es war angenehm kühl. Ob es sinnvoll wäre, noch einmal zurückzugehen und Temu an ihre zweite Bitte zu erinnern? Sie bezweifelte es. Er schien schon mit einer Aufgabe überfordert. Und sie hatte auch keine Zeit mehr, der Morgen graute. Sie musste laufen. Das Bet Schefir lag im nördlichen Viertel der Oberstadt von Ulbai, inmitten vieler prachtvoller Wohnhäuser. Hier wohnten die Großen der Stadt, die nicht im Bet Kaidhan oder einem der Tempel zu Hause waren. Hohe Verwalter, reiche Großpächter, mächtige Kaufleute. Es war ein ruhiges Viertel, vor allem jetzt, in der Stunde der Morgenstille. Türen und Fenster waren verschlossen, manche für die Nacht, manche dauerhaft, weil ihre Besitzer tot oder geflohen waren. Maru entdeckte an einer der Türen ein Stück schwarzen Stoffs. Sie schauderte und rannte weiter. Es war nicht weit bis zum nächsten Turm der oberen Mauer. Er wurde Der Großvater genannt, weil er der älteste Turm der Stadt war, angeblich noch von den Dhaniern errichtet. In friedlicheren Tagen sollte er den Verliebten der Stadt als heimlicher Treffpunkt gedient haben. Maru erreichte ihn und hastete die steinerne Treppe empor. Sein Alter und seine Geschichte waren ihr gleich. Er war nicht besetzt, das war das Entscheidende. Die Kydhier und später die Akkesch hatten die Oberstadt ausgebaut und die Mauer nach außen verschoben, so dass der Großvater jetzt an einer weit zurückspringenden Ecke der Mauer stand und nicht mehr sehr gut geeignet war, die Stadt und das Land zu überwachen. Für ihre Zwecke jedoch gab es keinen besseren Ort. Völlig außer Atem erreichte sie die obere Plattform. Eine Krähe flog mit missmutigem Krächzen auf. Maru blickte ihr hinterher. Es war der erste Vogel, den sie seit Tagen in der Stadt sah. Krähen galten in Ulbai inzwischen als Leckerbissen. Auf anderen Türmen sah sie Wachfeuer brennen, und zu ihren Füßen erwartete die Unterstadt den neuen Tag. Jenseits der äußeren Stadtmauer lag das weite, flache Land im Morgendunst. Die Aussicht beeindruckte sie jedes Mal aufs Neue. Da war die Oberstadt mit ihren Steinhäusern, dem mächtigen Bet Kaidhan und dem Schirqu, dem hoch aufragenden Stufentempel der Hüter. Maru war, als würden sich ganz oben, auf dem Dach der obersten Plattform, einige schwarze Punkte bewegen. Sie hatte gehört, dass der Sterndeuter des Kaidhans von dort aus den Lauf der Gestirne beobachtete. Ein schwieriges und verantwortungsvolles Amt, denn seine Voraussagen hatten, wie man sagte, einiges an Gewicht bei Luban, dem Kaidhan des Reiches. Aber jetzt waren die letzten Sterne verblasst, und wenn Maru richtig sah, begannen die Punkte auch gerade den Abstieg über die lange Treppe. Sie blickte nach Westen. Unterhalb der Oberen Mauer begann das Gewirr der engen Gassen der Unterstadt, in denen sich weiße Lehmhütten aneinanderdrängten. Die Ulbaitai nannten diese Hälfte der Unterstadt die Weiße Seite, denn sie zog sich den Hügel hinab bis fast zum Weißen Dhanis. Es war die ruhigere Hälfte der Stadt. Dort wohnten niedere Verwalter, Schreiber und kleine Händler, die nicht bedeutend genug waren, um in der Oberstadt unterzukommen, aber zu wohlhabend, um noch auf der lebhafteren Schwarzen Seite mit ihrem Hafen und den geschäftigen Handwerkergassen leben zu müssen. Jenseits der äußeren Mauer folgte ein schmaler Gürtel von Feldern. Die niedergebrannten Hütten der Bauern und Fischer dort erinnerten Maru daran, dass Krieg herrschte und dass das Leben außerhalb der schützenden Mauern gefährlich war. Der Weiße Dhanis strömte ungerührt durch das stille Land. Jenseits davon begann das Wolfsfenn, jenes Sumpfgebiet, das sich ungezählte Tage weit nach Westen erstreckte, ein endloses Gewirr von Wasserwäldern, Schilfinseln, Moorlöchern und Teichen. Maru konnte den Rauch sehen, der, ein gutes Stück südlich, vom Lager der Serkesch aufstieg. Es lag beinahe außer Sichtweite, denn gegenüber der Stadt bot das Fenn kaum festes Land, jedenfalls nicht genug, um mehr als zwei Zelte nebeneinander aufzustellen. Sie rieb sich die Augen. Die ganze Nacht war sie auf gewesen und hatte den Staub des Bet Schefir geschluckt. Und in den vier Nächten zuvor war es ebenso gegangen. Dicht unterhalb der Stadt zweigte ein kurzer und breiter Arm des Flusses nach Westen ab. Dort vermählte sich der Weiße mit dem Schwarzen Dhanis. Die Ulbaitai nannten dieses kurze Stück Strom mit ihrem nüchternen Sinn für das Naheliegende den Grauen Dhanis. Kein Fischerboot war zu sehen. Maru starrte nach Westen, hinaus ins Wolfsfenn, und suchte nach einer bestimmten kleinen Gruppe von Weiden. Da standen sie zwischen einigen schütteren Wasserwäldchen und ließen die Äste im Morgendunst hängen. Wenn geschah, worauf sie nun seit vier Nächten wartete, dann geschah es genau dort. Maru blickte nach Osten. Der Himmel verfärbte sich bereits und teilte sich in blassblaue und zartrosafarbene Streifen. Edhil war bereit, den Himmel zu betreten. Vom Norden tönte der leise Ruf eines Horns. Maru spähte hinüber. Ein brennender Pfeil stieg von der Mauer in die Luft. Vielleicht war dem Posten dort etwas aufgefallen, irgendein Ereignis im kleinen Lager, das die Serkesch auf den Hügeln jenseits des Kanals errichtet hatten. Etwas, das die Aufmerksamkeit der anderen Wachen verdiente. Sie beobachtete den Flug des rauchenden Pfeils, bis er aus ihrem Gesichtsfeld entschwunden war. Ulbai, die Hauptstadt des Akkesch-Reiches, lag auf dem südlichsten Ausläufer einer lang gezogenen Hügelkette, den Hlain Ulbas. Maru hatte sofort verstanden, warum die Dhanier einst diesen Ort für ihre Stadt gewählt hatten. Die Hügel boten fruchtbares und flutsicheres Land, und Dhanis beschützte sie auf beiden Seiten mit seinen starken Armen. Im Süden berührten sich die beiden Hauptarme des Flusses sogar, bevor sie, jeder für sich, dem Schlangenmeer zustrebten. Als die Akkesch vor nun schon über hundert Jahren die Stadt eingenommen hatten, hatten sie sich als Erstes darangemacht, sie weiter zu sichern. Sie hatten einen breiten Kanal durch die Hügel gegraben, dicht unter der nördlichen Mauer. Ein gewaltiges Unterfangen, aber es hatte sich ausgezahlt. Fortan war die Stadt auf allen vier Seiten von Wasser umgeben. Maru glaubte den Ulbaitai, die sagten, dass die Stadt uneinnehmbar sei. Numur und seine Serkesch waren angetreten, das Gegenteil zu beweisen, aber bislang ohne Erfolg, wie alle ihre Vorgänger. Das Horn erklang nicht wieder, und es stieg auch kein weiterer Pfeil auf, also hatte sich die Lage offenbar wieder beruhigt. Maru gähnte und wandte sich wieder ihrer eigentlichen Aufgabe zu. Da - ein Licht blinkte aus dem Wolfsfenn herüber. Zwischen den Weiden, genau dort, wo es sein sollte, flammte es auf, verlosch wieder und blinkte erneut herüber. Maru war sich ziemlich sicher, dass dieser kleine Lichtpunkt von keinem der anderen Türme zu sehen war. Tasil hatte den Punkt damals mit viel Bedacht ausgewählt. Sie eilte hinab auf die nächste Plattform im Inneren des Turmes. Hinter einem Haufen von Wurfsteinen, aufgeschichtet für den Fall, dass es dem Feind doch gelänge, die äußere Mauer zu überwinden, war eine Fackel verborgen. Als sie das Holz hervorzog, flogen Fliegen und Stechmücken auf, die einzigen Tiere, von denen es in der Stadt noch reichlich gab. Sie spähte nach links und nach rechts. Zum Glück war die innere Mauer nur schwach bewacht. Sie entzündete die Fackel und hielt sie dicht an die schmale Schießscharte, zog sie zurück, hielt sie wieder an die Öffnung und wiederholte diesen Vorgang noch zweimal. Dann löschte sie die Flamme wieder und spähte hinaus. Zweimal flackerte es kurz unter den fernen Weiden auf. Die Botschaft war angekommen.
Maru lief durch die kühlen Gassen. Ulbai erwachte nur widerstrebend zu neuem Leben. In der Unterstadt war sicher schon mehr Betrieb, aber hier oben blieb es noch still. Es war, als scheuten sich die Bewohner davor, aufzuwachen. Die Nacht mochte Träume unterschiedlichster Art bringen, angenehme und düstere, der helle Tag aber hatte den Menschen wenig außer Hunger und Verzweiflung zu bieten. Maru hörte das schwere Rumpeln eines Karrens. Sie beeilte sich. Sie wollte unbedingt vor dem Gefährt am Bet Kaidhan sein. Auf der Hauptstraße holte sie es ein. Es war ein Ochsenkarren, doch wurde er von einem Mann gezogen - lebende Ochsen gab es in Ulbai schon seit vielen Wochen nicht mehr. Der Mann war groß und breitschultrig und seine Arme muskelbepackt. Er trug einen grauen Umhang, den er tief ins Gesicht gezogen hatte. Er sah nicht nach rechts und nach links und hielt auch nicht an, obwohl Maru an mindestens zwei Türen das schwarze Zeichen des Verhängnisses angeschlagen sah. Der Karrenschieber ächzte unter seiner Last, und die schweren Scheibenräder knarrten auf der Achse. Ein dickes Wolltuch war über die Ladefläche gezogen und verdeckte den Inhalt fast vollständig. Sie überholte den Wagen und sah Füße, die unter dem Tuch herausragten. Sie achtete auf Abstand und drehte sich nicht um. Es war zwar kein Mensch auf der Straße, aber Tasil hatte ihr eingeschärft, jederzeit auf der Hut zu sein. Niemand drehte sich nach einem Leichenkarren um, also sollte sie das auch nicht tun. Sie lief weiter, über den gro ßen Edhil-Platz, durch das Tempeltor und dann die Stufen zum Haus des Herrschers, dem Bet Kaidhan, entlang. Es war nicht ein Haus, es waren viele, in der Mitte ein mächtiger, steinerner Block, umgeben von vielen Anbauten, Höfen, Säulengängen, Sälen und Kammern, eigenen Tempeln, Ställen, Werkhallen und Lagern. Maru folgte einem gepflasterten Weg, der durch die breiten Stufen schnitt und sie über einen kleinen Hof zu einem unscheinbaren Anbau führte. Dort an der Tür stand Tasil. Er schien auf sie zu warten.
»Na endlich, Kröte. Hast du Gybad gesehen?«, begrüßte er sie.
»Guten Morgen, Onkel«, antwortete sie verdrossen. »Du kannst ihn doch schon hören. Er wird gleich hier sein.« Tatsächlich war das Rumpeln des schweren Karrens unüberhörbar.
»So empfindlich?«, erwiderte Tasil mit einem Grinsen. »Mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden?«
Maru zögerte. Sie hielt es für besser, ihm nicht zu sagen, wo sie die Nacht verbracht hatte. Aus dem Bet Kaidhan drangen leise Geräusche. Die Herren mochten noch schlafen, aber die Diener und Sklaven hatten schon zu tun. Schließlich sagte sie: »Ich war auf dem Turm, wie du sicher weißt, Onkel. Und ich kann dir sagen, dass deine Freunde heute endlich das Zeichen geschickt haben.«
»Ah, sie sind zurück. Das wurde auch Zeit. Sie haben uns dieses Mal lange warten lassen.«
Das Rumpeln wurde lauter. Der Leichenkarren erschien und wurde über den Hof geschoben. Hinter einer Säule kam er zum Stehen. Der Mann, der ihn geschoben hatte, blickte sich kurz um. Außer Tasil und Maru war niemand in dem verschwiegenen kleinen Vorhof zu sehen. Er klopfte zweimal auf die Deichsel. Das Tuch wurde zurückgeschlagen, und zwei Männer sprangen von der Ladefläche. Der größere der beiden streckte sich und schlenderte dann hinüber zu Maru und Tasil, während der kleinere zusammen mit dem Karrenschieber begann, schwere Säcke abzuladen und hinter der Säule aufzustapeln.
»Ich grüße dich, Hardis«, sagte Tasil.
Hardis gähnte und verscheuchte eine Fliege. »Wenn die Fieberkranken wüssten, wie hart diese Wagen sind, würden sie sich das mit dem Sterben noch einmal überlegen. Ich grüße euch.«
»Sind das die letzten Säcke mit Gerste?«, wollte Tasil wissen.
»Gerste und drei Ballen bester iaunischer Wolle. Es ist beinahe der Rest. Morgen werden wir noch einen halben Karren voll bekommen. Wir haben noch etwas Gerste und zwei Fässer mit Brotbier, aber dann ist Schluss. Es wird Zeit, dass unsere Freunde wiederkommen.«
»Da habe ich gute Nachrichten für dich. Heute Morgen kam das Zeichen.«
Hardis reckte die langen Glieder und gähnte noch einmal. »Ausgezeichnet. Die Stadt hat großen Durst, und ich hatte schon Sorge, unsere Quelle würde versiegen.« Er senkte seine Stimme: »Außerdem sind mir im Hafen gewisse Gerüchte zu Ohren gekommen. Da sollen heimlich Boten gekommen sein. Es heißt, die Flotte würde bald aus dem Silberland zurückkehren.«
»Das möge Fahs verhindern«, erwiderte Tasil mit einem Stirnrunzeln.
»Ja, es wäre der Todesstoß für unsere Geschäfte. Fahs könnte übrigens bei Gelegenheit auch deinen Mann daran erinnern, dass es Gerste und Bier nicht umsonst gibt. Er ist mit seinen Zahlungen in Rückstand.«
»Wenn du erlaubst, werde ich Fahs diese Aufgabe abnehmen. Aber ich mache mir keine Sorgen. Der Verwalter hat uns viel zu verdanken. Und er hat Angst vor uns.«
»Zu Recht«, meinte Hardis mit einem Grinsen.
Seine beiden Gehilfen hatten inzwischen Gerste und Wolle abgeladen. Der kleinere von beiden stieß einen leisen Pfiff aus, während der Große mit hängenden Schultern zur Deichsel trottete und sie aufhob.
Hardis gab ihnen einen kurzen Wink. »Wir werden also das Boot für heute Nacht vorbereiten.«
»Wir werden da sein«, versicherte Tasil.
Hardis schlenderte zurück zum Wagen, sprang auf die Ladefläche und machte sich lang. Dann deckte er sich und den Schmächtigen mit dem Tuch zu. Der Große zog es zurecht, bis wieder nur die nackten Füße der beiden Männer hervorsahen. Dann packte er die Deichsel und schob den Karren davon.
Maru sah ihnen nach. »Dass nie jemand auf die Idee kommt, den Wagen zu überprüfen?«, wunderte sie sich.
»Es ist, wie ich dir gesagt habe, Kröte. Wenn du etwas verstecken willst, dann am besten vor aller Augen. Niemand will einem Fiebertoten zu nahe kommen. Wenn es uns nicht schon den einen oder anderen Käufer gekostet hätte, würde ich sagen, dieses Sumpffieber ist beinahe ein Segen.«
Kaum war der Wagen verschwunden, als sich eine Seitentür der Lagerhalle öffnete und einige Sklaven heraushuschten. Sie luden sich die schweren Säcke und Ballen auf und schleppten sie hinein. Maru sah ihnen an, dass sie nicht genug zu essen bekamen. Sie wankten unter ihren Lasten und gingen langsam. Das Herrscherhaus war groß und ihr Weg bis zu den Küchen weit. Tasil reckte den Hals, doch denjenigen, auf den er wartete, sah er nicht. Die Tür schloss sich wieder. Tasil runzelte die Stirn. »Komm, Kröte, diese neue Sitte, Waren zu nehmen, aber nicht zu bezahlen, gefällt mir nicht.«
Maru folgte ihm. Die Tür war weder verriegelt noch bewacht, und sie konnten ohne weiteres eintreten. Das Lager war ein hoher, schmuckloser Raum, der Platz für viele Säcke, Ballen und Fässer bot. Durch einige wenige schmale Schlitze unter der Decke drangen die ersten Strahlen der Morgensonne ein und tauchten die Halle in Dämmerlicht. Sie war beinahe leer. Unbenutzte Holzgestelle lehnten an den Wänden, und Staub war das Einzige, das die großen Lagerflächen bedeckte. Am gegenüberliegenden Ende des Raumes stand ein Tisch, auf dem eine einzelne Öllampe gegen das morgendliche Zwielicht ankämpfte. Ein Mann saß dort hinter einer Anzahl von Bleigewichten, wie sie zum Abwiegen der Ware verwendet wurden, und war offenbar damit beschäftigt, einige Zeichen in weiche Tontafeln zu drücken. Er schien die beiden Eindringlinge nicht zu beachten. Tasil räusperte sich.
»Es ist Fremden nicht gestattet, die Warenlager des Kaidhans zu betreten«, sagte der Mann, ohne aufzublicken.
»Verzeih unser Eindringen, hoher Verwalter, aber ich suche einen Mann namens Pirischtu. Soweit ich weiß, untersteht dieses Lager sonst seiner Obhut.«
Der Mann am Tisch blickte endlich auf. »Das mag sein, doch erteile ich keine Auskunft an Fremde, deren Namen ich nicht weiß.« Seine Stimme war von schneidender Kälte.
Tasil zögerte, bevor er mit aalglatter Höflichkeit sagte: »Verzeih mir meine Unhöflichkeit, Herr. Ich bin Tasil aus Urath, und dies ist meine Nichte Maru. Ich habe ein Anliegen, das ich gerne mit Pirischtu erörtern möchte. Darf ich nach deinem Namen fragen, Herr?«
»Mein Name geht dich nichts an. Du darfst aber wissen, dass ich der Vierte Verwalter aller Lager des Kaidhans bin. Ich war einst Vorgesetzter, dann Gleichgestellter, dann Untergebener und nun Nachfolger dessen, den du suchst, aber nicht finden wirst. Pirischtu ist am Sumpffieber erkrankt, und ich bezweifle, dass er sich davon erholen wird.«
Tasil unterdrückte einen Fluch. Mit einem ebenso freundlichen wie falschen Lächeln erklärte er dann: »Ich bedaure sehr, das zu hören, Herr. Wenn du ihn vertrittst, dann ist es wohl geboten, mein Anliegen an dich zu richten, ehrenwerter Verwalter.«
Der Mann sah ihn kalt an. »Ich nehme an, es geht dir um die Bezahlung gewisser Waren, die unter deiner Führung ihren Weg in dieses Lager gefunden haben.«
»Ah, so weißt du von unseren Geschäften?«
»Ja, ich habe von dir gehört, Tasil aus Urath, und von deinen Geschäften mit Pirischtu. Dank dir ist er schnell in der Gunst des Immits aufgestiegen. Bedauerlich, dass ihn dieser Weg nach oben letzten Endes nicht vor dem Fieber retten konnte.«
»Nun, es liegt mir fern, mich zu beklagen, doch die Güter, die deine Sklaven eben so fleißig davongetragen haben, sind derzeit schwer zu beschaffen, wie du wohl wissen wirst. Und ich fürchte, der Strom wird ganz versiegen, wenn er nicht bald wieder aus silberner Quelle gespeist wird.«
»Ich verstehe nur zu gut, was du mir sagen willst, Urather.« Der Verwalter nahm eines der Bleigewichte und schlug damit dreimal langsam auf den Tisch. Das Echo der Schläge hallte durch das leere Lagerhaus, und durch die zwei Türen des Lagers drangen etliche Speerträger ein. Maru sah sich erschrocken um. Jeder Fluchtweg war versperrt. Der Verwalter sah zufrieden aus. »Ich bin froh, dass du zu mir gekommen bist, Urather, denn sonst hätte ich diese Männer aussenden müssen, dich zu suchen.« Er stellte das Gewicht zurück in die Reihe und richtete es mit einer knappen Bewegung genau an seinen Nachbarn aus. Er schien die Ordnung zu lieben. Dann lehnte er sich ein wenig zurück. Um seinen verkniffenen Mund spielte ein Lächeln. Tasils Hand fuhr zum Dolch, und sein Blick flog hektisch von einer Tür zur nächsten, aber ihm war sicher ebenso klar wie Maru, dass sie nicht entkommen konnten. Die Krieger mochten bleich und unterernährt sein, aber es waren einfach zu viele.
»Nun, ehrenwerter Verwalter. Darf ich fragen, was das zu bedeuten hat?«, erkundigte sich Tasil vorsichtig.
»Wir wissen zu schätzen, dass du Waren an unseren Feinden vorbei in unsere Stadt schaffst, doch sind wir betrübt, dass du sie ebenso an unseren Verwaltern vorbeischmuggelst. Und das zu Preisen, die sehr von denen abweichen, die wir festgesetzt haben.«
»Zu den festgesetzten Preisen bekommst du nur, was du hier siehst, Herr«, erwiderte Tasil zornig und deutete auf die leeren Regale.
»Dennoch kann dies nicht länger hingenommen werden«, antwortete der Verwalter kühl.
»So möchte der hochgeborene Kaidhan in Zukunft auf sein Frühstück verzichten? Denn dies wird geschehen, wenn ich nicht weiterhin tun kann, was ich eben tue. Doch dann gib mir nicht die Schuld, Mann.« Tasil seufzte und zuckte schicksalsergeben mit den Schultern. Sein Zorn schien vollständig verflogen zu sein. Er trat in demütiger Haltung näher an den Tisch des Verwalters heran. Beinahe flehentlich fragte er: »Glaubst du, ehrenwerter Verwalter, dass es den Kaidhan sättigt, wenn du dich hier an meinem Unglück weidest?«
Maru kam nicht umhin, ihn zu bewundern. Seine Verzweiflung wirkte echt, aber sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er keineswegs so verzagt war, wie er tat. Ganz im Gegenteil: Sie konnte sehen, dass er sich sammelte, um seine geheime Waffe einzusetzen. Doch dazu musste er den Verwalter berühren.
»Du möchtest mir drohen, Fremder?«, fragte der Mann ungerührt. Die Krieger waren näher gerückt. Maru ließ Tasil nicht aus den Augen. Er stand mit hängenden Schultern am Tisch, blickte niedergeschlagen zu Boden und hob geistesabwesend eines der Gewichte auf. Der Verwalter streckte unwillig seine Hand aus, um es zurückzufordern. »Wirst du wohl das Eigentum des Kaidhans stehen lassen, Urather?«
Und schon kam es zu der kleinen Berührung, die Tasil brauchte. Er drückte dem Verwalter das Gewicht in die Hand. »Selbstverständlich, ehrenwerter Verwalter. Verzeih, ich will doch die Ordnung dieser Halle nicht erschüttern.«
Aber das war nur, was die Krieger hören konnten, denn das, worauf es ankam, geschah jenseits des Hörbaren: Tasil setzte die geheime Stimme ein. Wie ein Sperling umflatterte sie den Geist des Verwalters und sprach davon, dass es doch am einfachsten sei, diese Krieger fortzuschicken, die nichts als Unordnung bedeuteten mit ihren Waffen und dem Schmutz, der an ihren Stiefeln klebte. Maru musste ein Lächeln unterdrücken. Es war geschickt, auf die Ordnungsliebe des Mannes zu zielen. Es war immer leichter, einen Geist mit dem zu verführen, was er hören wollte. Bei den meisten war es Reichtum oder Macht, aber dieser Verwalter hatte offensichtlich andere Bedürfnisse. Er starrte Tasil nachdenklich an, machte aber keine Anstalten, der unhörbar eingeflüsterten Bitte Folge zu leisten.
Tasil war verunsichert. Maru konnte sehen, wie ihm Schweißtropfen über den Nacken rannen. Es kostete ihn jedes Mal viel Kraft, die Stimme einzusetzen. In dieser Kunst übertraf sie ihn längst.
»Wirklich«, sagte Tasil laut, »es besteht keine Notwendigkeit, dass vernünftige Männer sich über eine solche Kleinigkeit streiten oder gar Krieger zur Hilfe rufen.«
Seine zweite Stimme sagte dem Verwalter, dass er in seiner Weisheit doch keiner Bewaffneten bedürfe, er, der doch bald mit seiner - Tasils - Hilfe, zum Dritten oder gar Zweiten Verwalter aufsteigen könne.
Der namenlose Vierte Verwalter runzelte missmutig die Stirn, entzog Tasil seinen Arm und stand auf. »Ich denke, dass du ein gefährlicher Mann bist, Tasil aus Urath. Und ich gestehe, dass ich mich in Gesellschaft dieser tapferen Krieger sicherer fühle, denn ich habe dir zu sagen, dass du verhaftet bist. Nehmt sie fest, Männer, ihn und auch das Mädchen.«
Maru war fast ebenso verblüfft wie Tasil. Der Verwalter war völlig unbeeindruckt. Der Stimmenzauber hatte versagt.
Luban-Etellu
Jeder Herrscher kann einen Krieg beginnen. Doch die wenigsten verstehen es, einen Krieg auch zu beenden.
Sie folgten dem Verwalter unter Bewachung durch etliche Gänge und über viele Innenhöfe. Maru konnte Tasil ansehen, wie beunruhigt er war. Der Stimmenzauber hatte ihn Kraft gekostet und, weit schlimmer noch, war völlig fehlgeschlagen. Er hatte ihr noch im Lagerhaus einen vielsagenden Blick zugeworfen. Verwunderung lag darin und auch eine Bitte, die er nicht laut aussprechen konnte: Er wollte, dass sie ihr Glück versuchen sollte. Aber sie hatte stumm abgelehnt. Dafür gab es gute Gründe. Wika, die Kräuterfrau aus dem Isberfenn, hatte sie eindringlich gewarnt: Jeder Zauber konnte die Aufmerksamkeit der Bruderschaft der Maghai auf sie lenken. Und das musste sie um jeden Preis vermeiden. Zum anderen begriff sie nach der ersten Überraschung schnell, dass auch sie bei dem Verwalter nichts würde ausrichten können. Er war einfach nicht empfänglich für diese Kunst. Ihr war schon früher aufgefallen, dass einige Menschen leichter und andere schwerer zu beeinflussen waren. Tasil behauptete, das läge an der Willensstärke des Betroffenen. Dieser Verwalter war der lebende Gegenbeweis. Nicht an seinem eisernen Willen war Tasils Zauber zerschellt, sondern an seinem Mangel an Vorstellungskraft. Noch nie war Maru einem Geist begegnet, der so vertrocknet war wie der dieses Mannes. Mit Zauberei war da nichts auszurichten. Also folgten sie ihm jetzt, bewacht durch die hohlwangigen Gestalten der Speerträger, die Mühe hatten, Schritt zu halten. Maru versuchte, sich keine Gedanken zu machen. Sollten sie wirklich vor einem Richter landen, nun, dann war immer noch Zeit, die Gabe einzusetzen. Sie liefen lange durch das Bet Kaidhan, aber der Weg führte nicht treppab. Also war wohl nicht der Kerker das Ziel, denn der würde doch sicher in den unteren Stockwerken zu finden sein. Überhaupt war diese Verhaftung eigentümlich. Sie wurden nicht gefesselt, wie es sonst geschah, wenn man Verbrecher vor einen Richter schleifte, ja, Tasil wurde noch nicht einmal aufgefordert, seinen Dolch abzugeben. Das alles war seltsam und rätselhaft. Die Akkesch waren gefürchtet für ihre strengen Gesetze, und in Ulbai waren sie jetzt besonders hart, denn es war Krieg und die Stadt von Feinden belagert. Sie warf einen Seitenblick zu Tasil. Er schien sich von der Anstrengung des Zaubers erholt zu haben. Und auch den Fehlschlag hatte er wohl verdaut. Vermutlich machte er sich seinen eigenen Reim auf die Ereignisse dieses Morgens. Je länger sie durch das Bet Kaidhan liefen, desto gelassener blickte er drein. Sie überquerten noch einen weiteren Hof, als ihnen ein seltsamer Zug begegnete. Es waren sieben Männer, die von einer Eschet Krieger abgeführt wurden. Vier sahen wie Fischer oder Seeleute aus, denn sie waren mit dem kurzen rockartigen Sker gekleidet, den diese Leute zu tragen pflegten, die anderen schienen aus weiter Ferne zu stammen. Sie waren nackt bis auf einen Lendenschurz und einen Schwertgurt, an dem jedoch die Waffe fehlte. Sie sahen erschöpft aus. Maru las noch etwas aus ihren Blicken. Diese Männer mussten Furchtbares erlebt haben. Das Entsetzen stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Sie sah ihnen nach, bis sie verschwunden waren, und prallte auf Tasil, der unvermittelt stehen geblieben war, denn ihr eigener Marsch endete plötzlich vor einer hohen Pforte.
»Wartet hier«, befahl der Verwalter und verschwand im Inneren des Gebäudes.
»Was hat das zu bedeuten, Onkel?«, fragte Maru leise.
Tasil zuckte mit den Achseln und ließ seinen Blick nachdenklich über die Mauern schweifen. »Ich weiß es nicht, Kröte, aber ein Gericht ist das hier jedenfalls nicht.«
Maru folgte seinem Blick und entdeckte Schriftzeichen über dem Eingang. Eines erkannte sie wieder. Sie hatte es gerade vorhin erst gesehen, auf der Tafel über den Bannfluch, die Temu ihr vorgelesen hatte. Es waren zwei lange stehende Linien, gekrönt von drei kurzen. Das Zeichen für Etellu, den ersten Kaidhan des Reiches. Bevor sie Tasil diese Entdeckung zuflüstern konnte, öffnete sich die Pforte, und der Verwalter winkte sie heran. Auf der Schwelle hielt er sie noch einmal auf. »Zeigt Demut, Sterbliche, denn nun tretet ihr unter die Augen Kaidhan Luban-Etellus, Herr des Reiches und Nachkomme von Göttern.«
Maru schluckte. Seit vier Monden war sie nun in der Stadt, aber noch nie hatte sie den Kaidhan gesehen. Sie drängte sich unwillkürlich dichter an Tasil heran. Der lang gestreckte Saal, den sie nun betraten, war von der strengen Schlichtheit, die die Akkesch so liebten. Schmucklose Säulen trugen eine hohe Decke, die an ihrem hinteren Ende zum Himmel geöffnet war. Unwillkürlich dachte Maru an die Regenzeit. Es musste hineinregnen in diesen Saal. Aber das war nur ein kurzer Gedanke, denn Marus Aufmerksamkeit wurde von der steinernen Statue gefesselt, die unter dieser Öffnung thronte. Sie glich keinem Götterbildnis, das sie kannte. Das war weder Brond, der Hüter des Feuers, noch Fahs, der Hüter der Winde, und schon gar nicht der alte Vater Dhanis. Es war ein Mann, der eine große Schale in den Händen hielt, was Maru einleuchtete, denn so konnte er den Regen auffangen. Sein ernstes Haupt wurde gerade von den ersten Strahlen der Morgensonne berührt. Die allgegenwärtigen Fliegen, die sein Haupt umschwirrten, wirkten in diesem Licht wie tanzender Goldschmuck. Außer der offenen Decke gab es keine Fensteröffnungen. Dämmerlicht erfüllte den Saal. Zu Füßen des Gottes waren einige schemenhafte Gestalten zu Gange. Offenbar bereiteten sie gerade ein Opfer vor.
»Du also bist Tasil aus Urath?« Ein Mann trat mit diesen Worten aus dem Halbdunkel hervor. Er war in ein prachtvolles, blaues Gewand gekleidet und trug eine schwere, goldene Halskette. War das Luban-Etellu? Er sah aus, wie Maru sich einen hohen Fürsten immer vorgestellt hatte, würdevoll, mit einem langen, schwarzen Bart, der in kunstvolle Locken gedreht war. Stolz sprach aus seinen Augen.
»Der bin ich, Herr«, antwortete ihm Tasil schlicht.
»Und die junge Frau dort, wer ist das?«
»Meine Nichte Maru.«
»Sie sieht nicht aus, als sei sie mit dir verwandt.«
»Ihr Vater war ein Farwier, Herr«, wiederholte Tasil die Lüge, die er sich vor nun fast einem Jahr ausgedacht hatte.
»Natürlich«, sagte der Blaugekleidete, der ihm offensichtlich nicht glaubte. Er lächelte nachsichtig. »Ich habe gehört, sie ist immer an deiner Seite, bei allen deinen … Unternehmungen.«
»Wir hängen sehr aneinander, Herr«, behauptete Tasil.
»Sogar, wenn du den gefährlichen Fluss überquerst?«
»So ist es, Herr.«
Maru fragte sich, worauf das hinauslief. Natürlich war sie bei Tasil, wenn sie den Fluss überquerten. Wenn man so wollte, war sie das Geheimnis seines Erfolges. Es war ja nicht so, dass sie die Einzigen wären, die versuchten, Waren durch die feindlichen Linien zu schmuggeln. Sie waren nur die Einzigen, die bisher jede Fahrt überlebt hatten.
»Sie scheint kühn zu sein, Urather, und du bist es wohl auch?«
»Oh, nein Herr, es ist nicht Kühnheit, sondern Not, die mich antreibt. Die der Meinen und die dieser Stadt.«
Der Mann, der vielleicht der Kaidhan war, lachte. »Wenn dich die Not der Ulbaitai so bewegt, wie kommt es dann, dass du deine Waren zu Wucherpreisen verkaufst?«
»Es ist, wie ich sagte, Herr, ich muss auch an das Wohl der Meinen denken. Das Leben in dieser Stadt ist teuer und meine Arbeit sehr gefährlich. Jede Fahrt könnte die letzte sein. Was, wenn ich sterbe? Wer versorgt dann meine Nichte?«
»Und du nimmst sie mit, damit sie dich nicht überleben muss? Wie fürsorglich, Urather«, spottete der Blaugekleidete.
Maru fragte sich, ob der Mann etwas von ihrem Geheimnis ahnte. Tasil nahm sie nicht trotz, sondern wegen der Gefahr mit. Sie dachte an das weiße schuppige Band, das sich um ihre Hüfte schlang und das sie nicht ablegen konnte. Die Heilung durch diesen Fetzen Haut der Awathani war nicht ohne Folgen geblieben. Maru hatte bald die Gelegenheit erhalten festzustellen, dass sie es spürte, wenn die Erwachte in der Nähe war. Es war auf einer ihrer ersten Schmuggelfahrten geschehen. Damals waren sie noch mit drei Booten über den Fluss gerudert. Als Maru endlich die Bedeutung der seltsamen Spannung klar geworden war, die sie plötzlich befallen hatte, war es schon zu spät gewesen. Sie war erschienen. Maru schauderte immer noch, wenn sie daran dachte, wie das Ungetüm sich aus dem Fluss erhoben und erst das erste, dann das letzte Boot unter Wasser gedrückt hatte. Noch immer gellten die verzweifelten Schreie der Männer in ihren Ohren, und manchmal sah sie in ihren Träumen noch einmal die Gesichter der Ertrinkenden, wie sie im kalten Wasser versanken. Aber ihr eigenes Gefährt, das doch in der Mitte gefahren war, das hatte die Erwachte verschont. Und zwei Nächte später hatte Tasil sie aus dem Schlaf gerissen, durchdringend angesehen und schließlich verkündet: »Du bist Fleisch von ihrem Fleisch. Sie wird dich nicht angreifen, und auch mich nicht, wenn du bei mir bist!«
Sie hatte ihn verdattert angeschaut und gefragt: »Bist du sicher, Onkel?«
Und er hatte sie mit finsterem Blick angestarrt und nichts mehr gesagt. Bis jetzt hatte er recht behalten. Viele Schiffe und Boote hatte die Zermalmerin seither geholt, aber wer mit Maru den Fluss überquerte, der fuhr sicher.
»Lass ihn, guter Immit, lass ihn«, rief eine Stimme aus dem Hintergrund. Eine Gestalt löste sich aus den Schatten. Sie trug ein graues, grob gewirktes Gewand und schien von der Last vieler Jahre gebeugt. Maru sah noch einmal genauer hin. Nein, es war nicht das Alter, das diesen Mann drückte, er konnte nicht viel älter als Tasil sein, aber schwere Sorgen schienen auf ihm zu lasten, und großer Kummer stand ihm ins Gesicht geschrieben.
Der Blaugekleidete, der also nicht Luban, sondern der Immit war, die rechte Hand des Kaidhans, deutete eine Verbeugung an. »Wie du es wünschst, Herr.«
Also sollte das Luban-Etellu sein, diese gramgebeugte Gestalt in grobem Gewand? So hatte sich Maru den Herrn des Reiches und Nachfahren von Göttern nicht vorgestellt.
Der Kaidhan schlurfte etwas näher heran und betrachtete Tasil und Maru nachdenklich. »Sie sieht dir nicht sehr ähnlich, Urather. Und da hat sie Glück, deine Nichte.« Er kicherte über den kleinen Scherz. »Recht hübsch ist sie, aber sie hat die grünen Augen der Hirth. Bist du sicher, dass ihr verwandt seid? Sie hat so gar nichts mit den Frauen des Südens gemein.«
»Ihr Vater war ein Farwier, Herr«, wiederholte Tasil noch einmal.
»Einer dieser schrecklichen Wilden aus dem Waldland? Aber die blaue Haut ist ihr erspart geblieben, wie mir scheint. Sie bemalen sich, wusstest du das, Uschparu?«
»Ich habe davon gehört, Herr«, antwortete der Immit. »Man weiß gar nicht, wie sie aussehen, diese Farwier, unter all der Farbe. Also kann diese junge Frau eine sein, oder nicht? Ein Mischling. Alles vermischt sich, ist dir das schon aufgefallen, Urather?«
»Nein, Herr«, antwortete Tasil. Maru sah ihm an, wie gespannt er jedem Wort des Kaidhans lauschte. Sie waren sicher nicht hier, weil Luban-Etellu über Abstammungsfragen reden wollte. Oder doch?
»Siehst du meinen Immit dort? Ein prachtvoller Mann, ja, es gibt keinen besseren, nicht, seit der unvergleichliche Immit Schaduk ermordet wurde. Aber wusstest du, dass Uschparu zu einem Achtel ein Kydhier ist? Kannst du dir das vorstellen, Urather? Die rechte Hand des Kaidhans ist kein reiner Akkesch! Früher war so etwas undenkbar, nicht wahr?«
Maru sah die Gesichtszüge des Immits gefrieren, als der Kaidhan leichthin über seine Herkunft plauderte. Offenbar war das sein wunder Punkt. Sie hatte von Tasil gelernt, auf solche Dinge zu achten.
1. Auflage Originalausgabe September 2009 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © 2009 by Torsten Fink Umschlagfoto: © HildenDesign unter Verwendung eines Motivs von © photoiasson / shutterstock
Lektorat: Simone Heller Karten: Arnd Drechsler HK ∙ Herstellung: RF
eISBN : 978-3-641-03575-4
www.blanvalet.de
Leseprobe
www.randomhouse.de