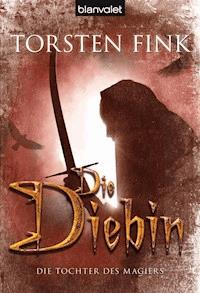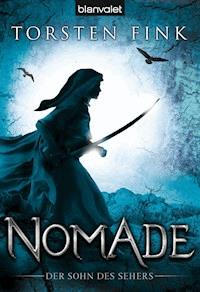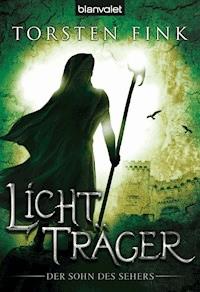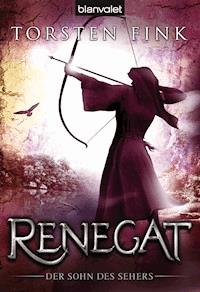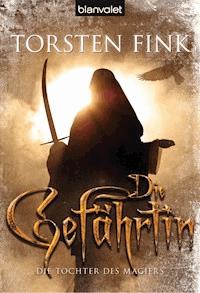11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Er sucht Vergeltung, er findet sein Verderben
Viltor Merson wächst unter den Ärmsten der Armen auf. Doch das war nicht immer so, sondern erst seit sein Vater durch eine Intrige hingerichtet und seine Familie in die Slums verstoßen wurde. Doch Vil hat seiner toten Mutter versprochen, bittere Rache zu üben. Verbissen kämpft er sich zurück an die Spitze der Gesellschaft. Der Preis, den seine kleine Schwester für seinen Ehrgeiz zahlen muss, ist schrecklich. Doch das ist für Vil nur ein weiterer Anspron, Rache für die Familie Merson zu üben. Er ahnt nicht, dass sein Weg nur Schmerz bereit hält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1076
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Will Gremm ist fünfzehn Jahre alt, als sein Vater ermordet wird. Andere mögen es eine ordentliche Hinrichtung nennen, aber Will weiß, dass sein Vater das Opfer eine skrupellosen Intrige geworden ist. Nun wächst er unter den Ärmsten der Armen auf und muss seine Mutter und seine jüngeren Geschwister beschützen. Doch er versagt auf schreckliche Weise.
Allerdings verspricht Will seiner Mutter vor ihrem Tod, dass er bittere Rache üben wird. Verbissen kämpft er sich rücksichtslos zurück an die Spitze der Gesellschaft. Der Preis, den seine kleine Schwester für seinen Ehrgeiz zahlen muss, ist schrecklich. Aber das ist für Will nur ein weiterer Ansporn, Rache für die Familie Gremm zu üben.
Er ahnt nicht, dass sein Weg nur Schmerz bereithält …
Autor
Torsten Fink, Jahrgang 1965, arbeitete lange als Texter, Journalist und literarischer Kabarettist. Er lebt und schreibt heute in Mainz.
Von Torsten Fink beim Blanvalet-Verlag erschienen
Die Tochter des Magiers bei Blanvalet:
1. Die Diebin ()
2. Die Gefährtin ()
3. Die Erwählte ()
Der Sohn des Sehers bei Blanvalet:
1. Nomade ()
2. Lichtträger ()
3. Renegat ()
Drachensturm ()
Der Prinz der Skorpione bei Blanvalet:
1. Der Prinz der Schatten ()
2. Der Prinz der Klingen ()
3. Der Prinz der Skorpione ()
Der Prinz der Rache ()
Torsten Fink
Roman
Originalausgabe
1. Auflage
Originalausgabe Februar 2014 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © 2014 by Torsten Fink
Umschlaggestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft, München
Illustration: © Isabelle Hirtz unter Verwendung
einer Fotografie von Olga Kessler
Karte: © Jürgen Speh
Lektorat: Simone Heller
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-14122-9
www.blanvalet.de
Zwei Männer zwängten sich durch einen Spalt tief unter der Erde. Sie mussten kriechen, und der Alte, der vorneweg kroch, eine kleine Berglampe in der Hand, hörte seinen Neffen hinter sich ängstlich keuchen. Er fragte sich, ob er auch derart die Hosen voll gehabt hatte, als er zum ersten Mal unter Tage gegangen war. Auch sein Meister hatte ihn hergeführt, obwohl hier schon damals nicht mehr gegraben worden war.
Der Spalt entließ sie in einen niedrigen, kurzen Gang. Weiter ging es nicht. Der alte Steiger wischte sich den Schweiß von der Stirn und wartete auf den Jungen, der schwerfällig angekrochen kam. Er genehmigte sich einen Schluck Wasser und bot dann seinem Neffen die Flasche an. Als er ihm die Flasche wieder abnahm, fragte er: »Hörst du das?«
Sein Begleiter richtete den Blick auf die niedrige Decke. »Was ist das, Onkel?«
»Das Meer, mein Junge, es rauscht über unseren Köpfen. Wir sind tief unter dem Meeresgrund, aber irgendwo in der Nähe muss es eine Spalte, einen natürlichen Kanal bis fast ganz hinauf geben. Deshalb hören wir, wie das Meer gegen die Ufer unserer Insel brandet.«
»Aber, Onkel, ist das nicht sehr gefährlich?«
Der Alte gab keine Antwort. Er schlug die Spitzhacke mit einem kurzen, trockenen Geräusch in den Stein. Er betastete die Wand, dann hielt er die kleine Lampe an die frische Wunde im Fels. »Siehst du das, mein Junge?«
Sein Neffe konnte den Blick jedoch nicht von dem Gestein lösen, das tonnenschwer über ihm hing.
Der Steiger bereute, dass er sich auf diese Geschichte eingelassen hatte, aber der Junge war nun einmal das Kind seiner Schwester. Doch je länger er mit ihm hier unten war, desto stärker wurden seine Zweifel, dass er zum Bergmann taugte.
»Also, siehst du das?«, fragte er und deutete auf die Kerbe.
»Es glänzt«, stellte der Junge fest. Sein Blick wanderte wieder zur Decke.
»Genau, und weißt du vielleicht auch, was da so schön glänzt?«
Der Junge zuckte mit den Schultern. »Silber, Onkel?«
»Silber? Bei allen Himmeln– seit wann finden wir rund um Xelidor Silber?«
»Dann… Stahl?«
»Stahl wird geschmiedet, er wächst nicht in der Erde, Dummkopf!« Worauf hatte er sich da nur eingelassen? »Eisen, mein Junge, bestes Eisenerz, das ist es, was du hier siehst. Wir graben es aus, und dann machen sie oben Schwerter und Rüstungen daraus. Dieses Eisen ist der Sockel, auf dem die goldenen Säulen von Xelidor in den Himmel ragen, wie man so sagt. Und wenn du geschickt und gelehrig bist«, und der Himmel weiß, dass du es nicht bist, dachte der Alte, »dann wirst du auch bald schon hier unten die Hacke schwingen und dem alten Felsen Chelos, auf dem unsere Stadt errichtet ist, das Erz abzwingen. Aber nicht hier, denn das ist der Tote Mann.«
»Der Tote Mann?«
»So nennen wir diese Stelle, denn hier graben wir nicht weiter.« Der Alte hob seine Lampe an. »Siehst du, wie es hier überall glitzert? Es gibt keine Stelle im ganzen Bergwerk, die ergiebiger wäre, aber wir wollen das Schicksal nicht herausfordern. Verstehst du das, mein Junge? Die Sicherheit geht vor!«
Sie lauschten. Von weit unten drang das leise Klicken der Spitzhacken herauf, aber man musste genau hinhören, denn das Meer über ihnen rauschte lauter.
»Ich habe gehört, dass man bald gar nicht mehr gräbt, Onkel«, erwiderte der Junge.
»Wer erzählt dir so einen Unsinn?«
»Bif, der Sohn vom Schuster. Er sagt, dass die Scholaren ein Pulver haben, das viel besser gräbt, als ein Mann es kann.«
»Na, der Sohn eines Schusters muss es ja wissen«, höhnte der alte Steiger. Es gab so viel über das Bergmannshandwerk zu wissen, und das Einzige, was der Junge gehört hatte, war dieser Unsinn, den die Scholaren in der Stadt in Umlauf gebracht hatten?
»So gibt es dieses Pulver gar nicht, Onkel?«
Anlügen wollte er den Knaben nun auch nicht. Er seufzte. »Doch, das gibt es. Es ist irgendeine Teufelei, die sie in der Fremde gefunden haben. Hast du schon einmal die großen Bombarden gesehen, die oben an der Festung stehen?«
Der Junge nickte eifrig.
»Die werden mit einem schwarzen Pulver geladen, das mit einem großen Knall explodiert und dann die Kugel aus der Bombarde weit hinaus aufs Meer schleudern kann.«
»Wie weit, Onkel?«
»Weit, sehr weit, mein Junge. Ein ganz ähnliches Pulver wollen die Scholaren nun auch unter Tage verwenden. Es explodiert nicht oder eigentlich doch, nur langsamer.« Er bemerkte, dass er sich verhedderte, weil er selbst nicht genau wusste, wie diese Sache funktionierte, doch er überspielte seine Unwissenheit: »Es brennt sich in den Stein, schneller als eine Hacke, das gebe ich gerne zu. Doch wird es niemals einen guten Steiger oder Hauer ersetzen. Und es ist gefährlich.«
Der Junge sah ihn mit großen Augen an.
Wunderbar, jetzt hat er wirklich Angst, dachte der Alte. Dann hat er hier unten auch nichts verloren.
»Komm, wir gehen zurück, mein Junge. Ich will dir unseren Tempel zeigen.« Der Junge schien sich für Tempel allerdings nicht sehr zu interessieren.
»Er ist sehr alt, weißt du, in einem anderen toten Gang. Manchmal versammeln wir uns dort und beten, dass die Himmel uns auch hier unten beschützen mögen. Verstehst du?«
Der Junge glotzte ihn stumpf an. Hatte er ihm überhaupt zugehört?
Eine Erschütterung lief durch den Stein.
»Was war das, Onkel?«
Noch eine Erschütterung, und dann noch eine. Das Lager!, durchfuhr es ihn. Sie hatten fassweise das Pulver der Scholaren in einer abgelegenen Kammer ganz in der Nähe eingelagert, weil hier nicht mehr gegraben wurde. Es sei dort sicher, hatten die Scholaren gesagt. Aber wenn sie sich irrten? Er hörte ein Knirschen und begriff, dass es aus dem Stein kam. Sein Blick ging zur Decke, die schwer und drückend über ihnen hing. Er konnte es fühlen, in seinen Knochen, der Fels riss auf.
»Was ist das nur, Onkel?«
Wieder eine Erschütterung, und jetzt hörten sie auch den Donner der Explosionen.
Der Steiger sah entsetzt, dass Gestein von der Decke platzte. Scharfe Splitter flogen ihnen um die Ohren. Er hob mit zitternder Hand die Lampe. Bildete er sich das nur ein, oder spaltete sich über ihnen der Fels? Er schloss die Augen. Irgendwo, gar nicht fern, stürzte ein Gang ein. Das schwere Gepolter war unverkennbar. Und dann war da noch etwas.
»Das Meer, Onkel, es rauscht so laut!«
»Es tut mir leid, mein Junge.«
Stein brach, und schon kam die Urgewalt des Wassers durch eine neue Kluft im Fels herangebraust. Der Alte nahm den Jungen in den Arm, dann riss das Wasser des Meeres sie fort, zermalmte sie und spülte sie durch den engen Spalt in einen anderen Gang, an dessen Ende die Bergleute vor langer Zeit einen Himmelstempel errichtet hatten.
Das Haus glänzte, Vil konnte es nicht anders beschreiben. Der steinerne Boden schimmerte, das silberne Geschirr blitzte vom großen Esstisch, und die Hausmagd begann gerade damit, zusätzlich zu den vielen schon brennenden Kerzen noch weitere Leuchter aufzustellen. Nur er selbst, er glänzte nicht im Mindesten, ganz im Gegenteil: Der Hemdkragen war zerrissen, er hatte Blut auf dem Ärmel, und mit der Zunge konnte er die aufgeplatzte Lippe erspüren.
»Wie alt bist du, Viltor?«
»Fünfzehn, Mutter.«
»So? Und was habe ich dir über den heutigen Abend gesagt?«, fragte seine Mutter streng.
»Dass er sehr wichtig ist«, murmelte er.
»Und ich habe dich gebeten, dich dementsprechend zu verhalten– oder nicht?«
»Ja, Mutter.« Er riskierte einen Blick. Ihre graugrünen Augen ruhten mit unnachgiebiger Strenge auf ihm. »Tut mir leid«, murmelte er.
»Du bist wirklich alt genug, um es besser zu wissen. Darf ich erfahren, wie es dazu kommen konnte?«
Vil zuckte mit den Achseln.
»Aha, es ist also ohne besonderen Grund geschehen?«
Wieder antwortete er mit einem Schulterzucken. Er konnte ihr doch schlecht erzählen, dass er sich wegen der Dinge, die sie über seinen Vater sagten, mit seinen Freunden geprügelt hatte. »Schön. Wenn du es mir nicht verraten willst, dann vielleicht deinem Vater. Ich bin schon sehr gespannt, was er dazu sagen wird, wenn er heimkommt. Doch jetzt geh nach oben und mach dich für den Abend bereit. Und versuch bitte, uns nicht noch weiter zu beschämen. Du bist ein Merson und ein Gremm– verhalte dich entsprechend, Viltor!«
»Ja, Mutter.«
Er stieg rasch die Treppe hinauf. Dass sie am Abend Gäste erwarteten, hatte unbestreitbar sein Gutes– seine Mutter würde ihn nicht ohne Abendessen ins Bett schicken können, wie sie es sonst nach solchen Vorfällen tat.
»Wie viele waren es?«, fragte Tiuri, seine jüngere Schwester, als er sich über der Waschschüssel das Blut abwusch.
»Hundert«, gab er schlecht gelaunt zurück.
»Gar nicht wahr«, rief sie lachend.
Er seufzte. »Es waren zwei.«
»Tut es sehr weh?«, fragte Faras, sein kleiner Bruder.
»Überhaupt nicht«, erklärte er grimmig und blickte in den silbernen Spiegel. Das Silber warf nur ein verzerrtes Bild zurück, und das sah übel aus.
»Warte, ich helfe dir.« Vorsichtig tupfte Tiuri ihm mit einem Tuch das Blut von der Lippe.
Er bewunderte sie für den heiligen Ernst, den sie bei solchen Dingen an den Tag legte. Sie wirkte dann viel älter als die zehn Jahre, die sie gerade zählte.
»Pass auf, dass dir nichts aufs Kleid tropft«, murmelte er.
»Mutter, Vil macht Tiri das Kleid schmutzig«, rief Faras vor der Tür.
»Und du machst dir in die Hosen, wenn du Blut siehst«, gab Vil wütend zurück.
Eigentlich erwartete er, dass gleich seine Mutter in die Kammer rauschen würde, aber Rohana Merson kam nicht. Offenbar nahmen die Vorbereitungen für den Abend sie zu sehr in Anspruch.
Faras streckte Vil die Zunge heraus und rannte dann davon.
»Er kann froh sein, dass wir heute Gäste haben«, murmelte Vil.
»Ich bin auch froh«, sagte Tiuri. »Und es ist doch auch schön– all diese wichtigen Menschen sind vornehm gekleidet und höflich und reden über bedeutende Dinge, über die sonst nie einer mit uns redet.« Sie betrachtete ihr Werk zufrieden aus den dunklen Augen, die sie von ihrem Vater geerbt hatte.
Er fuhr sich mit der Zunge prüfend über die Lippe. Sie hatte aufgehört zu bluten. »Lehrreich vielleicht, vor allem aber langweilig«, widersprach er.
»Finde ich nicht. Aber beeil dich jetzt besser. Es ist schon spät.«
Als Vil die Treppe hinunterstieg, hatte die Magd die letzten Kerzen bereits entzündet. Sie stand an der Tür, unterdrückte ein Gähnen und wartete auf die Gäste.
Vils Vater sah ihn kommen, runzelte die Stirn und bedachte ihn mit einem Unheil kündenden Blick.
Vil schluckte. Aber dann, als seine Mutter nicht hinsah, zwinkerte ihm sein Vater aufmunternd zu.
»Nehmt Aufstellung, Kinder, und bitte, benehmt euch wie die Kinder von Edelleuten– und nicht wie die von Raufbolden.«
Vils Platz war an der Seite seines Vaters.
»Hast du wenigstens gewonnen?«, fragte der leise.
»Unentschieden«, erwiderte Vil flüsternd. »Aber es ging auch zwei gegen einen.«
»Dann ist unentschieden ein gutes Ergebnis, mein Sohn.«
»Ermutige ihn nicht auch noch, Aretor«, sagte Rohana Merson kühl, die sie gehört hatte.
Dennoch, Vil hatte sich vor dem Urteil seines Vaters gefürchtet, und er war froh, dass es milde auszufallen schien.
Sie warteten, aber die Gäste verspäteten sich offenbar. Vil blickte zum Tisch. Beinahe zwanzig Männer und Frauen würden gleich dort sitzen, sich den Bauch vollschlagen und über Politik, Preise für Tee, kostbare Stoffe und Tragödien in der Verwandtschaft reden.
Der Geruch von Braten wehte aus der Küche heran, und Vil hörte den Koch fluchen, wie immer, wenn er eines seiner Meisterwerke vorbereitete. Vielleicht fluchte er aber auch, weil die Gäste sich verspäteten.
»Warum ist denn noch niemand da?«, fragte Tiuri leise. Sie wippte ungeduldig auf den Fersen.
»Es ist vermutlich wegen der Unruhen in der Stadt«, meinte Aretor Merson.
»Unruhen?«, fragte Faras ängstlich.
»Nur im Grubenviertel, auf der anderen Seite der Stadt, mein Sohn. Kein Grund zur Sorge. Die Wache wird das schnell in den Griff bekommen.«
Sein Vater hatte mit Vil über die Unruhen geredet. Sie waren ausgebrochen, nachdem das Meer in die größte Mine der Stadt eingedrungen war und viele Männer getötet hatte. Es war eine Mine, an deren Einnahmen sein Vater beteiligt war, und offenbar bedeutete es einen schweren Verlust für das Familienvermögen.
Aber es war auch das schlimmste Unglück seit Menschengedenken, und die Bergleute behaupteten nun, die Minen seien unsicher und schlecht geführt, vor allem aber gaben sie den Scholaren und ihrem schwarzen Pulver die Schuld. Mitglieder dieses Ordens sollten auf offener Straße angegriffen worden sein. Und nun musste die Wache mit eiserner Hand wieder für Ruhe sorgen.
»Aber wenn es auf der anderen Seite der Stadt ist, warum kommen dann deswegen diese Leute zu spät?«, fragte Tiuri.
»Tiuri, bitte, zu viele Fragen stehen einer Dame nicht gut zu Gesicht«, sagte die Mutter mit mild tadelndem Blick.
Also warteten sie weiter, doch niemand kam.
»Gut. Wir fangen an«, sagte Aretor Merson schließlich.
Vil fand, dass er blass aussah.
Zu fünft saßen sie an einer Tafel, die für zwanzig gedeckt war, und sie aßen schweigend. Rohana Merson setzte ein- oder zweimal dazu an, ihrem Mann etwas zuzuflüstern, aber er wehrte es ungehalten ab. »Bitte, Rohana, versuche nicht, es zu beschönigen. Es ist doch offensichtlich, was das bedeutet.«
»Es ist nur die Unruhe, Aretor. Du wirst sehen, das geht vorüber«, entgegnete sie mit einem gezwungen wirkenden Lächeln.
Vil aß, aber er aß ohne Appetit, und er hätte seinem kleinen Bruder gerne eine Ohrfeige verpasst, weil er die ganze Zeit mit seiner Gabel auf dem Teller herumkratzte, ein Misston, der die Stille am Tisch nur noch unerträglicher machte.
»Sie streiten sich«, flüsterte Faras, als sie im Bett lagen.
»Nein, sie unterhalten sich nur«, versuchte Vil ihn zu beruhigen.
»Für mich klingt es aber wie Streit«, meinte Faras trotzig.
»Ruhe jetzt«, mahnte Vil und schlich zur Tür.
»Wir dürfen nicht lauschen«, rief Faras leise.
»Halt die Klappe«, zischte Vil und schlüpfte in den Flur.
Auf der anderen Seite des Ganges stand seine Schwester in ihrer Tür. Sie lauschte also ebenfalls.
Vil konnte seine Eltern hören, die gedämpften Stimmen aber nicht verstehen, denn gerade jetzt räumten Koch und Magd dort unten geräuschvoll die Tafel ab.
»Worum geht es?«, fragte er leise.
»Ich glaube, Vater will, dass wir die Stadt verlassen.«
»Er will weg aus Xelidor?«
»Leise doch«, flüsterte Tiuri.
»Und Mutter?«
»Sagt, dass eine Gremm nie davonläuft. Irgendwas davon, dass unsere Familie an den Fundamenten der Stadt mitgebaut hat.«
Vil seufzte. Den Vortrag kannte er, er bekam ihn meist dann zu hören, wenn seine Lehrer seine Mutter darüber informierten, dass seine Leistungen zu wünschen übrig ließen.
»Und was sagt Vater dazu?«
»Er sagt, er sei kein Gremm und will immer noch weg.«
Vil verstand, was er meinte. Aretor Merson war aus der Fremde nach Xelidor gekommen, aus Cifat, einer Stadt am fernen Goldenen Meer. Dennoch war er in sehr kurzer Zeit ein sehr wichtiger Mann geworden, weshalb er in Vils Augen eigentlich besondere Achtung verdiente.
Die Söhne der anderen vornehmen Familien in diesem Viertel sahen das nicht so, und wenn sie in der Überzahl waren, sangen sie Spottlieder auf den abergläubischen Fremden und seinen Sohn. Vil gab sich gleichmütig, wenn sie sangen. Er hatte gelernt, darauf zu warten, dass er sie irgendwo allein antraf. Dann überzeugte er sie mit seinen Fäusten davon, solche Lieder in Zukunft nicht mehr zu singen. Er hatte nicht viele Freunde unter den anderen Ritter- und Kauffahrersöhnen, und seit heute waren es noch zwei weniger.
Unten war es unterdessen ruhig geworden. Der Tisch schien abgedeckt, und die Stimmen ihrer Eltern waren verstummt.
Tiuri sah ihn fragend an.
»Geh ins Bett«, meinte er. »Morgen früh sieht die Welt ganz anders aus.«
»Vil, steh auf.«
Er schlug die Augen auf. Es musste mitten in der Nacht sein. Seine Mutter stand an seinem Bett, eine Kerze in der Hand. Bleich und aufgewühlt sah sie aus. Vil erfasste sofort, dass etwas nicht stimmte.
»Zieh dich an und kümmere dich darum, dass auch dein kleiner Bruder sich ordentlich anzieht.«
Vil blickte zum Fenster. Durch die Schlitze in den hölzernen Läden meinte er, das erste Grau des Tages zu erkennen.
»Was ist denn, Mutter?«, fragte er beunruhigt.
»Es wird alles in Ordnung kommen, mein Sohn. Jetzt kümmere dich um deine Geschwister. Zieht euch warm an. Wir werden vielleicht einige Tage nicht wiederkommen.«
»Einige Tage?«, fragte Vil, aber seine Mutter stellte die Kerze ab, ein einsam flackerndes Licht, und verließ das Zimmer.
Vil sprang auf, öffnete die Butzenscheibe und riss den Holzladen auf. Kalt und grau sickerte der Wintertag in die Kammer. Möwen schrien vom Meer her, aber er konnte sie im dichten Nebel nicht sehen.
Tiuri stand plötzlich in der Tür. »Es sind Fremde im Haus, Vil.«
»Fremde?« Er öffnete seine Truhe und nahm seinen Dolch.
»Junger Herr, nicht doch!«, stammelte die Magd, die blass und verstört hinter Tiuri aufgetaucht war.
»Wer ist da im Haus, Ena?«, fragte er und zog die Klinge aus der Scheide.
»Die Gespenster, Herr, die Gespenster.«
Faras hatte sie gehört. Er klammerte sich an seine Bettdecke und wollte um keinen Preis aufstehen. »Hilf ihm, Ena, er soll sich gefälligst anziehen«, befahl Vil, erleichtert, wenigstens die Verantwortung für den ewig quengelnden Faras los zu sein. Aber auch Tiuri sah ihn nun ängstlich an.
»Es sind nicht wirklich Gespenster«, versuchte er sie zu beruhigen. »Es ist die Geheime Wacht, du hast sie schon gesehen, Tiuri.«
»Die grauen Männer?«, fragte sie und sah nun noch verstörter aus.
Er nickte, und dann wurde ihm klar, dass richtige Gespenster vielleicht das kleinere Übel gewesen wären. Er schlich zur Treppe.
»Geht nicht hinunter, junger Herr, sonst nehmen sie Euch auch noch mit!«, rief die Magd.
Er hörte Stimmen. Sein Vater, dessen Stimme sich überschlug, dann andere, ruhigere Männerstimmen und dazwischen, schneidend wie ein Schwert, die durchdringende Stimme seiner Mutter.
»Mitnehmen?«, fragte Vil, der erst jetzt verstand. Seine Hand verkrampfte sich um den Dolchgriff.
»Vil, nicht«, sagte Tiuri leise. Sie berührte ihn am Arm. Er sah in ihre großen, ängstlichen Augen. Ich werde sie beschützen, dachte er und blieb am Kopf der Treppe stehen.
Die Schritte schwerer Stiefel und fremde, raue Stimmen klangen durchs Haus. Es zog bitterkalt von unten herauf, die Haustür musste offen stehen.
Der Koch, leichenblass und verstört auch er, tauchte auf. »Die Doma bittet den jungen Herrn und seine Geschwister, nach unten zu kommen«, stieß er hervor.
Faras wollte nicht, aber Tiuri nahm ihn an der Hand. Vil holte tief Luft und ging dann vor ihnen die Treppe hinab.
Sie betraten die kleine Halle, in der am vorigen Abend dieses unwirkliche Festmahl ausgerichtet worden war. Irgendjemand hatte all die Kerzen wieder entzündet, so dass der Saal in sinnloser Pracht erstrahlte. Der kalte Wind, der durch die offene Tür hereinzog, ließ die vielen kleinen Flammen flackern.
Ihre Mutter war dort, die Arme verschränkt, und sie blickte stolz und mit unübersehbarer Verachtung auf den Mann, der ihr gegenüberstand und über andere Männer in Grau zu gebieten schien.
Die Graue Wacht, dachte Vil, und jetzt, da er sie leibhaftig sah, machte sie auch ihm Angst.
»Noch einmal, ich verlange Euren Namen zu wissen, Menher«, zischte Rohana Merson.
»Ich bin ein Hauptmann der Grauen Wacht, mehr müsst Ihr nicht wissen, Doma Merson. Ah, die Kinder!«
Der Hauptmann wandte sich ihnen zu und versuchte sich an einem Lächeln, aber seine Augen wirkten kalt und drohend.
Die Mutter winkte sie heran, und Vil war froh, als er ihre unmittelbare Nähe spürte. Sie schien keine Angst zu haben.
»Wo ist Vater?«, fragte Tiuri flüsternd.
»Er ist bereits abgeführt worden, junge Doma«, sagte der Hauptmann.
Abgeführt? Vil wurde es flau im Magen. Man hatte seinen Vater verhaftet? Er sammelte all seinen Mut, räusperte sich und fragte: »Was wird meinem Vater vorgeworfen?«
»Ah, der Erbe des Hauses Gremm, wie? Euer Vater ist des Verrats angeklagt und des heimtückischen Mordes an einhundert Männern, die in diesem Bergwerk so jämmerlich ertranken.«
»Lügen!«, rief Vil, der nicht glauben konnte, was er da hörte. Verräter? Das war wie ein Schlag in die Magengrube.
»Nun, das ist die Anklage. Ob es die Wahrheit ist, wird sich bald zeigen. Das Geheime Gericht ist bereits berufen.«
»Und das Urteil soll noch offen sein, Hauptmann?«, rief Rohana Merson höhnisch.
Der Mann zuckte mit den Achseln. »Es steht mir nicht an, an der Weisheit des Gerichtes zu zweifeln, Doma, und Euch auch nicht. Ganz im Gegenteil, es ist unklug, denn vielleicht seid Ihr noch auf die Gnade dieser Männer angewiesen. Wenn ich Euch nun bitten dürfte? Leutnant, sagt den Leuten, sie können jetzt beginnen.«
Der Leutnant salutierte und gab den Männern Befehle für die Durchsuchung des Hauses.
Rohana Merson straffte sich. »Kommt, Kinder.«
Vil verstand nicht, was vorging. Drei der Graugekleideten hatten offenbar die Absicht, sie aus dem Haus zu geleiten. Waren sie etwa auch verhaftet?
»Was geschieht hier, Mutter?«, fragte er leise, als er neben ihr durch den Flur schritt, verzweifelt bemüht, seine Angst nicht zu zeigen. Er hörte Faras hinter sich leise schluchzen.
»Unrecht, mein Sohn, hier geschieht großes Unrecht. Aber schon bald werden diese Männer es bedauern. Ihr werdet sehen, Kinder, wir sind bald zurück in unserem Haus.«
Auf der Straße drehte sich Vil noch einmal um. Das ganze Haus war hell erleuchtet, vermutlich, damit die Gespenster es besser durchsuchen konnten. Der Koch und die Magd standen mit ängstlichen Mienen auf der Treppe vor der Tür. Wachen waren bei ihnen. Würde man sie auch festnehmen?
Der Marsch durch die Stadt kam Vil später wie ein böser Traum vor. Sie marschierten stumm durch den Nebel, hinauf auf den Tempelberg, über den Obermarkt und an den großen Häusern des Perlenviertels vorbei. Die Wächter führten sie durch die Kaisergärten hinüber zur Festung. Als sich die mächtigen Torflügel hinter ihnen schlossen, begriff er allmählich, wie ernst die Lage war.
Sie wurden Männern übergeben, die die rotbraune Uniform der Stadtwache trugen. Diese führten sie über viele Treppen hinab und schließlich in einen schmucklosen, kalten Raum, wo sie von einem Mann erwartet wurden, der nicht zur Wache gehörte.
Vil kannte ihn von den Empfängen. Der Mann war jung und dennoch schon Kammerherr der Stadt. Sein Vater hatte geschäftlich viel mit ihm zu tun, allerdings wusste Vil nicht genau, welcher Art diese Geschäfte waren. Solche Dinge hatten ihn bisher nie interessiert. Es hatte mit den Minen zu tun, das wusste er immerhin.
»Menher Ajeler, seid Ihr hier, um diese Posse zu beenden?«, fragte Vils Mutter mit viel Bitterkeit in der Stimme.
Der Kammerherr schüttelte düster den Kopf. »Ich bedaure zutiefst, was hier geschieht, Doma Rohana, aber ich fürchte, ich kann nur wenig tun.«
»So? Sprecht Ihr da in jenem Geiste fester Freundschaft, den Ihr erst vor wenigen Wochen an unserem Tisch beschworen habt?«
»Ich wäre nicht hier, wenn es nicht so wäre«, sagte Ajeler, »denn eigentlich ist es mir verboten, mit Euch zu sprechen. Schließlich handelte Euer Mann auch in meinem Namen, und die Anklage gegen ihn hätte auch mich treffen können.«
»Wie praktisch, dass er vor Euch steht und den Bannstrahl des Geheimen Gerichtes abfängt«, zischte Rohana Merson.
»Ich verstehe Euren Zorn, Doma. Ich bin hier, um Euch einen Rat zu geben. Man wird Euch vermutlich ein Schiff anbieten– nehmt es!«
»Die Stadt verlassen? Um auf irgendeiner Insel im Süden dahinzuvegetieren? Niemals! Eine Gremm verlässt Xelidor nicht.«
Der Kammerherr seufzte. »Ich habe mir schon gedacht, dass Ihr es so seht, Doma Rohana. Nun, Ihr habt wohl ein paar Tage Zeit, es zu überdenken. Tut das, ich bitte Euch. Die Alternative wäre weitaus schrecklicher.«
Als er verschwunden war, ohne dass Vils Mutter ihn einer Antwort gewürdigt hätte, öffneten die Wachen eine niedrige Pforte.
»Was ist das?«, fragte Faras ängstlich, als er in die kahle Kammer mit ihren winzigen, vergitterten Fensterlöchern blickte.
»Euer neues Zuhause, edler Herr«, spottete die Wache.
Es war ein Loch, kalt und finster. Es gab weder Betten noch Stühle oder wenigstens einen Hocker, in einer Ecke gab es einen Abtritt für die dringenden menschlichen Bedürfnisse. Und in der anderen Ecke muffiges Stroh, auf dem sie schlafen sollten.
Vil stand unschlüssig in der Kammer und wusste nicht, wie er sich verhalten sollte, und er sah, dass auch seine Mutter, die sonst nie in Verlegenheit geriet, für den Moment ratlos war. »Was sollen wir jetzt tun, Mutter?«, fragte er schließlich.
»Setzt euch erst einmal, Kinder. Und dann werden wir uns in Geduld fassen, bis dieses böse Spiel vorüber ist.«
»Aber was ist das für ein Spiel?«, fragte Tiuri.
»Politik, Kinder, aber das versteht ihr noch nicht.«
Vil war der Meinung, dass er es sehr wohl verstehen würde, und er bat seine Mutter später, als seine Geschwister eingeschlafen waren, noch einmal leise um eine Erklärung.
»Dein Vater hat sich Feinde gemacht, Viltor, Männer, die ihm, dem Fremden, seinen Aufstieg nicht gönnen. Nun denken sie, dass sie ihn vernichten können, aber sie irren sich. Sie irren sich sehr. Diese ganze Geschichte wird auf sie zurückfallen.«
»Aber worum geht es denn, Mutter?«, wiederholte er seine Frage.
»Du weißt, dass dein Vater Minenlizenzen gepachtet hat?«
Vil nickte, auch wenn ihm nicht klar war, was das genau bedeutete.
»Es war eine seiner Minen, in der das Unglück geschah. Es gab viele Tote, Bergleute, die ertrunken sind, als das Meerwasser in die Stollen eindrang. Du hast von den Unruhen gehört, Viltor. Es sind andere Bergleute, die nun keine Arbeit mehr finden, und jene in den kleineren Minen, die Angst haben und nicht mehr in die Stollen hinabwollen. Und auch daran gibt man deinem Vater wohl die Schuld. Er ist ein Fremder. Es ist immer leicht, einen Fremden zu beschuldigen.«
Ein Fremder? Vil kannte das Gefühl. Er lebte schon immer in Xelidor, und doch nannten ihn die anderen Jungs den Fremden. »Aber wer beschuldigt Vater?«, fragte Vil.
»Viele, Viltor. Und es sind viele, die das bedauern werden, so wahr ich eine Gremm bin. Noch haben wir Freunde in der Stadt, mächtige Familien. Du wirst es sehen, Viltor.«
Vil dachte an das gespenstische Fest zurück, als sie allein an der Tafel gesessen hatten. Nein, viele Freunde konnten sie in dieser Stadt nicht mehr haben.
Später am Tag brachten die Wachen ihnen Essen, Suppe, Brot und Decken für die Nacht, mehr geschah am ersten Tag nicht. Am zweiten Tag verlangte Rohana Merson ein Gespräch mit den Anklägern, dann mit einem Hohen Rat, einem Richter und später mit dem Befehlshaber der Festung, sie verlangte ihre sofortige Freilassung und Auskunft über das Schicksal ihres Mannes, doch keiner dieser Bitten wurde entsprochen.
Am dritten und vierten Tag war es nicht anders. Sie lagen im Stroh, warteten, aßen und redeten nicht viel. Vil versuchte noch einmal, mit seiner Mutter über den Vater zu sprechen, und darüber, was wohl mit ihm und mit ihnen geschehen würde, aber sie gab ihm keine Antwort. Er erkannte jedoch, dass sich unter ihrer harten Unnachgiebigkeit allmählich auch Sorgen in sie hineinfraßen.
Vil übernahm es, sich um Faras und Tiuri zu kümmern, aber das war nicht schwer. Sie zankten nicht einmal mehr miteinander. Worum auch? Das Essen war so furchtbar, dass es sich nicht lohnte, darum zu streiten. Es gab nichts zu tun, und Vil versuchte, die Zeit zu verdösen.
Am achten Tag wurde Rohana Merson von einem Wächter der Grauen Wacht abgeholt.
»Wo bringt Ihr uns hin, Hauptmann?«, fragte sie und stellte sich schützend vor ihre Kinder.
»Die Kinder? Nirgends, Doma. Es ist das Gericht. Es will Eure Aussage hören.«
»Das Gericht?«
»Es wird nicht lange dauern. Ihr seid bald wieder hier.«
»Werde ich meinen Mann sehen?«
»Vielleicht, Doma, ich weiß es nicht.«
»Aber ich kehre hierher zurück?«
Der Hauptmann zuckte mit den Schultern. »Nach allem, was ich weiß, ja, Doma, doch ich weiß nicht, was das Gericht entscheiden wird.«
Vil und seine Geschwister verbrachten bange Stunden allein in ihrem Kerker, und Faras, der in den vergangenen Tagen erstaunlich tapfer gewesen war, weinte nun doch wieder.
»Memme«, murmelte Vil wütend, vor allem auf sich selbst, weil ihm auch zum Heulen zumute war, und er war froh, dass Tiuri seinen kleinen Bruder tröstete.
Dann kehrte die Mutter zurück. Sie wollte nichts über das Gericht sagen, aber sie hatte gerötete Augen, als hätte auch sie geweint, etwas, das Vil sich bis zu diesem Tag nicht hatte vorstellen können. Er sah ihr an, dass ihr im Gericht etwas Schreckliches widerfahren sein musste, noch schrecklicher als all das, was in den letzten Tagen geschehen war.
Kurz entschlossen ging er zur niedrigen Pforte und rief nach der Wache.
»Was wollt Ihr?«, wurde er mürrisch gefragt.
»Ich will wissen, wann wir endlich hier herauskommen!«
Die Wache schüttelte den Kopf. »Früher, als Euch lieb sein wird, junger Herr.«
Und dann, und das machte ihm noch mehr Angst, kam die böse Ahnung, dass dieses Furchtbare, das seine Mutter so erschüttert hatte, erst noch geschehen würde. Und nur ein Wunder würde sie noch retten.
Esrahil Gremm schrieb einen Brief. Das hieß, eigentlich starrte er nur auf die Schreibfeder in seiner Hand. Sie hatte sich seit Minuten nicht bewegt, und das Pergament, das sie beschreiben sollte, war noch beinahe leer. Die Anrede, er war über die Anrede nicht hinausgekommen!
Er stöhnte. Die Anspannung drückte ihm die Luft ab. Schließlich hielt er es nicht mehr aus: Er legte die Feder aus der Hand, stand auf, verließ die enge Schreibstube, lief durch den kurzen Flur zur Vordertür und trat hinaus, um Atem zu schöpfen.
Der Stundenturm des Viertels ließ seine blecherne Glocke erklingen.
Gremm hätte ihn nicht gebraucht, um zu wissen, was die Stunde geschlagen hatte. Die frische Frühlingsbrise, die vom Meer den Silbersteig heraufzog, half nicht. Die schweren Wolken, die über seinem Gemüt hingen, konnte kein Wind der Welt vertreiben.
Sein Blick glitt gedankenverloren durch die Gasse. Sie war beinahe menschenleer, ungewöhnlich für diese Tageszeit, aber er kannte den Grund nur zu gut. Er lauschte. Nein, der Wind war gnädig, er kam von der See und ließ Gremm den Lärm nicht hören, der ganz gewiss über der Arena aufstieg.
Stattdessen hörte er jetzt die hastigen Schritte von Abar Brasus, die den Silbersteig heraufeilten. Er war Kauffahrer, so wie Gremm, und sein Haus lag nur einen Steinwurf entfernt.
Gremm zog in Erwägung, ins Haus zurückzukehren, denn er verspürte wenig Lust, diesem stets fahrigen und zerstreuten Mann gerade jetzt zu begegnen. Doch Brasus hatte ihn schon erspäht und winkte aufgeregt.
Gremm zwang sich zu einem Lächeln und rief: »Euer Tuch, Menher Brasus, Ihr habt Euer Tuch verloren!«
Der Kauffahrer hielt inne, drehte sich um und bemerkte erst jetzt das leichte Stück Stoff, das der Wind die Gasse hinauftrieb, so dass es ihm fast wie ein Hund zu folgen schien. Er bückte sich behände, hob es auf und steckte es in seine zerbeulte Jackentasche, wobei er beinahe einige der Papiere verloren hätte, die er sich unter den linken Arm geklemmt hatte.
»Ich danke Euch, Menher Gremm«, rief er und hielt völlig außer Atem an. »Ich habe wirklich über die Arbeit die Zeit vergessen. Wisst Ihr, die Ladelisten, Ihr kennt das ja, nie werden sie fertig, immer gibt es noch etwas zu ändern oder zu ergänzen«, fuhr er fort und deutete auf die Pergamente unter seinem Arm.
Gremm nickte beiläufig und wünschte sich, der Mann würde einfach weitergehen.
»Kommt Ihr nicht mit?«, fragte Brasus freundlich.
»Mitkommen?«
»Die Arena. Wenn wir uns beeilen, sind wir vielleicht noch rechtzeitig zur Hinrichtung dort. Ich muss nur vorher…«
»Menher Brasus!«, unterbrach ihn Gremm schroff und einigermaßen fassungslos. »Seid Ihr toll? Wisst Ihr denn nicht, dass es mein Schwager ist, der dort heute hingerichtet wird? Glaubt Ihr etwa wirklich, ich wollte dabei zusehen?«
Brasus starrte ihn entsetzt an. »Bei den Himmeln, Gremm, wo habe ich nur meine Gedanken! Oh, es tut mir leid, es tut mir schrecklich leid. Ich hatte vergessen, ich…« Der Kauffahrer verstummte, verbeugte sich fahrig zum Abschied und hastete davon.
»Menher Brasus, Eure Papiere!«, rief ihm Gremm hinterher. Aber er sah nicht mehr zu, wie der andere den Pergamenten hinterherjagte, die er bei seinem überstürzten Aufbruch verloren hatte und die der Wind nun durch die Gasse trieb.
Es war ein Fehler gewesen, vor die Tür zu treten. Mit hängenden Schultern kehrte Gremm zurück in die Schreibstube. Die Schreibfeder lag immer noch da, wo er sie abgelegt hatte, sie hatte ihm nicht den Gefallen getan, die Arbeit, die er nicht zu bewältigen wusste, für ihn zu erledigen.
Esrahil Gremm setzte sich, wischte sich den kalten Schweiß von der Stirn und nahm die Feder zur Hand. Für seinen unglücklichen Schwager konnte er nichts mehr tun, aber vielleicht konnte er seine Schwester und ihre Kinder retten.
Der Trick war, die Augen nicht zu öffnen. Solange Vil sie geschlossen hielt, konnte er sich einbilden, zu Hause in seinem Bett zu sein, in der Kammer im ersten Stock, und er konnte versuchen, das Brüllen, das durch die dicken Wände drang, für das Tosen eines Sturmes zu halten, der sich an den festen Mauern des Hauses brach.
Jemand musste eine der schweren Türen geöffnet haben, denn das Gebrüll, das er so verzweifelt zu überhören versuchte, war lauter geworden.
»Es ist so weit«, sagte eine Männerstimme.
»Wir sind bereit«, erwiderte die kühle Stimme seiner Mutter.
Vil öffnete die Augen. Nein, das war nicht seine Kammer, und da draußen tobte ein Sturm, dem auch die Mauern des Hauses Gremm nicht gewachsen gewesen wären. Feuchter Staub rieselte von der Decke der muffigen Kammer.
Er betrachtete den Mann als Störenfried, dabei tat er nur seine Pflicht, das hatte ihm seine Mutter jedenfalls erklärt und respektvolles Benehmen ihm gegenüber eingefordert. Vil war trotzdem geneigt, ihn zu hassen. Er schloss die Augen wieder, um sich noch einen Augenblick zurückzuträumen, doch das wollte ihm nicht gelingen. Das Gebrüll der Menge dröhnte dumpf durch die alten Mauern der Arena.
Sie brüllte seinen Namen: Merson, Merson.
Er drängte sich enger an seine Mutter. Es war noch kein halbes Jahr her, da hatte er den Augenblick ersehnt, an dem sie hier seinen Namen rufen würden, so wie die der jungen Männer, die am Tag der Weihe auf dem hellen Sand der Kampfbahn mit Schwert und Lanze ihr Geschick bewiesen.
Seine Eltern hatten ihn in die Arena mitgenommen, um ihm einen Vorgeschmack auf das zu geben, was er im Jahr seines sechzehnten Geburtstages selbst erleben sollte. Er hatte zugesehen, gebannt von dem prachtvollen Schauspiel der jungen Patrizier, die sich in schimmernden Rüstungen vor den Augen der ganzen Stadt duellierten. Die blitzenden Schwerter, die nur mühsam zu bändigenden Streitrösser, die bemalten Schilde der vornehmen Häuser, die thronartigen Stühle auf den Plätzen, die ausschließlich seiner Familie vorbehalten waren. Er erinnerte sich noch an jede Einzelheit: die hoch stehende Sonne, die schwitzenden Wasser- und Weinverkäufer, die flatternden Fahnen, die Gerüche von gebratenem Fleisch, die klebrigen und süßen Leckereien.
Sein Vater hatte ihm erklärt, nach welchen Regeln dort unten gekämpft wurde, als wenn er das nicht längst gewusst hätte, und dass er bald auch so eine Rüstung tragen würde wie jene jungen Helden, die von der Menge bejubelt wurden. »Eines Tages«– er hatte die Stimme seines Vaters noch im Ohr– »eines Tages werden sie auch deinen Namen rufen.«
Und jetzt brüllten sie diesen Namen, aber Vil wusste, dass sie nicht nach ihm, sondern nach seinem Vater schrien.
»Fürchtet euch nicht, Kinder«, sagte die kühle Stimme seiner Mutter. »Den Mitgliedern unseres Hauses steht die Furcht schlecht an.«
Vil schaute zu ihr auf. Sie war blass, noch blasser als sonst, und das kurzgeschorene rote Haar ließ sie für einen Augenblick ganz fremd aussehen. Jetzt lächelte sie ihm zu, ohne dass sie viel Wärme in dieses Lächeln zu legen vermochte. Dann beugte sie sich zu ihm und flüsterte: »Vil, du musst deinen Geschwistern ein Vorbild sein.«
Er schluckte und sah die Furcht in den Augen von Tiuri und Faras. Man hatte auch ihnen die Haare kurz geschoren, angeblich, um die Läuse, die sie sich in diesem Kerker geholt hatten, zu bekämpfen, aber er nahm an, dass man es nur getan hatte, um sie weiter zu demütigen. Ob er wohl ebenso verängstigt und elend aussah wie seine beiden Geschwister? Seine Mutter hatte recht. Er musste sich zusammenreißen. Er war zu alt, um zu weinen.
Der Offizier stand immer noch in der schweren Eisentür und schien auf sie zu warten.
»Kommt, Kinder«, sagte Vils Mutter und erhob sich. Sie nahm Faras und Tiuri an der Hand. Für Vil war keine Hand mehr frei.
»Seid Ihr wirklich sicher, dass Ihr das wollt, Doma Rohana?«, fragte der Offizier im Gang.
»Ich will es sehen, und ich will, dass auch meine Kinder mit ihren eigenen Augen sehen, welches Unrecht hier geschieht. Sie sollen es nicht vergessen.«
Der Offizier zuckte mit den Achseln, gab seinen Männern einen Wink und hob die Laterne, um den Weg zu beleuchten.
Vor ihnen öffnete sich ein dunkler Gang, nein, eine Treppe, die Vil wie ein Schlund erschien, bereit, ihn und seine Familie zu verschlingen.
Sie stiegen langsam hinab. Die Wände mochten einst hell getüncht gewesen sein, aber die Jahrhunderte, in denen hier wohl schon viele Männer mit Fackeln entlanggegangen waren, hatten sie geschwärzt. Die Stufen waren ausgetreten und uneben, und Vil fragte sich, wie viele Menschen hier schon hinabgestiegen und ob sie alle von so großer Furcht erfüllt gewesen waren wie er selbst.
Das Gebrüll klang gedämpft durch die dicken Wände. Wie tief waren sie schon gekommen? Seltsame, fremde Gerüche stiegen Vil in die Nase. Er war nie in den Katakomben der Arena gewesen, sein Vater hatte ihm das ausdrücklich verboten, und die üblen Gerüche, die ihm entgegenschlugen, ließen ihn ahnen, dass es dafür gute Gründe gab.
Einer der Wächter schien seinen Blick bemerkt zu haben, denn er deutete auf eine dunkle Pforte und sagte: »Dahinter liegen die Eingeweide der Arena, junger Merson. Sie sind sonst etwas lebhafter, aber all die Huren und Diebe sind wohl jetzt oben, um das Spektakel zu sehen. Später, nach der Hinrichtung, da wird es hier zugehen, wie es sich deinesgleichen nicht einmal vorstellen kann.«
»Haltet die Klappe, dahinten!«, raunzte der Offizier.
Endlich, als Vil schon glaubte, die Treppe würde geradewegs immer weiter bis in die untersten Höllen führen, hielten sie an.
Der Offizier kratzte sich am Hinterkopf. »Ich frage Euch noch einmal, Doma Rohana, wollt Ihr das Euch und Euren Kindern wirklich antun?«
»Ihr kennt meine Antwort.«
Der Mann entriegelte seufzend eine eiserne Pforte und öffnete sie. Sofort schwoll der Lärm an, und immer noch brüllte die Menge denselben Namen. Vil sah fahles Licht durch schmale, vergitterte Fenster knapp unter der Decke der steinernen Kammer einfallen. Da draußen musste sie sein, die Arena, voller Licht und– Vil konnte es fühlen– voller Hass.
»Kommt, Kinder, zeigt ihnen die Würde der Häuser Merson und Gremm«, sagte seine Mutter mit bleichem Gesicht.
Plötzlich tauchte ein schwarzer Umriss in der Pforte auf, versperrte ihnen den Weg und fragte: »Was soll das werden, Hauptmann?«
Vil reckte sich, aber er konnte das Gesicht des Mannes in der Dunkelheit nicht erkennen.
»Sie hat darauf bestanden, Herr.«
»Seid Ihr toll, Mann? Hört Ihr das? Die Menge will Blut sehen. Das Blut eines Verräters. Aber was, glaubt Ihr, wird geschehen, wenn sie diese Frau mit ihren Kindern da draußen sehen? Wir wollen doch nicht, dass falsches Mitleid irgendwelche Zweifel an der Gerechtigkeit des Urteils weckt, oder?«
Der Offizier wurde verlegen und gab keine Antwort.
»Habe ich mich klar ausgedrückt?«, fragte der Mann in der Tür.
»Es ist meine Entscheidung, und es ist mein Recht. Mein Mann ist ein Ritter der Großen Versammlung. Ich habe das Recht, dieses Verbrechen, das Ihr begehen wollt, zu bezeugen!«
»Ah, die Rechte der Alten Häuser und Geschlechter«, erwiderte der Unbekannte in der Pforte gelassen. »Ich habe viel gehört von dem altehrwürdigen, nun aber beinahe verschwundenen Hause Gremm, und ich finde es wirklich bedauerlich, dass Euer Mann sich dieses Hauses und der Halle der Versammlung als so unwürdig erwies. Aber Ihr solltet Euren berühmten stahlharten Sinn vielleicht doch beugen, Doma Rohana, schon Euren Kindern zuliebe.«
»Geht mir aus dem Weg«, zischte Rohana Merson, »oder wollt Ihr dieses alte Recht der Familien auch noch mit Füßen treten?«
Der Schatten in der Pforte zuckte mit den Schultern. »Wenn Ihr mich so fragt, Doma Rohana, nein, das will ich nicht. Ich kenne diese Rechte, doch leider ist Euer Mann mit dem Urteil aus der Versammlung entfernt worden, und alle Privilegien der Halle sind erloschen. Doch selbst wenn es nicht so wäre, würde ich es verhindern, zum Wohle unserer Stadt, das mir sehr am Herzen liegt.«
Endlich erkannte Vil die Stimme. Es war der Kammerherr Ajeler, der sie im Kerker erwartet hatte, vor kurzem noch ein Freund seines Vaters.
»Ich bin nicht Euer Feind, Doma Rohana, und ich wage viel, wenn ich mein Angebot erneuere. Ein Schiff liegt im Hafen, es wird noch heute nach Süden segeln. Ihr könntet an Bord gehen, mit Euren Kindern, und in einer unserer Kolonien dort unten ein neues Leben beginnen. Warum wollt Ihr es nicht annehmen?«
Rohana Merson schüttelte den Kopf. »Das würde Euch so gefallen, Kämmerer, uns abzuschieben in die Ferne, um es den Wilden oder dem Sumpffieber zu überlassen, Euer ungeheuerliches Werk zu vollenden. Nein, wir bleiben in Xelidor, als Erinnerung an das, was heute geschieht, als Stachel in Eurem Fleisch! Schon bald wird man einsehen, wie Unrecht man uns tat. Dann werden wir zurückkehren und zusehen, wie Eure Untat Euch einholt.«
»Ihr seid zu stolz, Doma Rohana, genau wie Euer Mann. Aber Ihr täuscht Euch; man wird Euch vergessen, schneller als Ihr glaubt, wie noch jeden, der die Halde betrat. Aber gut, wenn Ihr Euch nicht helfen lassen wollt, so kann ich nichts mehr für Euch tun. Doch ganz gewiss werde ich nicht zulassen, dass die Menge Euch und Eure armen Kinder noch einmal zu Gesicht bekommt.« Der Mann trat zur Seite. »Wenn Ihr Euch das antun wollt, so könnt Ihr Euch das Geschehen von dieser Kammer aus anhören, so wie die Gladiatoren der längst vergangenen Zeit wohl zuhörten, als sich ihre Kameraden da draußen abschlachteten. Hauptmann, Ihr seid mir dafür verantwortlich, dass die Verurteilten in dieser Kammer bleiben. Und lasst nicht zu, dass sie ihre Gesichter da oben hinter den Gittern zeigen. Und danach bringt sie ohne weitere Verzögerung zur Halde, bevor die Menge sich in die Straßen ergießt. Bringt sie hinunter und übergebt sie dem Vergessen.«
»Jawohl, Herr«, erwiderte der Hauptmann und salutierte.
Vil sah zu den schmalen, vergitterten Fenstern auf, die er nicht erreichen konnte. Er sollte seinen Vater nicht noch einmal sehen dürfen?
»Haltung, Viltor!«, flüsterte ihm seine Mutter zu. Er beobachtete sie, wie sie schön und bleich in der Kammer stand und auf das Unvermeidliche wartete.
Die Nachmittagssonne warf durch die Gitter ein eigenartiges Muster auf die alten Mauern. Er hörte das Gebrüll der Menge, die den Namen seines Vaters verfluchte wegen der Verbrechen, die er angeblich begangen hatte.
Niemand in der Kammer sagte etwas, die Soldaten wirkten übellaunig, vielleicht weil sie nicht zusehen konnten. Und dann herrschte draußen plötzlich atemloses Schweigen, in dem laut die schweren Schritte eines einzelnen Mannes dröhnten.
»Hörst du das? Das ist der Henker«, flüsterte eine der Wachen ihrem Kameraden zu. »Das Schleifen, es stammt vom Stiel seiner schweren Axt.«
»Er macht das absichtlich, glaube ich. Ich meine, der Verurteilte hat doch schon die Augen verbunden, aber er lässt ihn hören, dass der Tod naht«, raunte ein anderer.
»Ruhe, Männer«, mahnte der Offizier.
Vil schloss die Augen und lauschte. Er folgte den schweren Schritten durch den Sand und dann auf ein hölzernes Podest. Er hörte auf zu atmen, als sie stehen blieben. Wie ruhig es da draußen war. Zu Tausenden, Abertausenden mussten sie sich auf den steinernen Sitzreihen drängen, aber jetzt war es totenstill. Plötzlich hörte Vil ein tausendfaches Zischen, das war die Menge, die den Atem anhielt. Dann einen scharfen Schlag, der ihm durch Mark und Bein ging.
Einzelne Frauenstimmen im Publikum schrien auf, gefolgt von kurzer Stille, aber dann brandete Jubel auf, laut und schrill, ebbte ab und brandete noch einmal auf.
Eine der Wachen sagte missmutig: »Jetzt zeigt er den Kopf.«
Vil spürte Tränen in den Augen, aber er schluckte sie hinunter, denn Tiuri und Faras, die beide weinten, sollten sie nicht sehen. Seine Mutter hatte den beiden die Hände auf die Schultern gelegt, sie war ganz bleich im Gesicht, und er fragte sich einen Augenblick, ob sie vielleicht auch gerade gestorben war. Es durchfuhr ihn wie ein kalter Blitz: Aretor Merson, sein Vater, war tot.
Der Hauptmann hatte es plötzlich sehr eilig. »Es ist wirklich besser, wenn wir aus den Katakomben heraus sind, bevor die Menge in die Schänken strömt, Herrin«, sagte er. »Denn nach einer Hinrichtung sind diese Leute noch unberechenbarer als sonst. Und es mag ein Verbrechen geschehen oder andere Schwierigkeiten geben, wenn sie Euch und die Kinder sehen.«
»Noch ein Verbrechen?«, fragte Vils Mutter kalt.
Aber der Hauptmann ging nicht darauf ein, sondern führte sie eilig durch dunkle Gänge aus der Arena hinaus, ohne dass sie jedoch den Untergrund verließen. Es ging weiter durch einen engen Hohlweg, der rechts und links von grauen Häusern überragt wurde, von Stegen überbaut war und gelegentlich ganz unter der Erde verschwand. In den Wänden waren Löcher, und als ein bleiches Gesicht ihn aus einem dieser Löcher heraus anstarrte, begriff Vil, dass in diesen alten Stollen Leute lebten.
Urplötzlich versperrte ihnen ein schweres Tor den Weg. Der Hauptmann öffnete es, und ein Geruch von fauligem Fisch schlug Vil entgegen.
Aus einem Wachhäuschen trat ein sehr unrasierter Soldat hervor.
»Ah, Hauptmann, Ihr bringt die Neuankömmlinge? Ich habe Euch bereits erwartet. Lasst sehen, lasst den guten, alten Arnfold sehen, was Ihr ihm gebracht habt.«
Der Offizier verzog angewidert das Gesicht. »Behandelt sie mit Respekt, Mann, dies sind keine Diebe oder Betrüger wie die, die sonst zu Euch gebracht werden.«
»Und doch sind sie hier.« Der Wächter kam näher und leuchtete mit seiner Laterne in die Gesichter der Kinder.
Faras und Tiuri wichen vor ihm zurück, aber Vil nicht, obwohl ihm der Geruch von Knoblauch, Bier und irgendetwas Verwestem den Atem raubte. Er hielt dem Blick des Wachmannes stand und bemerkte, dass eines der beiden Augen, die ihn so interessiert musterten, triefte.
»Das also ist die vornehme Familie Merson. Ja, ich weiß Bescheid. Interessante Neuigkeiten verbreiten sich schnell, selbst hier am Arsch der Welt, wenn Ihr den Ausdruck verzeihen wollt, Doma«, sagte der Wächter, der jetzt Vils Mutter musterte.
Sie blickte ihn kalt an. »Wir werden die Gastfreundschaft dieses Ortes nicht lange beanspruchen.«
Der Wächter lachte wiehernd auf. »Nicht lange? Oh, bei den Himmeln, wenn ich für jedes Mal, wenn ein Neuankömmling dies sagte, nur eine Krone bekommen hätte, hätte ich mich schon vor langer Zeit zur Ruhe gesetzt.«
»Ihr müsst mir bestätigen, dass ich die Gefangenen übergeben habe«, warf der Hauptmann ein, der sich sichtlich unwohl in seiner Haut fühlte.
»Gebt ihn nur her, Euren Wisch. Was ist das? Besondere Anweisungen?«
»Sie erhalten keinen Passierschein, keiner von ihnen. Unter keinen Umständen.«
Der Wächter sah ihn scheel an. »Ich kann lesen, Herr Hauptmann«, brummte er.
»Dann habt Ihr auch gelesen, dass Ihr mit Eurem Kopf dafür haftet, oder?«
»Da macht Euch keine Sorgen. Einer meiner Vettern ist in der Mine ersoffen. Ich kannte ihn zwar kaum, aber dennoch, Familie bleibt Familie. Ihr müsst also keine Sorge haben, dass ich die da zu gut behandle. Aber jetzt wartet ein Augenblickchen. Ich gehe nur eben hinüber in meine prachtvolle Wachstube, hole das Buch und sehe mir dieses Schreiben etwas genauer an. Ihr bekommt es gleich zurück.« Gemächlich schlurfte er davon.
Eisenstäbe trennten den kleinen Bereich um die Hütte, um die eine Handvoll Wächter herumlungerte, von einer weiten Höhle dahinter, deren Ende Vil nicht sehen konnte, mit einer Decke, die sicher zwanzig oder mehr Ellen hoch war. Das Licht der schon tief stehenden Sonne fiel durch mehrere große Öffnungen von oben ein. Wie in der Arena wurden die Sonnenstrahlen durch Gitter gefiltert.
Unten, im Zwielicht, an das sich seine Augen inzwischen gewöhnt hatten, schienen merkwürdige Dinge vorzugehen.
»Was tun die da?«, fragte seine Schwester Tiuri leise. Sie deutete auf eine Gruppe zerlumpter Gestalten, die in einem Haufen aus zerbrochenen Brettern und allerlei anderem Unrat herumwühlten.
»Alles Eisen, hört Ihr!«, rief eine dröhnende Stimme. »Dass ihr mir keinen Nagel vergesst, ihr Ratten!«
Ein stämmiger Mann war aus einem windschiefen Verschlag getreten. Er schien sie ebenfalls gesehen zu haben. Er spähte hinauf zu ihnen, dann drehte er sich um und rief jemandem im Inneren des Verschlags etwas zu, das Vil aber nicht verstehen konnte.
Der Wächter kam zurückgeschlurft, und eine schneeweiße Katze, die sehr fehl am Platz wirkte, streunte miauend um seine Beine. Er hielt das Blatt in den Fingern und reichte es dem Hauptmann mit einer übertriebenen Verbeugung, die er auch noch mit einem ironischen »Zu Eurer Verfügung, Euer Gnaden« ergänzte. Dann zog er das dicke Buch, das er unter den Arm geklemmt hielt, heraus und legte es auf ein Stehpult. »Seid so gut und tragt hier die Namen ein, Hauptmann.«
Der Hauptmann nickte und übertrug fein säuberlich die Namen der Mersons in dieses Buch. Vil sah gespannt zu.
»Sind das Eure Namen, Doma Merson?«, fragte der Wächter, als der Hauptmann fertig war.
Vils Mutter warf einen Blick in das Buch. Vil bemerkte ihre Nervosität. Dann nickte sie.
»Gut«, sagte der Wächter, spuckte aus und legte ein Lineal auf die Seiten. Dann nahm er eine zerfledderte Feder und zog nacheinander vier dicke Striche über die Seite. »Hiermit sind Eure Namen aus dem Gedächtnis der Stadt gestrichen«, verkündete er. »Sie sind nicht mehr von Bedeutung. Willkommen in der Halde der Vergessenen.«
»Ihr macht den Kindern Angst, Mann«, meinte der Hauptmann missbilligend.
Das Triefauge zuckte mit den Achseln. »Ich kann es nicht ändern.«
Der Hauptmann trat näher an ihn heran: »Diese Doma stammt aus einem alten und sehr würdigen Haus. Ihr haftet mir dafür, dass hier nichts Ungebührliches geschieht, verstanden? Ich werde mich dessen vergewissern.«
»Natürlich, Herr Hauptmann, natürlich, doch darf ich Euch daran erinnern, dass an dieser Pforte Eure Befehlsgewalt endet. Ab hier gehören die Gefangenen mir. Aber ich bin zu Eurem Glück ein wohlwollender Mensch mit einem goldenen Gemüt, wenn Ihr versteht, was ich meine.«
Der Offizier griff mit verkniffenem Gesicht in seinen Beutel und zog ein paar Kronen heraus, die sofort in der Klaue des Wächters verschwanden. »Ich habe ein Auge auf Euch, vergesst das nicht!«
»Oh, Ihr solltet mich von Zeit zu Zeit mit ein paar Kronen daran erinnern, Hauptmann«, erwiderte der Wächter grinsend.
Dann war der Hauptmann mit seinen Männern verschwunden.
»Da sind wir nun also endlich unter uns«, sagte der Wächter zufrieden.
»Zeigt uns unsere Unterkünfte«, verlangte Vils Mutter.
Der Wächter schüttelte den Kopf, hob die weiße Katze auf und streichelte sie zärtlich. »Wir sind hier nicht in Eurem Herrenhaus, und Ihr habt mir nichts zu befehlen, Gefangene. Ich werde dieses Tor dort aufschließen, Ihr werdet mit Euren Kindern hindurchgehen, und dann müsst Ihr sehen, wie Ihr zurechtkommt. Ihr gehört nun zu den Vergessenen, den Ratten von der Halde, Doma. Es mag sein, dass dieser Hauptmann sich noch ein- oder zweimal nach Euch erkundigt, aber das wird aufhören. Das tut es immer.«
»Ich habe Freunde in der Stadt. Meine Familie ist alt und einflussreich. Schon bald wird man uns hier herausholen.«
Der Wächter zuckte mit den Schultern. »Ich würde mich an Eurer Stelle nicht darauf verlassen. Richtet Euch ein und sucht Euch jemanden, der Euch und die Kinder beschützt. Die Halde ist ein gefährlicher Ort. Aber dort kommt ein Mann, an den Ihr Euch halten könnt. Man nennt ihn den Eisenkönig. Unter seinem Schutz seid Ihr so sicher, wie man es in der Halde nur sein kann.«
Er öffnete das zweiflügelige Gittertor. Jenseits davon stand der kräftige Mann, den Vil zuvor schon gesehen hatte. Aus der Nähe wirkte er noch feister. Seine fleischigen Arme waren dicht behaart, während sein Kopf beinahe kahl war. »Semer Geffai, zu Euren Diensten«, stellte er sich vor.
Es sollte wohl freundlich klingen, aber Vil konnte keine Freundlichkeit in diesem Mann erkennen. Seine Mutter nickte dem Mann höflich zu, aber er sah ihr an, dass es sie viel Überwindung kostete. »Rohana Merson mit ihren Kindern Viltor, Tiuri und Faras.«
»Wenn Ihr mir folgen wollt, Doma Rohana, ich denke, für ein lediglich kleines Entgelt kann ich Euch die beste Unterkunft besorgen, die Ihr hier unten bekommen könnt«, rief der Eisenkönig und ging voraus. »Achtet auf den Weg, ich fürchte, er ist voller Unrat.«
»Aber ich habe derzeit kein Geld, Menher Geffai. Wir durften nicht mehr mitnehmen, als wir an unseren Körpern trugen.«
»Natürlich nicht, Doma, das ist mir bewusst. Aber ich sehe da zum Beispiel Eure Handschuhe aus bestem Leder. Schöne Stücke, die Ihr hier unten aber nicht brauchen werdet. Sie wären eine gute Anzahlung auf die Miete für Euer neues Heim.«
Jetzt sah Vil etwas Lauerndes im Gesicht von Semer Geffai. Er sah auch, wie sehr seine Mutter mit sich rang. Schließlich aber zog sie rasch ihre Handschuhe aus und hielt sie dem Mann hin, der sie mit einer übertriebenen Verbeugung entgegennahm. »Hier entlang bitte, hier entlang. Es ist nicht weit, aber achtet auf den Weg.«
Viltor spürte ein Zupfen an seinem Hemd. Es war seine kleine Schwester. »Was ist das für ein Ort?«, fragte sie leise.
Semer Geffai hatte sie gehört. Er wandte sich ihr zu und sagte: »Dies, Kind, ist einer der ältesten Teile unserer schönen Stadt. Vor vielen hundert Jahren grub man hier nach Eisen– und fand diese Höhle. Ihr Boden, so heißt es, war eine einzige, viele Ellen starke Erzader, an der man Jahre zu graben hatte. Aber heute gibt es kein Eisen mehr, nur noch uns.«
»Es gefällt mir hier nicht«, meinte Faras.
Rohana Merson wandte sich an ihre Kinder und lächelte ihnen auf eine Art zu, die sie ermutigen sollte, aber Vil seltsam traurig machte. »Keine Angst, Kinder. Wir haben Freunde in der Stadt, die uns helfen werden. Schon bald wird dieser Albtraum vorüber sein.«
»Aber Papa ist tot«, stellte Tiuri ernst fest.
Rohana Mersons Gesicht erstarrte. »Das ist wahr, mein Kind, aber seine Mörder werden bald dafür bezahlen. Wir werden sie das büßen lassen. Habt ihr das verstanden? Es ist ein Unrecht geschehen, eurem Vater, uns. Aber niemand tut einer Gremm oder einem Merson unrecht, ohne dafür zu büßen. Und jetzt kommt, reißt euch zusammen! Gönnen wir unseren Gegnern nicht das Vergnügen, uns verzweifelt oder niedergeschlagen zu sehen. Sehen wir uns lieber unser neues Heim an. Auch wenn es nur für wenige Tage ein Zuhause sein wird.«
Esrahil Gremm saß immer noch an seinem Brief. Es gab vieles, was er besser konnte als Briefe verfassen, er war ein Mann der Zahlen, nicht der Buchstaben. Sein Schreiber hätte sich wohl besser auf wohlklingende Schmeicheleien verstanden, aber den hatte er schon lange nach Hause geschickt. Mit einer gewissen Bitterkeit dachte Gremm daran, dass der Mann den freien Nachmittag wohl genutzt hatte, um sich die Hinrichtung anzusehen. Aber diese Angelegenheit war auf jeden Fall zu heikel, um einen Schreiber einzubeziehen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!