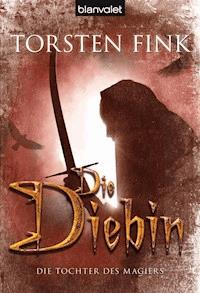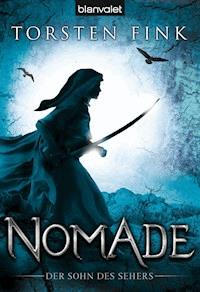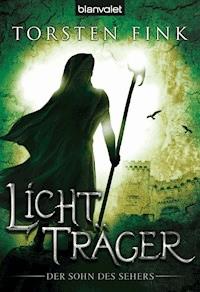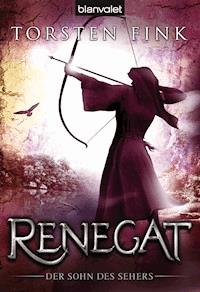
8,99 €
8,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Sohn des Sehers
- Sprache: Deutsch
Die neue All-Age-Trilogie
Der Lichtstein wurde geraubt, kaum dass der junge Seher Awin – der rechtmäßige Träger des Artefakts – mit seiner Macht die Wüstengöttin Slahan besiegt hatte. Dabei ist Awins Mission noch nicht beendet. Er muss den Lichtstein zurück an seinen angestammten Ort bringen, um zu verhindern, dass Riesen und Daimone die Welt der Menschen überrennen. Doch der Dieb des Steins ist längst unter den Einfluss der übernatürlichen Wesen geraten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 765
Veröffentlichungsjahr: 2010
4,9 (16 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
Prolog
Das Reich des Todes
Copyright
Für Daniela und Lilly, ohne die ich das alles nie geschafft hätte.
Prolog
DER WÄCHTER SPÜRTE es in den Knochen, dass das Wetter umschlagen würde. Missmutig starrte er das lange Tal hinab. Aus den tieferen Lagen stieg Nebel zwischen den schneebedeckten Hängen auf. Er würde die Stadt bald verschlingen, und dann würde sie mit umso größerem Recht »Die Verborgene« heißen. Der Wächter spuckte aus und versuchte, sein steifes rechtes Bein zu entlasten, aber es brachte ihm keine Linderung. »Tauwetter«, brummte er, stützte sich auf seine zweihändige Kriegsaxt und blickte zum Himmel. Zerfranste Wolkenfetzen jagten darüber. Das passte gar nicht zu der dicken Suppe, die sich durch das Tal hinaufwälzte. Baldim der Wächter war kein Seher, und so hatte er nicht die leiseste Ahnung, was ihm die Wolken sagen wollten. In gewisser Weise erschienen ihm ihre zerfetzten Umrisse wie eine Warnung, aber was verstand er schon von diesen Dingen? Er schulterte seine schwere Axt und hinkte zur anderen Seite der Pforte. Dabei verfluchte er wieder einmal, wie eigentlich jeden Tag, der kein Feiertag war, den Ussar, der ihm seinerzeit den Pfeil ins Bein geschossen hatte. Der Heiler hatte ihn damals aufgefordert, den Göttern ein großes Dankopfer zu bringen, weil er vom Wundbrand verschont geblieben war und sein Bein behalten hatte, aber der Mann hatte gut reden. Baldim war kein Heiler, der nur mit den Händen im Schoß darauf wartete, dass die tapferen Reiter aus der Schlacht zurückkehrten, um dann viele von denen, die den Kampf überlebt hatten, doch noch mit seinen Kräutern, Ritualen und Gebeten ins Jenseits zu befördern, nein, er war ein Krieger, ein Yamanoi. Was aber war ein Krieger wert, der nicht mehr reiten konnte? Er hätte mich sterben lassen sollen, dachte der Wächter, dann würde ich jetzt den Wind und die Mähne eines unsterblichen Rosses im Gesicht spüren, und mit anderen Helden um die Wette reiten, so wie früher. Noch einmal spuckte Baldim aus. Er war einst an der Seite des Tiudhan geritten, der beste Reiter in der Leibschar des Fürsten. Jetzt stand er sich vor diesem steinernen Tor die Beine in den Bauch.
Der Wächter schüttelte den Kopf über diese Gedanken. Er nahm an, dass der Tiudhan es sogar gut gemeint hatte, als er ihn zu einem der Ehrenwächter des Dhanag, des großen Hauses des Fürsten, ernannt hatte. Es war ein angesehener Posten, und es war besser, als in der leeren Hütte zu sitzen und auf das Ende zu warten. Baldims Frau war früh verstorben, und er hatte keine Kinder, und da nach seinem Tod wohl niemand seiner gedachte, würde sein Aufenthalt auf Marekets Weiden nicht sehr lange dauern. Und dann würde er im großen Ahngeist verschwinden. Er würde den Deutern des Orakels seine wenigen Besitztümer vermachen, damit sie für ihn die Flamme wenigstens eine Zeit lang unterhielten.
»Aber mögen muss ich sie deshalb noch lange nicht«, brummte er. Er hielt inne und blickte sich misstrauisch um. Er sprach mit sich selbst, eine leidige Angewohnheit, seit er meist allein vor dieser Pforte stand. Das war der Haken an dieser Ehrenwache - sie war im Grunde genommen überflüssig. Das war Tiugar, die Verborgene Stadt - kein Fremder hatte sie je betreten. Baldim humpelte zurück zur anderen Seite der breiten Pforte. Seine blassblauen Augen starrten trübe auf den Nebel, der erstaunlich schnell näher gerückt war und bereits die ersten steinernen Häuser verschluckte. Die Stadt hatte keine Mauer, sie brauchte sie nicht, die Berge ringsum waren Schutz genug. Und an der einzigen Stelle, an der sie nicht genügten, wartete ein gut befestigtes Bollwerk auf mögliche Feinde, die aber bisher noch nie den Weg hierher gefunden hatten. Für die Völker außerhalb Srorlendhs, des Staublandes, war Tiugar nur ein Gerücht, eine Sage, die davon erzählte, dass selbst die rastlosen Hakul, die mit ihren Zelten jahraus, jahrein über die Weiden zogen, irgendwo eine feste Stadt hatten und in den Bergen oberhalb dieser verborgenen Siedlung das sagenhafte Orakel der weißen Stuten hüteten. Baldim lachte grimmig, als er an die Dummheit ihrer Feinde dachte, und versuchte, sein schlimmes Bein zu entlasten. Am Anfang war die Langeweile sein ärgster Feind gewesen, aber irgendwann hatte er gemerkt, dass es vieles gab, worüber es nachzudenken lohnte, an diesen langen und ruhigen Tagen. Doch in letzter Zeit hatte sich vieles geändert. Während früher nur die Deuter des Orakels zum Dhanag, dem Haus des Fürsten, gekommen waren, oder der eine oder andere Yaman von den Klans der Ebene, so riss jetzt der Strom der Besucher fast nicht mehr ab, und ruhige Stunden wie diese waren selten geworden.
Durch die schmalen Fensterschlitze des großen Hauses drangen laute Stimmen. Baldim lauschte, aber er kannte den Redner nicht. Vermutlich hielt wieder irgendein Yaman eine wichtige Ansprache. Seine Miene verdüsterte sich. Seit dem Mittag saßen sie schon dort drin, die Yamane, die Seher, die Deuter des Orakels. Und dann war da noch dieser Heredhan der Schwarzen Hakul. Nach Baldims erstem Eindruck war er nur ein verzogener Knabe, den er nicht einmal in seinem Sger geduldet hätte, jedenfalls nicht unter den Yamanoi. Es hieß aber, er habe Großes vollbracht, er habe eine Göttin besiegt und zuvor auch den berühmten Heredhan Horket im Zweikampf getötet. Letzteres war immerhin eine beachtliche Leistung, wie der alte Krieger anerkannte. Es wurde auch erzählt, dass der Junge, nachdem seine Sippe ihn auf den Schild des Yamans gehoben hatte, diesen genommen und mit bloßer Faust zerbrochen habe, angeblich mit den Worten, ihm sei ein größerer Schild bestimmt. Eri Schildbrecher nannten sie ihn deshalb. Es war eigentlich eine gute Geschichte, und der Wächter hätte gern mehr erfahren, aber seine Leute wurden wortkarg, wenn man sie darauf ansprach. Schwarze Hakul. Für Baldims Geschmack waren viel zu viele der Schwarzmäntel in der Stadt. Er wanderte noch einmal vor dem Tor auf und ab und stützte sich dabei auf den Stiel seiner großen Axt, um sein schmerzendes Bein zu entlasten. Das war mehr als Nebel, was seine Knochen da ankündigten, ohne Zweifel. Missmutig blickte Baldim auf die Nebelbank, die sich den Berg hinaufschob.
Der Knabe hatte den Heolin, das war nicht zu vergessen. Baldim selbst hatte den Stein leuchten sehen, und dieser Anblick hatte ihn, den hartgesottenen Kämpfer vieler Schlachten, tief berührt. Er hätte nie für möglich gehalten, dass seine alten Augen einmal den berühmten, wundermächtigen Stein sehen würden, den einst der große Etys vom Wagen des Sonnengottes geraubt hatte. Leider zog dieser Stein auch die Yamane und Krieger aus dem ganzen Land an. Sie kamen von den Weiden und wollten ihn selbst sehen, den Lichtstein. Der Wächter spuckte wieder aus. Lichtstein hin oder her: Seiner Meinung nach nutzte der Heredhan die Gastfreundschaft seines Stammes aus. Unter Tiudhan Liwin hätte es das nicht gegeben. Aber der Tiudhan war tot und sein einziger Sohn schwachsinnig, und bei aller Achtung vor dem Blut, er kam als Nachfolger nicht in Frage. Und jetzt saßen sie dort seit Tagen und berieten. Yaman Dheryak führte die Verhandlungen mit den Klans. Ein guter Mann, sie waren zusammen geritten. Dheryak hatte einen Arm in der Schlacht verloren und war dennoch zum wichtigsten Ratgeber des Tiudhan aufgestiegen. Jetzt schlug er sich mit den Klans herum, die sich nicht auf einen Anwärter einigen konnten - oder wollten. Zwei mögliche Bewerber gab es, gute Männer aus alten, angesehenen Sippen, entfernte Verwandte des Tiudhan. Wenn sie sich wirklich bewarben, würden es schnell arme Sippen werden, das wusste der Wächter. Die Yamane würden Geschenke erwarten, bevor sie bereit waren, einen der Bewerber auch nur als möglicherweise würdig in Betracht zu ziehen. Früher waren solche Dinge durch den Dolch entschieden worden.
Baldim streckte sich erneut. Sein Bein quälte ihn. Er hinkte ein paar Schritte auf und ab. Es wurde Zeit, dass die Sonne unterging und seine Ablösung erschien. Der Schmerz war inzwischen eine schlimme Plage, aber das verfluchte, das nutzlose, das steife Bein hatte ihn noch nie getäuscht. Irgendetwas lag in der Luft, oder vielleicht auch im Nebel, der nach und nach die Häuser verschlang. Wie eine Wand rückte er näher. Baldim runzelte die Stirn. Er blickte nach Osten. Dort war der Himmel immer noch strahlend blau, und die zerrissenen Wolken flossen um die Flanken der hohen Berge, und irgendwo dahinter weiter bis zum Rand der Welt. Er hatte bei seinen langen Wachdiensten oft darüber nachgedacht, was geschah, wenn sie den Rand erreichten. Es hieß, sie lösten sich in einem undurchdringlichen Gewölk auf, das das Ende der Welt den Blicken der Menschen entzog, aber er hatte noch nie jemanden gefunden, der das Sonnengebirge überquert und es selbst gesehen hätte. Der große Etys sollte dort gewesen sein.
Der Wächter drehte sich um. Die Umrisse der nächsten Rundhäuser verschwammen schon im Dunst. Jetzt waren sie noch leichter mit den Zelten der Hakul zu verwechseln. Baldim hinkte noch einmal zum gegenüberliegenden Torpfosten und zurück. Er spürte die klamme Kälte, die der graue Dunst mitgebracht hatte. Die Nebel am Rande der Welt können nicht dichter und nicht unheimlicher sein, dachte er. Er fluchte, um diesen düsteren Gedanken zu vertreiben, trat gegen einen Stein, was es nicht besser machte, und hielt inne. Im Nebel waren vier Schatten. Schwarze Umrisse vor dem dichten Grau. Sie schienen ihm zuzusehen. Wie lange standen sie schon da?
Baldim nahm Haltung an. Er war der Wächter des Dhanag, des großen Hauses des Tiudhan, und jeder, der über die Schwelle wollte, musste an ihm vorüber. Die vier waren näher gekommen. Sie waren nun kaum ein Dutzend Schritte entfernt, aber die Nebelschleier machten es schwer, ihre Gesichter zu erkennen. Es waren drei Männer und eine Frau, genauer, zwei Männer, ein Knabe und eine junge Frau, vielleicht noch ein Mädchen. Ihre Kleidung war seltsam. Es waren Hakul-Gewänder, aber sie schienen ihnen nicht recht zu passen, und über ihren langen Reitmänteln trugen sie grobe Fellüberwürfe. Der Wächter blinzelte. Es schien, als seien die vier näher gekommen, ohne dass er gesehen hatte, wie sie sich bewegten. Jetzt wurden die Gesichter deutlicher. Die vier sahen einander nicht ähnlich, aber dennoch deutete irgendetwas in ihrer Haltung, ihrer Art, darauf hin, dass sie miteinander verwandt waren. Der Knabe hatte dichtes schwarzes Haar und einen durchdringenden Blick. Der Mann neben ihm schien den Nebel durch die schiere Anwesenheit seines kraftstrotzenden Körpers zu verdrängen. Dann war da der Alte, unter dessen weit ins Gesicht gezogener Kapuze vor allem die buschigen Augenbrauen auffielen, und darunter wiederum zwei Augen, die Baldim unverhohlen feindselig anstarrten. Der Wächter hielt diesem Blick nicht stand. Er hätte die vier längst anrufen, sie fragen müssen, wer sie waren, was sie hier zu suchen hatten. Aber er brachte keinen Ton über die Lippen. Er spürte, dass sein Mund ganz trocken war. Sein Blick wanderte zu der Frau. Ihr Gesicht war das eines jungen, hübschen Mädchens, und sie lächelte. Zwei Lagen Fell trug sie über ihrem Mantel, wohl gegen die Kälte, aber gleichzeitig war ihr Untergewand an mehreren Stellen aufgeschnitten, als wolle die Trägerin mehr von sich zeigen, als sittsam war. Sie war keine Hakul, die anderen auch nicht. Der Wächter straffte sich. Fremde? In Tiugar? Er sollte besser Alarm schlagen. Aber andererseits schienen die vier keine Waffen zu tragen. Baldims Gedanken verwirrten sich. Wie waren diese seltsamen Fremden überhaupt in die Stadt gelangt? Es gab nur einen Weg hierher, und der war bewacht. Der Wächter rückte seinen Gürtel gerade, fasste die Axt fester und rief den Fremden ein »Halt« entgegen.
Die Nebel ballten sich dichter zusammen. Der Wächter räusperte sich. Sein Ruf hatte heiser geklungen. Immer noch war sein Mund trocken. Die Fremden standen nur da und schienen ihn zu betrachten. Ihre Blicke gefielen ihm nicht. »Wer da? Was habt ihr hier zu suchen?«, fragte er rau.
Der Hüne legte den Kopf von einer Seite auf die andere, und der Wächter sah starke Halsmuskeln hervortreten und glaubte, Knochen knacken zu hören. »Es ist nur einer«, sagte der Hüne jetzt.
»Ein alter Mann«, spottete der Knabe.
Baldim straffte sich. »Es wird noch reichen, dich übers Knie zu legen, mein Junge.« Als er das sagte, widersprach ihm eine innere Stimme - sie warnte ihn, behauptete, dass er sich vor diesem schmächtigen Knaben in Acht nehmen sollte. Seine Hände verkrampften sich um den Griff seiner großen Axt. Der Älteste der vier zischte verächtlich. Aber jetzt hob die Frau eine Hand und schlenderte, nein, tänzelte näher heran. »Wie ist dein Name, Großvater?«, fragte sie mit einer Stimme süß wie Honig.
Unwillkürlich lächelte der Wächter. »Baldim werde ich genannt.«
»Gut, Baldim, sag uns, ist dies das Haus des Mannes, den ihr Tiudhan nennt?«
»Der Tiudhan ist tot«, stieß Baldim hervor. Eine, wie er sich eingestand, reichlich dumme Bemerkung.
»Zeitverschwendung«, polterte der Hüne.
Die Frau lächelte. Ihre Nähe verwirrte den alten Krieger. An ihr war etwas, das ihm die Sinne vernebelte.
»Wir wissen, dass er tot ist. Wir haben ihn getötet. Doch hier wird sein Nachfolger wohnen, und auch der Lichtstein ist hier. Ist es nicht so?«
Was hatte sie gerade gesagt? Getötet? Tiudhan Liwin war in der großen Schlacht gegen Slahan, die Gefallene Göttin, erschlagen worden. Sie redete Unsinn. Er beantwortete die Frage der Frau mit einem gestotterten »Ja«.
»Du bist eine Schwätzerin, Schwester«, spottete der Knabe. »Warum erzählst du ihm das?«
»Glaubst du, er weiß es nachher noch?«, fragte die junge Frau mit einem Lächeln, das das Herz des alten Kriegers schneller schlagen ließ. Ihre Nähe war so betörend.
»Wir wissen bereits, was wir wissen wollen, und dieses Tor ist kein Hindernis«, brummte der Hüne.
»Immer denkst du an Gewalt, Bruder«, rief die Frau heiter. »Ich bin sicher, Baldim wird uns mit Freuden einlassen, nicht wahr?«
Baldim nickte, hinkte zum Tor und stieß es auf. Der missmutige Alte huschte als Erster über die Schwelle. Noch immer hatte er kein Wort gesagt. Der Hüne bedachte den Wächter mit einem Blick zwischen Verachtung und Mitleid und folgte dem Älteren.
Der Knabe blieb auf der Schwelle stehen und betrachtete Baldim, wie ein Jäger ein Kaninchen betrachtet, das er gefangen hat.
»Siehst du. Es geht ohne Gewalt«, sagte die junge Frau. Der Wächter wünschte sich, sie würde endlich aufhören zu lächeln.
»Sie sind so schwach. Wir sind Narren, dass wir unsere Hoffnungen in sie setzten«, sagte der Knabe leise.
»Ich weiß. Aber wir haben nichts Besseres, liebster Bruder«, sagte die Frau und zog einen Schmollmund. »Lässt du ihn jetzt vergessen?«
»Gut, da mein Bruder es nicht für nötig hielt, ihn zu töten …«, erwiderte der Knabe mit einem bösen Lächeln.
Der Wächter runzelte die Stirn. Wovon redeten die beiden bloß? Er hörte sie, aber ihre Worte erreichten seinen Verstand nicht. Es war, als würden sie durch Watte sprechen. Da war nur der süße Mund des Mädchens, ein Hauch von Blumen und Frühling in der Luft. Baldim bemerkte, dass er schwitzte. Redeten die beiden über ihn? Plötzlich spürte er eine schmale Hand auf der Schulter. Sie war so überraschend kalt, dass er erschrocken zusammenzuckte. Der Knabe sah ihn durchdringend an. Baldim bekam von einem Augenblick auf den nächsten fürchterliche Kopfschmerzen. Tränen schossen ihm in die Augen. Er schloss sie, um den Schmerz zu lindern - vergebens. Blut rauschte in seinem Kopf. Er spürte Tränen - er, der alte Recke aus hundert Schlachten, fühlte Tränen des Schmerzes und der Angst über seine Wangen laufen. Rasch öffnete er die Augen wieder. Verschwommen sah er die Sonnenscheibe, die sich durch den Dunst kämpfte. Ächzend schüttelte er den Kopf. Der Schmerz fuhr plötzlich sein Rückgrat hinunter wie ein Stachel aus Eis. Sein Herz setzte aus. Seine Beine gaben nach. Für einen Augenblick glaubte Baldim, in der Ferne die immergrünen Weiden Marekets zu sehen. Dann brachen seine Augen, und er fiel tot zu Boden.
»Du hast ihn umgebracht, lieber Skefer«, stellte die junge Frau fest.
Der Junge zuckte mit den Achseln. »Er war alt und noch schwächer, als ich dachte.«
»Sie sterben so leicht«, wunderte sich seine Schwester.
»Und es werden noch viel mehr von ihnen sterben, bis wir erreichen, was wir wollen. Doch jetzt komm, Schwester, oder willst du diese Angelegenheit etwa Nyet überlassen?«
Die Frau lachte, schüttelte den Kopf und schritt leichtfüßig über die Schwelle. Der Knabe warf noch einen Blick auf den am Boden liegenden Wächter, als versuche er, den Schrecken, den er im Gesicht des Toten sah, zu verstehen. Dann wandte er sich mit einem weiteren Achselzucken ab und folgte seiner Schwester in das große Haus des Tiudhan.
Das Reich des Todes
AWIN STARRTE AUF die Gegenstände, die vor ihm auf dem Pflaster ausgebreitet lagen: Sein Dolch, die Bronzeschale, die Kerze, die Schale mit den Kräutern, der irdene Krug mit Wasser.
»Ich bin nicht sicher, ob du das Richtige tust, Yaman«, sagte Tuge. »Nein, eigentlich bin ich sogar fast sicher, dass du das Falsche tust.«
Er bekundete das nicht zum ersten Mal. Awin antwortete nicht. Er schloss die Augen, um sich zu sammeln. Es war längst alles gesagt. Seine Hand strich über die Pflastersteine. Sie waren fein behauen und kühl, und wenn er die Augen wieder öffnete, würden sie im reinsten Weiß erstrahlen. Nichts deutete darauf hin, dass hier vor gerade einmal zwei Monden ein furchtbarer Kampf ausgetragen worden war.
»Es sieht nach Regen aus. Kannst du denn bei Regen überhaupt …?« Der Bogner vollendete den Satz nicht. Schließlich schnaubte er unwillig, da er wohl eingesehen hatte, dass er keine Antwort bekommen würde. Awin hörte, wie Tuge sich umwandte, die Zeltbahn zurückschlug und sich anschickte, ihn zu verlassen. Dann blieb er stehen und sagte leise: »Möge Mareket dich leiten, Awin, und vor allem, möge er dich zurückbringen.«
Awin nickte gedankenverloren und lauschte auf die Schritte des Bogners, die sich langsam entfernten. »Bitte, ehrwürdiger Raschtar«, sagte er dann freundlich.
»Yeku meint, dass du nicht zurückkehren wirst. Er freut sich«, antwortete Mahuk Raschtar.
Awin öffnete die Augen. Der Ussar sah fast so aus wie damals, als sie sich zum ersten Mal begegnet waren, in jenem Birkenwäldchen vor der Festung Pursu: schwarzbärtig und finster, doch Awin konnte die Miene des Raschtars inzwischen weit besser lesen als früher. Sorge stand darin geschrieben. »Yeku sagt, die Seelenschlange wird dich holen.«
»Ich werde deinem Stock nicht den Gefallen tun, mich fressen zu lassen«, erklärte Awin ruhig. Mahuk brummte und verließ das Zelt. Dabei stützte er sich schwer auf den knorrigen Stab mit den drei geschnitzten Gesichtern, in den der Geist eines bösen Raschtars gebannt war. Awin sah Mahuk nach, bis auch er die schwarzen Decken hinter sich zuschlug.
Endlich war er allein. Jedenfalls beinahe. Ihm gegenüber stand eine Bahre. Merege lag reglos darauf, Merege, die genau an dieser Stelle Slahan, die Gefallene Göttin, bezwungen hatte. Sie hatte teuer für ihren Sieg bezahlt. Sie lag dort, bleich, ohne Leben, aber auch nicht tot, mit geöffneten, weiß leuchtenden Augen, und seit über sechzig Tagen hatte sich dieser Zustand nicht geändert. Draußen hörte er es flüstern. Da war Wela, die Schmiedin, die immer noch nicht verstand, warum er diese Gefahr auf sich nahm, nur um »die« zu retten. Er hörte auch Gunwa, seine Schwester, die sanft widersprach, aber sehr besorgt war, und Tuge, der sich Mühe gab, beide zu beruhigen. Awin atmete tief durch. Für einen kurzen Augenblick kehrte die Furcht zurück. Vielleicht ist es besser, Angst zu haben. Das verhindert, dass ich leichtsinnig werde, dachte er. Die Anspannung würde hoffentlich nachlassen, wenn er erst einmal mit dem Ritual begonnen hatte. Mit einem Mal konnte er den Sonnenuntergang nicht mehr erwarten. Er blickte zu den Wolken. Eine Schar Tauben, die die Viramatai so liebten, zog ihre Kreise über dem Hof. Gerade noch streifte das Sonnenlicht die Wolkenränder, aber lange konnte es nicht mehr dauern. Awin hatte auf das Dach des Zeltes verzichtet, denn die Überlieferung sagte, dass das Ritual der Reise unter freiem Himmel durchgeführt werden musste, damit der Geist bis zu den Sternen reisen konnte. Awin wusste, dass das nicht stimmte. Er selbst hatte die Reise schon in einer finsteren Kammer angetreten, damals, als sie in die Gänge von Uos Mund hinabgestiegen waren. Uos Mund. Ein unbegründetes Lächeln zuckte über Awins Lippen. Die Hakul erzählten sich, dass Uos Mund ein Zugang zur Unterwelt war. Er schickte sich nun an, einen anderen zu finden.
Er lauschte den Schritten auf der anderen Seite der Zeltbahn. Seine Freunde würden in der Nähe bleiben, als könnten sie ihm bei dem, was er nun vorhatte, helfen oder ihm beispringen, wenn er in Not geriet. Ich hätte ihnen nicht sagen sollen, was ich vorhabe, dachte Awin, obwohl er genau wusste, dass es sich nicht hätte vermeiden lassen. Er war auf den Rat von Mahuk angewiesen, der viel über die Geisterwelt wusste, und er brauchte Tuge, weil dieser kein Blatt vor den Mund nahm und Awin seine Entscheidungen überprüft wissen wollte. Er schüttelte noch einmal den Kopf über sich selbst. Am Anfang war es nur ein abwegiger Gedanke gewesen, geboren aus der Verzweiflung darüber, dass Tengwil ihm nicht mehr erlaubte, auf die Reise zu gehen. Wenn aber die Schicksalsweberin ihm nicht half, konnte er dann vielleicht eine andere Macht um Hilfe bitten? Als dieser Gedanke erst einmal geboren war, war er gewachsen, hatte sich selbständig gemacht und schließlich eine Antwort gegeben, die Awin nicht gefiel. Er hatte plötzlich gewusst, an wen er sich wenden musste, um Merege zu helfen, aber er wusste nicht, ob das ratsam, ja, ob es überhaupt möglich war. Er hatte Mahuk nach seiner Meinung gefragt, der sein Entsetzen kaum hatte verbergen können, dann Brami Vareda, die ebenso bestürzt gewesen war. Wela war von seinen langen Gesprächen mit der Priesterin nicht begeistert gewesen, auch, weil er sich zunächst geweigert hatte zu verraten, was er mit der Brami besprach. Vareda hatte ihm seine Fragen jedoch nicht beantworten wollen, indem sie behauptete, es überstiege ihr Wissen. Sie hatte um Rat in Dama gebeten, der Hauptstadt der Viramatai am Allsee, und Wela, die dann offenbar gespürt hatte, dass etwas Dunkles, Gefährliches im Gange war, hatte begonnen, sich Sorgen zu machen. Die Antwort war überraschend schnell gekommen: Die Hohepriesterinnen der Sonnentöchter rieten ihm dringend von seinem Vorhaben ab. Aber sie gaben zu, dass es möglich war, und das war es gewesen, was Awin hatte wissen wollen. Erst dann hatte er Wela und die anderen eingeweiht. Natürlich hatten auch sie versucht, ihm seinen Plan auszureden. Er hätte auf sie gehört, wenn er noch eine andere Möglichkeit gesehen hätte, aber die sah er nun einmal nicht. Alle Versuche zur Rettung Mereges hatten sich bisher als untauglich erwiesen, also musste er neue, dunklere Pfade einschlagen.
Awin dachte noch einmal verbittert an die Fehlschläge zurück, die sie erlitten hatten. Mahuk hatte ihn einmal gefragt, ob er seine Sehergabe verloren hatte, und Awin hatte eingestanden, dass es so war, doch eigentlich war das nicht ganz richtig. Seine Gabe war noch da, aber sie führte ihn immer nur an denselben finsteren Ort. Wie oft hatte er versucht, auf die Reise des Geistes zu gehen, und immer hatte es in einem schwarzen Raum geendet, der erfüllt war von leisen, aber furchterregenden Stimmen, und auch seine wenigen Träume führten ihn stets dort hin. Er hatte gehofft, Mahuk würde bei seiner langen Suche in der Wüste ein hilfreiches Kraut finden, aber der Raschtar war mit leeren Händen zurückgekehrt. Dann hatten sie in ihrer Verzweiflung sogar versucht, den leblosen Leib Mereges auf einer Trage zu den Kariwa zu bringen, in der schwachen Hoffnung, diese wüssten Rat. Auch das hatten viele wohlmeinende Menschen Awin ausreden wollen; zu weit und gefährlich sei der Weg, zu zahlreich seine Feinde. Er hatte sich durchgesetzt, allerdings waren sie nicht weit gekommen: Kaum hatten sie die Festung verlassen, hatte der Körper Mereges zu zittern begonnen. Sie hatten für einen kurzen Augenblick geglaubt, dies sei ein gutes Zeichen. Aber Mahuk hatte ihr ins Antlitz gesehen und gesagt: »Sie stirbt.«
Und dann hatte auch Awin gesehen, dass das Leben Merege endgültig verlassen wollte. Er konnte später nicht erklären, woran er das erkannt hatte, denn bis auf das Zittern schien sie unverändert, aber er hatte es gesehen. Erst als Merege wieder in der Festung gewesen war, hatte das Zittern aufgehört, und der letzte Rest Leben, der noch in ihr war, schien zu bleiben.
Jetzt lag sie vor ihm auf der Bahre, in ihrem schlichten schwarzen Gewand, und ihr helles Gesicht strahlte Ruhe aus. Wären ihre Augen geschlossen gewesen, hätte man sie für schlafend oder tot halten können, aber sie standen weit offen und schimmerten matt weiß. Die Pupillen waren verschwunden, so wie in dem Augenblick, als sie nach dem fürchterlichen Zweikampf mit Slahan zusammengebrochen war. Merege hatte von der Alten Kraft genommen, jener Kraft, die den Göttern vorbehalten war, und deren Quelle die verfluchte Göttin hier gefunden hatte. Und dann hatte die Kariwa Uo herbeigerufen, den Totengott, und der hatte den Kampf entschieden. Er hatte Slahan mitgenommen, die Gefallene Göttin - und Awin war sich inzwischen sicher, dass er auch Mereges Geist fortgeführt hatte in sein dunkles Reich. Dorthin wollte er nun selbst aufbrechen. Awin biss die Zähne zusammen. Er hatte lange genug überlegt und abgewogen. Seine Entscheidung war gefallen, er würde den Weg gehen - bis zum bitteren Ende, wenn es sein musste.
Er legte das Messer und die Bronzeschale zurecht. Awin versuchte sich zu sammeln und entzündete die plumpe Wachskerze, die vor ihm auf dem Boden stand. Er betrachtete nachdenklich den Beschwörungskreis, den die Seher zogen, wenn sie sich auf die Reise begaben, diese dünne Linie, die sie in die Erde oder in Lehmböden kratzten, damit ihr Geist nicht über den Rand der Welt abgetrieben wurde. Er hatte seinen mit schwarzer Kohle auf das weiße Pflaster gemalt. Brami Vareda und Mahuk hatten ihn bei seinen Vorbereitungen überwacht. Sie hatten überhaupt nur zugestimmt, weil er sie in die wichtigsten Geheimnisse des Rituals eingeweiht hatte, und sie hatten peinlich genau darauf geachtet, dass ihm keine Fehler oder Nachlässigkeiten unterliefen. Der Erdkreis war etwas, über das er lange nachgedacht hatte. Jetzt stand er kurz entschlossen auf und verwischte ihn mit dem Fuß. Er war nicht sicher, ob sein Ziel innerhalb der Welt lag. Noch einmal atmete er tief durch und sprach ein Gebet. Es konnte nicht schaden, Tengwil, die Schicksalsweberin, um ihren Schutz und ihren Beistand anzuflehen, auch wenn es dieses Mal nicht ihr Reich der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft war, das er betreten wollte.
Awin blickte zum Himmel. Die Sonne musste inzwischen untergegangen sein, und es sah wirklich nach Regen aus. Er füllte Wasser aus dem bereitstehenden Krug in die Schale, nahm das Messer, zog es durch seine Handfläche, bis etwas Blut hervorquoll, und ließ es in die Schale tropfen. Dann legte er sich die Kräuter, die Mahuk ihm gegeben hatte, auf die Zunge. Sie schmeckten bitter. Er setzte die Schale an und spülte sie hinunter. Anschließend lauschte er auf seine Atmung, beruhigte sie, atmete gleichmäßig ein und aus. Er sandte stumme Gebete an Tengwil und an Mareket, damit sie ihm halfen, dann räusperte er sich und sprach das aus, was gesagt werden musste: »Uo Jega«, begann er, und seine Stimme versagte. Es waren die Worte, die er von Merege gehört hatte, wenn sie den Totengott um Beistand anrief. Es fiel ihm schwerer als gedacht, den Namen dieses Gottes auszusprechen. Er unterdrückte die aufsteigende Furcht, räusperte sich erneut und flüsterte: »Uo Jega. Steh mir bei und geleite mich auf deinen Pfaden. Erlaube mir, dein Reich zu betreten. Erlaube mir, die verlorene Seele zu finden.«
Es gab kein Vorbild für das, was er vorhatte - noch kein Seher hatte Uo um Beistand für eine Reise des Geistes ersucht. Awin richtete seine Gedanken auf das dunkle Land des Todes. Er hatte sich lange den Kopf über die richtigen Worte zerbrochen, aber jetzt sagte er, was ihm in den Sinn kam. Er hatte ein großes Anliegen, und er konnte den Gott nur bitten, ihm zu helfen. Was konnten schöne Worte oder Schmeicheleien dazu beitragen? Er sprach zum Gott des Todes, da wollte er aufrichtig sein, denn er fühlte, dass er nur so zum Ziel gelangen konnte. Die Hakul glaubten daran, dass ihre Helden das nächste Leben auf den immergrünen Weiden des Gottes Mareket verbringen würden, und nur die Verstoßenen, die Verbrecher, die Ehrlosen, stiegen hinab in das Reich des Todes, das sonst allen Nicht-Hakul vorbehalten war. Ud-Sror nannten die Akkesch die Stadt, über die der Totengott herrschte. Awin hoffte inständig, dass er nicht in diese Stadt gehen musste, um Merege zu finden. Yeku hatte von dem großen, finsteren Wald erzählt, in den die Ussar nach ihrem Tod gingen, und er hatte ihn vor der Seelenschlange gewarnt, die durch das dichte Blattwerk kroch und die Seelen jener Ahnen verschlang, die von ihren Nachkommen vergessen worden waren. Yeku musste es wissen, denn er war dort gewesen, aber von den Ahnen seiner bösen Taten wegen zurückgeschickt worden.
Awin atmete tief und gleichmäßig, richtete seine Gedanken auf Merege und auf Uo. Er konnte sein Herz pochen hören. Er bat den Totengott um einen Gefallen und konnte nur hoffen, dass der große Uo das nicht als anmaßend auffasste. Awin wiederholte die Worte wieder und wieder im Geiste. Aber er wusste, dass er sie laut aussprechen musste, um seinen Willen, seine Ernsthaftigkeit unter Beweis zu stellen. Er fühlte die Beklemmung wachsen. »Uo Jega! Großer Gott des Todes, ich bitte um Einlass in dein Reich, lass mich die Seele finden, die ich suche. Und lasse uns zurückkehren aus deinem Land ohne Wiederkehr.«
Ein dumpfes Knacken sprang durch das Pflaster, und Awin fühlte es plötzlich absinken. Der Boden schien unter ihm nachzugeben. Awin schlug die Augen auf. Er lag in einer Grube. Grauer Sand rann über die Ränder herein. Die weißen Steinplatten des Platzes waren fort, die Kerze ebenso. Wieso lag er? Wann hatte er sich ausgestreckt? Awin blinzelte verwirrt. Der Morgen schien angebrochen zu sein. Es knackte wieder, fast wie brechendes Eis. Awin setzte sich rasch auf. Der Sand strömte schneller in die Grube und begann, seine Beine zu bedecken. Er begriff endlich, dass er sein Ziel erreicht hatte. Sein Geist war auf die Reise gegangen. Doch wo war er? Der Boden unter ihm sackte noch einmal ein Stück ab. Hastig kletterte Awin über den rutschenden Sand aus der Grube, robbte einige Schritte fort, bevor er anhielt, aufstand und sich umsah. Hinter ihm rutschte weiterer Sand in die neu entstandene Vertiefung. Es knackte wieder, und Awin sah einen schmalen Spalt, der von der Grube in die Ebene sprang. Er zog sich hastig einige Schritte zurück. Wo war er?
Die Landschaft, die sich vor ihm auftat, glich keiner, die er je gesehen hatte. Es war eine ebene Wüste, und der Boden, auf dem er stand, war steinhart. Awin fragte sich, wo der Sand hergekommen war, der ihn eben beinahe verschüttet hätte. Seltsame graue Türme, vielleicht auch Felsen, wuchsen in einen fahlweißen Himmel, der die Ebene in bedrückendes Zwielicht tauchte. Ein leises Seufzen wanderte durch den Boden, dann knackte es wieder. Die schmale Grube, aus der er geklettert war, schien sich zu einem Trichter zu weiten. Der steinharte Boden riss, verwandelte sich in Sand und geriet ins Rutschen. Awin drehte sich um und rannte viele Längen, bevor er innehielt. Er war an einem der Felsen angekommen. Verblüfft stellte er fest, dass er gemauert war. Tausende Lehmziegel waren hier aufgeschichtet worden - doch von wem? Awin konnte keine Menschenseele entdecken. Er strich nachdenklich über die verwitterten Ziegel. Unter seiner Berührung zerfielen sie zu Staub. Erschrocken zog er die Hand zurück. Der Turm erzitterte, aber er blieb stehen. Erst jetzt begriff Awin wirklich, dass er sein Ziel erreicht hatte: Er hatte das Land des Todes betreten. Es war nicht, was er erwartet hatte, denn dies waren weder die immergrünen Weiden Marekets, noch die Wälder der Ussar oder die meerumspülte Insel, zu der die Viramatai nach ihrem Tod aufbrachen. War es vielleicht doch Ud-Sror, die Totenstadt der Akkesch? Aber das war keine Stadt, nur eine verstreute Ansammlung von Türmen. Und wo waren die Bewohner? Sollte das etwa das Land sein, das die Kariwa nach ihrem Tod erwartete? Awin ging langsam weiter. Dieses Land war bedrückend leer, und nichts von dem, was er sah, schien auf Mereges Volk hinzudeuten. Sie hatte nicht viel über ihre Heimat erzählt, aber Awin wusste immerhin, dass es dort Berge gab, und in den Wintern das Land unter dichtem Schnee versank. Und hier fand er keine Spur von Schnee oder Eis und noch nicht einmal Berge.
Er hatte keine Ahnung, in welche Richtung er gehen sollte. Kein Wind, kein Tier und kein Zeichen wiesen ihm den Weg. Er zog in Erwägung, auf einen der Türme zu klettern. Vielleicht waren nicht alle in einem so erbärmlichen Zustand wie jener, den er nun hinter sich ließ. Er lief zum nächsten Turm, der einige hundert Schritt entfernt aus der Ebene ragte. Bevor er ihn erreichte, hörte er hinter sich ein klagendes Seufzen. Er drehte sich um und hoffte, einen Menschen dort zu sehen, aber es war nur der Turm, den er verlassen hatte. Er neigte sich zur Seite und fiel in sich zusammen. Mit Entsetzen sah Awin, dass der ganze Boden dort absackte. Der Trichter schien immer weiter zu wachsen. Er hastete fort, ließ den nächsten Turm links liegen und hielt auf den übernächsten zu. Erst dort blieb er keuchend stehen. Die Ziegel waren ebenso verwittert wie die des ersten Turmes. Er suchte nach einem Eingang, aber er fand keinen, nur schmale Schlitze, die vielleicht etwas Licht ins Innere ließen. Er rief nach den Bewohnern, auch wenn er sich fast sicher war, dass er hier keine finden würde. Seine Stimme klang laut über die Ebene, viel zu laut. Wie erwartet, bekam er keine Antwort. Er beschloss, den Turm zu erklettern, aber schon bei seiner ersten Berührung verwandelten sich die Ziegel zu Staub, und er gab sein Vorhaben schnell wieder auf. Das dumpfe Knacken, das er bei seiner Ankunft gehörte hatte, schien ihn weiter zu verfolgen. Immer wieder warf er Blicke über die Schulter. Die Türme hinter ihm standen noch. Awin lief weiter, ohne eine Vorstellung zu haben, wohin er sich wenden sollte. Würde Merege hier irgendwo in einem der Türme sitzen und warten? Er rief von Zeit zu Zeit nach ihr, aber er bekam nicht einmal ein Echo als Antwort. Seine Stimme wurde von der Weite der Ebene einfach verschluckt. Dann fiel ihm etwas auf. In großer Entfernung erhob sich ein Turm über all die anderen, die in dieser Wüste aufragten. Wie weit mochte er weg sein? Awin schüttelte den Kopf. Das war doch unwichtig, er musste dorthin, so viel war sicher. Sicher? Was ist hier schon sicher?, widersprach seine innere Stimme. Er hörte nicht auf sie und machte sich auf den Weg.
Stunde um Stunde wanderte Awin über den harten Boden, den einen, hohen Turm immer fest im Blick. Den anderen Türmen schenkte er schon längst keine Beachtung mehr. Allmählich wurde er müde, und obwohl er schon so lange lief, schien sein Ziel kaum näher gekommen zu sein. Die Sonne geht bald auf, sagte eine dunkle Stimme, die Awin bekannt vorkam. Ich kann es nicht ändern, antwortete trocken eine zweite. Er blieb stehen und sah sich um. Türme verloren sich in der Ferne. »Ist hier jemand?«, rief er. Aber er bekam keine Antwort. Seine Sinne spielten ihm offenbar einen Streich. Dann wurde Awin klar, was die erste Stimme gesagt hatte. Die Seher wussten, dass der Sonnengott Edhil keine Sterblichen auf der Ebene des Geistes duldete. Daher konnte diese Reise nur nachts angetreten werden. Die einen sagten, das grelle Licht würde die Kerze überstrahlen, die dem Geist des Sehers den Rückweg zeigte, andere behaupteten, die Hitze der Sonne würde jeden verbrennen, der sich am Tage noch auf dieser Ebene aufhielt. Awin biss die Zähne zusammen und lief schneller. Hier war es weder hell noch dunkel. Dämmriges Zwielicht, fast wie beim Morgengrauen, beherrschte die Wüste, und es war unmöglich zu sagen, wann hier der Tag anbrechen würde. Awin erkannte bald, dass der hohe Turm sich auch in seiner Form von den anderen unterschied. Er schien nur im unteren Teil gerade aufzuragen, sich aber in seinem oberen Drittel stark zur Seite zu neigen. Awin hielt an, denn seine Füße schmerzten, und er brauchte eine Rast. Er musste schon viele Stunden unterwegs sein. Oder täuschte er sich da? Die Sonne war nicht aufgegangen, das Donnern des Sonnenwagens, das er bei einer seiner früheren Reisen vernommen hatte, blieb bislang aus. Aus der Ferne klang schwach ein leises Geräusch herüber, beinahe wieder wie das Knacken in brechendem Eis. Awin hielt nach dem Ursprung des Geräusches Ausschau. Eine Staubwolke stand über der Ebene, und es schien, als seien die Türme dort, wo er herkam, verschwunden. Stöhnend setzte er seinen Marsch fort. Der Schmerz in den Füßen wurde schlimmer, aber er marschierte weiter, Stunde um Stunde. Er hatte noch nie gehört, dass ein Seher so lange auf der anderen Seite verweilt hätte. Außer jenen, die nie zurückgekehrt sind, sagte eine innere Stimme. Er überhörte sie und humpelte weiter voran.
Er sollte es erfahren, sagte plötzlich eine weibliche Stimme, die ihm bekannt vorkam. Das war nicht der erste Bote, und die Antwort wäre die gleiche wie beim letzten Mal, antwortete eine feste männliche Stimme. Aber die Frage ist eine andere, widersprach die erste. Awin reckte sich, aber die Stimmen waren verstummt. Er rief nach den Sprechern, bekam aber keine Antwort. Er schüttelte den Kopf und war sich bald sicher, diese sinnlosen Sätze nur geträumt zu haben. Er fühlte sich erschöpft und durstig. Wann hatte er zuletzt getrunken, wann gerastet? Offenbar konnte sein Geist weder ruhen noch schlafen, während er hier war. Er hielt an. Wo war er eigentlich? Er sammelte sich, denn er spürte, dass sein Geist begann, sich zu verwirren. Das durfte er nicht zulassen. Er war Awin, der Seher vom Klan der Schwarzen Dornen, und er war in das Reich des Todes gereist, um Merege zurückzuholen. Das sagte er sich immer wieder, während er weiterstapfte und versuchte, den Schmerz in seinen Füßen auszublenden.
Die Zahl der Türme, die vor ihm lagen, nahm jetzt ab, und sein Ziel schien bald zum Greifen nahe zu sein. Awin erkannte, dass es kein Turm war, sondern ein Tor - vielmehr ein zur Hälfte eingestürzter Torbogen, der sich in gewaltiger Höhe über die Ebene erhob. Es sah irgendwie falsch aus. Der Bogen stieg in kühnem Schwung auf, überstieg den Scheitelpunkt und brach dann jäh ab. Aber was hielt die gewaltigen Blöcke, aus denen er gemauert sein musste, dort oben? Awin lief weiter. Er würde es vielleicht verstehen, wenn er dort war. Und vielleicht würde er auch Merege dort finden. Der Torbogen rückte langsam näher. Noch nie hatte Awin ein so großes Bauwerk gesehen. Es würde selbst den höchsten Turm von Pursu überragen, obwohl dieser auf einem gewaltigen Felsen erbaut war. Der Bogen war grau und wirkte uralt. Awin biss die Zähne zusammen und verdoppelte noch einmal seine Anstrengungen. Ihm war, als würde dort im Schatten jemand sitzen. Ein fernes Donnern drang an seine Ohren. Für einen kurzen Augenblick fürchtete er, der Sonnengott würde doch noch erscheinen und ihn verbrennen, aber dann begriff er, dass das Geräusch aus der Ebene hinter ihm kam. Er blickte über die Schulter zurück. Die Staubwolke, die hinter ihm die Türme verschlang, war bedrohlich angewachsen. Sie schien bereits die halbe Wüste verschluckt zu haben. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie auch den Torbogen erreichen würde. Awin war so gebannt von der schnell wachsenden Wolke, dass er stolperte, als er die erste Stufe erreichte. Unversehens war er angekommen. Zwei Dutzend flache Stufen führten hinauf, und oben im Schatten saß eine dunkel gekleidete Gestalt. Merege? Er wollte rufen, doch die Stimme versagte ihm. Er sprang schnell die breiten Stufen hinauf, blieb dann jedoch stehen. Das war nicht Merege. Eine schlanke Gestalt saß dort, in dunkelgrauem Gewand und mit schwarzem Haar. Die Gestalt erhob sich. Es war ein Mann, sicher einen ganzen Kopf größer als Awin, sein Gesicht war fahl weiß wie der Himmel und beherrscht von zwei schwarz schimmernden Augen, deren Blick schwer zu ertragen war, und es schien, als sei diese Gestalt von Schatten eingehüllt, die wie Rabenflügel aus ihren Schultern wuchsen.
»Ich grüße dich, Awin«, sagte der Fremde und zeigte seine nadelspitzen Zähne.
Awin nickte stumm.
»Wir haben lange auf dich gewartet. Aber endlich bist du hier.«
»Gewartet?«, fragte Awin heiser.
»Wir haben dich gerufen. Hast du uns nicht gehört? Ich habe dich gesehen, in der schwarzen Kammer deines Geistes. Aber du bist unseren Rufen nicht gefolgt.«
»Aber wer bist du?«, stieß Awin hervor. Er fror - dieses Wesen schien Kälte auszuströmen. Jähe Zweifel überfielen ihn. Würde diese Schrecken erregende Gestalt ihm helfen können - und wollen? War dies überhaupt das Totenreich der Kariwa?
Die Gestalt starrte ihn unverwandt an. Sie schien erst über die richtige Antwort nachsinnen zu müssen. »Ich bin Uqib, der Seelenverweser dieses Landes, und treuer Diener Uos. Auf dieser Schwelle sitze ich und befrage die Toten, entscheide, ob sie eintreten dürfen, oder nicht.«
Awin war erschöpft und verwirrt. Er versuchte zu verstehen, was die Gestalt meinte. »Aber - hier ist doch niemand?«, sprach er das Offensichtliche aus.
»Du bist hier, Awin Sehersohn«, erklärte Uqib, »doch hast du Recht. Es sind schon lange keine Seelen mehr durch dieses Tor gewandert. Hierher kamen einst die Seelen der Nurbai. Doch ihre Städte wurden zerstört und ihr Volk in alle Winde zerstreut, wie es so oft in eurer Welt geschieht. So gerieten ihr Glaube und ihre Ahnen in Vergessenheit. Niemand gedachte noch der Toten oder brachte ihnen Opfer, und so verblassten ihre Seelen und gingen auf im großen Ahngeist, aus dem die neuen Seelen geschöpft werden. Dies ist ein leeres Land. Es stirbt. Und nun kommst du und bringst das Ende.«
»Ich?«, fragte Awin erschrocken.
»Sieh dich um«, forderte der Seelenverweser.
Als Awin der Aufforderung nachkam, sah er, dass die Staubwolke bedrohlich nahe gerückt war.
»Das Land ist alt, längst hat Uo es aufgegeben, und seinen treuen Diener hatte er schon fast vergessen. Deinetwegen hat er sich meiner erinnert. Nun zerbricht mein Reich unter den Schritten des Wanderers, der hier und doch nicht hier ist. Durch dich, Seher.«
Awin hörte keine Spur von Trauer in der dunklen Stimme. »Wie lange wartest du denn schon auf mich?«, entfuhr es ihm.
Uqib lachte heiser. »Zeit spielt hier keine Rolle mehr.«
Awin war anderer Ansicht. Die Staubwolke und mit ihr der gewaltige Trichter, den sie verschleierte, würde das Tor bald erreichen. Er hörte schon das beunruhigende Krachen des brechenden Bodens. Er durfte keine Zeit mehr verlieren. »Du weißt, weshalb ich hier bin? So kannst du mir helfen, ehrwürdiger Uqib?«, fragte er schnell, als Uqib nach der ersten Frage nickte.
Die Gestalt schien die flügelartigen Schatten jetzt enger um sich zu ziehen und nachzudenken, bevor sie antwortete. »Ja, ich kann dir helfen. Doch steht noch nicht fest, dass ich es tue.«
»Was heißt das?«, drängte Awin.
»Du musst mir etwas geben, bevor ich dir den Weg zeigen darf.«
»Etwas geben?«
»Du bist hier, um etwas mitzunehmen. Also musst du dafür etwas geben. So will es der Totengott, Seher.«
Awin durchsuchte mit fahrigen Händen die Taschen seines Gewandes, doch vergebens. »Ich habe nichts!«, rief er. Das Brausen in der Wüste war so laut geworden, dass er die Stimme heben musste.
Uqibs schwarze Augen starrten ihn durchdringend an. »Du hast eine Gabe«, sagte er schließlich.
Awin erbleichte. »Du willst mir meine Gabe nehmen?«, fragte er.
»Nutzt sie dir denn noch?«
»Sie hat mich hierhergeführt!«
»Weil Uo es wollte«, sagte Uqib. »Er hat seine Hand auf deine Gabe gelegt, denn er hat bemerkt, dass du ihn gesehen hast. Dies kann nicht geduldet werden.«
»Aber wie soll ich Merege finden, wenn …«
Wieder unterbrach ihn der Seelenverweser. »Ich werde dir den Weg weisen, Wanderer, denn deshalb haben wir dich gerufen. Uo will, dass du die Kariwa fortbringst, denn sie sitzt vor der Pforte, und dort gehört sie nicht hin.«
Awin musste sich anstrengen, um ihn zu verstehen, denn starker Wind war aufgekommen, er wehte den Staub der sterbenden Wüste heran. »Aber warum hat er sie dann mitgenommen?«, rief Awin über das Brausen des Sandes.
»Hat er das? Oder ist sie ihm gefolgt?«, erwiderte Uqib. Es klang beinahe höhnisch. »Nun? Entscheide dich, Seher. Willst du geben, was ich verlange, oder bleiben und zusehen, wie dieses Land vergeht?«
Der Wind zerrte an Awins Gewand. Wenn es keinen anderen Weg gab, würde er eben auf seine ohnehin nutzlos gewordene Gabe verzichten. »Ich gebe sie«, rief er.
»Dann geh über diese Schwelle, Wanderer. Du kannst auf der anderen Seite finden, was du suchst.«
Awin erwartete, dass er etwas spüren würde. Aber nichts geschah. In gebührendem Abstand lief er am Seelenverweser vorbei, auf die Schwelle des halben Torbogens zu. Doch plötzlich tauchte Uqib dicht vor ihm auf. Awin prallte erschrocken zurück. Der Seelenverweser beugte sich zu ihm herab und flüsterte: »Noch eines, Wanderer. Du wirst keinem Sterblichen berichten, was du gesehen und gehört hast. Du wirst keinem Menschen erzählen, was du getan hast, und auch, dass du mich getroffen hast, wird vor Deinesgleichen ungesagt bleiben.«
Awin nickte stumm. Die Kälte in Uqibs Nähe raubte ihm den Atem. Dann war die Gestalt plötzlich verschwunden. Awin stand auf der Schwelle. Vor ihm breitete sich eine endlose Ebene aus. Sie schien sich nicht im Geringsten von jener zu unterscheiden, die er gerade hinter sich lassen wollte, nur dass es dort keine Türme gab. Er spürte ein unheilvolles Knistern, das durch die Steine lief. Ein lautes Krachen ertönte und ein riesiger Felsbrocken löste sich aus dem Torbogen und fiel herab. Awin hob den Fuß, um die Schwelle zu überschreiten, aber wieder zögerte er. Was, wenn der Seelenverweser ihn getäuscht hatte, und er nun für immer in das Land des Todes ging? Über ihm zerbrach der Bogen. Awin biss die Zähne zusammen und trat hinüber.
Er stolperte, denn sein Fuß suchte eine Stufe, die dort nicht war. Verblüfft hielt er inne. Er stand im Schnee. Vor ihm ragte ein Berg in einen bleigrauen Himmel. Er drehte sich um. Das Tor, die Wüste, der Seelenverweser - das alles war fort. Stattdessen fand er sich am Hang eines felsigen Berges wieder. Schneefelder zogen sich über seine Flanken bis in eine geröllübersäte Ebene. Wo war er? War Merege hier irgendwo? Er rief nach ihr, aber er bekam keine Antwort. Er beschloss, sich einen Überblick zu verschaffen, und begann, den Berg nach oben zu klettern. Er fragte sich, was eben geschehen war. Hatte er wirklich seine Gabe verloren? Wie sollte er dann zurückfinden? Würde er einer jener Seher sein, die von der Reise des Geistes nicht zurückkehrten? Lag vielleicht auf der anderen Seite des Berges der Rand der Welt, über den er stürzen würde, um dann für alle Zeit durch das Nichts zu treiben, das die Welt umgab?
Er schafft es nicht, sagte eine leise Stimme. Ist denn überhaupt sicher, dass er noch lebt?, fragte eine zweite, weibliche Stimme. Sie klang hart. Ich sehe seinen Atem, antwortete eine dritte. Er sollte bald zurückkehren, sonst entscheiden wir diese Frage ohne ihn, erklärte wieder die harte Stimme.
Awin blieb stehen und lauschte. Er war alleine am Berg. Wo kamen diese Stimmen her? Ihm war, als würde er sie immer noch sprechen hören, doch waren sie so leise, dass er sie nicht mehr verstand. Etwas an diesen Stimmen war ihm vertraut erschienen, aber er konnte sich nicht erinnern, woher. Erwarteten ihn die Sprecher vielleicht hinter der nächsten Felsengruppe? Er ging weiter, um nachzusehen. Aber da war niemand. Merege, dachte er. Ich bin hier, um Merege zu suchen. Das darf ich nicht vergessen. Trockene Gräser hatten Wurzeln im Geröll geschlagen. Es waren die ersten Pflanzen, die er sah, seit er sich hier befand, auch wenn er nicht wusste, wo dieses »hier« war. Er beschloss, das Gras als gutes Zeichen zu nehmen, und setzte seinen Aufstieg fort. Es wurde rasch kälter. Er kam nur langsam voran, denn das Geröll unter seinen wunden Füßen war tückisch, gab oft unter seinem Gewicht nach, und es war Kraft raubend, sich nach oben zu arbeiten. Er blieb von Zeit zu Zeit stehen, um sich umzusehen und nach Hinweisen Ausschau zu halten. Schwarze Büsche zeigten sich zwischen den Steinen. Sie trugen kein Blatt und keine Blüte. Als Awin aufblickte, sah er, dass dichtes Gestrüpp dieses kahlen Buschwerks auf ihn wartete. Es hatte sich in die Flanke des Berges gekrallt, und die Zweige hatten sich ineinander verflochten, als müssten sie sich gegenseitig Halt geben. Oberhalb davon leuchteten weite Schneefelder. Awin hatte jegliches Zeitgefühl verloren, und die tiefe Müdigkeit, die der Anspannung am Tor gewichen war, kehrte bleischwer zurück. Er biss die Zähne zusammen und kletterte weiter.
Als Awin sich durch die schwarzen Gewächse kämpfte, setzten sie sich mit langen Dornen zur Wehr. Sie durchbohrten Kleidung und Haut, und bald blutete Awin aus vielen kleinen Wunden. Aber er ließ sich nicht aufhalten. Irgendwann wuchs das Buschwerk spärlicher und Awins Fuß trat in weichen Schnee. Er zog Dornen aus seinen Beinen und Armen, noch während er weiterging. Nach einer Weile war ihm, als würde er ein leises Murmeln hören. Er folgte dem Geräusch und stieß auf einen kleinen Bach, eigentlich nur ein Rinnsal, das über die Steine ins Tal floss. Awin war sich nicht sicher, ob er durstig war oder nicht, aber er nahm einen Schluck kalten Wassers und wusch sich das getrocknete Blut ab. Mitten in der Bewegung hielt er inne. Er hörte Stimmen und hielt den Atem an. Die Stimmen kamen aus dem Rinnsal. Der Regen. Er holt sich noch den Tod, murmelte es. Niemand betritt den Kreis. Aber der Kreis ist gar nicht mehr zu erkennen. Lass mich wenigstens die Kerze entzünden. Awin lauschte, aber die Stimmen verebbten.
Regen? Hier gab es keinen Regen. Awin richtete sich auf. Er war die ganze Zeit nur vorangehastet und hatte sich lange nicht mehr umgesehen. Zu seiner Linken erhob sich der Berg, zu seiner Rechten zogen sich schwarze, zerklüftete Felsen bis zum Horizont hin, und vor ihm öffnete sich ein schmales Tal. Schnee deckte die Hänge, aber er taute zu vielen kleinen Rinnsalen, die ins Tal hinabsprangen und einen breiten Bach speisten. Awin folgte diesem Gewässer. Die Luft war klar und kühl, der Bach schlängelte sich durch den Talgrund, und dichtes Gras deckte den Boden. Einsam reckte ein knorriger Baum seine kahlen Äste in den Himmel. Awin ging langsam weiter. Wo war er nur? Und warum war er hier? Er blieb stehen. Es gab einen Grund. Awin sammelte sich. Er spürte, dass sich sein Geist hier verlieren konnte, also versuchte er, sich zusammenzureißen. Merege! Er wusste wieder, weshalb er aufgebrochen war: Merege. Daran hielt er sich fest, während er weiterwanderte.
Immerhin war es in diesem Hochtal viel besser als in der Wüste. Es wirkte friedlich, das Gras war rau, aber üppig, das Wasser frisch. In gewisser Weise strahlte der Ort Ruhe und kühle Schönheit aus. Doch etwas fehlte Awin. Er brauchte eine Weile, um zu erkennen, was es war: Farben. Die Bäume streckten schwarze Äste in einen bleigrauen Himmel ohne Wolken, das Gras deckte den Boden, als sei es nur ein Schatten, und das Wasser floss farblos über blasse Steine. Hier gab es weder grüne Weiden noch blauen Himmel. Er hob seine zerkratzte Hand. Dunkelgraue Narben zogen sich über seine bleiche Haut. Also war selbst das Blut ohne Farbe. Er hastete weiter und merkte erst nach einer Weile, dass er auf einen Pfad gestoßen war, der sich das Tal hinabwand. Er folgte ihm. Die Felsen traten zurück, und dann bot sich ihm ein beeindruckendes Bild. Er stand über einer Bucht, die von steilen, schwarzen Felsen gesäumt war. Zu seinen Füßen schäumte ein graues Meer gegen eine weit geschwungene Küste. Ferner Rauch stand über den Bergen und zeichnete sich dunkel vor dem bleifarbenen Himmel ab. Der Pfad schwenkte nach links über einen schmalen Streifen Land zwischen Bergen und See. Ein seltsames Gefühl der Vorfreude erfüllte Awin. Er sah zwei hohe Steinsäulen, die sich über dem Pfad aneinanderlehnten. Er freute sich darauf, dieses Tor zu durchschreiten, auch wenn er den Grund nicht nennen konnte. Er fühlte sich leicht. Als er näher kam, sah er, dass die beiden Säulen nicht von Menschenhand behauen, sondern von der Natur in ihre Form gebracht worden waren. Sie rahmten den Pfad wie ein hohes, schmales Tor. Eine niedrige Mauer aus verwitterten Steinen strebte zu beiden Seiten fort. Auf der einen Seite endete sie im Meer, auf der anderen zog sie sich noch ein Stück einen Hang hinauf. Ihre Bruchsteine waren mit Moos bewachsen. Im Schatten der Säule kauerte eine schlanke Gestalt, den Kopf leicht an die Säule gelehnt, als würde sie am Stein lauschen.
»Merege!«, rief Awin.
Die Kariwa blickte auf und nickte ihm zu. »Ich grüße dich, Awin. Ist es nicht schön hier?«
Sie schien sich gar nicht über seine Anwesenheit zu wundern. Aber auch Awin kam es wie das Natürlichste der Welt vor, dass er die Kariwa an genau diesem Ort traf.
Er zuckte mit den Achseln. »Schön? Ich weiß nicht.« Er blickte sich um. Die steilen Felswände bedrückten ihn, und das graue Meer, dessen Wellen gegen das Ufer brandeten, schien ihm plötzlich bedrohlich. Er sah weiße Punkte, die in der Ferne über das Wasser dahinschossen.
»Was sind das für Vögel?«, fragte er, weil er nicht wusste, was er sagen sollte.
»Seemöwen. Wären sie näher, könntest du sie rufen hören«, antwortete die Kariwa. Beim letzten Satz klang sie traurig.
»Es ist zu still hier«, stellte Awin plötzlich fest.
Merege stand auf. »Mir reicht es, wenn ich das Meer rauschen höre.«
»Aber es rauscht gar nicht!«, erwiderte Awin, dem das gerade erst aufgefallen war.
Merege sah ihn verunsichert an.
»Das Meer ist still, die Vögel rufen nicht«, sagte er leise. Seine eigene Stimme schien ihm unangemessen laut und rau zu sein. »Ich bin einem Bach gefolgt. Aber ich glaube, selbst sein Murmeln habe ich mir eingebildet, denn ich habe Stimmen im Wasser gehört.«
»Wasser«, echote Merege und wandte sich ab. Sie blickte über die niedrige Mauer hinweg. »Auf der anderen Seite dieser Mauer liegt unser Dorf«, sagte sie.
»Warst du dort?«, fragte er.
Sie schüttelte den Kopf. »Alle anderen sind dort. Aber sie lassen mich nicht durch das Tor.«
Awin blickte auf die beiden hohen Steine, die sich über dem Weg aneinanderlehnten. Niemand war dort. Es sah verlockend aus. Er war versucht, einfach durch das Tor zu gehen, um zu erfahren, was er auf der anderen Seite vorfinden würde. Aber da war etwas in den schwachen Schatten hinter dem hohen Tor, das ihn schaudern ließ. Es war unsichtbar, aber er konnte seine Anwesenheit fühlen. Er spürte: Dort wartete ein anderer Seelenverweser, und der würde niemanden, der über die Schwelle dieses Tores trat, je zurückkehren lassen.
»Sie wissen, dass du nicht hier sein solltest«, sagte Awin vorsichtig. »Und ich denke, wir sollten gehen, Merege.«
Sie drehte sich zu ihm um, legte den Kopf schief und lächelte. »Ich will nicht gehen. Mir gefällt es hier. Es ist ruhig. Niemand streitet. Es ist nicht wie bei Deinesgleichen. Der Wind bringt immer frische Luft, und bald werden hier die Schneeglöckchen ihre Köpfe zeigen und den Frühling ankündigen.«
»Hier geht gar kein Wind, Merege, und ich glaube nicht, dass er jemals wehen wird. Sieh dich um - das Gras ist grau, der Boden und das Meer ebenso. Ich nehme an, dass selbst die Blumen ohne Farben sein werden, wenn sie denn je hier erblühen. Vielleicht ist hier auch immer Winter, denn da, wo ich herkomme und wohin wir nun gehen sollten, hat der Frühling längst begonnen.«
Merege legte die glatte Stirn in Falten und widersprach: »Wie kann das sein? Ich bin doch noch keinen Tag hier. Und gegangen bin ich, als Winter war.«
Awin streckte die Hand aus. »Du bist schon viele Tage hier. Zu viele. Komm, deine Freunde warten auf dich.« Er versuchte, Zuversicht auszustrahlen, obwohl er keine Ahnung hatte, wie er sie von diesem Ort fortbringen sollte.
»Freunde? Ich bin eine Wächterin des Tores. Ich habe keine Freunde. Schon gar nicht unter den Hakul. Niemand vermisst mich«, entgegnete Merege nachdenklich.
»Und warum bin ich dann hier?«, fragte Awin.
Merege sah ihn ernst an. »Das weiß ich nicht. Warum bist du hier?«
»Das kann ich dir erklären, doch nicht im Schatten dieses Tores, Merege. Komm, wir gehen ein Stück.« Er war sich plötzlich sicher, dass er sie von diesem Tor fortlocken musste, um mit ihr zurückzukehren. Noch immer hielt er seine Hand ausgestreckt.
»Kann ich hierher zurückkommen?«, fragte sie unschlüssig.
»Jederzeit«, versprach Awin.
Ihre Hand war kühl. Er zog Merege vom Tor weg. Er war sich sicher, dass er mit ihr nur bis zur nächsten Biegung gehen musste. Hinter der Biegung schien es heller zu werden. Die Kariwa ließ sich ziehen. Es schien ihr nicht wichtig zu sein, wohin sie gingen. Sie bogen um die Felsen. Licht schien auf den Pfad. Plötzlich blieb sie stehen.
»Hörst du das?«, fragte sie.
Awin lauschte. Ein ferner Donner klang über das Meer. Er erbleichte. Das Licht! Wenn Edhils Sonnenwagen hier erschien, waren sie verloren.
»Das ist das Meer«, sagte Merege.
Mir ist gleich, was du sagst, ich werde jetzt zu ihm gehen, erklärte eine helle Stimme.
Wela, nein!, rief jemand.
Vier Tage liegt er nun schon im Regen. Ich wecke ihn.
Das Meer donnerte ans Ufer. Nein. Es war weder das Meer noch Edhils Sonnenwagen. Es war Awins Herz, das laut schlug und ihn zurückrief ins Leben. »Du hörst es auch?«, fragte er Merege.
Sie sah ihn verwundert an. »Das Meer, wie ich es sagte. Wenn wir zum Tor gehen, kannst du es noch besser hören.« Sie drehte sich um und schickte sich an zurückzugehen.
»Nein!«, rief Awin und hielt sie am Arm fest. Unter ihm tat sich plötzlich ein Abgrund auf, und er stürzte. Und die Kariwa stürzte mit ihm. Dort unten brannte ein feuriger Kreis, und sie stürzten in rasender Geschwindigkeit darauf zu. Nackte Angst durchflutete Awins Körper, aber er ließ Merege nicht los. Der Donner wurde lauter, so laut, dass sein Kopf dröhnte. Und gerade, als er glaubte, der Schmerz würde ihm den Schädel sprengen, endete der Sturz und alles um Awin herum war Nacht und Ruhe.
Die Stille endete.
»Siehst du. Ich habe ihn geweckt«, stellte eine Stimme befriedigt fest. Awin schlug die Augen auf. Über sich sah er Welas Gesicht im flackernden Licht einer Fackel. Ihr Haar klebte ihr nass an den Schläfen. Er richtete sich ruckartig auf. Alles um ihn herum drehte sich. Er fühlte Schmerzen im ganzen Körper. Er stützte sich auf seine zitternden Arme und hustete sich die Seele aus dem Leib. Menschen waren um ihn herum, sie klopften ihm aufmunternd und offenbar glücklich auf den Rücken, was es nicht besser machte. Da waren Tuge, Wela, seine Schwester Gunwa, der junge Mabak, sogar der stille Karak und auch die Priesterin der Sonnentöchter. Awin wich ihren Fragen aus und versuchte, tapfer zu lächeln, aber er fühlte sich elend wie selten in seinem Leben, seine Füße schmerzten, und als er die Stiefel auszog, stellte er fest, dass er sie blutig gelaufen hatte. Ganz allmählich verstand er, dass seine Reise volle vier Tage und Nächte gedauert hatte, und dass alle schon befürchtet hatten, er sei verloren, zumal der Regen die Kerze gelöscht und den schützenden Kreis weggewaschen hatte. Awin nahm das nickend zur Kenntnis. Dass nicht der Regen den Kreis zerstört hatte, konnte er ihnen noch früh genug erzählen. »Aber die Kerze brennt doch«, sagte er in seiner Verwirrung.
1. Auflage
Originalausgabe Oktober 2010 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © 2010 by Torsten Fink
Umschlaggestaltung: HildenDesign München
Lektorat: Simone Heller
HK · Herstellung: sam
eISBN 978-3-641-05100-6
www.blanvalet.de
Leseprobe
www.randomhouse.de