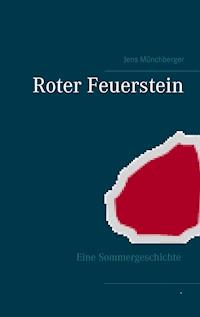Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf einer Vulkaninsel im Atlantik, einem Naturparadies, trifft sich der Biologe Professor Zabert mit Kollegen und Freunden. Zugleich erschüttern gesellschaftliche Auseinandersetzungen den Südwesten Europas und überschatten zunehmend den Aufenthalt der Gruppe auf der Insel und die Gespräche über politische und ökologische Themen. Die Sorge um eine Rückkehr in die Heimat beginnt den Aufenthalt auf der Insel zu dominieren ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Handlung und alle Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit der Realität sind zufällig, manchmal auch beabsichtigt.
Der Verfasser.
Für Ute, die mit mir die Insel im Atlantik erkundete...
„Vielleicht gibt es schönere Zeiten, aber diese ist unsere.“
(Jean-Paul Sartre, 1905 – 1980, französischer Philosoph und Schriftsteller)
„...Ich glaube, dass die Menschheit 'mal in Frieden lebt und es dann wahre Freundschaft gibt...“
(Die Toten Hosen: „Wünsch' dir was“)
„...Und nicht über und nicht unter
ander'n Völkern woll'n wir sein...“
(Bertold Brecht „Kinderhymne“)
„Gibt es den Reichtum der Welt morgen noch?
Oder ist vieles davon schon hin?
Das Land und auch die Ozeane
können sich nicht wehr'n...“
(Holger Biege: „Reichtum der Welt“)
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Der erste Tag
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Zweites Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Der vierte Tag
Der fünfte Tag
Der sechste Tag
Der siebente Tag
Epilog
Erstes Buch
1
Jemand klingelte. Fünfmal oder sechsmal. Und dann noch einmal. Das war genau um acht Minuten vor halb zehn am Vormittag.
Weil ich nicht schnell genug an der Tür war, wurde der Brief durch den Schlitz in der Tür geschoben und mit einem Finger solange in der Öffnung herumgestochert, bis der Umschlag klatschend auf die Dielen fielen.
Die Tür hätte ich öffnen können, ich stand in Reichweite der Klinke. Vielleicht fehlten einige Zentimeter. Aber mit ausgestrecktem Arm wäre ich an die Klinke gelangt. Jedoch beobachtete ich statt dessen, die Bemühungen, den Briefumschlag durch den Türschlitz zu stecken.
Ich war mir sehr sicher, man hatte mich nicht gehört, denn ich trug in der Wohnung keine Schuhe, sondern nur dicke Socken. Und außerdem waren alle Türen geöffnet.
Es war ein Mann, der mir den Brief brachte. Das weiß ich genau. Ich sah ihn noch die Gartenpforte schließen.
Der Umschlag lag so auf dem Fußboden, dass ich sofort an den großen und, wie es mir erscheinen wollte, etwas unbeholfen auf den Umschlag geschriebenen Buchstaben, die im Zusammenhang betrachtet, meine Adresse ergaben, erkannte, wer mir geschrieben hatte.
Ich nahm den Umschlag und ging zu meinem Schreibtisch.
Einige Jahre waren vergangen, vielleicht waren es fünf, sechs können es auch gewesen sein, dass ich von Professor Zabert letztmalig Post erhalten hatte.
„Warum hat er sich jetzt an mich erinnert?“, fragte ich leise in die Stille des Zimmers.
Eine Antwort erhielt ich nicht. Auch dann nicht, nachdem ich einige Minuten gewartet und dabei in die Stille gelauscht hatte. Während der Zeit nahm ich den Umschlag in meine Hände. Drehte und wendete und befühlte die verschlossene gelb-braune Tüte aus Packpapier. Natron-Kraftpapier heißt das Material heute, wie mir eine Verkäuferin im örtlichen Papierladen erst vor wenigen Wochen erklärte, als ich Packpapier kaufen wollte. Für einen Moment dachte ich, irgend jemand erlaubte sich einen Scherz und wenn ich den Umschlag öffne, würde ich von einem weiß-gelben Blitz geblendet werden.
Weil ich keine Antwort erhielt, nahm ich einen Brieföffner und schlitzte den Umschlag an der einen kurzen Seite auf.
Entgegen den beinahe grob geschriebenen Buchstaben, zu Worten aneinander gefügt auf dem Umschlag, zierte den Briefbogen die sehr akkurate und darum auch leserliche Zabert'sche Schrift.
Es waren nur wenige Zeilen, die an mich gerichtet waren. Wohl auf das Papier gedruckt. Allerdings, die Unterschrift war original. Ich schaute schräg auf den Bogen und erkannte das. Außerdem glänzte die Tinte noch im Licht, das durch die Fenster auf meinen Schreibtisch schien.
„Na ja“, sagte ich wieder sehr leise, „er kann ja nun nicht wer weiß wie viele Briefe handschriftlich verfassen.
Ich faltete das Blatt auseinander und begann zu lesen:
Liebe Freunde,
wir müssen uns treffen...
Genau diese wenigen Worte hatte ich gelesen, als das Telefon klingelte.
Noch bevor ich mich melden konnte, hörte ich die Stimme von Franz, der mich fragte:
„Hast du auch einen Brief von Zabert erhalten?“
„Ja!“, antwortete ich wahrheitsgemäß.
„Und...?“
„Nichts und. Ich habe erst 'mal nur die Anrede und die erste Zeile gelesen!“
„Aha!“
Mich interessierte, was der Professor geschrieben hatte und deshalb sagte ich zu Franz:
„Du lässt mich jetzt in Ruhe den Brief lesen und dann rufe ich dich wieder an!“
„Na gut! Dann warte ich am Telefon!“
Ich drückte den roten Knopf am Telefon und hörte anschließend das monotone Tuten des Freizeichens.
Ich nahm den Brief und begann, noch einmal zu lesen:
Liebe Freunde,
wir müssen uns treffen.
Ich meine, dafür gibt es gute Gründe und viel, was besprochen werden soll und muss.
Gegenwärtig arbeite ich an Vorschlägen darüber, welche Probleme am dringendsten beraten werden sollten. Und glaubt mir, es ist sehr ernst.
Deshalb zögere ich auch nicht, Euch zu unserer diesjährigen Zusammenkunft zu bitten. Und zwar nicht, wie sonst, im frühen Winter (oder sehr späten Herbst) zu einem Termin vor Weihnachten, sondern möglichst bald.
Mein Vorschlag ist das zweite Oktoberwochenende zuzüglich zweier Tage. Anreise (individuell) Donnerstag, erstes Treffen dann Freitag, letztes Treffen Dienstag und Abreise, wieder individuell, am Mittwoch. Wer will, kann verlängern In Reiseprospekten wird das 'Badeurlaub' genannt. Regine hat schon 'mal mit dem „Hotel am Atlantik“ auf der Insel im Atlantik Kontakt aufgenommen und bittet um Euren Anruf.
Liebe Grüße,
Zabert
P.S. Weil das als Familienausflug im Hotel angemeldet wird, solltet ihr, wenn möglich, mit Begleitung anreisen!
Z.
Selbstverständlich meldete ich mich nicht bei Franz. Jedenfalls nicht per Telefon, denn ich hielt es für wahrscheinlich, dass ich einen unerwünschten Mithörer hatte.
Statt dessen faltete ich den Brief zusammen und steckte ihn in die innere Tasche meiner Jacke.
Professor Zabert hatte auf die Mitreise einer „Begleitung“ hingewiesen. Später sagte er mir, als ich mein Kommen per e-mail zugesagt hatte und wir uns einige Tage später zufällig trafen, das erscheint seriöser und er meinte noch:
„Du kannst meinetwegen für deine Begleitung auch ein separates Zimmer bekommen. Und wenn du willst nebeneinander oder weit auseinander gelegen. Auf dem selben Flur oder auf verschiedenen Etagen. Mir egal! Mitte Oktober ist das Hotel ohnehin kaum besucht und jeder Gast ist willkommen. Mach das dann mit Regine klar!“
Ich fragte dann noch, wie er das mit der „Begleitung“ verstanden wissen wollte. Er sah mich verschmitzt an und meinte:
„Einem jungen und interessanten Mann sollte es ohne Mühe gelingen, ein weibliches Wesen zu finden, zu begeistern und zu einer Reise in das 'Hotel am Atlantik' zu überreden. Denke aber daran, sie sollte auch zu uns passen. Aber das muss ich dir nicht noch extra erklären...“
„Nee, nee!“, beeilte ich mich, das zu versichern.
Professor Zabert duzte jeden und alle. Und Regine war seine rechte Hand, sein Gedächtnis, sein Notizbuch. Sie war sein zweites Ich. Es wird erzählt, er hätte auch schon bei Regine gewohnt, als seine Frau einen jüngeren Bekannten zu sich eingeladen hatte. Aber erzählt wird bekanntlich viel...
Mir war es egal, ob er mich duzte oder nicht. Ich kenne allerdings Leute, die reagierten darauf, auf das duzen, sehr pikiert. Doch ich gestand Zabert diese Form der Anrede zu.
Genauso, wie ich es akzeptierte, dass er grundsätzlich mit ausgewaschenen Jeans und Holzfällerhemd bekleidet war. Im Winter kam dann noch ein Pullover dazu, den Regine für ihn in jedem Herbst strickte und meistens am letzten Arbeitstag vor den Weihnachtsferien feierlich überreichte.
Noch am nächsten Tag bestellte ich bei Regine für meine Begleitung, egal wer das sein würde, und mich zwei separate, aber dennoch nebeneinander befindliche Zimmer.
„Zwischen beiden ist dann eine Tür. Von beiden Seiten verschließbar. Ist in dem Haus so üblich!“, erklärte mir Regine.
Und beeilte sich, zu ergänzen:
„Wenn es dann die jeweiligen Nachbarn wollen, können sie sich gegenseitig besuchen!“
„Aha!“, sagte ich.
„Und für wen, außer für dich, darf ich reservieren?“
„Das sage ich dir noch!“
„Aber bitte bald! Du solltest dich nun 'mal entscheiden, wem du den Vorzug gibst!“
„Mach ich bald!“
„Versprochen?“
„Ja!“
Ich wusste damals, als ich bei Regine reservierte, nicht, wer mich auf die Insel begleiten sollte. Wenn auch Professor Zabert der Meinung war, es sollte mir schnell gelingen, eine junge Frau für die Reise auf die Insel im Atlantik zu begeistern, so hatte er damit nur zum Teil recht
Erstens war der Kreis meiner weiblichen Bekannten nicht so umfangreich, wie vom Professor vermutet. Denn es waren in der Tat „Bekannte“, mit denen mich ausschließlich freundschaftliche Beziehungen verbanden. Manchmal noch nicht einmal das...
Zudem hatten die meisten andere Sorgen. Beispielsweise mit dem Vorbereiten von Hochzeiten. Oder wie Claudia mit ihrem dreijährigen Sohn. Und Susanne steckte momentan in einer Beziehungskrise. Und so weiter...
Und als ich Otto dann fragte, ob er vielleicht Interesse hätte, mit mir auf die Insel zu reisen, sagte der nur:
„Dein Angebot ehrt dich! Wirklich und danke dafür! Aber das kann ich meiner Frau nicht antun! Außerdem wollen wir in den Herbstferien, wenn die Kinder bei den Großeltern sind, renovieren!“
„Ach so! Ja! Verstehe!“, beeilte ich mich verständnisvoll zu antworten.
Was anderes hatte ich von Otto auch nicht erwartet. Aber der Versuch, ihn zu fragen, war das wert.
So würde ich, der angeblich -zig Bekannte und Freundinnen hatte, wohl als Einziger allein auf die Insel und in das „Hotel am Atlantik“ reisen.
Ich begann, mich zu bedauern. Und zwischendurch hörte ich aus weiter Ferne einen Dichter rufen, am Ende von zu viel Freiheit hätte er immer nur Einsamkeit gefunden.
Ich gab mir noch einige Tage, dann würde ich Regine anrufen und mein Kommen ohne Begleitung anmelden.
*
Damals, nach der Sommerexpedition in das norwegische Jotunheimen hatte ich im darauf folgenden Winter mein Reisetagebuch mit Fotos und Skizzen ergänzt.
Ich hatte über die Biologie und Geografie dieser Region in den südlichen Skanden geschrieben und hoffte, meine Aufzeichnungen würden für den interessierten Laien ebenso ansprechend sein wie für den Fachmann. Den Text hatte ich mit einigen historischen Details ergänzt. Auch mit dem Hinweis darauf, dass Edvard Grieg für sein Werk „Peer Gynt“ aus den Volksliedern der Skandenbewohner und besonders der des Jotunheimen, dem „Reich der Riesen“, entscheidende Anregungen empfangen hatte. Vor allem und unter anderem für „Solveigs Lied“ und „In der Höhle des Bergkönigs“.
Bereits während der Arbeit an diesem Reisebericht hatte ich begonnen, einen Verlag für mein Manuskript zu suchen und, hoffte, den auch bald zu finden. Beides, suchen und finden, erwies sich innerhalb kürzester Frist mühsamer als zunächst erwartet.
Das Norwegen-Manuskript war längst abgeschlossen und ich befand mich inmitten der Vorbereitungen für die nächste Reise, dieses Mal in die rumänischen Karpaten, als mich der Brief eines Umweltverlages erreichte.
Es wurde Interesse an meiner Arbeit mitgeteilt, zumal das Verlagsprogramm um fachlich fundierte Reiselektüre erweitert werden sollte.
Welch ein Zufall!
Als Ansprechpartnerin wurde mir Frau Braemer genannt, dazu Telefonnummer und E-mail Adresse.
Selbstverständlich beeilte ich mich, möglichst bald Frau Braemer kennen zu lernen. Ich vermutete, der Verlag hatte nicht nur Interesse an meinem Manuskript, sondern war wirklich interessiert. Das meinte ich jedenfalls erkannt zu haben. Auch deshalb, weil mir Frau Braemer auf elektronischem Wege wissen ließ, sie würde mich gern für ein erstes Gespräch in ihrem Büro begrüßen.
Darum klopfte ich, pünktlich auf die Minute zur vereinbarten Zeit, an die Tür im Verlag, an die mit zwei Reißzwecken (Später wurde habe ich erfahren, es wären Architekten-Reißbrettstifte mit extra stabilem Stahlstift. Heute nicht mehr zu erhalten, die Planer hatten längst die Programme von Apple und Co. für ihre Zwecke entdeckt und zeichneten nicht mehr auf Papier.) ein Pappschild, mit den Worten „Louise Braemer“ ordentlich und sauber beschriftet, geheftet war.
Manchmal, so bildete ich mir ein, kann es geschehen, dass der Name eines Menschen in mir eine Ahnung erweckt über die betreffende Person. Eine meiner Nichten hatte eine Schulfreundin, die hieß Luise. Als ich den Namen 'Louise Braemer' auf dem Pappschild las, meinte ich, es müssten Ähnlichkeiten, zumindest äußerliche Ähnlichkeiten mit der Schulfreundin meiner Nichte erkennbar sein.
Doch mein erahnter Vergleich entsprach nicht der Realität, die mich nach dem „Herein“ und darauf folgendem Öffnen der Tür mit dem strahlendstem Lächeln der Welt begrüßte.
Louise Braemer war groß und schlank und blond. Im ersten Moment dachte ich, sie wäre etwas größer als ich. Aber ich hatte mich getäuscht! Als Louise Braemer mir gegenüber stand und die Hand zur Begrüßung reichte, stellte ich beruhigt fest, sie war wenigstens acht oder zehn Zentimeter kleiner als ich.
Große Frauen beängstigen mich. In ihrer Nähe habe ich immer das Gefühl, ich würde, sichtbar für jedermann, meinen Kopf zwischen den Schulterblättern versinken lassen. Also absenken...
Bis vor wenigen Minuten kannte ich einen Verlag und dessen Aufgaben nur aus den Berichten anderer Menschen, oftmals Kollegen oder Bekannte.
Übereinstimmend wurde mir häufig berichtet, die Gespräche vor der Veröffentlichung eines Manuskriptes würden lang und langweilig sein und Termine selten eingehalten.
„Irgendwie hatte ich jedes Mal das Gefühl, die Damen und Herren hinter ihren mit stapelweise Papier bedeckten Schreibtischen wären ständig überreizt und wollten nur ihre Ruhe haben!“, sagte mir dazu 'mal ein Kollege. Dessen Aussage zweifelte ich nicht an, hatte er bereits mehrere Bücher veröffentlicht.
Darum war ich bereits nach den wenigen Sätzen, die Louise Braemer nach den Begrüßungshöflichkeiten zu meinem Manuskript sagte, darüber erstaunt, dass sie meine Arbeit mit Sachkenntnis und Genauigkeit besprach. Sie kannte jedes Detail und jede Fotografie und Reiseskizze. Mit traumwandlerischer Sicherheit blätterte sie im Manuskript und sagte einige Male:
„Hier! Hier habe ich eine andere Formulierung vorgeschlagen!“
Oder sie meinte:
„Dieser Satz sollte in zwei Hauptsätze geteilt werden. Das liest sich dann besser!“
Oder:
„Auch wir trennen den 'erweiterten Infinitiv mit zu' noch immer durch Kommata! Wider alle modernen Überlegungen und praktizierten drucktechnischen Ausführungen!“
Jedoch, Louises Bemerkungen und Anmerkungen waren bereits in den Text eingearbeitet worden, so dass ich nicht, wie ein Schüler zur Korrektur des Hausaufsatzes, mit meiner Arbeit nach Hause geschickt wurde.
Das hatte ich nicht erwartet!
Louise Braemer muss wohl mein verdutztes Gesicht gesehen haben und sagte:
„Es ist eine sehr ordentliche Arbeit! So 'was bekommt man selten auf den Schreibtisch gelegt! Respekt!“
„Ich dachte, so ist es den Normen entsprechend. Auch denen der Zusammenarbeit.“, antwortete ich, „Darf ich verlangen dass im Verlag aus mehr oder weniger ausführlichen handschriftlichen Notizen die richtigen, weil wichtigen, Sätze herausgefunden werden?“
Die junge Frau antwortete nicht. Statt dessen stand sie auf, reichte mir über die Arbeitsplatte ihres Schreibtisches, der eine Holzplatte auf Holzböcken war, die Hand und sagte:
„Herzlich willkommen! Ich bin Louise!“
Ich ergriff ihre Hand und dann sahen wir uns einen Augenblick in die Augen.
Und in diesem Moment wusste ich nicht, was ich sagen sollte.
Dann, als sich Louise wieder gesetzt und mir gleiches zu tun bedeutet hatte, sagte sie:
„Wir werden das Manuskript so schnell es möglich ist, drucken und ausliefern. Es ist üblich, dass der Autor vor dem endgültigen Druck noch einmal die Fahnen liest und prüft und dann freigibt.“
„Danke!“, sagte ich, „Nur haben wir das Problem, dass ich in wenigen Tagen nach Rumänien in die Karparten fahren werde...“
„Wie lange?“
„Sechs bis acht Wochen!“
„Dann wissen wir ja, was im nächsten Buch zu lesen sein wird! Ich könnte das Lesen der Druckfahnen von dem Norwegen-Buch übernehmen!“
Ich sah Louise wohl erneut etwas fragend an, denn sie sagte, nachdem sie mich einige Augenblicke beobachtet hatte:
„Das werden wir dann in den Vertrag schreiben! Den bekommen Sie in den nächsten Tagen mit der Post!“
„Ja!“
Und während Louise einige Notizen aufschrieb, fragte ich:
„Was habe ich jetzt noch zu tun?“
„Für das Norwegen-Buch nichts weiter. Ansonsten nach Rumänien fahren und das neue Manuskript über die Karparten-Bären und Wölfe vorbereiten Und Graf Dracula nicht vergessen!“
„Bestimmt nicht!“
Ich wollte mich für Louises Bemühungen bedanken und außerdem wollte ich sie kennenlernen. Ich meinte, das wäre so üblich. Deshalb sagte ich:
„Ich möchte mich bedanken. Mit einem Abendessen oder einem Besuch im Kino. Oder mit beidem!“
Louise nahm ihre Lesebrille ab und sah mich an. Dann sagte sie:
„Das werden wir gern tun, wenn das Buch in den Läden liegt und ich dann die ersten Ideen zum Karparten-Buch erfahre!“
Mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Ich sah Louise an und sagte nur:
„Gern!“
*
Drei Wochen und zwei Tage nach dem Gespräch mit Louise Braemer sollte ich, übrigens in aller Frühe, was mir nicht angenehm war, nach Bukarest fliegen.
Die Umweltorganisation, für die ich seit vier Jahren tätig war, hatte sich mit gleichen Vereinigungen aus anderen Ländern Europas und Kanadas an einem Projekt zur Erkundung von Lebensräumen bedrohter Spezies beteiligt. Professor Zabert beteiligte sich mit dem Institut für Politische Ökologie an dem Projekt. Allerdings nur als Berater. Zu dieser Zeit war das Institut, auch auf Grund der damals noch sehr aktiven Umwelt- und Ökologiepolitik der Bundesregierung, finanziell gut ausgestattet.
Der damalige Umweltminister war Biologe und am Zabert'schen Institut promoviert worden. Was nun wiederum nicht bedeutete, die oft geschmähte, weil praktizierte Politik der Begünstigungen würde auch hier anzutreffen sein. Im Gegenteil! Sowohl der Minister, Dr. Vassilikos, seine Eltern waren als Gastarbeiter in den 1950-er Jahren nach Deutschland gebeten worden, als auch Professor Zabert legten größten Wert auf allumfassende Transparenz der Beziehungen.
Es war selbstverständlich, dass Regine, übrigens ein Organisationstalent erster Güte, für mich und meine beiden Begleiter den Flug und den Tarnsport der Ausrüstung organisiert hatte.
Wir sollten zunächst einige Tage in Bukarest am dortigen Partnerinstitut die letzten Details unserer Arbeit in den Karparten besprechen und planen.
Danach würde die Reise in das zum Teil noch urwaldähnliche Gebirge erfolgen.
Für die letzten Tage unseres Aufenthaltes in Rumänien war eine wissenschaftliche Konferenz in Russé, am Rand des weltberühmten Donaudeltas, geplant. Professor Zabert war es auf Grund seiner weitreichenden Beziehungen gelungen, für die Konferenz den stellvertretenden UNESCO-Direktor als Schirmherr und Gastredner zu gewinnen.
*
Als ich nach dem Gespräch mit Louise Braemer wieder auf der Straße vor dem Verlagsgebäude stand, hatte ich die Zuversicht, mein Manuskript würde in Louises kleinen, aber kräftigen Händen zu einem guten Buch. Sie hatte mich davon überzeugt, ohne viele Worte zu sagen.
Zufrieden ging ich in das Café das ich immer dann besuchte, wenn es mir gut ging. Und manchmal auch dann, wenn mich Sorgen bedrückten.
Irgendwann hatte ich Ria, ihr gehörte der Laden, von dem Norwegen-Buch und meiner Reise nach Rumänien erzählt und so war es auch nur selbstverständlich, dass sie bei meinem Eintreffen sagte:
„Da kommt unser Glückspilz!“
„Ja! Da ist er wieder 'mal!“, antwortete ich und bestellte: „Wie immer, bitte!“
Meine Aufenthalte, in größeren Abständen, aber regelmäßig, in Ria's Café währten selten länger als eine Stunde. Höchstens eine und eine halbe Stunde. Das aber nur sehr selten.
Dann saß ich an dem kleinen Tisch, von Ria als „Zentrale“ bezeichnet: Von diesem Platz aus konnte sämtliches Geschehen in und vor dem Café beobachtet werden. Nun gab ich den Voyeur.
Leute kamen und Menschen gingen. Pärchen betraten uneins den Raum und verließen ihn wie frisch verliebt. Oder umgekehrt. Vor zwei Wochen musste Ria einen jungen Mann und seine Freundin wegschicken. Sie stritten so heftig, dass Ria begann, um ihr Geschirr zu bangen.
An diesem Tag und nach meinem Besuch bei Louise Braemer blieb ich länger als gewohnt in Ria's Café. Ich wollte und wollte nicht gehen. Nach drei Tassen Kaffee bat ich Ria um ein Glas trockenen und gekühlten Weißwein.
Dann las ich in einer in einem Klemmstab aufbewahrten Zeitungen. Danach in einem der wöchentlich erscheinenden Magazine. Ich bat Ria um ein weiteres Glas Weißwein und blätterte in einer anderen Zeitschrift, diesmal mit der letzten Seite beginnend.
Ich beobachtete die Gäste. Frauen, die mit Männern kamen oder sich mit Frauen verabredet hatten. Und auch Männer, die auf Frauen warteten. Pärchen, die miteinander diskutierend eintraten und ihre Rede nur für eine flüchtig genannte Bestellung unterbrachen.
Als der letzte Gast das Café verlassen hatte, bald war Feierabend, setzte sich Ria zu mir und fragte:
„Na, was feierst du heute?“
Ria war eine von den Gastwirten, denen man ohne Bedenken sein Innerstes erklären konnte. Nie habe ich, wo auch immer es gewesen sein könnte, etwas von dem, was ich ihr anvertraut hatte, wieder gehört. Auch nicht Teile davon oder in anderer Variante erzählt. Ria war verschwiegen. Ohne Wenn und auch ohne Aber. Alles andere wäre wohl auch geschäftsschädigend gewesen.
Ich konnte ihr, wenn auch nicht detailliert, aber doch ausreichend genug, von meinem Besuch im Verlag und den erfreulichen Folgen berichten. Louise erwähnte ich nicht. Denn ich wusste, in Ria war Interesse für mich. Nicht hellauf lodernd, keinesfalls. Eher zaghaft und klein. Dafür beständig und stetig, bereits einige Jahre. Und das sollte so bleiben.
„Nun sollst du auch noch berühmt werden!“ kommentierte Ria meinen Bericht.
„Hoffentlich nicht!“, entgegnete ich, „Dann ist es mit der Ruhe vorbei!“
„Und die erste Lesung machst du bei mir?“
„Versprochen!“
Ria stand auf, Gäste hatten das Café betreten.
Später, ich meine, ich meine, es war nach dem vierten Glas Weißwein, köstlich und gut gekühlt, stellte sie mir Rührei mit Krabben auf den Tisch und meinte:
„Die Säure im Wein ist nicht der Freund deiner Magenschleimhaut. Und ich wette, heute war das Frühstück deine letzte Mahlzeit!“
„Stimmt!“
Dann sagte sie noch, schon bereits im Weggehen:
„Ist vom Haus gesponsert!“
„Danke!“
Als gegen zehn Uhr am Abend nur noch vereinzelt Gäste das Café betraten und etwas später nicht mehr mit Besuchern zu rechnen war, schloss Ria die Tür ab und sagte:
„Das war's für heute! Ich räume noch auf, dann gehen wir nach Hause! Ich rechts die Straße entlang, du links! Jürgen wartet!“
*
Die folgende Woche verbrachte ich, neben meiner Arbeit, mit den weiteren Vorbereitungen für die Reise nach Rumänien.
Dann fuhr ich an die See. Eine Woche wollte ich in der Pension hinter dem Deich wohnen, in der ich schon als Student in jedem Sommer mindestens eine Woche war.
Am dritten Tag, sieben Tage vor meinem Abflug nach Bukarest, rief mich Regine am Morgen an und erklärte sehr aufgeregt:
„Du kannst nicht fliegen. Die Rumänen haben sich gestern, am späten Nachmittag, gemeldet. Ich stand schon in Hut und Mantel und wollte nach Hause, als das Telefon klingelte!“
Tagelange Unwetter, von heftigstem Regen begleitet, der in höheren Legen sogar mit Schnee und Graupel vermischt war, hatten genau den Teil der Karparten verwüstet, in den wir fahren wollten.
Wie mir später per E-mail berichtet wurde, hatten sich kleine, kaum knietiefe Gebirgsbäche, in reißende Ströme verwandelt. Die nahmen alles, was sich auf ihrem Weg befand, mit in das Tal. Stürme, Böen sollen Orkanstärke erreicht haben, entwurzelten Bäume und sorgten dafür, dass ehemals bewaldete Berghänge innerhalb weniger Stunden kahl und felsennackt brachlagen. Es wurde Holz und dann der Mutterboden, ohnehin nur wenige Zentimeter dick, abgetragen und weggespült. Und aus den Felsspalten ragten die abgerissenen Wurzeln wie Arme, die um Hilfe rangen, zum Himmel empor. An dem sorgten tief ziehende Wolken für nicht enden wollenden Nachschub an Regen, Graupel und Schnee.
Die Behörden hatten die Region und die benachbarten Berge und Täler umgehend zum Katastrophengebiet erklärt und den Notstand ausgerufen. Was bedeutete, unbedingten Vorrang hatten Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen. Da hätten wir mit unseren geplanten Forschungen nur im Wege gestanden.
„Weiß der Professor davon“, fragte ich die noch immer aufgeregte Regine.
„Ja! Er hat mich gebeten, dich zu benachrichtigen!“
„Was hiermit geschehen ist!“, antwortete ich und fragte:
„Kommt er heute in das Institut?“
„Er müsste jeden Moment eintreffen!“
„Ich werde mich nachher noch einmal melden. Sag' ihm das bitte!“
„Ja!“
Später, als ich dann noch einmal im Institut anrief, wurde ich sofort von Regine zu Professor Zabert durchgestellt. Er war, verständlicherweise, sehr unzufrieden mit den Meldungen aus Rumänien und der abgesagten Reise in die Karparten:
„Eigentlich habe ich keine Zeit, bin auch schon wieder beinahe unterwegs. Kannst du morgen um halb zehn hier sein? Ich sag' Regine Bescheid!“
„Ja!“
Dann war nur noch das Tuten aus dem Telefon zu hören.
*
Ich bin kein Frühaufsteher. Auch kein Langschläfer. Aber so gegen neun Uhr am Vormittag kann man schon mit mir rechnen. Das lässt mein Biorhythmus zu. Doch ich habe auch beobachtet, es gibt, mitunter periodische, Abweichungen. Dann bin ich sehr zeitig wach und auch bereit, zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen.
An einem solchen Tag erreichte mich Regines Anruf und die Mitteilung von den Unwettern in den Karparten. Ich war bereits sehr zeitig aufgestanden. Vielleicht hatte mich die nervöse Anspannung vor der bevorstehenden Reise aus dem Bett getrieben...
Ich gönnte mir nach dem Anruf noch einen weiteren schönen Tag am Strand. Ändern konnte ich an der Situation ohnehin nichts und nach Hause konnte ich auch am Abend fahren. Auf mich wartete ohnehin keiner in meiner Wohnung unter dem Dach...
„Das tut mir ja nun sehr leid“, sagte Professor Zabert, „aber wegen der uns bekannten Umstände ist wohl eine Reise, wenn auch zu wissenschaftlichen Zwecken, in die Karparten nicht möglich. Ich habe bereits veranlasst, dass wir unser Kommen absagen!“
„Alles abgesagt?“, fragte ich.
„Ja!“
„Ich wäre bereit und interessiert, dennoch zu reisen, um wenigstens einen Teil der Unwetterschäden zu dokumentieren!“, entgegnete ich.
Professor Zabert sah mich einen Augenblick an, dann sagte er:
„Keine schlechte Idee. Aber ich meine, die Leute dort haben jetzt andere Sorgen. Vielleicht komme ich auf das Angebot später zurück, im September vielleicht!“
„Dann beginnt in einigen Hochlagen bereits der Scheefall!“, gab ich zu bedenken.
Doch Professor Zabert reagierte nicht auf meine Worte. Statt dessen zog er den Pullover aus, krempelte die Ärmel seines rot und blau karierten Hemdes auf und ging zu seinem Schreibtisch. Ich wusste nur zu gut, er wollte jetzt allein sein und sagte:
„In Ordnung!“
2
Als die Reise nach Rumänien abgesagt und ich vorzeitig aus der Pension an der See zurück gekommen war, rief ich bei Louise Braemer im Verlag an.
„Woher hast du diese Telefonnummer?“
Ich war erstaunt darüber, dass Louise Braemer mich duzte. Aber vielleicht, so überlegte ich, hatten wir das so vereinbart und ich konnte mich nicht mehr an diese Abmachung erinnern. Deshalb machte ich auch kein Aufheben darum und sagte:
„Von dir!“
„Wann?“
„Hast du vergessen, dass du mich damals zu unserem ersten Gespräch schriftlich eingeladen hast? Und mir damals...“
„Stimmt!“, erinnerte sich Louise.
Und nach einer kleinen Pause fragte sie:
„Du wolltest doch an der See sein? Oder habe ich da 'was verwechselt?“
„Nein! Im Gegenteil! Ich bin eher zurückgekommen. Und auch die Fahrt nach Rumänien ist abgesagt!“
„So?“
Ich antwortete nicht auf diese Frage und meinte statt dessen:
„Kann ich dir das heute Abend bei einem, meinetwegen auch einem weiteren, Glas Wein erklären? Das würde mich sehr freuen!“
Ohne zu zögern sagte Louise sofort zu und ich versprach, vor dem Verlag auf sie zu warten.
„Ich wohne da gleich, wie sagt man?“
„Weiß ich nicht!“, antwortete ich wahrheitsgemäß.
„Um die Ecke!“, meinte Louise.
„Also um acht vor dem Verlagshaus!“
„Ja!“
Als Louise dann pünktlich, wie verabredet, kam, meinte sie, leider nur eine, höchstens eine und eine halbe Stunde bleiben zu können. Etwas sehr privates verhindere längeres Bleiben. Ich nickte und dann habe ich sie zu Ria eingeladen.
Obwohl Ria, ich erwähnte es bereits, in ihrem Innersten ein kleines, aber feines, Feuerchen für mich schürte. Aber sie hatte ja ihren Jürgen...
Später habe ich Ria erklärt, wer Louise ist.
„Dachte ich mir!“
Was ich Ria ohne Widerspruch glaubte. Ich wusste, sie ist für ihre überdurchschnittliche Menschenkenntnis bekannt. Beinahe in der gesamten Stadt.
Ohne Umschweife begann ich, Louise zu erklären, warum ich früher aus der Pension abgereist war und auch, weshalb ich nicht in die Karparten fahren würde.
„Also auch kein Buch über Draculas Heimat?“
„Nein! Leider nicht. Eigentlich schade. Aber aufgeschoben soll ja nicht aufgehoben bedeuten!“, entgegnete ich und bemerkte, Louise wurde allmählich unruhig. Sie wollte nach Hause oder dorthin, wo sie noch etwas zu erledigen hatte.
„Du willst gehen, ja?“
„Ja! Es tut mir leid. Das musst du mir glauben!“
„Ist schon in Ordnung. Manchmal kommt 'was dazwischen, das da nicht hingehört und man kann sich nicht wehren!“, versuchte ich Louise entgegen zu kommen.
„Danke für dein Verständnis!“
„Gerne!“
Dann brachte ich sie zur Tür und schaute ihr noch nach, als sie in die Abenddämmerung ging.
Als ich wieder in das Café zurückkam, bestellte ich bei Ria noch ein Glas Weißwein:
„Du weißt, welche Sorte und etwas gekühlt!“
„Für dich immer!
Ria brachte mir den Wein und meinte:
„Und wenn ihr zusammen keine Bücher macht, dann...“
„Nee, nee! Nicht, was du denkst! Vielleicht mal! Ist aber alles noch taufrisch und unberührt wie ein junger Frühlingsmorgen!“
„Glaube ich dir!“
*
In jenem Sommer trafen Louise Braemer und ich uns dann öfter in Cafés und Restaurants. Drei Mal waren wir gemeinsam im Kino, an die Filme erinnere ich mich nicht mehr. Und zwei Theatervorstellungen besuchten wir ebenfalls. Nach den Theaterferien Ende August.
Einmal wurde ein modernes Stück gegeben. Ich erinnere mich nur daran, dass ich die Sprache und die Dialoge nicht verstanden habe, sie waren gespickt mit neudeutschen Termini. Louise hatte gleiche Schwierigkeiten. Zudem auch mit dem inhaltlichen Verständnis des Werkes. Sie erinnerte sich in diesem Zusammenhang daran, dass sie einen Bekannten gebeten hatte, den oder die Gründe für den mangelhaften Betrieb ihres Computers zu beseitigen. Und das der Mann ihr nach erfolgter und erfolgreicher Reparatur während eines Fachvortrages erklärte, was die Gründe für die Störung waren.
„Ich habe wirklich nichts verstanden!“
„Das glaube ich dir gerne!“, sagte ich und fügte dann noch hinzu, das muss eine Lektorin nicht unbedingt wissen. Auch Louise Braemer nicht.
Das andere Stück, welches wir uns angesehen haben, war Tschechows „Die Möwe“. Das wurde gut und grundsolide aufgeführt.
Danach meinte Louise:
„Wollen wir vielleicht öfter in's Theater gehen? Nächsten Monat werden „Die Räuber“ aufgeführt.“
„Gerne!“
Doch dazu kam es nicht. Wenige Tage vor der mit viel Lob im voraus bedachten Premiere rief mich Louise an und musste unseren Theaterabend absagen:
„Du kannst jemanden anderes fragen, ob er mit dir die Vorstellung besuchen möchte. Ich wäre dir deshalb nicht böse!“
Aber daran hatte ich kein Interesse. Ich hatte da eigene Ansichten und meinte, die Theaterbesuche sind Louises und meine Erlebnisse. Mit anderen Menschen verbindet mich anderes. So fuhr Louise, um ihre familiäre Situation zu begleiten und ich blieb zu Hause.
In's Theater sind wir nicht mehr gegangen. Es hat sich nicht mehr ergeben.
*
Danach habe ich Louise einige Tage nicht gesehen. Wir telefonierten aber beinahe an jedem Abend miteinander und ich versuchte vergebens, sie zum Wein einzuladen.
Bis sie dann anrief und sehr aufgeregt sagte:
„Ich habe eine Überraschung für dich! Rate 'mal, was das sein könnte!“
„Das weiß ich nicht! Sag es mir! Bitte!“, forderte ich sie auf.
Nach einigem Zögern meine Louise:
„Das Norwegen-Buch verkauft sich sehr gut. Sogar sehr, sehr gut!“
„Wirklich?“
„Im letzten Quartal hat es die Spitze, also den ersten Platz, der verlagsinternen Liste erreicht!“
Das hatte ich nicht erwartet und deshalb sagte ich:
„Lass uns das feiern!“
„Aber morgen geht nicht und dann fahre ich zu einer Buchmesse. Und dann gehen wir zusammen weg!“
„Am Sonnabend in einer Woche?“, fragte ich nochmals nach.
„Ja!“
„Um acht am Abend bei Ria?“
„Ja!“
„Ich wünsche dir eine gute und erfolgreiche Woche. Und nicht vergessen, nächsten Sonnabend um acht am Abend bei Ria!“
„Ja! Gerne!“
Dann kam am Dienstag der Brief von Professor Zabert mit der Einladung auf die Insel im Atlantik...
3
Wir hatten geglaubt, die politische Wende in den meisten osteuropäischen Staaten, der beginnende arabische Frühling und ein sanft einsetzender Liberalisierungsprozess in vielen Ländern der Welt würden den Zustand des Kalten Krieges beenden.
Jahrelang, beinahe während eines Dezenniums, hatte man überall und beinahe jederzeit über die sich anbahnende neue Weltordnung gesprochen. Es wurde gefeiert, sich gegenseitig bessere Zeiten versprochen, verhandelt, Abkommen in Aussicht gestellt, sich gegenseitig besucht und auch begonnen, Misstrauen abzubauen. Und die Politiker hatten, wie üblich, geredet und geredet und geredet...
Neue Umweltorganisationen wurden gegründet, vorhandene reformiert, deren Ziele erweitert und manchmal ergänzt. Und Politiker, die sich bis vor wenigen Jahren, deren Anzahl konnte man noch an zwei Händen abzählen, gegenseitig der Untätigkeit und Unfähigkeit und Schuld an der schlechten globalen Umweltbilanz bezichtigten, saßen nun friedlich nebeneinander wie alte Freunde und lächelten in die Kameras der Bildreporter und Fernsehstationen.
Die eine und alles bedrohende Umweltverschmutzung, der Krieg, egal, wo auf der Welt und zwischen wem, schien plötzlich aus dem Alltag der Menschen verschwunden.
Verbannt noch lange nicht, darüber waren sich alle einig. Aber, und darüber waren sich auch alle einig, zurückgedrängt und unwahrscheinlicher geworden.
Daran hatten ohne Zweifel auch die in der Endphase des Kalten Krieges zwischen den politischen Lagern abgeschlossenen Verträge über die Vernichtung atomarer, biologischer und chemischer Waffensystem beigetragen. Das sah selbstverständlich jedes Lager als sein Verdienst an, dem anderen diese Verträge abgetrotzt zu haben.
Und wieder lobten und redeten die Politiker, meistens über sich selbst, manchmal über einen Kollegen, selten über den Vertragspartner und dessen Partner.
Die charakterliche Eigenschaft einiger Menschen ist es, sich selbst und andere zerstören zu wollen. Denn eigenartigerweise schafften es solche Menschen die auch in hohen und höchsten Regierungsämtern anzutreffen sind, im politischen und vertraglichen Miteinander der gesellschaftlichen Systeme Lücken und Schlupflöcher zu finden, um neue und dann meistens verbesserte Waffensystem installieren zu können.
Ich erinnere mich daran, in einem der Verträge war festgelegt worden, Artilleriegeschütze nur bis zu einer genau bestimmten Linie auf dem eigenen Territorium zu stationieren oder bis dahin zurückzuziehen. Es handelte sich dabei, gerechnet von der Grenze zwischen beiden Systemen, um die Reichweite einzelner Geschosse zuzüglich eines Sicherheitskorridors.
Die Tinte unter diesem Vertrag war noch nicht trocken, als eine der beiden Seiten, angeführt von den hinlänglich bekannten Selbstzerstörern, Artilleriegeschütze präsentierten, die auch die nun größere Entfernung überfliegen konnten. Und das mühelos!
Also musste erneut verhandelt werden. Und so weiter, und so fort...
Doch es schien, mit all' diesen unliebsamen Spitzfindigkeiten und Narreteien unverbesserlicher und selbsternannter Weltenlenker, war es mit den politischen Tauwettern und Wenden, wo immer auf der Welt das geschah, größtenteils vorbei. Denn die militärischen Lager existierten in der jahrzehntelang bekannten Form bald nicht mehr, ebenso und als Voraussetzung dafür, die einst in einem Pakt verbündeten Armeen Osteuropas. Oder die Armeen wurden in das westliche Bündnis, also das des einstigen Gegners, teilweise samt Kriegsgerät, integriert.
Dann mussten wir weiterhin, und das vor allem auf dem alten Kontinent Europa, ein anderes Problem beobachten:
Aus den unterschiedlichsten Gründen drängten Menschen aus den Staaten des Nahen Ostens und aus Afrika auf den Kontinent. Sie favorisierten dabei als Ziel ihrer zumeist abenteuerlichen und lebensgefährlichen Reise die ehemaligen sogenannten Mutterländer der damaligen afrikanischen Kolonien sowie die Länder Skandinaviens, vor allem Schweden. Selbstverständlich stand auch Deutschland sehr weit oben auf der Wunschliste der Länder, die das Ziel der Flüchtlinge waren.
Diese Menschen machen von einem elementaren Recht Gebrauch. Nämlich, dem Recht auf freie Wahl des Wohnsitzes, egal in welchem Land.
Einer der Gründe, warum diese Menschen ihre Heimat verließen, sind die dort existierenden Kriegsschauplätze. Nicht nur in den Staaten des Nahen Ostens, sondern auch in Ländern, die zunehmend der Gewalt terroristischer Organisationen ausgesetzt sehen.
In der jüngsten Zeit waren zunehmend warnende Stimmen renommierter Wissenschaftler, Politologen und Historiker sowie die von Politikern zu hören, die die durchaus begründeten Meinung äußerten, während der politischen Wenden suchten die in Auflösung befindlichen Machtblöcke bereits nach neuen Wirkungsfeldern und begannen in einigen Ländern, Widerstandsorganisationen außerhalb der Machtblöcke zu favorisieren.
Irgendwann war es dann soweit, dass sie die staatliche Macht in diesen Ländern kontrollierten: die alten Machthaber waren vertrieben. Und aus den durchaus wohlmeinenden Widerständlern entwickelten sich die heute bekannten Terrororganisationen gegen alle Andersdenkenden.
Beobachter äußerten zudem die Vermutung, das Erstarken dieser häufig durch religiöse Gründe animierten und äußerst gewaltbereiten Terrorgruppen könnte auch mit den politischen Wenden und Wandlungen, wie bereits beschrieben, in Zusammenhang gebracht werden.
Oder, wie jemand während einer der regelmäßig an einem Freitagabend im Stadttheater stattfindenden „Dialoge im Theater“ sagte:
„Mit dem Auflösen Jahrzehnte währender staatlicher Machtstrukturen, auch in den Ländern Osteuropas, wurden dann zuweilen anarchistische Kräfte ermutigt, Verantwortung zu übernehmen. Jedoch, statt das Land zu regieren und die neue, im Entstehen begriffene Staatsgewalt zu manifestieren, waren diese Menschen mit dem Festigen der Strukturen ihrer Organisationen und ebenso ihrer eigenen Belange beschäftigt.“
So kam es, dass einerseits von Vertretern dieser anarchistischen Gruppen die Herrschaft des Menschen über den Menschen abgelehnt wurde, sie selbst jedoch die noch in Resten bestehenden staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen zum Erreichen ihrer eigenen Ziele durchaus zu verstehen wussten.
Aber diese Meinung bedarf noch einer genaueren Auseinandersetzung ist aber durchaus interessant genug, um besprochen zu werden...
Dieser Zustand teilweise anarchistischer Verhältnisse, währte einige, wenn nicht sogar mehrere Jahre und führte am Ende zur Herausbildung von Spannungen innerhalb der jeweiligen Gesellschaften.
Was mit Demonstrationen und Forderungen nach Demokratie und Freiheit in Wendezeiten begann, was beinahe ein Vierteljahrhundert währte und nicht in jedem Fall zu gesicherten und gefestigten Demokratien führte, endete nun und vorerst in dem Verlangen nach einem starken Mann.
Das, so wollte es mir und meinen Freunden erscheinen, war der Aufruf an das Militär, übrigens nicht nur in Bananenrepubliken oder ostasiatischen Königreichen, dieses Begehren nach dieser Person zu befriedigen und damit dem Begehren der gleichen Demonstranten nachzukommen, die damals totalitären Parteidiktaturen und ihren Repräsentanten den Garaus gemacht hatten.
Generäle und andere hohe Stabsoffiziere, häufig für Überraschungen gut, hielten in den Kasernen Tagungen und Konferenzen ab, zu denen die Öffentlichkeit nicht zugelassen war. Und worüber gesprochen wurde, blieb hinter den Kasernenmauern und -toren verborgen. Heimlichtuerei begann, sich im Alltag breit zu machen...
Jetzt wurden die Politiker, besonders die Außenpolitiker, beinahe aller europäischen westlichen Demokratien aufmerksam! Und es war, mit Abstand betrachtet, für Aufmerksamkeiten und Debatten und Konferenzen bereits zu spät. Man hatte den Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt, für ein diplomatisches Eingreifen verpasst. Kritiker sind sogar der Meinung, den durch Wende und Bürgerbewegungen befreiten Ländern hätte, neben Geld und wirtschaftlichem know-how, auch weitaus umfangreichere politische Entwicklungshilfe als geschehen, geliefert werden müssen.
Doch dafür war es jetzt ebenfalls zu spät. Jetzt konnte nur noch sofortige und effektive Schadensbegrenzung Schlimmeres verhindern.
So kam es, dass sich in Paris die Außenminister und Staatssekretäre Westeuropas trafen. Auch Kanada, die USA sowie Brasilien als Vertreter der Schwellenländer waren eingeladen. Man wollte miteinander reden. Genau das tun, was Politiker besonders gern tun: reden.
Später wollte man dann, während weiterer Gespräche an unterschiedlichen Orten und zu verschiedenen Zeitpunkten, die Vertreter Osteuropas einladen.
Meine Freunde und ich konnten uns der Meinung nicht enthalten und bezeichneten diese geplante und teilweise erfolgte Vorgehensweise als im Grunde genommen unmöglich. Und klassifizierten als Sinnbild einer arroganten Gutsherrenmanier. Statt die Vertreter derjenigen Staaten, über die gesprochen wird, von Beginn an den Konferenztisch zu bitten, wird zunächst „unter sich“ beraten, um den betroffenen Staaten dann zu offerieren, was zu tun ist.
*
Am dritten Tag der Pariser Zusammenkunft, es war zugleich der letzte dieses Treffens in der französischen Hauptstadt, erreichte die Vertreter die Vertreter der westeuropäischen Außenpolitik und deren Gäste aus Übersee eine bedeutsame Nachricht: Im Mittelmeer kreuzt ein Passagierschiff mit mehreren tausend Flüchtlingen an Bord. Der genaue Standort des Schiffes konnte zunächst nicht bekannt gegeben werden. Gegenteilige Meldungen sprachen von „...nahe der Balearen...“ und auch „...vor Palermo...“ wurde genannt.
Nur wenige Minuten später erreichte ein anderer Bote den Tagungsort in einem Hotel nahe dem „Centre Georges-Pompidou“ und legte dem französischen Außenminister einen Brief vor. Als der die Mitteilung gelesen hatte, bat er um Aufmerksamkeit und sagte:
„Meine Damen und Herren,
mir wurde soeben mitgeteilt, dass die genaue Position des Schiffes jetzt bekannt ist. Und zwar handelst es sich um das Seegebiet zwischen Catania und Syrakus, etwa zehn Meilen, nautische Meilen selbstverständlich, vor der sizilianischen Küste. Bei dem Schiff handelt es sich um einen finnischen Kreuzfahrer. Soweit bekannt, sollte in Alexandria ein Passagierwechsel stattfinden, als das Schiff gekapert wurde. An Bord sind zwischen 1800 und 2100 Flüchtlinge. Vorwiegend aus dem Nahen Osten. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen und werde auch keine Fragen beantworten“
Nach dieser Mitteilung beherrschte Ruhe, bedrückende Ruhe, den Saal.
Waren bis heute Flüchtlinge mit Booten und kleineren Schiffen über das Mittelmeer gekommen, so hatte das Kapern eines Passagierdampfers und die Verschiffung von möglicherweise mehr als etwa 2000 Flüchtlingen damit einen weiteren Höhepunkt und somit Premiere erlebt.
Es ist nur allzu verständlich, dass die Nachricht von dem Kreuzfahrtschiff mit annähernd 2000 Menschen an Bord, die sich auf der Flucht befanden, innerhalb weniger Minuten die Regierungen Europas und Nordamerikas erreichten. Presse, Funk und Fernsehen wurden zunächst nicht informiert. Man wollte die Situation in Ruhe besprechen und dann eine Pressemitteilung für die Öffentlichkeit herausgeben.
„Dass die Menschen an Bord nach Europa wollen, ist klar!, meinte ein Vertreter der niederländischen Delegation.
„Dann sollten wir auch für einen geordneten Ablauf sorgen!“, entgegnete ein italienischer Diplomat und ergänzte:
„Mehr können wir kaum tun. Irgendwann gehen auf dem Schiff die Vorräte zur Neige. Vielleicht ist es möglich, den Menschen auf dem Schiff anzubieten, nicht nach Italien oder Griechenland zu kommen. Wir sind häufig ohnehin nur Transitländer. Die meisten wollen nach Deutschland oder Schweden. Norwegen wird auch nicht verachtet!“
„Stimmt!“, meinte ein Grieche.
„Aber vergessen Sie bitte nicht das Dubliner Abkommen!“, meinte der deutsche Staatssekretär.
„Ich weiß“, sagte der Grieche, „der Kreuzfahrer ist in italienischen Hoheitsgewässern und demzufolge müssen die Leute auch erst einmal in Italien ihren Antrag stellen!“
„Ja!“
„Aber da findet sich bestimmt noch eine Lösung...“, meinte noch jemand, „Denn eigentlich gehören die Leute ja jetzt nach Finnland. Sie befinden sich auf einem finnischen Schiff!“
„Moment, bitte! Da hat sich die Rechtsauffassung allerdings geändert. Schiffe stellen zunächst kein schwimmendes Staatsgebiet dar!“, sagte der deutsche Staatssekretär.
„Wie denn nun?“, fragte der um eine Lösung bemühte Diplomat,
„Wenn die Besatzung eines Schiffes Menschen aus Seenot rettet, dann gelten die Bestimmungen des Flaggenstaates. Fährt das Schiff unter maltesischer Flagge... Na, Sie wissen, was ich meine. Sollte dann aber ein Flüchtling an Bord kommen und um Asyl bitten, dann ist nach den Vorschriften der UN-Konventionen zum internationalen See- und Flüchtlingsrecht zu verfahren...“
„Was bedeutet...“
„Was bedeutet, der Kapitän hat die Flüchtlinge darüber zu informieren, dass er nicht berechtigt ist, den Asylwunsch zu beachten. Und auch nicht darüber zu entscheiden.“
„Also müssen wir jetzt noch eine Kommission einrichten?“
„Ich hoffe nicht und weiterhin, dass wir das mit den Finnen regeln können“, entgegnete der deutsche Diplomat.
Später wurden Einzelheiten darüber bekannt, wie die Flüchtlinge auf das Schiff gelangten. Nachdem der Kreuzfahrer für die Ankunft neuer Passagieren bereit war, wurde das Schiff von bewaffneten Schleusern gekapert. Helfershelfer öffneten die Zufahrten zum Hafen und die Flüchtlinge wurden mit LKW und Bussen auf die Pier vor dem Schiff gebracht. Noch während die letzten Flüchtlinge über die Gangway an Bord gingen, begannen die unmittelbaren Vorbereitungen für das Ablegemanöver.
„Und die Sicherheitsleute in Ägypten?“, fragte der italienische Vertreter.
„Die gesamte Aktion dauerte keine Viertelstunde. Als die Polizei eintraf, hatte der Kreuzfahrer bereits abgelegt. Ich sage Ihnen ehrlich: Man wollte keine Befreiungsaktion riskieren! Bei den vielen Flüchtlingen an Bord!“, sagte der deutsche Diplomat.
„Und Ägypten dürfte jetzt zweitausend Sorgen weniger haben!“, ergänzte der Brite.
Bereits nachdem die erste, noch mit vielen Fragen und Vermutungen behaftete Mitteilung über das mit Flüchtlingen besetzte finnische Kreuzfahrtschiff die Teilnehmer der Pariser Konferenz erreichte, hatte, von allen unbemerkt, ein für derartiges Kidnappping speziell ausgebildeter Krisenstab der französischen Regierung die Arbeit aufgenommen. Frankreich sah es als seine Pflicht und Aufgabe an, das zu tun.
Zunächst wurde die ägyptische Regierung konsultiert und nach diesem Telefonat war klar, die Fluchthelfer und Schleuser hatten Helfer. Mehr wollte oder konnte der Vertreter der ägyptischen Regierung nicht sagen. Vielleicht durfte er das auch nicht. Das, so war es später im Abschlussbericht zu lesen, wurde nie geklärt.
Zur gleichen Zeit, als mit den Ägyptern gesprochen wurde, fanden Gespräche mit den Regierungen Griechenlands und Italiens, beide Staaten sind EU- und NATO-Mitglieder, statt. Die Sonderbeauftragten beider Länder machten deutlich, dass die Flüchtlingsunterkünfte völlig ausgelastet und sogar überfüllt sind und man doch bitte nach anderen Aufenthaltsorten für die Menschen an Bord suchen möchte. Man respektierte diesen Wunsch, ohne Versprechungen abzugeben.
Die Reederei des Kreuzfahrtschiffes wurde offiziell informiert und stellte problemlose Zusammenarbeit in Aussicht. Egal, wann und wie lange.
In der Zwischenzeit gingen die Beratungen der Pariser Konferenz so, wie geplant, weiter.
Die Diplomaten der teilnehmenden Staaten arbeiteten an den letzten Formulierungen für das Abschlussprotokoll und die in Aussicht gestellte Pressekonferenz
„Gebracht hat die Pariser Konferenz nichts. Außer, dass sich alle wieder einmal gesehen haben und miteinander sprachen!“, meinte Professor Zabert, der als Beobachter eingeladen war.
Weil die Öffentlichkeit über das Flüchtlingsgeschehen vor der Ostküste Siziliens mehr als mangelhaft informiert wurde, besonders über den Verbleib des Schiffes und der Menschen an Bord, fragte ich später den Professor nach dessen Rückkehr aus Paris.
„Da hat die französische Diplomatie ein Meisterstück abgeliefert! Das meine ich nicht ironisch. In keiner Weise...“
„Nämlich?“, fragte ich.
„Einige Tage nach dem Ende der Pariser Konferenz war man sich mit Dänemark und der finnischen Reederei darüber einig, dass das Schiff, zunächst für ein halbes Jahr, von der Reederei als Flüchtlingsunterkunft bereit gestellt wird. Alle Kosten, außer für die Verpflegung und für ärztliche Betreuung, übernimmt die EU. Dann wurde das Schiff im dänischen Hafen in Hirtshals vertäut, für Verpflegung und medizinische Versorgung kommt Dänemark auf.
„Aha! Und nach dem halben Jahr?“
„Die Finnen nutzen die Zeit, um die Maschine des Schiffes zu reparieren. Die Reederei hat das Geschäft gemacht!“
„Weshalb?“
„Der Kreuzfahrer war ohnehin für einen Werftaufenthalt vorgesehen. Und hätte kein Geld eingefahren. Jetzt wurde die Maschine in Dänemark repariert, zwar alles etwas umständlicher. Aber die Liegezeit wurde, wir wissen es, bezahlt!“
„Einer gewinnt immer!“
„Stimmt!“
„Und die Flüchtlinge?“, fragte ich.
„Diplomaten konnten für die allermeisten von denen einen Aufenthalt in Skandinavien erreichen. Einige wollten auch zu ihren Familien in Frankreich und Deutschland.
„Verständlich!“
4
Louise kam pünktlich. Ich kenne keine andere Frau, die so auf absolute Pünktlichkeit achtet, wie Louise.
„Die Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige!“, erklärte sie mir.
„Na gut! Dann bist du meine Königin!“
„Aber bitte nicht Königin Louise!“
„Die hieß Luise. Und du Louise!“
„Ja!“
Ich war selbstverständlich, Louises Pünktlichkeit eingeplant, eine viertel Stunde vor unserem verabredeten Termin bei Ria. Sie hatte für uns den Tisch neben dem Fenster reserviert und sagte:
„Du sollst sehen, wann deine Herzdame kommt!“
„Ja, das ist gut so!“, antwortete ich und setzte mich.
Jetzt konnte ich den Eingang von Ria's Café und einen Teil der Straße sehen.
Louise ging um die Ecke auf der gegenüber liegenden Straßenseite. Mein erster Blick galt ihren Schuhen. Heute hatte sie flache, wohl aus Bast geflochtene Sommerschuhe an, stellte ich zufrieden fest.
Louise trug, wenn wir uns trafen, nie Schuhe mit hohen Absätzen.
„Die Frau muss, was die Körpergröße betrifft, kleiner sein als der Mann“, erklärte sie mir gleich bei einem unserer ersten Treffen.
Das fand ich in Ordnung und zudem bemerkenswert, wenn kleine Männer mit großen Frauen oder große Frauen mit kleinen Männern des Weges kamen.
Louise war nur einige Zentimeter kleiner als ich. Aber das hatte ich bereits bei unserem ersten Treffen festgestellt...
Dann hielt genau vor dem Café ein Bus. Leute steigen aus, andere ein. Wegen einer auf rot geschalteten Ampel musste der Bus einige Minuten warten und als er weiter gefahren war, konnte ich Louise nicht sehen. Hatte sie sich im letzten Moment gegen unser Treffen entschieden? Ich beugte mich ein wenig vor, um weiter auf die Straße blicken zu können. Doch Louise war nicht zu sehen. Dann hörte ich ihre Stimme:
„Hallo! Was machst du denn...?“
„Ich suche dich.“, antwortete ich wahrheitsgemäß.
„Warum? Weshalb? Ich bin doch hier!“
Ich erzählte über meine Beobachtungen. Louise sah mich an, lächelte und sagte:
„Mit dem Bus kam eine Bekannte, mit der habe ich neben der Eingangstür noch einige Worte gesprochen. Da konntest du mich nicht sehen!“
„Stimmt! Beim Auto sagt man dazu toter Winkel!“
Ich half Louise dabei, sich an den Tisch zu setzen und fragte:
„Was darf ich für dich bestellen?“
„Trockenen Weißwein und dazu Wasser!“
Ich ging zu Ria, die hinter dem Tresen stand und Louises Ankunft beobachtet hatte und bestellte zwei Glas Weißwein und dazu Wasser.
„Das bringe ich euch gerne.“
Als ich mich wieder zu Louise an den Tisch gesetzt hatte, sagte ich: