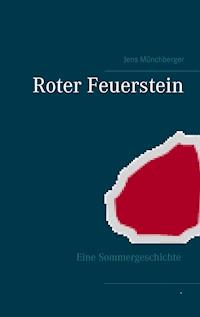Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während des Kalten Krieges lässt die ESA einen Tunnel von Europa zum Raketenstartplatz Kourou in Französisch-Guayana bauen. Als am Mittelatlantischen Rücken ein Vulkanausbruch die Arbeiten zum Erliegen bringt, wird das Projekt abgebrochen. Jahrzehnte später interessiert sich die Müllmafia für dieses Projekt, um in die eventuell noch vorhandenen Bauwerke Industriemüll einzulagern und Endlager für Atommülllager zu schaffen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Dream on...“
Nazareth, schottische Rockband
„DREAMS – Next Exit“
(Straßenschild in San Francisco)
„Träume verwehn', wenn niemand da ist, der sie träumen will!“
(Rio Reiser)
Verlag Book on Demand Norderstedt
Jens Münchberger, geboren 1958, Dipl.-Bauingenieur. Während des Ingenieurstudiums Gasthörer an der Kunstakademie in Dresden. Arbeit als Bauingenieur. Gründung eines Büros für nachhaltiges Bauen. In den 1990-er Jahren Eröffnung einer Galerie und verstärkte Hinwendung zur Malerei, Holzarbeiten und Keramiken.
Veröffentlichung von Kurzgeschichten und der Romane „Meeresfahrt" und „Das Rote Haus" und „Die Insel im Atlantik" sowie der Erzählungen „Roter Feuerstein“ und „Am Meer“ und „Der Besuch“.
Jens Münchberger lebt in Schleswig-Holstein.
Die Handlung und alle Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit der Realität sind zufällig, Manchmal jedoch beabsichtigt.
Der Verfasser
Für K.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Epilog
I
„... wie Träume liegen die Inseln im Nebel auf dem Meer...“ (Theodor Storm „ Meeresstrand“)
Auf der Schnellfähre, die im Wattenmeer vor Küste Nordfriesland und zwischen den Inseln Nordstrand und Sylt unterwegs ist, lernten sich im Sommer des Jahres 2001 zwei Männer kennen.
Der ältere der beiden Herren war sehr hager und sehr groß und hatte ein gebräuntes Gesicht. In dem sprießte ein kurzer stoppeliger Bart. Den Kopf des Mannes zierten weiße, beinahe unsichtbare Haare, die, ebenso wie der Bart, sehr kurz geschnitten waren.
Sehr auffallend war die große und hakenförmige Nase. Die Ärmel seines weißen Hemd waren aufgekrempelt und die Knopfleiste vor der behaarten und muskulösen Brust war sehr weit offen. Und außerdem war er mitausgewaschenen Jeans bekleidet. An den Füßen trug er derbe Ledersandalen.
Der andere Mann, mindestens zwanzig Jahre jünger, war von etwas kleinerer, gedrungener Statur. Kleidung und äußere Erscheinung ähnelten der des älteren Mannes, nur hatte er nicht so eine auffallend geformte Nase.
Beide Männer standen an der Reling der Fähre, man hätte bei flüchtigem Betrachten meinen können, es wären Brüder während eines gemeinsamen Ausfluges.
Der ältere Mann sah, bereits seit der Abfahrt des Schiffes, auf das Meer hinaus, so als suchte er irgendetwas in der Ferne.
Als die Küste der Hamburger Hallig passiert wurde und auf der Steuerbordseite die grünen Dächer des Sönke-Nissen-Kooges(1) zu erkennen waren, sagte der ältere Mann:
„Das ist doch nicht typisch für die hiesige Region, dass die Häuser, die wir dort sehen, grüne Dächer haben.“
Der jüngere Mann, meinte, wohl weil ihm nichts anderes einfiel, nur kurz:
„Ja!“
Dann schwiegen beide wieder und als das Schiff an der Hallig Gröde vorbei fuhr und der Sönke-Nissen-Koog nun achteraus lag, versuchte der ältere Mann erneut, ein Gespräch zu beginnen:
„Ihnen ist die Geschichte dieses Kooges bekannt?“
Der jüngere Mann sah seinen Nachbarn an, wohl einen Moment zu lange und mit einem etwas vorwurfsvollen Blick.
„Ich möchte Sie nicht belehren!“, sagte der Ältere, „Bitte, auf gar keinen Fall!“
„Ach, wissen Sie, wir leben seit einigen Jahren in dieser Region, meine Frau, meine Tochter und ich. Im Sommer fahren wir oft mit diesem Schiff nach Amrum, der weite Strand, die Nordsee… wir sind Strandmenschen. Da ist es, beinahe, schon zur Gewohnheit geworden, dass wir von fremden Menschen angesprochen werden. Meist wollen sie dann wohlmeinende Erklärungen, erlesen aus Reisebüchern oder anderer Literatur, zum Besten geben. Aber Sie kennen, vermute ich, die Geschichte des Sönke-Nissen-Koogs?“
Nun antwortete der ältere Mann auf diese Frage mit einem knappen, aber nicht unfreundlich formulierten „Ja!“.
Nach einigen Augenblicken fügte er hinzu:
„Ich bin Geologe. Allerdings, wenn es dann so etwas gibt, im Ruhestand. Früher sagte man zu Leuten meines Alters, sie sind Rentner. Ich habe mich, vor Zeiten und unter anderem, mit den geologischen Besonderheiten der Diamantminen beschäftigt, die von Sönke Nissen entdeckt worden sind.“
„Das ist ja interessant!“
Nach diesem kurzen Dialog standen beide Männer wieder an der Reling und sahen aufs Meer. Das Schiff näherte sich nun mit langsamer Fahrt der Hallig Hooge, um einen Zwischenstopp einzulegen und einige Fahrgäste an Land zu lassen und andere Reisende mitzunehmen.
Der ältere Mann sagte:
„Meine Bekannten erwarten mich auf Hooge, für einen Tag möchte ich sie besuchen. Fahren Sie heute Abend wieder mit diesem Schiff zurück?“
„Ja, warum fragen Sie mich das?“
„Vielleicht sehen wir uns auf der Rücktour. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen angenehmen Tag am Strand!“
„Den sollen Sie auch auf Hooge haben!“
*
Auf diesem Schiff begann mit dem diesem wortkargen Gespräch eine Freundschaft zwischen zwei Männern, die dazu führen sollte, dass der Öffentlichkeit ein Geheimnis preisgegeben wird, von dem bisher nur ein sehr kleiner Kreis von Menschen wusste
Selbstverständlich trafen sich beide Männer am Abend auf dem Schiff. Der Jüngere hielt, weil er sich bereits auf der Insel Amrum eingeschifft hatte, für den Älteren einen Platz an der Reling frei,
Denn so meinte er, die Fahrt durch das Wattenmeer an Bord der Schnellfähre sollte an der Reling stehend erlebt werden.
„Danke, dass Sie so freundlich waren und mir diesen herrlichen Blick auf das abendliche Meer ermöglichen“, begrüßte der Ältere den Jüngeren und fragte:
„Sie erwähnten heute Vormittag, dass Sie mit Ihrer Familie in Nordfriesland zu Hause sind. Darf ich fragen, wo Sie wohnen?“
„Das dürfen Sie!“
Der Ältere bemerkte diese kleine Wortspielerei und fragte:
„Wo wohnen Sie?“
„Unser Zuhause ist ein altes, mit Reet gedecktes Haus und einem großen Garten darum in einem kleinen Dorf bei Husum, genauer gesagt, bei Husum an der Nordsee.“
„Gibt es noch ein anderes Husum?“
„Ja, in Niedersachsen, zwischen Nienburg an der Weser und Neustadt am Rübenberge.“
„Das war mir bis jetzt nicht bekannt! Ich kann mir vorstellen, dass es, besonders im Winter, recht einsam ist in den flachen Weiten Nordfrieslands.“
„Ach wissen Sie, wir lebten viele Jahre in einer Stadt und haben uns dort nie richtig wohl gefühlt. Das Leben in der Stadt ist aufreibend, in einem Dorf zu wohnen dagegen beruhigend. Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch! Wir wollten, als wir aufs Dorf gezogen sind, uns nicht zur Ruhe setzen, wir wollten in Ruhe leben. Da gibt es, meines Erachtens, zwischen diesen Meinungen einen sehr großen Unterschied!“
„Ja, ich verstehe, was Sie meinen!“
„Meine Frau und ich und ich haben für uns dieses Leben auf dem Dorf gewählt, weil das Leben in der Stadt uns mit täglicher Hektik und abendlichem Lichtergeflimmer nicht willkommen war, erst recht nicht nach des Tages Mühen.“
„Nun, es gibt Stadtmenschen und es gibt Landmenschen. Sie gehören zu den Landmenschen. Habe ich das richtig verstanden?“
„Ja, so ist es. Wir wollten immer am Meer wohnen, das ist uns nun vergönnt. Die Nordsee ist von unserem Zuhause nur soweit entfernt, dass wir, ohne Mühe und immer dann, wenn es uns drängt, an den Strand fahren können. Ob im Sommer oder im Winter, ob Stürme im Frühjahr oder im Herbst über den Strand fegen, wir sind oft am Wasser. Ist es da verwunderlich, dass wir sogar unseren Strand haben? Wo der ist, das verrate ich aber nicht, sonst wäre es nicht mehr unser Strand.“
Die Männer standen dann wieder schweigend an der Reling des Schiffes und sahen aufs Meer. Als sich die Fähre der Insel Nordstrand bereits mit kleiner Fahrt näherte, sagte der jüngere Mann zu dem älteren Mann:
„Sie sind, meine ich, für einige und, hoffentlich erholsame, Tage zu Besuch in Nordfriesland. Ich wünsche Ihnen dazu alles Gute!“
„Danke! Vielleicht sehen wir uns wieder, ich bin in jedem Jahr hier zu Besuch.“
„Ich werde auf Sie warten und freue mich auf unser Wiedersehen!“
II
Die Galerie öffnete, gegen zehn Uhr am Vormittag. Für Besucher zugänglich war dann, wenn ein Schild auf der Straße stand. An einem Sonntagvormittag, gegen elf Uhr, parkte ein älterer Herr sein Auto vor dem Haus, in welchem sich die Galerie befand. Er ging zur Haustür und betätigte die Klingel und hörte sodann, wie eine Frau, im Flur des Hauses stehend, sagte:
„Da möchte ein Besucher in deine Galerie!“
Dann kam die Frau zur Haustür und öffnete dem Gast mit den Worten:
„Kommen Sie ’rein!“
Sie geleitete den Besucher in die Ausstellung. Dann meinte sie zu Ihrem Mann:
„Du, ich glaube, den kenne ich, woher, weiß ich aber nicht.“
Der Mann ging zu dem Besucher in die Galerie und stellte sehr verwundert fest:
„Das habe ich nicht erwartet, dass wir uns so schnell wieder sehen!“
„Nee, ich auch nicht“, sagte der Besucher, „nun verstehe ich auch, was Sie mir auf dem Schiff erklärten und meinten, in der Stadt hat die Hektik und in dem Dorf die Ruhe ihr Zuhause gefunden. Darf ich mir Ihre Galerie ansehen?“
„Aber, bitte, auch die Bilder!“
Der Besucher hatte diese erneute Wortspielerei verstanden.
„Wegen der Bilder bin ich doch zu Ihnen gekommen!“
„Störte es Sie, wenn ich Sie mit Musik begrüße?“
„Nein, im Gegenteil, Musik und Bilder können harmonieren! Ich glaube, nun muss ich mich Ihnen vor- stellen, das ist mir auf dem Schiff nicht gelungen. Mein Name ist Jürgen A.“
„Sie kennen das „Köln-Konzert“ von Keith Jarrett(2)?“
„Ja, sicher. Ich war übrigens am 24. Januar 1975 Besucher dieses Konzertes in der Kölner Oper. Damals war mir nicht bewusst, dass ich einen der besten Jazzpianisten erleben durfte. Wissen Sie eigentlich, dass die Aufführung dieser Musik, wie Jarrett es später einmal beschrieben hatte, unter für ihn etwas widrigen Umständen stattfand?“
„Nein, das ist mir nicht bekannt, erzählen Sie, bitte!“
„Der von ihm favorisierte Flügel war nicht rechtzeitig eingetroffen, er musste auf einem anderen Instrument spielen. Nun ja, Sie wissen sicher, dass jedes Klavier, jede Geige, jede Gitarre oder Trompete, über einen genau auf dieses Instrument zutreffenden Klang verfügt. Somit blieb Keith Jarrett nichts weiter übrig, als seine improvisierte Musik diesem Ersatzflügel anzupassen und sich auf tiefe und mittlere Töne zu beschränken. Dennoch ist der Mitschnitt dieses Konzert seine bekannteste Veröffentlichung.“
Der Mann ließ den Besucher mit der Musik von Keith Jarret und den Bildern allein in der Galerie. Er wollte nicht stören und ihn auch nicht nötigen, irgendwelche höflichen Gespräche führen zu müssen.
Als er nach einer Weile wieder in die Galerie kam, saß der Gast, tief in Gedanken versunken, auf einem Stuhl.
„Ihre Bilder haben mich in eine gute, aber auch nachdenkliche, Stimmung versetzt. Das, was ich hier sehe, ist so harmonisch, einerseits. Und dann auch herausfordernd, beinahe aufrüttelnd!“
„Das wollte ich so und habe es, ich bemerke Ihre Reaktion, auch bewirkt. Ich will mit meinen Bildern die Schönheit und Vergänglichkeit der uns umgebenden Natur, deren Teil wir sind, aufzeigen. Und dazu ermahnen, dass wir diese Natur schützen müssen, vor uns, den Menschen.“
„Ja, Sie haben damit Recht, die Natur muss vor den Menschen geschützt werden. Zwar kann die Natur ohne den Menschen sehr gut existieren, das ging ja hunderttausende Jahre gut. Aber die Menschen vergessen leider, dass sie ohne die Natur nicht bestehen können.“
„Ich bemühe mich, Respekt und Ehrfurcht vor der Natur zu vermitteln, im Sinne des großen Albert Schweitzer, der die ‚Ehrfurcht vor dem Leben’ einforderte. Wollen wir in den Garten gehen? Seien Sie, bitte, unser Gast!“
„Darf ich das denn annehmen?“
„Sie haben es bereits getan, als Sie unsere Galerie aufsuchten.“
Der Hausherr geleitete seinen Gast in den Garten. An den Tisch, der unter den großen und alten Bäumen stand.
„Übrigens“, sagte der Hausherr, „mein Name ist Rieger, Thomas Rieger.“
Dann sagte der Besucher:
„Glauben Sie mir, Herr Rieger, ich durfte mir in meinem Leben sehr viel ansehen, habe die Welt bereist. Manchmal alleine, oft auch in Begleitung. Dennoch, oder vielleicht deshalb?, habe ich an der Nordseeküste die schönsten und eindruckvollsten Stunden meines Lebens erfahren dürfen. Bis auf eine Ausnahme!“
Der Mann lehnte sich in seinen Gartensessel zurück und sein Blick suchte etwas, was sich in einer unendlichen Ferne, die nur er zu kennen schien, befinden musste.
„Um welche Ausnahme handelt es sich? Das darf ich Sie fragen?“
„Ich glaube, wenn ich jetzt beginne davon zu berichten, dann sitzen wir morgen früh noch in Ihrem Garten!“
„Hätten Sie damit ein Problem?“
„Nein! Im Gegenteil, ich will nicht aufdringlich sein und Ihre Gastfreundschaft keinesfalls über Gebühr beanspruchen!“
„Ach, wissen Sie, wenn wir unsere Gäste weiter als bis zur Galerie in unser Haus lassen, dann sind wir es gewohnt, mitunter stundenlang im Garten zu sitzen. Was meinen Sie, wie oft wir hier, unter den alten Bäumen, schon den Sonnenaufgang erlebt haben! Einmal, es ist bereits einige Jahre her, haben wir mit Besuchern sogar eine partielle Sonnenfinsternis erlebt, die sich genau zum Zeitpunkt des Sonnenaufgang ereignete.“
„Ich hatte Ihnen bereits auf dem Schiff gesagt, dass ich meine, Sie und Ihre Frau sind Landmenschen, Natur- menschen. Dieser Eindruck hat sich nun bestätigt. Ihr Haus, der Garten, Ihre Bilder… Es erscheint mir so, als lebten Sie einen Traum und träumen nicht Ihr Leben!“
„Danke, das ist ja beinahe ein Kompliment!“, sagte die Frau und setzte sich, „ich heiße Claudia Rieger.“
„Sie leben hier auf einer Insel, das darf ich doch sagen?, in einem sehr schönen Dorf. Ich verstehe immer mehr von dem, was Sie mir auf dem Schiff sagten. Seit wann wohnen Sie hier, in diesem alten Haus?“
„Nachdem in dem Teil dieses Landes, der östlich der Elbe liegt, gewendet wurde, haben meine Frau und ich, leider, erkannt, dass sich in diesen Regionen des Landes keine Möglichkeiten zur Gestaltung unseres Lebens eröffnen werden.“
„Weshalb urteilen Sie so hart?“
„Ich meine, nicht hart, sondern einsichtig und gerecht zu beschreiben, was uns, meine Frau und mich veranlasste, andere (eigene) Wege zu gehen. Wir haben jederzeit, das ist nachweisbar, eine liberale Einstellung nicht nur vertreten, sondern auch gelebt. Meine berufliche Karriere, ich habe Bauingenieurwesen studiert, war in dem Moment beendet, als ich mich weigerte, mir das Märchenauge ans Revers zu heften.“
„Was ist ein Märchenauge?“
„Das Abzeichen der SED wurde, selbstverständlich nur hinter der vorgehaltenen Hand, so genannt. Wir mussten dann, nach den Ereignissen im Herbst 1989, unter anderem, erfahren, dass sich ehemalige Funktionäre, also Arbeiter dieser Partei, sich ihr Pöstchen auch in dieser neuen Gesellschaft sichern konnten. Irgendwann haben wir diese Zustände nicht mehr akzeptiert und unsere Koffer gepackt. Meine Frau und ich sind aus dem Land zwischen Elbe und Oder gegangen, weil wir diese sich ausbreitenden unmoralischen Zustände nicht mehr ertragen und für uns und unsere Tochter dort keine Perspektive erkennen konnten.“
„Können Sie mir das, vielleicht an einem Beispiel, erklären?“, der Besucher sah den Mann und die Frau fragend an.
„Nach der Ausbildung, mein Mann erwähnte es bereits, er hat Bauingenieurwesen studiert, wurde ihm die Bauleitung für den Neubau einer Schleuse übertragen. Beinahe wöchentlich wurde sodann einbestellt und bedrängt, das bereits beschriebene Märchenauge ebenfalls zu präsentieren. Irgendwann haben die Genossen das Werben aufgegeben und ihm erklärt, er wäre als Bauleiter solch’ wichtiger Baustelle nicht mehr zu akzeptieren. Dann, nach den Ereignissen im Herbst des Jahres 1989, konnte er diese Leute in den unterschiedlichsten, teilweise öffentlichen, Verwaltungen wieder antreffen.“
„Jetzt glaube ich zu wissen, was Sie meinen!“
„Wir möchten jetzt aber nicht weiter über diese Dinge sprechen“, sagte dann die Frau so bestimmt, dass jeder Widerspruch ausgeschlossen wurde.
„Wir sind dann, Umwege eingeschlossen, in diesem Haus angekommen“, sagte der Mann zu dem Gast.
Nach einem Moment der Überlegung fügte er hinzu:
„Und hier möchten wir bleiben, ganz lange.“
„Arbeiten Sie noch in Ihrem Beruf als Bauingenieur?“
„Ja. Allerdings habe ich mir eine berufliche Nische gesucht, ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Ich erarbeite Gutachten und schreibe Aufsätze für Verlage. Und manchmal, das geschieht ein- oder zweimal im Jahr, erarbeite ich die Unterlagen für die Instandsetzung, manchmal auch Rekonstruktion, denkmalgeschützter Häuser. Es gibt viele solche Gebäude, allerdings haben die Besitzer oft nicht das Geld für eine ordnungsgemäße Wiederherstellung.
„Es gibt doch, so ist es mir bekannt, öffentliche Zuschüsse für solche Rekonstruktionen, oder?“
„Ja, es ist, Sie sagten es völlig richtig, Geld, welches das Land, die Kreisverwaltung und die Gemeinde zur Verfügung stellt. Die hauptsächliche finanzielle Belastung trägt allerdings der Bauherr.“
„Ich entnehme Ihren Worten, daß eben doch sehr viel Liebe zu alten Häusern erforderlich ist, um diese zu erhalten. Man muß die unbedingte Einstellung zu dem Vorhaben ‚Ich wohne in einem alten Haus’ haben.“ “Ja, so ist es, ohne Einwand! Wo wohnen Sie, das darf ich Sie doch fragen?“, wollte die Frau wissen.
„Ich bin überall zu Hause. Ich habe an der Algarve eine Eigentumswohnung, dahin fahre ich im Winter, so etwa nach Weihnachten. Und ich Hamburg lebe ich in einer Stadtwohnung. Manchmal wünschte ich mir so etwas dauerhaftes, ein Haus auf dem Land, in dem ich wohnen und arbeiten kann. Ich habe nun auch das Lebensalter erreicht, da möchte ich wissen, wohin ich gehöre.“
„Wir haben Ihnen über uns berichtet, jetzt müssen Sie aus Ihrem Leben erzählen!“, forderte der Hausherr den Besucher auf. Erzählen Sie, bitte, von der Ausnahme, die Sie vorhin erwähnten!“
Zögernd begann Herr Dr. A. zu sprechen:
„Wissen Sie, junger Mann, es gibt in jedem Leben Situationen, Konstellationen der Umstände, die treten nur ein einziges Mal auf. Ein Freund von mir sagte einmal, erst wenn alle Randbedingungen einer bestimmten Situation das Optimum erreicht haben, wird aus dieser Situation ein Ereignis, das dann zum Erlebnis werden kann.“
„Und, was haben Sie erfahren?“
„Ich habe es nicht nur erfahren, ich habe es erlebt. Meiner Familie gehörten Anteile, größere teilhaberbezogene Anteile, einer Bank. So lag es, dem Selbstverständnis meiner Eltern folgend, daß ich eine Ausbildung erhalte die dazu geeignet gewesen wäre, dieses beträchtliche Vermögen zu verwalten und zu vermehren. Nebenbei bemerkt, ich war das einzige Kind meiner Eltern. Noch als ich ein kleiner Junge war, interessierten mich naturwissenschaftliche und technische Dinge. Später dann, als Halbwüchsiger, waren mir die abendlichen Gespräche meiner Eltern und deren Freunde, die, bis auf ganz wenige Ausnahmen, alle ihr Vermögen in der Banken- und Finanzwelt erworben hatten, völlig egal. Es ging meistens, Sie werden es erahnen, ums Geld. Das ging soweit, daß ich mich, oft angewidert von diesen Gesprächen, die, fast ausnahmslos, nur finanzielle Dinge beinhalteten, von meinen Eltern und deren Besuchern abwendete. Ich ging dann zu meinen Freunden, mit denen ich die Dinge besprechen konnte, die mich wirklich faszinierten: Die Entstehung der Erde, das Funktionieren wissenschaftlicher Apparate und das Erleben kleiner Experimente. Ach, was haben wir alles gemacht! Wir züchteten Salzkristalle, legten einen Eisblock auf zwei Hocker und warteten gespannt darauf, was geschieht, wenn um diesen Eisblock ein dünnes Stahlseil, beschwert mit einem Gewicht, gelegt wurde. Na, eben diese bekannten Schülerversuche führten wir aus.“
„Möchten Sie etwas Wein haben?“, fragte die Frau.
„Ja, gern!“
„Ihre Eltern haben doch sicherlich bemerkt, daß Sie andere Interessen als den Umgang mit Aktienkursen und Börsendaten bevorzugen?“
„Ja, das haben sie. Eines Tages fragte mich mein Vater auch danach. Ich erklärte ihm ohne viel zu zögern, daß ich, nach dem Abitur ein Studium der Geologie beginnen werde. Sie müssen wissen, ich konnte in einem sehr aufgeschlossenen und liberalen Elternhaus groß werden. Als ich diese für mich getroffene Festlegung äußerte, bemerkte ich, daß das zwar nicht den Vorstellungen meines Vaters über meine Zukunft entsprach. Jedoch, und eigentlich hatte ich nichts anderes erwartet, stellte er sich nicht gegen mich. Es wäre mein Leben, sagte er, für das ich ab einem gewissen Alter selbst verantwortlich bin. Und im übrigen würde er meinen Wunsch akzeptieren und auch fördern. Mit der Verwaltung der Familienanteile an der Bank würde ein Weg gefunden werden.“
„Solch’ eine Einstellung wünschte ich mir heute, zu Beginn des vermeintlich aufgeklärten 21. Jahrhundert, öfter zu hören“, unterbrach die Frau die Rede des Besucher.
„Ach, wissen Sie, das hat nichts mit dem 21. Jahrhundert zu tun, sondern in erster Linie mit der Einstellung der Eltern zu ihren Kindern. Viele Eltern haben noch immer nicht begriffen, daß sie nicht die Regisseure des Lebens ihrer Kinder sind. Irgendwo habe ich einmal gelesen, daß man seinen Kindern, außer einer glücklichen Kindheit und einigen lebenspraktischen Ratschlägen, nichts weiter mitgeben kann. Ich habe selbst zwei Kinder, aber dennoch meine ich, das könnte so sein.“
„Sie studierten dann…?“
„Nach dem Abitur begann ich dann ein Studium der Geologie an der Bergakademie in Freiberg, in Sachsen. Das war damals, bevor die Mauer unser Land zerteilte, noch möglich, nämlich, daß jemand, der aus dem Westen kam, in der damaligen DDR studieren konnte. Leider war mir der Aufenthalt an dieser Universität nur für drei Semester vergönnt, dann verdunkelten die Wolken der damaligen politischen Ereignisse den Horizont. Auf Anraten meines Vaters brach ich das Studium ab, um es, dann im Westen, fortzusetzen.“
„Und an welcher Universität?“
„In München, ab dem Sommersemester 1961.“
„Und weshalb haben Sie das Studium dann in München weiter geführt?“
„Ab 1880 war Karl Alfred von Zittel(3) an der Münchner Universität Professor für Geologie und Paläontologie. Übrigens, den einzigen Lehrstuhl für diese Wissenschaft, ich meine die Paläontologie, der damals in Deutschland bestand. Das hat mich interessiert, die Paläontologie als gleichwertige Disziplin der Geologie und nicht als deren Teilgebiet zu erfahren. Nachdem ich das Diplomzeugnis im Fachgebiet Geologie erhalten hatte, war ich von der Paläontologie so begeistert, daß ich beschloß, dann noch meine Doktorarbeit über ein Thema dieses Fachgebietes zu schreiben. Außerdem hatte ich, da bin ich ganz ehrlich, keine Lust zum Arbeiten in irgendwelchen Firmen oder Ämtern. Die vier Jahre, in denen ich an meiner Doktorarbeit schrieb, war eine Wiederholung des studentischen Leben, eine Verlängerung meiner Studentenzeit.“
„Man ist immer versucht, schöne Momente und Erlebnisse unvergänglich zu machen. Nur, meistens gelingt das nicht!“
„Während ich mich mit meiner Doktorarbeit beschäftigte, wie könnte es anders sein, hatte ich mir ein Thema aus dem Fachgebiet der Fossilisation(4), also der Entstehung von Fossilien, gewählt, lernte ich, wann und wo, weiß ich heute nicht mehr, einige Menschen kennen, die mein späteres Leben entscheidend beeinflussen, sogar prägen sollten. So, und wenn ich jetzt weiter berichte, dann dauert das nun wirklich sehr, sehr lange.“
„Uns macht es nichts aus“, sagte Claudia Rieger.
„Nein, nein, ich möchte Ihre Gastfreundschaft nicht über die Maßen in Anspruch nehmen. Nun denken Sie bestimmt über mich, daß ich Sie, zunächst versuche, für die Dinge meines Lebens zu interessieren und wenn dann die wirklich wichtigen Dinge berichtet werden sollen, ziehe ich mich zurück. Nein, so ist es nicht. Deshalb mache ich Ihnen folgenden Vorschlag: Ich berichte Ihnen jetzt, sehr zusammengefaßt, von dem, was mein Leben, ich sagte es bereits, entscheidend prägte. Wenn Sie dann Weiteres wissen möchten, lade ich Sie nach Hamburg ein und ich zeige Ihnen dann Dinge, die haben, vermutlich, nur wenige Menschen auf dieser Welt jemals gesehen. Habe ich Ihr Interesse geweckt, ja?“
„Selbstverständlich!“, erwiderten Thomas und Claudia Rieger.
„Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, daß ich während der Zeit, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, Menschen kennen lernte, mit denen ich das größte Abenteuer meines Lebens bestehen sollte, nämlich, den Bau eines Tunnel von Portugal nach Südamerika.“
„Wie, bitte?“, unterbrach Thomas Rieger.
„Ja, Sie haben es richtig gehört, wir haben tatsächlich versucht, einen Tunnel von Europa nach Südamerika zu graben. Sie wissen, spätestens seit Ihrer eigenen Studentenzeit, daß, oftmals im weinseligen Zustand, über die ungewöhnlichsten Ideen ’mal so laut nachgedacht wird.
Damals trafen sich einige Doktoranden und Studenten der höheren Semester, mehr oder weniger regelmäßig, um wissenschaftliche Probleme in angenehmer Runde zu besprechen. Aber auch, um darüber zu philosophieren, was wäre wenn… Es waren keine Phantasten, die sich da trafen, im Gegenteil, alle waren bodenständige und sehr nüchterne und realistische Menschen.
Eines Tages meinte jemand, wer das war, weiß ich heute nicht mehr, aus dieser Gesprächsrunde, er hätte das Buch „Der Tunnel“ von Bernhard Kellermann(5) gelesen.
Nun, wer hatte dieses Buch nicht gelesen? Wir wußten, in diesem Buch sind die Phantasien des Schriftstellers Kellermann nachzulesen. Diese Rahmenhandlung ermöglicht, gesellschaftskritische Ansichten darzulegen. Nun, wir waren keine Literaturwissenschaftler, uns interessierte, aus verständlichen Gründen, der naturwissenschaftlich-technische Aspekt dieses Buches. Ich kann mich erinnern, daß wir tagelang über dieses Buch sprachen, beinahe jede einzelne Szene dahingehend überprüften, ob das Geschilderte mit den damals bekannten technischen Mitteln und Möglichkeiten überhaupt durchzuführen gewesen wäre. Bedenken Sie, Kellermann hat dieses Buch im Jahre 1913 veröffentlicht!“
„Und zu welchem Ergebnis sind Sie gelangt?“, wollte Thomas Rieger wissen.
„Ach, eigentlich zu keinem. Wir hatten damals nur begrenzte Kenntnisse über die Geschichte der Technik, was ja auch nicht unser Fachgebiet war. Deshalb war uns eine genaue Beurteilung des Machbaren, zur damaligen Zeit, wohlgemerkt, nicht möglich.“
„Nun gut“, sagte Thomas Rieger, „das Kellermann’sche Buch lesen und über die Machbarkeit des Geschilderten sprechen ist eine Sache. Wie kamen Sie denn nun auf die Idee, einen Tunnel von Europa nach Südamerika zu graben?“
„Den eigentlichen Anstoß zu diesem Vorhaben gab mein Vater. Er hatte sich schon lange damit abgefunden, daß ich nicht, als sein Nachfolger, in das Bankhaus eintreten würde. Heute meine ich, er hatte auch frühzeitig erkannt, ich eignete mich ohnehin nicht für diesen Job als Banker. So unterstütze er bedingungslos meine geologischen Studien und unterstützte meinen Plan, nach der bestandenen Diplomprüfung eine Doktorarbeit zu schreiben, bedingungslos. Er schickte mir jeden Monat einen Scheck, so daß ich mir keinerlei finanzielle Sorgen machen mußte.“
„Eindeutiger kann die liberale Einstellung Ihrer Eltern nicht beschrieben werden!“
„Ach wissen Sie, Claudia, eigentlich konnte ich mit meinen Eltern ganz zufrieden sein. Ich hätte sie gern noch einige Jahre bei mir gehabt. Sie sind, während einer Urlaubsreise, bei einem Flugzeugabsturz umgekommen, es war in dem Sommer, als ich meine Doktorarbeit erfolgreich abgeschlossen hatte. Und, um Ihrer möglichen Frage zuvor zu kommen, meinen Anteil an der Bank habe ich gut verkaufen können, bis auf einen Anteil, den ich mir als zukünftiges Auskommen im Alter, schon damals, sicherte.“
„Nein, wir werden nicht weiter danach fragen.“
Dr. A. rückte seinen Stuhl noch ein Stück in den Schatten der alten Bäume und berichtete weiter:
„Trotzdem, als mein Vater sich mit der von mir selbst gewählten beruflichen Perspektive abgefunden hatte, erzählte er mir, nicht häufig, aber hin und wieder, einiges über seine geschäftlichen Aktivitäten. Sie müssen dazu wissen, mein Vater hatte weitreichende Beziehungen bis in die Vorstandsetagen einiger Firmen, aber auch bis in hohe und höchste Regierungskreise, besonders des Forschungs-und des Finanzministeriums. Es waren alte Schulfreundschaften, die er pflegte und ebenso sich daraus entwickelte Bekanntschaften, denen er diese Kontakte verdankte.
An einem Abend, ich war zu Besuch bei meinen Eltern, es muß im Winter 1968/69 gewesen, sein fragte mich mein Vater, ob ich die ELDO kenne. Wahrheitsgemäß verneinte ich seine Frage und dann erklärte er mir, die ELDO wäre die von einigen europäischen Staaten und Australien gegründete Organisation zur Entwicklung europäischer Trägerraketen. Man hatte nämlich die Notwendigkeit erkannt, europäische Satelliten in den Weltraum zu befördern. Australien wurde an diesem Projekt beteiligt, weil das in Woomera gelegene Raumfahrtgelände für den Start der europäischen Raketen benötigt wurde.“
Thomas Rieger fragte:
„Meines Wissens werden die europäischen Weltraumraketen doch in Kourou, in Französisch-Guayana, gestartet?“
„Sehen Sie, Herr Rieger, ich bin Geologe und kein Raketenfachmann. Ich weiß nur, daß ab dem Jahr 1968 dann der von Ihnen bereits erwähnte Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana gebaut wurde. Während dieses Gespräches im Winter 1968/69 im Haus meiner Eltern erklärte mir mein Vater, aus zuverlässigen Quellen zu wissen, die politische Lage sei so gestaltet, daß in der Europäischen Organisation für Weltraumforschung, kurz ESRO genannt, überlegt, wie die Raketen auf sicherstem Weg nach Kourou gebracht werden können. Es soll nämlich vorgekommen sein, daß die Transporte dieser Raumfahrtmodule per Schiff oder, manchmal auch mit dem Flugzeug, das unnötige Interesse des politischen Nachbarn geweckt hätten. Genaueres wußte mein Vater nicht, was ich ihm durchaus glaubte. So war die Idee entstanden, unter dem Meeresboden des Atlantik einen Tunnel zu bauen, durch welchen dann die Raketenteile transportiert werden können.“
„Das ist, vollständig der Weltöffentlichkeit verborgen geblieben?“, fragte Claudia Rieger.
„Haben Sie davon irgendetwas in den Zeitungen gelesen oder im Radio oder gar dem Fernsehen gelesen oder gehört?“, antwortete Dr. Jürgen A.
„Nein, obwohl wir in einer Region der ehemaligen DDR wohnten, die durchaus über einen sehenswerten Empfang des Westfernsehen verfügten.“
„Sehen Sie, die Sache war top secret, wie man in Geheimdienstkreisen so etwas nennt. Mein Vater überlegte natürlich auch, welche Aufgabe ich nach dem Abschluß meiner Doktorarbeit übernehmen könnte. Und so machte er mir den Vorschlag, an der Ausarbeitung einer Studie, heute sagt man wohl dazu ‚Machbarkeitsstudie’, übrigens eine, ironisch gemeint, herrliche Wortschöpfung, mitzuarbeiten, er hätte mich bereits empfohlen.“
„Jetzt schließt sich ein so oft zitierter Kreis“, unterbrach Thomas Rieger die Ausführungen des Geologen.
„Nee, der Kreis begann, sich erst zu schließen. Nachdem mich mein Vater mit einigen bedeutenden Herren zusammengeführt hatte, die mir die Idee vom Tunnel nach Südamerika erklärten und mich zu äußerstem Stillschweigen verpflichteten, bat ich mir etwas Bedenkzeit aus, auch um darüber zu überlegen, wie solche Studie, wenn ich dann daran mitwirken sollte, zu erarbeiten wäre.
Nach einigen Tagen, die ich im Haus meiner Eltern verbrachte, fuhr ich nach München zurück…“
Der Besucher, Dr. Jürgen A. sah seine Gastgeber, Thomas und Claudia Rieger, an und sagte:
„Meine Lieben, ich darf Sie doch so nennen, ich lade Sie zu mir nach Hamburg ein. Sie bringen sehr viel Zeit mit, denn ich erzähle Ihnen dann, wie es mit diesem Abenteuer weitergeht. Außerdem werde ich Ihnen sehr interessante Dinge zeigen, die ich noch niemals jemandem offenbarte!“
„Sie wollen jetzt gehen?“
„Ja! Hier haben Sie meine Telefonnummer und meine Adresse. Bedenken Sie, jetzt ist es Ende August. Vor Mitte, gar Ende September, brauchen Sie nicht anzurufen. Der Spätsommer ist so schön in Nordfriesland, den möchte ich noch, fast bis zum letzten Sonnenstrahl, genießen.“
„Danke für die Einladung!“
Thomas Rieger nahm die Karte mit der Adresse und der Telefonnummer, die Dr. A. ihm übergab. „Wissen Sie“, sagte Dr. A. „ich habe mich bei Ihnen sehr wohl gefühlt und fahre mit dem Wissen nach Hause, daß wir uns bald wieder sehen werden.“
Am 28. September 2001 sagte Claudia Rieger zu ihrem Mann:
„Wollen wir versuchen, den Geologen zu erreichen, ich meine, wollen wir ihn anrufen?“
„Du kannst das versuchen. Er sagte doch, Ende September wäre er wieder in Hamburg zu erreichen“, erwiderte Thomas Rieger und fragte dann seine Frau:
„War der Postbote heute schon da?“
„Ich gehe, um nach der Post zu sehen.“
Als Claudia Rieger den Postkasten öffnete, war, neben den heutzutage üblichen, Werbesendungen, ein umfangreicher Brief eingeworfen worden.
„Na, das ist ja eine Überraschung, Thomas, sieh’, bitte, soeben haben wir noch über Dr. A. gesprochen. Und jetzt hat er uns geschrieben! Der Brief ist an uns beide adressiert, wer macht ihn auf, wer liest vor?“
„Ich weiß doch, wie gerne du Briefe öffnest. Du hast die Post aus dem Kasten geholt, also steht dir auch das Recht zu, den Briefumschlag aufzumachen und das vorzulesen, was Dr. A. uns geschrieben hat.“
Claudia nahm ein Messer, schlitzte den Umschlag auf und entnahm den Brief. Sie begann das vorzulesen, was Dr. A. mitgeteilt hatte:
Ein phantastisches Vorhaben
(Der Bericht des Herrn Dr. Jürgen A.)
Liebe Freunde,
die Stunden vor einigen Wochen bei Ihnen und in Ihrem Garten waren so recht geeignet zu erkennen, daß es in unserer hektischen Welt Oasen der Ruhe und Zufriedenheit gibt. Haben Sie, bitte, noch einmal und, auf diesem Wege, sehr vielen Dank für die freundliche Aufnahme in Ihrem Haus!
Hatte ich Sie gebeten, mich in Hamburg zu besuchen, so muß ich heute um Nachsicht dafür bitten, daß das, jedenfalls bis zur Zeit des diesjährigen Weihnachtsfestes, nicht möglich sein wird. Ich wurde gebeten, in das portugiesische Staatsarchiv zu kommen.
Wollte ich Ihnen bei Ihrem Besuch in meinem Haus, was eher ein Museum ist, denn eine Wohnung, über die Erlebnisse berichten, die mich beim Bau des Tunnel erreichten, so müssen Sie sich nun damit begnügen, daß ich Ihnen all’ das, was ich erzählen wollte, aufgeschrieben habe.
Ich bemerkte bei meinem Besuch, vor einigen Wochen bei Ihnen, daß Sie mit Interesse meinen Bericht verfolgten und so sollen auch Sie es sein, denen ich meinen Bericht anvertraue weil ich weiß, er ist bei Ihnen in guten und vertrauensvollen Händen. Sollte mir, man weiß es ja nie, irgendetwas zustoßen, so habe ich testamentarisch verfügt und notariell beurkunden lassen, daß Sie beide, Thomas und Claudia Rieger, mein Testament zu vollstrecken haben. Die dazu notwendigen Verfügungen sind in meiner Wohnung in Hamburg hinterlegt.
Doch ich hoffe, dieser Fall wird, zumindest in den nächsten Jahren nicht eintreten. Man weiß allerdings nie…
Nun machen Sie sich keine unnötigen Gedanken und seien, bitte, recht freundlich gegrüßt,
Ihr A.
P.S. Mein Ihnen vorliegender Bericht darf erst am 01. Oktober 2006 veröffentlicht werden!
A.
„Claudia, ich glaube, jetzt brauche ich erst ’mal einen Moment, um das hier zu verstehen. Damit habe ich nicht gerechnet.“
Thomas Rieger nahm die von Dr. A. handschriftlich und eng beschriebenen Seiten aus dem Umschlag und begann zu lesen:
„Dieser Bericht geht zu treuen Händen von Herrn Thomas und Frau Claudia Rieger und darf ohne meine ausdrückliche Zustimmung nicht vor dem 01. Oktober 2006 in keiner Weise, auch auszugsweise, veröffentlicht werden. Die alleinigen Rechte an diesem Bericht verbleiben bis zum genannten Datum beim Verfasser und gehen danach uneingeschränkt an die oben genannten Personen über.
Im Winter 1968/69 vermittelte mir mein Vater ein Gespräch mit einer Arbeitsgruppe, die im Auftrag der Europäischen Organisation für Weltraumforschung (ESRO) beauftragt worden war zu überprüfen, wie Raketen auf dem sichersten Weg von Europa nach dem Weltraumbahnhof in Kourou (Französisch-Guayana) zu verbringen seien.
Zu diesem, damaligen, Zeitpunkt hatte ich meine Doktorarbeit über geologische Probleme der Fossilisation soweit abgeschlossen, dass ich diese Ausarbeitungen meinem ‚Doktorvater’ in wenigen Wochen übergeben und somit das Promotionsverfahren eingeleitet werden konnte, was dann auch für mich erfolgreich im Mai des Jahres 1969 abgeschlossen war.