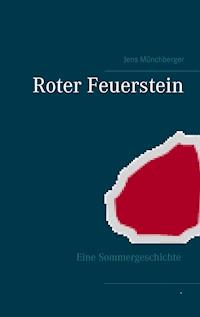Die Reise des Wilhelm Ernst Karstbaum und seiner Ehefrau Marie, geborene Weilandt, übers Meer nach Samoa, geborene Weiland E-Book
Jens Münchberger
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Max Ernst Karstbaum berichtet während vieler Gespräche über die Reise seiner Eltern im 1938-er Sommer und Herbst aus dem braunen Deutschland via Kapstadt nach Samoa. Ein Denunziant hatte sich am Namen der Familie gestört und gemeint, jüdische Wurzeln erkannt zu haben. Zuvor mussten die Familienunternehmen, Holzhandel und Hotel, verkauft werden. Freunde, damals rar, halfen als "gute Geister". Vom Friaul reisten sie mit dem Schiff nach Marseille und weiter auf die Azoren, wo sie eine Bekannte trafen und dann nach La Palma, Kanarische Inseln. Mit einem ehemaligen französischen Expeditionsschiff fuhren die Reisenden sodann die westafrikanische Küste entlang bis nach Südafrika. Neben bedeutenden abenteuerlichen Erlebnissen während der Seereise, u.a. im tropischen Regenwald, müssen die Karstbaums stets wachsam vor Spähern, Häschern und Denunzianten sein. Wobei ihnen die Besatzung, besonders der Kapitän des Dampfers, behilflich ist, bis sie endlich Kapstadt erreichen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jens Münchberger, geboren 1958, Dipl.-Bauingenieur. Während des Ingenieurstudiums Gasthörer an der Kunstakademie in Dresden. Arbeit als Bauingenieur. Gründung eines Büros für nachhaltiges Bauen. In den 1990-er Jahren Eröffnung einer Galerie und verstärkte Hinwendung zur Malerei. Auch Arbeiten in Holz und Keramiken.
Veröffentlichung von Kurzgeschichten und der Romane „Meeresfahrt" und „Unter dem Atlantik" und „Die Insel im Atlantik" sowie der Erzählungen „Roter Feuerstein“ und „Am Meer“ und „Der Besuch“.
Jens Münchberger lebt in Schleswig-Holstein.
Die Handlung und alle Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit der Realität sind zufällig, manchmal auch beabsichtigt.
Der Verfasser.
Für meine Familie.
Alle.
„Die einzige Bank, in der man seine Ersparnisse deponieren sollte, ist die Erinnerung. Diese Bank macht niemals pleite.“
Jewgeni Jewtuschenko in „Beerenreiche Gegenden“
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Zum Beginn
Kapitel 2: Die Gespräche, die Aufzeichnungen und die Tagebücher
Kapitel 3: Familiengeschichte
Kapitel 4: Die Reise nach Samoa
1
Zum Beginn
Manchmal, aber nur manchmal, meinte ich, Max Ernst Karstbaum wäre der jüngere Bruder meines Großvaters Henner.
Mein Großvater Henner beging im vorigen Jahr bei bester Gesundheit seinen 90. Geburtstag. Und zum Beweis darüber las er mir am Morgen nach diesem Tag, ohne die Brille zu benutzen, aus der Zeitung vor.
Aber das ist eine andere Geschichte, die ich vielleicht auch erzählen werde...
Beide, mein Großvater Henner und Max Ernst Karstbaum, waren von großer und sehr schlanker Statur, beinahe hager.
Ebenfalls trugen beide ihre eisgrauen Haare sehr kurz geschnitten. Allerdings, Karstbaum hatte einen Bart. Drei oder vier, vielleicht auch fünf, Tage alt.
Mein Großvater Henner war glattrasiert. Darauf legte er größten Wert. Das Rasieren zelebrierte er an jedem Morgen mit Schaum und scharfer Klinge.
Großvater Henner war während der meisten Zeit seines Lebens auf See gewesen, davon 24 Jahre als Kapitän eines Hochseebergungsschleppers.
Irgendwann war ihm Hemingway begegnet. Auf einem Schiff, mit dem der berühmte Mann von Afrika nach Europa reiste.
Das war im Leben meines Großvaters die einzige Begegnung mit einem Künstler. Dennoch war er belesen, kannte sich in der Musik aus und ging oft und regelmäßig, wenn er dann an Land war, in Kunstausstellungen.
„Weißt du“, erklärte er mir an einem Sommerabend, „wenn ein Schiff den Hafen verlassen hat und die offene See ansteuert, dann reguliert sich sehr schnell der Schiffsbetrieb. Jeder weiß, was er wann und wie zu tun hat. Auch der Kapitän. Und so, wie andere Leute zum Feierabend nach Hause gehen, bin ich dann in meine Kajüte gezogen und habe gelesen und Musik gehört. Vor jeder Reise habe ich mir eine Kiste Bücher und Schallplatten an Bord geholt...“
„Ja!“, sagte ich.
Max Ernst Karstbaum hingegen war Künstler bis in die Fingerspitzen. Und um das zu bestätigen, sagte er:
„Eigentlich wollte ich Dichter werden. Aber irgendein Ereignis, welches, ist mir nicht mehr bekannt, ließ mich für meine Ausbildung schließlich die bildenden Künste favorisieren!“
Womit er wohl auch eine richtige Entscheidung getroffen hatte...
Dann zeigte er mir ein Foto, auf dem war er als sehr junger Mann abgebildet:
„Das wurde in dem Sommer, bevor ich mich an der Kunstakademie eingeschrieben habe, aufgenommen!“
Der junge Mann, noch ein Junge, trug seine Haare sehr lang, was ungewöhnlich für die damalige Zeit war. Außerdem ein viel zu großes Hemd, das aus der Hose gerutscht oder nie 'reingesteckt worden war. Fast konnte man meinen, der junge Karstbaum wäre ein weiterer Sohn des Brahmanen und Bruder Siddhartas.
Er machte auf dem Foto einen, wie man es zuweilen bezeichnet, sehr durchgeistigten Eindruck.
„Ich war Zeit meines Lebens, im pädagogischen Sinne, Spätentwickler!“
„Das ist vielen Menschen zu Eigen!“, antwortete ich.
„Mag sein, allerdings, bei mir war das besonders ausgeprägt. Sieh dir dieses Foto an! Da meint man doch, aus der einen Tasche der Jacke könnte in jedem der nächsten Momente Heines 'Buch der Lieder' fallen, aus der anderen ein Bändchen mit Rilke-Gedichten und hinter dem Rücken wird ein Hesse in den schmalen Händen gehalten...“
„Möglich!“
„Und ich weiß es noch sehr genau, es war meinen Eltern, besonders meinem Vater, nicht recht, dass ich an die Akademie gegangen bin. Er hätte sich einen praktischen Beruf, Ingenieur etwa, mit einem späteren sicheren monatlichen Einkommen als die bessere Variante meines beruflichen Lebens gewünscht...“
„Vaterwünsche!“, antwortete ich.
„Allerdings war er so klug, sich nicht gegen diese, meine Vorstellungen und Vorhaben, auch nicht andeutungsweise, zu stellen. Er wusste, es wäre zwecklos gewesen. Die einzige Forderung, die er mir auferlegte, war, dass ich in der Regelstudienzeit, Krankheiten verlängerten die akademischen Bemühungen entsprechend, meinen Abschluss erwerbe...“
„Und?“, fragte ich.
„Das war ich ihm schuldig und habe das Diplom dann auch pünktlich abgeliefert...“
*
Heute kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wann ich Max Ernst Karstbaum kennen lernte. Nicht einmal, wo das war, kann ich mit Bestimmtheit sagen. Ich weiß allerdings seitdem, dieser Tag, an dem ich ihm begegnete, war ein Glückstag in meinem Leben .
Wenn nicht sogar einer der bedeutendsten Tage meines Lebens.
Zugegeben, man weiß es oft erst viel später, dass ein besonderes Ereignis einen Tag genügend geprägt hat, um ihn unvergesslich zu machen.
So auch den Tag, an dem ich Max Ernst Karstbaum kennen lernte.
*
Einige Wochen nach unserer ersten Begegnung durfte ich Max, wie er mir später gestattete, ihn zu nennen, erstmals in seinem Atelier im Dachgeschoss des Hauses besuchen.
Hier war er an den meisten Tagen zwischen Anfang Oktober und Ende April eines jeden Jahres anzutreffen. Etwa ab zehn Uhr am Vormittag. Max Ernst Karstbaum gab es ohne Bedenken zu, nicht zu den Freunden des frühen Morgens zu gehören.
„Weißt du“, sagte er mir, „früh arbeiten macht auch früh müde!“
Allerdings, und das war für ihn kein Widerspruch, sagte er über den Morgen eines jeden Tages:
„Dann, wenn dir der Tag noch so herrlich jungfräulich begegnet. Und du bei einem Morgenspaziergang die klare Luft genießen kannst, werden die besten Ideen geboren. Darum trage ich bei meinen morgendlichen Gängen auch stets ein Notizbuch bei mir...“
So war Max Ernst Karstbaum doch ein fleißiger Mann! Weil die Bildende Kunst für ihn mehr als ein Broterwerb und eher, ebenso wie seine Frau, für ihn Inhalt seines Lebens bedeutete, arbeitete er oft auch an den Wochentagen und den Feiertagen.
Darum sah man ihn so selten in der Stadt. Und wenn, dann meistens beim Bäcker. Karstbaum aß so sehr gern frischen Kuchen...
Im Sommer suchte man Max Ernst Karstbaum allerdings an manchen Tagen vergebens vor seiner Staffelei im Dachgeschoss des Mietshauses.
Dann war er, die Feldstaffelei auf dem Rücken und Farben, Pinsel, Zeichenblock und Stifte in einer Tasche tragend, „in der Natur“, wie er mir erklärte. Später habe ich ihn einige Male begleitet und bei der Arbeit beobachtet. Doch davon werde ich noch berichten...
Oder er war auf Studienreisen. Mit seiner Frau nach Norwegen oder, und das bevorzugt, nach Frankreich. Auch im Donaudelta hatte er schon gemalt und gezeichnet. Damals, als die Reise dorthin, besonders unter jüngeren Leuten, 'in' war.
An der Algarve und auf den Kanarischen Inseln war er ebenfalls. Damals, als junger Mann, nach dem Studium und als noch nicht alle Welt den Archipel im Atlantik besuchte...
Aber Max Ernst Karstbaum mit Karla. Mit seiner ersten Frau Karla. Die habe ich allerdings nicht mehr kennen gelernt, denn, so Karstbaum:
„Das ging nach der Geburt unserer Tochter nicht lange gut mit Karla und mir. Warum, weshalb und weswegen kann ich nicht sagen. In meinem Leben gab es keine andere Frau und auch Karla hatte keinen anderen Mann, Vielleicht hatte das Ende unserer Ehe auch mit meinem Spätentwickler-Status zu tun...“
„Warum?“, fragte ich.
„Vielleicht war ich den Aufgaben eines Vaters und Ehemannes noch nicht gewachsen? Ich weiß es nicht! Heute noch nicht. Sie ist dann mit der Kleinen zu ihrer Mutter und ihrem Vater gezogen.
Wir haben uns dennoch gemeinsam um unsere Tochter gekümmert. Und als sie dann irgendwann einen neuen Mann kennen lernte und später auch heiratete, wurde ich sogar zur Hochzeit eingeladen. Der neue Mann, ein netter, kumpelhafter Zeitgenosse, hat sich sehr um Karla und unsere Tochter gekümmert und auch darum, dass sie nie den Kontakt, bis heute nicht, zu mir verloren hat. Ich weiß nicht, wie oft er mir die Kleine brachte oder sie holte...“
2
Die Gespräche, die Aufzeichnungen und die Tagebücher
Max Ernst Karstbaum war älter als ich. Was bedeutete, mir fiel es nicht leicht, ihm mit der unter gleichaltrigen gewohnten ungezwungenen Weise zu begegnen. Das Alter fordert einigen Abstand und schafft Distanz!
Freundlich begegneten wir uns immer. Auch wenn wir, was oft vorkam, nicht in jedem Fall die Meinung teilten.
Heute kann ich reinen Gewissens feststellen, zwischen Max Ernst Karstbaum, Max, wie ich ihn nennen durfte, und mir wurde nie ein böses Wort gesprochen.
Konnte das, vielleicht, seiner Lebenserfahrung und meiner Achtung vor dem Alter geschuldet sein? Vielleicht.
Die, zunächst Bekanntschaft, später dann Freundschaft zu Max Ernst Karstbaum, teilte ich, und das für viele Jahre. mit keinem anderen Menschen aus meinem Freundeskreis. Mit Bekannten schon gar nicht.
Und nur schwer konnte ich mich entschließen, anderen Leuten gegenüber zu erwähnen, oft Stunden mit Max und bei ihm verbracht zu haben.
Ich hatte Bedenken, etwas zu teilen, um es dann vielleicht zu verlieren.
So ist es zu erklären, dass meine Besuche im Atelier unter dem Dach außer Max' Frau Juliane niemandem anderes bekannt waren.
Später habe ich begonnen, die Gespräche aufzuschreiben. Dann, wenn ich von meinem Besuch bei Maler Karstbaum nach Hause kam, habe ich, in den meisten Fällen noch am gleichen Abend, die Gespräche aus der Erinnerung notiert. Gegen Ende jeder dieser Aufzeichnungen dann auch meine Empfindungen und Eindrücke. Aber das oft nur skizzenhaft. Wichtiger waren mir die Worte, die Max sagte und mit denen er seine Meinungen formulierte und begründete.
Die Aufzeichnungen sind in Notizbücher, zumeist auf liniertes Papier, geschrieben. Mitunter allerdings auch auf unbedrucktes, reinweißes Papier. Je nachdem, was in den Läden zu erhalten war. Ich kaufte dann meist zwei oder drei dieser Notizhefte oder -bücher, im Format etwa DIN A 5. Manchmal und besonders an gute Freunde, verschenkte ich auch eines der Notizbücher. Selbstverständlich unbeschrieben. Denn ich hatte begonnen, besondere Editionen dieser Bücher zu sammeln.
War die letzte Seite in den Notizbüchern beschrieben, auch Zeitungsausschnitte oder Mitteilungen aus Kalendarien hatte ich eingeklebt, dann setzte ich das Datum des letzten Eintrags in dieses Buch auf die letzte Zeile der letzten Seite und stellte es in ein gesondertes Fach meines Bücherschranks.
So hoffte ich, sie würden staubfrei durch die Jahre kommen.
Später habe ich fast immer eines dieser kleinen und mit Batterien betriebenen Aufzeichnungsgeräte auf den Tisch zwischen uns gestellt und Max' Worte so aufgenommen. Mitgeschnitten Und so der Nachwelt erhalten. Immer habe ich ihn nach seinem Einverständnis für die Aufnahmen gefragt.
Nur einige wenige Male konnte ich sein Einverständnis dazu nicht bekommen. Aus Gründen, die ich heute nicht mehr nennen kann. Aber fast immer sprach er am Anfang unserer Unterhaltung, wenn ich sie mit dem Diktiergerät aufzeichnete, den folgenden Satz:
„Ich bin Max Ernst Karstbaum. Heute, am [… hier nannte er das Datum des Tages …] bin ich damit einverstanden, dass das nachfolgende Gespräch aufgezeichnet wird.“
Anfangs tat er das aus eigentlich nur ihm verständlichen Gründen. Aber irgendwann meinte er, das wäre wohl besser so. Wegen der Autentizität...
"... und auch, um irgendwelchen Nörglern und Zweiflern, na, du weisst, welche Typen ich meine, zu begegnen!"
Recht hatte er!
So ist es zu erklären, warum es mir möglich ist, vieles, nicht alles, aber vieles, von dem, was Max Ernst Karstbaum sagte und meinte und dachte, wiederzugeben.
Immer dann, wenn ich seine Stimme höre, diese angenehme Stimme eines Mannes, der mir aus seinem Leben und über seine Ansichten zu den Dingen des Lebens berichtete, sehe ich ihn, wenn ich die Augen schließe, vor mir sitzen.
Aufrecht, den Kopf leicht geneigt, saß er mir oft gegenüber und sah mich mit seinen blauen Augen an. Solche blauen Augen habe ich nur bei sehr wenigen Menschen gesehen. Auch im Alter waren diese Augen noch so sehr blau und sehr klar.
Was dann, wenn ich nicht mehr bin, mit diesen Aufzeichnungen geschieht, habe ich noch nicht verfügt.
Ich hatte, leider, auch keine Gelegenheit, mit Max darüber zu sprechen.
Mit Juliane kann ich darüber nicht reden. Sie begegnet mir sehr liebenswürdig und höflich. Aber Max, so will es mir erscheinen, ist für sie in einer Tabu-Zone angekommen. Und jedes Gespräch über ihn wird von ihr vermieden.
Vielleicht ist das auch gut so.
Nun, allerdings:
Soll doch, was die Notizbücher betrifft, die Nachwelt entscheiden, was damit geschieht!
3
Familiengeschichte
Gegen Ende der 1880-er Jahre expandierte unerwartet die kaum mehr als drei Querstraßen weiter bekannte „Handlung für feste Brennmaterialien“ des Paul Ernst Karstbaum, Urgroßvater väterlicherseits des Max Ernst Karstbaum
Aus dem kleinen Holz- und Kohlenhandel, den der Gründer, zugleich Inhaber, Paul Ernst Karstbaum mit einem Pferd, später mit zwei Pferden betrieb, hatte sich nach wenigen Jahren eine von drei wirtschaftlich bedeutenden Holzhandlungen Ostdeutschlands entwickelt.
„Karstbaum – Holzhandel“ war der Inbegriff für Qualität, Solitidät und kaufmännisches Geschick.
Auch aus diesem Grund war dann der Vater von Max Ernst Karstbaum, Wilhelm Ernst Karstbaum, der Sohn von Fritz Ernst Karstbaum und Enkel von Paul, einer der Lieferanten der Firma Christoph & Unmack aus Niesky in der Oberlausitz.
Für den Leser:
Als der Brennmaterialienhandel des Paul Ernst Karstbaum in die Entwicklung kam, das war im Jahre 1887, verlagerten zur gleichen Zeit der Tischler Christoph und der Architekt Unmack ihre Holzbaufirma von Kopenhagen nach Niesky in der Oberlausitz.
Nachdem die 1882 gegründete Firma einen Großauftrag des Preußischen Militärs zum Bau zerlegbarer und transportabler Baracken erhalten hatte, entschied man sich für den Umzug
Wenige Jahre später hatten die beiden Dänen die Produktion ihrer Firma auf Wohnhäuser aus Holzfertigteilen erweitert und legten den Interessenten eine Vielzahl von Varianten und Grundrissen vor. Das führte dazu, dass sich Christoph & Unmack in den 1920-er Jahren zur größten und bedeutendsten europäischen Holzhausbaufirma entwickelt hatte.
Ein zu gleichen Teilen interessanter und werbewirksamer Auftrag dürfte dann die Errichtung des Sommerhauses von Albert Einstein in Caputh („Chikago des Schwielowsee“, Theodor Fontane) im Jahre 1929 gewesen sein. Der Entwurf für dieses Haus stammte von dem damals jungen Architekten Konrad Wachsmann, einem Poelzig- und Tessenow-Schüler. Wachsmann zeichnete als Chefarchitekt der Firma Christoph & Unmack für sehr viele Projekte und Planungen verantwortlich, wenngleich auch die Zusammenarbeit mit seinerzeit namhaften Architekten gesucht wurde.
Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden erneut transportable Holzbaracken hergestellt, die in Lagern für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, deportierte Juden und Häftlinge aufgebaut wurden.
Nach 1945 wurden die Produktionsanlagen von der sowjetischen Besatzungsmacht als Reparationsleistungen beschlagnahmt und demontiert.
Wilhelm Ernst Karstbaum, der Vater von Max Ernst Karstbaum, heiratete an seinem vierzigsten Geburtstag Marie, geborene Weilandt.
Marie war, zur damaligen Zeit nicht unüblich, fünfzehn Jahre jünger als ihr Mann.
Wilhelm Ernst Karstbaum hatte nach dem Erhalt des Abiturs eine Lehre zum Zimmermann erfolgreich abgeschlossen und nach der üblicherweise dreijährigen Wanderschaft die Ausbildung zum Kaufmann begonnen und dann ebenfalls mit gutem Erfolg beendet.
Somit war er für die Arbeit in der väterlichen Holzhandlung sehr gut vorbereitet.. Denn es war ihm vorbestimmt, weil einer Familientradition folgend, dass er, sollte die Zeit gekommen sein, dem „Karstbaum – Holzhandel“ vorstehen würde.
Alle Gewohnheiten und Traditionen legten fest, dass der älteste Sohn beginnt, die Firma einen Tag nach dem 70. Geburtstag des Vaters alleinverantwortlich zu leiten. Oder einen Tag nach seinem eigenen 40. Geburtstag diese Aufgabe übernimmt. Je nachdem, was zuerst eintritt.
Allerdings blieb Wilhelm Ernst Karstbaum nach Abschluss seiner kaufmännischen Ausbildung nur die Frist von einem Jahr und wenigen Wochen, um sich mit Struktur und Organisation der väterlichen Firma vertraut zu machen.
Denn, in des Wortes wahrster Bedeutung, wurde Fritz Ernst Karstbaum plötzlich und unerwartet von Freund Hein besucht, der ihn, ohne zu zögern, mit sich nahm.
Wenige Wochen nach seinem 31. Geburtstag wurde Wilhelm Ernst Karstbaum nun Inhaber und zugleich Geschäftsführer einer der drei größten Holzhandlungen Ostdeutschlands.
Das war im Juni 1921.
In diesem Jahr, das sei hier nur nebenbei erwähnt, erhielt Albert Einstein den Nobelpreis für Physik. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Einstein die Auszeichnung für die Entdeckung und Beschreibung des „Gesetzes des photoelektrischen Effekts“ erhielt und nicht, wie vielleicht vermutet, für seine Arbeit zur Entdeckung und Beschreibung der allgemeinen und speziellen Relativitätstheorie.
Wilhelm Ernst Karstbaum wusste um seine unvermittelt übertragene Verantwortung. Er konnte sich allerdings auch der absoluten Loyalität und Hilfsbereitschaft der gesamten Belegschaft seines Holzhandels unbedingt und ohne Ausnahme sicher sein.
Unter seiner Leitung und Geschäftsführung expandierte die Firma weiter, was mit beinahe gesetzmäßigem Selbstverständnis Neider und missgünstige Zeitgenossen weckte. Denen blieben die geschäftlichen Erfolge der Firma „Karstbaum – Holzhandel“ nicht verborgen. Diese unangenehmen Zeitgenossen begannen, Gerüchte, gleich welcher Art und welchen Inhalts, zu streuen, um so den ausgezeichneten Ruf der Karstbaum'schen Firma in Misskredit zu bringen.
„Irgendjemand hatte am Anfang der 1930-er Jahre das Gerücht gestreut, unsere Familie hätte jüdische Wurzeln“, sagte mir Max Ernst Karstbaum, als er über seine Familie sprach. Und erklärte mir dann:
„Aber das ist und war selbstverständlich Quatsch und Humbug. Aber gegen Dämlichkeit war auch damals schon kein Kraut gewachsen!“
„Und was war richtig?“, fragte ich.
„Damals, als unsere Vorfahren begannen, neben dem Vornamen auch einen Zunamen, heute sagt man dazu Familienname, zu führen, waren meine Vorfahren diejenigen, die in einer Hütte in der Nähe eines Baumes im Karst gelebt hatten. Also die vom Karstbaum, später von Karstbaum. Das 'von' hat sich dann, weil für meine Ahnen als bedeutungslos angesehen, im Laufe der Zeit abgenutzt und wurde dann auch nicht mehr erwähnt. Übrig blieb Karstbaum...“
„Aber der Begriff 'Karst' ist mir nicht unbekannt!“, sagte ich.
„Die Geologen bezeichnen als Karst eine Hochfläche oder aber auch eine gebirgige Landschaft, je nachdem, mit vorwiegend kalkhaltigem Gestein. Aber auch eine Landschaft in Slowenien und Kroatien an der Grenze zu Italien wird so bezeichnet.“
„Da war deine Familie ursprünglich beheimatet?“
„Ja! Wir, also meine Familie, sind ehemals im Friaul beheimatet gewesen! Allerdings sind wir vor mehr als dreihundert Jahren von der adriatischen Küste nach Norden ausgewandert. Die Gründe kenne ich nicht. Und habe darüber auch nie etwas in verschiedenen Aufzeichnungen gefunden...“
„Schade!“, sagte ich.
Und Max bestätigte:
„Wirklich sehr schade. Aber nicht mehr zu ändern. Vielleicht hatte einer meiner Verwandten begonnen, die Geschichte unserer Familien aufzuschreiben. Und konnte nicht weiter daran arbeiten. Wer weiß! Alles, was mir bekannt ist, haben mir meine Mutter, vor allem, und mein Vater berichtet und erklärt!“
Damit war für Max Ernst Karstbaum das Gespräch über die Herkunft seiner Familie, zumindest für diesen Tag, beendet. Aber irgendwann würde er noch über weitere Einzelheiten und Begebenheiten sprechen...
An dieser Stelle sei ergänzend erwähnt, Max Ernst Karstbaum hatte eine bedeutende Bindung und Beziehung zu seiner Familie. Das konnte ich bei jedem unserer vielen interessanten und oft lange währenden Gespräche wieder und wieder bemerken...
Ich hoffe, dem Leser ist das Gleiche, zumindest ähnliches, vergönnt...
4
Die Reise nach Samoa
Max Ernst Karstbaum und ich führten unsere Gespräche, Grundlage dieser Aufzeichnungen, in seinem Atelier. Ausschließlich dort.
An einem kleinen Tisch, einem Teetisch, saßen wir uns in großen und schweren Sesseln gegenüber.
*
„Mein lieber Freund“, sagte Max eines Tages zu mir, „stell dir 'mal die folgende Situation vor! Nun, da wir hier sitzen und beginnen, uns auf unser Gespräch zu konzentrieren, klopft es an der Tür. Nicht so zaghaft, wie jemand, der sehr höflich um Einlass bittet. Sondern grob und derb und laut! Und noch ehe wir dieses Klopfen so richtig begriffen und vernommen hätten, würde die Tür aufgestoßen, würden drei Männer im Raum stehen... Und durch die geöffnete Tür würden wir erkennen, da draußen, auf dem Flur stehen weitere schwer bewaffnete Männer. Einer von den drei Männern, die eingedrungen wären, würde mit einem Ausweis vor unseren Gesichtern herumfuchteln und erklären, wir hätten ab jetzt genau eine halbe Stunde Zeit, um einige für uns wichtige und notwendige Sachen zusammen zu suchen und müssten dann das Haus verlasen...“
„So geschehen in Deutschland während der braunen Zeit?“
„Ja! Und die Kommunisten haben dann nach '45 im Osten Deutschlands dieses Ritual, wohl weil das unter den Braunen so gut geklappt hat, übernommen und weiter benutzt...“
„Leute zu einer unmöglichen, eigentlich unmöglichen Zeit, aus ihren Wohnungen zu holen, ist der Executive allgemein zu Eigen!“, sagte ich.
„Sicher! Ja, das ist wohl so!“, Max sah mich an und sprach dann weiter:
„Genau diese Situation, wie ich sie eben beschrieben habe und wie sie mehrtausendfach geschehen ist, wollten meine Mutter und mein Vater nicht erleben...“
„Und haben dann, so vermute ich, begonnen, den geordneten Rückzug, besser Auszug, aus dem braunen Deutschland zu organisieren.“
„Ja!“
„Noch bevor das dringend wurde?“
„Ja! Meine Mutter sprach, auch als die braune Zeit dann Geschichte war, immer nur von der Quelle...“
„Was für eine Quelle?“, fragte ich, „Ein Freund? Ein Warner?“
„So oder ähnlich. Besser: Genau so. Ein Jemand, der an exponierter Stelle saß und von dort schützend die Hand nicht nur über meine Familie hielt. Meine Mutter hat den Namen nie gesagt, auch später nicht.“
„Nein?“
„Nein! Auf keinen Fall in meiner Gegenwart. Und nie im Zusammenhang mit den Ereignissen um die Ausreise aus Deutschland. Ich weiß bis heute nicht, wer da meine Familie behütet hat. Ich weiß es nicht... Auf alle Fälle war das ein anständiger Mensch...“
„Und warum hat deine Mutter, zumindest im Familienkreis, nicht offen den Namen gesagt?“
„Kannst du dir das nicht denken?“, Max sah mich an.
Und noch ehe ich antworten konnte, sagte er:
„Aus Angst. Während der braunen Zeit ohnehin und sowieso. Und danach ebenfalls. Wir, du und ich, andere Menschen ebenfalls, wissen nur zu genau, dass auch im Westen dieses Landes nicht so sehr gründlich an der Bewältigung der braunen Vergangenheit gearbeitet wurde... Du weißt, was ich meine?“
„Ja! Gab es vor nicht allzu langer Zeit nicht diese Schrift darüber, wie die Ministerien von Bund und Ländern mit Beamten bestückt waren, die bereits den braunen Herren dienten?“
„Davon habe ich auch 'was gehört. Nicht nur meine Mutter wird das gewusst haben und hat sich entsprechend verhalten...“
„Ja! Verbindungen und Beziehungen funktionieren immer. Und schaden eigentlich nur dem, sagt der Volksmund, der keine hat!“
„Und dann vergiß nicht, auch im Osten waren viele, die dann an exponierter Stelle tätig waren, bereits unter den braunen Machthabern zu Ruhm und Ehre gelang, Und mancher Kommunist war ebenfalls ein Wendehals!“
„So ist das, mein Freund!“, Max blickte aus dem Fenster und in den frühen Herbsttag, der den Nebel wie Watte auf die Stadt drückte. Ich meinte, Max blickte, wie so oft, irgendwo hin. Vielleicht sprach er auch still und in Gedanken mit einem ihm sehr vertrauten Menschen. Dann blickte er wieder zu mir und sagte:
„Also haben meine Eltern nach der Warnung aus der Quelle, begonnen, sich und die Familie in Sicherheit zu bringen. Wie das nun detailliert vollzogen wurde, kann ich dir nicht erklären. Aber, der Holzhandel wurde verkauft, das Geld dann in das Ausland transferiert. Gleiches geschah mit dem Hotel meiner Mutter. Und ebenso wurde viel von unserem sonstigen Besitz außer Landes gebracht: hauswirtschaftliche Dinge, Schmuck, Bilder. Na, was man so sein Eigen nannte... Und, es durfte nicht bemerkt werden... So hat es mir meine Mutter, zwar nicht oft, aber einige Male erzählt. Und, erstaunlicherweise, ähnelten sich ihre Berichte. Beinahe bis aufs Wort. Nur später, als sie alt war, brachte sie dann einige Dinge durcheinander. Aber die Kernaussage war immer die gleiche... Aber das durfte sie dann auch...“, Max' Stimme war sehr leise geworden und nur noch sehr schwer zu verstehen, als er ergänzend meinte:
„Ja, das durfte sie...“
Ich war sehr berührt und saß still und ohne mich zu regen, in dem großen Sessel. Dann, als ich mir sehr sicher war, nicht zu stören und ebenso meinte, es wäre der rechte Augenblick, sagte ich:
„Ich habe ich schon oft gehört, dass ältere Menschen in der Vergangenheit leben und das während dieser vergangenen Zeiten Erlebte und Geschehene nahezu minutiös wiedergeben. Ähnliches habe ich bei meinen Großeltern erfahren. Bei meiner Mutter konnte ich das noch nicht beobachten...“
„Das ist wohl auch vom geistigen und vom körperlichen Zustand, wenn ich das so sagen darf, abhängig. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei Menschen, die in Begleitung großer körperlicher Gebrechen und Schmerzen alt werden, die Erinnerung an die Süße der Jugend und frühen Erwachsenenzeit deutlich ausgeprägt ist. Sie wünschen sich in diese Zeit zurück, damals, als sie körperlich noch in sehr guter Verfassung waren...“
Ich spürte, jetzt wollte Max allein sein. Ich wollte nicht stören, stand auf, nahm meinen Mantel und verließ, leise grüßend das Atelier. Seine Werkstatt.
*
Wir sahen uns einige Tage nicht. Auch, weil ein Wochenende unserem letzten Treffen folgte. Irgendwann hatte Max geäußert, das Wochenende gehört ihm und seiner Frau Juliane allein.
„Für jeden gewerblichen Arbeitnehmer ist am Freitag, und dann spätestens um drei am Nachmittag, Feierabend. Schichtarbeiter nicht beachtet! Warum sollte das für mich nicht auch gelten? Man muss, dringend sogar, auch 'mal etwas anderes machen. Man kann nicht immer nur Kunst produzieren! Du und ich, wir haben bei unseren Gesprächen das Künstlerische uns nicht zu Eigen gemacht. Aber, mein Lieber, kreativ sind wir allemal! Also lass' uns nach einigen Gesprächstagen die Tage der gegenseitigen Ruhe voneinander genießen!“
Dazu konnte und wollte ich nichts weiter sagen. Deshalb nicht, weil Max recht hatte und ich die Tage zwischen unseren Treffen nutzen konnte, um die Mitschnitte und Notizen unserer Gespräche noch einmal zu hören und zu lesen.
*
„In Berlin gab es damals den Anhalter Bahnhof.“, sagte Max am Beginn unseres nächsten Gespräches.
„Ein sehr geringer Rest der Ruine steht heute noch. So, als Mahnmal!“, sagte ich.
„Richtig! Der Anhalter Bahnhof, eher das, was nach dem Krieg davon noch übrig war, wurde im Jahre 1959 abgerissen. Aus stadtplanerischen Gründen und wider die heftigen Proteste der Berliner Bevölkerung und der Architekturfachleute. Letztendlich konnte nur der Erhalt eines sehr geringen Teils dieses ehemaligen bedeutenden Bahnhofsgebäudes erreicht werden...“
„Nämlich?“
„Ein Teil der Portikus mit den beiden Figuren des Bildhauers Ludwig Brunow. Der Senat hatte den Leuten vorher den Bau eines neuen Bahnhofs zugesichert. Doch, das ist nichts Neues, wenn Politiker 'was versprechen...“
Ich wusste sehr genau, dass Max gegenüber jedem Politiker sehr skeptische war. Und vor allem dann, wenn begonnen wurde, etwas zu versprechen, erreichte seine Skepsis ungeahnte Dimensionen.
Und dann sagte Max:
„Nun sollte allerdings auch bedacht werden, dass der Anhalter Bahnhof während des Krieges sehr schwer beschädigt wurde. Darum bestand die Gefahr des Einsturzes der Ruine. Allerdings hat man den Bahnhof, oder das, was noch übrig geblieben war, soweit repariert, dass wenigstens einige Nahverkehrszüge in die damaligen Länder Brandenburg und Sachsen-Anhalt fahren konnten. Allerdings nur bis zum Jahr 1952, dann wurde der Zugverkehr eingestellt...“
„Nach dem Krieg gab es also noch, auch in der sowjetischen Besatzungszone, die Länder?“, fragte ich.
„Ja! Die Neugliederung der DDR erfolgte in Bezirke, so meine ich, im Jahre 1952. Ich will dir aber auch nicht verschweigen, dass vom Anhalter Bahnhof während der braunen Zeit Juden in die Vernichtungslager transportiert wurden. Besonders ab etwa Juni 1942. Und bemerkenswert ist, dass an planmäßig verkehrende Züge ein oder zwei Personenwagen angekuppelt wurden, in denen die Juden ihrem Schicksal entgegen gebracht worden sind. Vom Anhalter Bahnhof wurden insgesamt mehr als 9.600 Menschen deportiert. Daran erinnert seit dem 27. Januar 2008 eine Stele an der Portikus...“.
Max sah mich einige Augenblicke schweigend an. Ich meinte zu wissen, was er dachte. Wohl, dass es, nach der versuchten Denunzierung hätte sein können, auch seine Mutter und sein Vater wären in einem dieser angekuppelten Waggons nach Theresienstadt verschleppt worden...
Dann, nach dieser mir endlos erscheinenden Pause begann Max weiter zu sprechen:
„Das Bahnhofsgebäude wurde am 3. Februar 1945 während eines Bombenangriffs der Alliierten schwer beschädigt und brannte aus...“, Max machte erneut eine Pause und sagte anschließend:
„Das, was ich dir über den Anhalter Bahnhof berichtet habe, erzählte mir meine Mutter nach dem Krieg, als wir wieder in Deutschland waren. Sie legte im Übrigen sehr großen Wert darauf, dass ich Kenntnis, und zwar umfassende Kenntnis, erhielt über das, was zwischen 1933 und 1945 in Deutschland geschehen ist...“
„Oft wird in den Familien über diese Zeit geschwiegen...“
„Ja! Darüber haben wir bereits gesprochen! Allerdings möchte ich dir auch nicht die gesamte Historie des Anhalter Bahnhofs erklären. Darüber gibt es inzwischen Bücher...“
„Ja!“
„Lieber will ich dir von der Reise meiner Mutter und meines Vaters berichten!“
„Gerne!“
„Vom Anhalter Bahnhof war es möglich, nach Wien und weiter nach Budapest und dann Triest zu reisen. Auch nach Rom und Neapel, Nizza und Marseille. Eigentlich in fast alle süd- und südosteuropäischen Städte. Auch nach Athen und dann per Schiff weiter nach Alexandria in Ägypten. Und von dort weiter mit dem Zug nach Kairo und Khartum im Sudan...“
„Mit dem Zug, der Eisenbahn, nach Athen durch den Balkan?“
„Ja!“
Ich muss Max wohl sehr ungläubig angesehen haben, denn er beeilte sich, mir anschließend zu erklären:
„Zur damaligen Zeit war das Eisenbahnwesen in Europa bereits sehr gut organisiert. Für Fernreisen standen dem, der das bezahlen konnte und wollte, komfortabel ausgestattete Abteile in Personenwaggons zur Verfügung. Vergleichbar etwa mit denen, die heute für Touristen durch Namibia, Marokko oder auch Spanien rollen. Beinahe alle Welt fuhr mit der Eisenbahn! Diese gut ausgestatteten Wagen hießen damals schon Salonwagen.“
„Aha! Und du hast deine Mutter und deinen Vater während dieser Reise ab dem Anhalter Bahnhof begleitet?“
„Nein, nein. Meine Mutter und mein Vater reisten allein. Ich war noch gar nicht auf der Welt. Meine Mutter schenkte mir das Leben, als wir noch in der Emigration waren. Überhaupt hat meine Mutter mir alles das, was ich dir über die Wanderschaft meiner Eltern durch die Welt erzähle, berichtet. Später, als wir nach den braunen Jahren wieder in Deutschland waren.“
Ich hatte nicht bedacht, Max Ernst Karstbaum war älter als ich. Um aber die Abreise seiner Mutter und seines Vaters aus dem braunen Deutschland so erlebt zu haben, wie er es mir schilderte, hätte er selbst acht oder zehn Jahre alt sein müssen. Um sich einigermaßen deutlich an die Ereignisse erinnern zu können. Aber das war bekanntlich nicht der Fall...
So blieb mir, wieder einmal, nichts weiter übrig, als zu sagen:
„Daran habe ich nicht gedacht!“
„Macht nichts!“, meinte Max und blickte mich an. Dann sah er zum Fenster hinaus, so als suchte er dort, unter den Wolken und über den Dächern der Stadt den berühmten und oft erwähnten Faden, den er benötigte, um mir seine Geschichte weiter zu erzählen.
Max sah wieder zu mir und sprach nun leise weiter:
„Selbstverständlich war das Reisen mit der Eisenbahn so, wie meine Mutter und mein Vater es taten, nicht billig. Aber das Geld war vorhanden. Auch wenn mein Vater dafür gesorgt hatte, dass der überwiegende Teil aus dem Verkauf von Holzhandel und Hotel auf ausländische Konten eingezahlt worden war. Heute kann ich das sagen und Juliane weiß darüber ebenfalls Bescheid, dass wir, unter anderem in der Schweiz, immer noch einen nicht unerheblichen Teil dieses Vermögens besitzen. Aber das habe ich nur so nebenbei und am Rande und der Vollständigkeit wegen erwähnt... Meine Eltern waren somit finanziell in der Lage, derart zu verreisen!
„Du musst mir überhaupt nichts über deine und eure wirtschaftlichen Verhältnisse erklären, Max!“
Doch Max reagierte auf diese Bemerkung nicht und erzählte mir weiter:
„Juliane und ich sind, nachdem, meine Mutter nicht mehr bei uns war, in die Schweiz gefahren. Geld zählen, wie sie sagte...“
„Das war aber erst vor einigen Jahren?“
„Ja! Ja! Aber noch im anderen Jahrtausend. Meine Mutter hatte, als gelernte Buchhalterin wusste sie sehr genau, wie das erfolgen muss, ein Buch angelegt. Das Kassenbuch. Manchmal sprach sie auch vom Schweizer Buch...“
„Das war ja nun naheliegend...“
„Allerdings! Anfangs, ich sagte es bereits, hatte meine Familie nicht ausschließlich den Banken der Eidgenossen ihr Geld anvertraut. Auch in Südamerika, in Uruguay, und wohl auch noch in den USA war ein Teil des pekuniären Familienvermögens untergebracht. Auch diese Kontobücher hatte meine Mutter geführt und aufbewahrt. Noch lange, als diese Konten bereits aufgelöst waren... Dann als Erinnerung.“
„Ist nur verständlich!“, antwortete ich.
„Das Geld auf den amerikanischen Banken haben meine Mutter und mein Vater, zunächst auch meine Großeltern, für ihren Lebensunterhalt im Exil benötigt. Als deutscher Exilant war es besser, wenn man nachweisen konnte, für seinen Lebensunterhalt allein aufzukommen. Um dem Gastgeberland, in dem man sich aufhielt, nicht auf der oft zitierten Tasche zu liegen!“
„Ist wohl heute nicht oder kaum anders, oder?“
„Beispielsweise wird, so ist mir bekannt, in Kanada, wohl etwas genauer hingesehen, was die wirtschaftlichen Verhältnisse betrifft...“
„Kann sein...“
„Ich habe unsere Finanzgeschäft in Julianes Hände gegeben. Bereits vor Jahren. Damals, nachdem wir in der Schweiz waren, um das Konto besuchen. Ich meine, das war eine gute Entscheidung. Manchmal haben Frauen den geschickteren Umgang mit Geld und Finanzen...“
„Möglich. Aber wohl auch nicht alle Frauen?“
„Auch wiederum möglich. Es soll ja Frauen geben und gegeben haben, die brachten innerhalb weniger Jahre ein Vermögen unter die Leute. Wohl für allerlei Firlefanz. Na, egal... Das müssen die Männer dieser Frauen wissen, ob das gut und so in Ordnung war und ist...“
„Ja!“
„Ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater ebenfalls meiner Mutter einen bedeutenden Teil der Finanzverwaltung übertragen hatte...“
„Das hatte sie wohl auch gelernt?“, fragte ich.
„Ja! Sagte ich bereits, Buchhalterin! Und ich kann mich daran erinnern, beide, Mutter und Vater, sind bald, nachdem sie aus dem Exil zurück gekehrt waren, in die Schweiz gefahren.... Max blickte erneut aus dem Fenster und sagte dann:
„Ich kann mich allerdings auch ebenso daran erinnern, dass sie nach ihrer Rückkehr oft und lange über Hermann Hesse gesprochen haben.“
„Deine Mutter und dein Vater waren bei Hermann Hesse? Zu Besuch?“, fragte ich und blickte Max an.
Der lächelte und meinte:
„So können Gerüchte entstehen!“
„Das verstehe ich jetzt nicht!“
„Ich sagte, nach ihrer Rückkehr sprachen Mutter und Vater über das Tessin und Hermann Hesse!“
„Stimmt! Das hast du so gesagt!“, bestätigte ich.
„Sie waren nicht bei Hesse. Wohl aber im Tessin, wo Hesse seit Anfang der 1930-er Jahre in Montagnola wohnte.“, Max blickte mich einige Augenblicke an, bevor er weitersprach:
„Es war, wenn ich mich heute an die Gespräche erinnere, die meine Mutter und mein Vater noch lange nach ihrer Rückkehr aus der Schweiz über das Tessin führten, wohl so, dass sie einen oder zwei Tage in Montagnola waren, sich dort auch in dem Ort, wie sagt man...?“
„Weiß ich nicht, was du meinst!“
„Wohl auch umsahen, vielleicht wollten sie dort wohnen, das kann ich dir heute nicht mehr sagen. Aber dem Dichter sind sie nicht begegnet. Vielleicht standen sie, eher zufällig und ohne irgendwelche Absichten zu hegen, vor der Casa Hesse... Aber mehr war da bestimmt nicht. Zudem war, das ist dokumentiert, das Tor zu Hesses Anwesen stets geschlossen und ein an den linken Pfeile der Torkonstruktion befestigtes Schild wies Neugierige ab: ,Bitte keine Besuche'...“
„So?“
„Ja! Und nicht anders. Und, übrigens, das Tessin, die herrliche Gegend am Südrand der Schweizer Alpen, wo dich bereits mediterranes Flair umarmt, war schon immer für viele Menschen, auch deutsche, eine Wahlheimat. Oder zumindest Ort eines längeren Aufenthalts...“
„Ja, das ist mir bekannt!“
*
„Wann sind deine Mutter und dein Vater endgültig aus Deutschland abgereist?“
Max Ernst Karstbaum blickte erneut für einige Augenblicke aus dem Fenster und wieder über die Dächer der Stadt. Und hinauf zu den am Himmel ziehenden Wolken. Und wieder so, als suchte er dort oben etwas, das nur ihm bekannt und vertraut war. Dann räusperte er sich, sah mich an und begann, zu erzählen:
„Darüber gibt es unterschiedliche Angaben! Aber, bevor wir das besprechen, möchte ich mit dir noch über etwas anderes reden.“
„Gerne, Max!“
„Ich sagte bereits, den Verkauf des Holzhandels und des Hotels begründeten beide damit, sich nun und auch zukünftig karitativen Aufgaben zuwenden zu wollen. Heute werden diese Menschen, meine ich, auch oft als Botschafter einer Idee bezeichnet...“
„Ja! Kann sein! Nicht zu verwechseln mit den sogenannten Markenbotschaftern, die fürs Anpreisen irgendwelcher Produkte von Feier zu Feier tingeln, dabei ein gutes Leben führen und dann dafür auch noch Geld kassieren...“
„Nein, diese Leute meine ich nicht! Ganz bestimmt nicht! Das hätten Mutter und Vater auch nie getan. Aber die, die für soziale oder auch Umweltorganisationen oft kostenlos unterwegs sind, die meine ich! Meine Mutter und mein Vater hatten selbstverständlich nicht die Absicht, im Ausland Propaganda für das braune Deutschland zu veranstalten. Aber dennoch kamen sie, um das Land verlassen zu wollen, an den braunen Mächtigen nicht vorbei. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hatten, aber sie bekamen beide ein ordentliches und amtliches Ausreisevisum, um die Interessen eines Vereins im Ausland zu vertreten!“
„Eines Vereins?“
„Ja! Meine Mutter und mein Vater haben sehr selten darüber gesprochen. Aber, aus dem Wenigen, was sie sagten, habe ich während einiger Zeit erfahren, um was für eine Vereinigung es sich damals handelte...“
„Nämlich?“
„Um einen Verein, der sich mit dem deutschen Liedgut, Volkslieder beispielsweise, beschäftigte...“
„Na, da wurde in den zwölf braunen Jahren auch nichts vollbracht!“
„Genau! Und das wollte dieser Verein, den es heute nicht mehr gibt, ändern! Ich meine, man wollte das altdeutsche Liedgut bewahren und fördern! Volkslieder bekannt machen!“
„Da wurde damit eine wunde, eine sehr wunde Stelle im für deine Eltern positiven Sinne der braunen Herrschaften berührt?“
„Könnte sein. Denn für alles Deutsche, deutsche Frau und deutscher Mann, deutsches Land und deutsche Eiche und deutscher Wald... Na, und so weiter... Dafür konnte man sich ab '33 wieder sehr erwärmen“
„Und noch heute für deutschen Honig und deutsche Markenbutter aus deutschen Landen... Und dann haben deine Mutter und dein Vater... Aber da muss ich dich noch etwas fragen!“
„Bitte! Gerne!“
„Du sagtest, deine Eltern haben nach einem Tipp, so will ich es 'mal nennen, das Land verlassen?“
„Ja!“
„Aber so, wie du mir das eben berichtet hast, verkauften sie noch Holzhandel und Hotel, haben eine Legende geschaffen und sind dann los, außer Landes...!“
„Stimmt alles! So, wie mir beide unabhängig voneinander berichteten, war ihnen das Leben in Deutschland seit 1933 vergällt. Spätestens, so beide, nach dem Januar '33 planten sie ihre Ausreise. Endgültig, so meine Mutter, dann, nach der Bücherverbrennung im Mai '33. Sie wollte ordentliche Verhältnisse hinterlassen. Darum auch der Verkauf der Geschäfte, das Wegschaffen materieller Güter und Geld und einiges mehr. Die Abreise wäre ohnehin erfolgt. Der Tipp aus der Quelle hat deren Zeitpunkt festgelegt und, möglicherweise, vorverlegt...“
„Ja, das habe ich verstanden! Manchmal sagt man dazu auch geordneter Rückzug.“
„Na, ob das alles dann wirklich so geordnet vollzogen werden konnte! Wer weiß das heute noch! Wenn damit gerechnet werden musste, das man dich abholt! Ich weiß es nicht! Wirklich nicht! Aber, um nun auf meine Eltern zurück zu kommen, sie haben sich, als es soweit war, sehr beeilt, um das Land zu verlassen....
„Und deine Großeltern?“
„Die sind schon gleich nach der Machtübernahme in ihr Haus in Südfrankreich abgereist. Dort waren sie, ich meine, bis zum Sommer 1938. Übrigens, später, in den 1960-er Jahren, hat der aus Eberswalde in Brandenburg stammende Maler Paul Wunderlich das Nachbaranwesen gekauft und ist dann auch in Saint-Pierre-de-Vassols im Juni 2006 begraben worden. Und, um mit meinem Erzählen weiter zu kommen, mein Lieber, meine Eltern verließen Deutschland im Sommer 1938...“
„Hm!“
„Ja! Sie bestiegen im Anhalter Bahnhof den Fernzug nach Athen... Über den Anhalter Bahnhof haben wir uns bereits unterhalten!“
„Ja!“
„Einige Tage zuvor waren sie aus der Pension an der Ostsee, auf Rügen, nach Berlin gereist...“
„Warum von der Ostsee?“
„Wenn man seine Heimat verlassen muss, ist das schon eine emotional tiefgreifende Angelegenheit. Kann ich mir jedenfalls vorstellen... Meine Mutter und mein Vater haben in der Pension, die wurde nicht verkauft, vor ihrer Abreise noch einige schöne, wohl auch unbeschwerte, Tage erlebt. Beide haben Rügen so sehr geliebt – das Meer, den Strand. Überhaupt, die Insel. Ich bin später mit meiner Mutter oft an die Ostsee gefahren. Allerdings, Rügen hat sie nie wieder gesehen. Sie fragte auch nie danach. Wusste wohl, die Mauer war zu hoch...“
„So wird das anderen, vielen anderen, Menschen wohl ähnlich widerfahren sein, die nicht nur aus Deutschland vertrieben worden sind! Ich nenne, stellvertretend für alle, die Schlesier, die Ostpreußen... Und heute? Syrer, Menschen aus Schwarzafrika... Na, da brauchen wir uns nicht zu agitieren...“
„Stimmt!“, Max sah mich an und ich spürte, jetzt durfte ich nichts sagen. Jetzt wollte er für einige Augenblicke in Ruhe gelassen werden... Bis er leise weiter sprach:
„Vielleicht war es auch gut so, dass meine Mutter Rügen nicht wiedergesehen hat...“
„Warum?“
„Sie hätte, verständlicherweise, zur Pension gewollt. Und wäre darüber erschrocken, entsetzt, gewesen, wie herunter gewirtschaftet, nahe der Grenze zur Verkommenheit, das Haus und das Anwesen sich ihr dargeboten hätten. Einst ein Prachtbau der Bäderarchitektur, dämmerte das Haus am Stadtrand bis zum Spätherbst 1989 verfallen, verkommen und ungepflegt einer ungewissen Zukunft entgegen. Und auf der Ostsee fuhren täglich die weißen Fähren... Die Kommunisten und ihre Helfershelfer haben noch nie ein Gespür für Eigentum und Werterhaltung gehabt! Dass Eigentum auch verpflichtet, ist diesen Leuten völlig unbekannt!“, Max sah mich erneut einige Augenblicke an und ich sagte jetzt wieder nichts und hörte, als er weiter sprach:
„Juliane und ich haben dann, als die Mauer Geschichte war, zwei oder drei Jahre nach der Wende, Rügen besucht. Selbstverständlich haben wir nicht das Rügen meiner Mutter angetroffen. Nicht das Rügen, von dem sie besonders mir immer berichtete. Egal, wo wir waren, hat sie den jeweiligen Ort mit dem Rügen ihrer Erinnerung verglichen. Und, um ehrlich zu sein, die anderen Orte waren, beinahe selbstverständlich, nicht denen auf Rügen ebenbürtig...“
„Kann ich mir nach all' dem, was du mir berichtet hast, sehr gut vorstellen...“