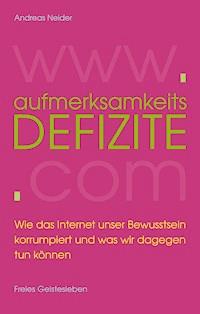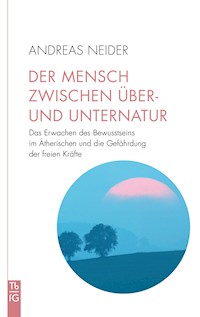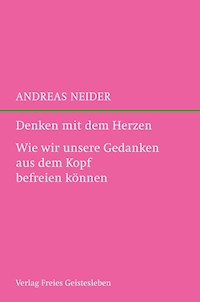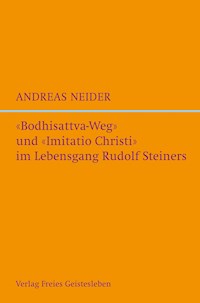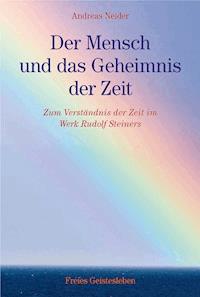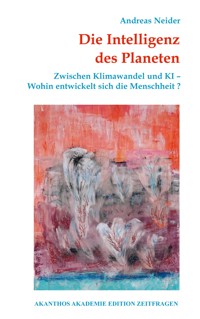
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch wird, anders als in vielen gegenwärtigen Untergangsszenarien, gezeigt, dass es heute jedem Menschen möglich ist, sein distanziertes und mitunter zerstörerisches Verhältnis zur Natur und damit auch die Getrenntheit von ihr in ein positives, die Lebenskräfte förderndes Verbunden-sein mit der Natur zu verwandeln. Zugleich aber kann sich damit auch das eigene Verhältnis zur Technik zu einem Energie spendenden, schöpferischen Tätigsein umgestalten. Damit sollen jedoch die heutigen Technologien, insbesondere die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, keinesfalls bekämpft oder gar abgeschafft werden. Vielmehr geht es darum, der bisherigen Art von Technik, die durch Elektrizität und Magnetismus mit der Unternatur verbunden ist, eine neue Art von Technologie gegenüberzustellen, durch die der Mensch mit der Übernatur in Verbindung treten kann. Dadurch aber kann er sich zur eigentlichen Intelligenz des Planeten weiter entwickeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÜBER DEN AUTOR
Andreas Neider, Jahrgang 1958, Studium der Philosophie, Ethnologie, Geschichte und Politologie. 17 Jahre Tätigkeit im Verlag Freies Geistesleben, zunächst als Lektor und dann als Verleger.
Seit 2002 Leiter der Kulturagentur „Von Mensch zu Mensch“. Seit 2004 Veranstalter der jährlich stattfindenden Stuttgarter BildungsKongresse.
2015 Mitbegründer der Akanthos-Akademie Stuttgart e.V. Buchautor und Referent für Anthroposophie, Meditation, Medienpädagogik und Kritik der digitalen Transformation.
Zahlreiche Veröffentlichungen im Verlag Freies Geistesleben und im Rudolf Steiner Verlag.
Der Autor steht für Seminare und Vorträge zum Thema des vorliegenden Buches zur Verfügung. Kontakt: aneider@gmx. de und www.andreasneider.de
Rudolf Steiner (1861 – 1925) zum 100. Todestag gewidmet
Ihr seid die Bewohner ein und desselben Planeten, die Passagiere ein und desselben Schiffes. …
Die Erde lehrt uns mehr über uns als alle Bücher.
Antoine de Saint Exupéry (1900 – 1944)
Wind, Sand und Sterne
INHALT
Vorwort
1. Das Anthropozän und das Verhältnis des Menschen zur Erde
2. Die Zerstörung der Erde als Folge der menschlichen Freiheit
3. Die Schulden der Menschheit und die Bedeutung des Christus für die Erde – der Mensch und die Intelligenz des Planeten
4. Menschliche und Künstliche Intelligenz – auf dem Weg in den Transhumanismus
5. Die Verwandlung von negativer Kritik in den „Pfad der Verehrung“
6. Die Natur als Subjekt und die Erde als Lebewesen – das ökologische Gewissen
7. Energie ohne Elektrizität – Ausblicke auf eine zukünftige Technologie
Danksagung
Anmerkungen
VORWORT
Ein zentraler Topos der gegenwärtigen Menschheitskrise, ist wohl das vor allem durch die Corona-Krise in das Bewusstsein der gesamten Menschheit getretene Gefühl der Getrenntheit.1 Dieses Thema wird auch durch den Untertitel Zwischen Klimawandel und Künstlicher Intelligenz umschrieben und bildet damit eine wesentliche Grundlage des vorliegenden Buches. Es ist aus einer Reihe von Vorträgen und Seminaren hervor gegangen, die der Verfasser in den Jahren 2022 bis 2024 an verschiedenen Orten in Deutschland und in der Schweiz gehalten hat.
Die Antwort auf die zentrale Frage, wie diese Getrenntheit im Hinblick auf unser Verhältnis zur Natur zu überwinden sei, dürfte – so jedenfalls die Überzeugung des Verfassers – einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise und damit zur Gesundung unseres Planeten liefern. Durch die Überwindung der Getrenntheit könnte sich weiterhin auch die Möglichkeit zu einem selbstbestimmten, sozial verträglichen und ökologisch vertretbaren Umgang mit der Künstlichen Intelligenz und zugleich zu einer völlig neuen Art von Technologie ergeben, die der Zukunft des Planeten dienen und ihn nicht mehr zerstören würde.
Ein solch ambitioniertes Programm mag jedoch zu Recht als ein sehr gewagtes und viel zu großes Unterfangen erscheinen, um in einem Buch und dazu noch von einem einzelnen Autor bewältigt werden zu können. Und es wäre tatsächlich als Hybris zu betrachten, wenn der Verfasser meinen würde, mit dem vorliegenden Buch die Universalantwort auf die genannten großen Menschheitsfragen der Gegenwart liefern zu können. Um eine solche Universallösung kann es also hier nicht gehen.
Vielmehr soll anhand einer tiefer in diese Fragen eindringenden Betrachtungsweise eine Blickwendung angeregt werden, die es den Leserinnen und Lesern ermöglicht, eine neue Perspektive für die im Titel dieses Buches genannte Intelligenz des Planeten zu gewinnen. Diese umfasst im Wesentlichen drei Gebiete: die Natur, die menschliche Moralität und den ganzen Bereich der Technologie, die sich heute vor allem auf dem Felde der Künstlichen Intelligenz weiter entwickelt.
Die ersten drei Kapitel behandeln zunächst um die mit der Zukunft der Natur verbundenen Fragen, die sich heute vor allem angesichts des Klimawandels stellen. Dabei geht es uns nicht so sehr um die Frage, wie sich das für den Klimawandel verantwortlich gemachte CO2 möglichst schnell reduzieren lässt, sondern vielmehr um die Frage, durch welche Haltung der Natur gegenüber die ökologische Krise überhaupt erst entstehen konnte.
Es zeigt sich nämlich, dass die Menschheit und ihr Planet keinesfalls als getrennt voneinander zu betrachten sind, sondern einen gemeinsamen Ursprung und eine gemeinsame Evolution durchlaufen haben. In deren Verlauf hat sich der Mensch aber zugunsten seiner Freiheit immer mehr aus den ursprünglichen Zusammenhängen mit den Naturreichen des Mineralischen, des Pflanzlichen und des Tierischen herausgelöst. Dadurch wiederum ist der Mensch der ihm ursprünglich zugedachten Aufgabe, die Intelligenz des Planeten zu bilden, verlustig gegangen.
Um die Zukunft des Planeten zu sichern, musste diese Aufgabe nun an Stelle des Menschen zunächst von einem anderen, mit der Sonne verbundenen Wesen, übernommen werden. Diese Sonnenintelligenz, die wir auch als den Christus bezeichnen, hat aber in der Folge die Sonne verlassen und sich mit der Erde vereinigt. Mit diesem Opfer sollte dem Menschen die Erfüllung seiner ursprünglichen Aufgabe, die Intelligenz des Planeten zu bilden, doch noch ermöglicht werden. Das aber kann, dem Wesen des Menschen entsprechend, nur in Freiheit geschehen. Sich dieser in seiner Freiheit liegenden Verantwortung bewusst zu werden, darum sollte es also, um der Zukunft des Planeten willen, in erster Linie gehen.
Im vierten Kapitel beschäftigen wir uns dann mit der sogenannten KI und zeigen auf, wie uns die Entwicklung der KI nicht nur vor technologische und ethische Probleme stellt, sondern vor allem auch vor ökologische und soziale Probleme. Wir lenken den Blick also weniger auf die Problematik einer scheinbar die menschliche Intelligenz ersetzenden KI, wozu sie mitnichten in der Lage sein wird.* Vielmehr versuchen wir aufzuzeigen, dass die KI als die heute als maßgeblich angesehene Form zukünftiger Technologien die ökologischen und sozialen Problem immer weiter verschärfen und die Zukunft des Planeten deshalb, deutlich stärker als bisher wahrgenommen, in Frage stellen wird.
In Zukunft könnte sich als ein Gegengewicht jedoch eine ganz anders geartete Technologie entwickeln, die als Energiequelle nicht mehr auf Elektrizität, sondern auf der menschlichen Moralität beruhen wird. Sie kann deshalb auch als moralische Technologie bezeichnet werden. Darauf werden wir vor allem im letzten Kapitel Buches näher eingehen. Eine solche Technologie benötigt jedoch als Voraussetzung eine Weiterentwicklung der menschlichen Moralität und damit auch unseres Verhältnisses zur Natur, d.h. unseres ökologischen Gewissens. Auf dieses werden wir im fünften und sechsten Kapitel ausführlich zu sprechen kommen.
Die grundlegenden Ideen, die in diesem Buch dazu entwickelt werden, verdankt der Verfasser der Anthroposophie Rudolf Steiners, die seit über 45 Jahren seinen zentralen Lebensinhalt bildet. Damit verbindet er die Hoffnung, dass diese anthroposophischen Ideen möglichst vielen Leserinnen und Lesern helfen werden, die Zukunft von Erde und Menschheit in einem neuen Licht sehen zu lernen und durch eigenes Tun dazu beizutragen, den Pessimismus, der im Hinblick auf diese Zukunft vor allem auch die jungen Menschen bedrückt, zu überwinden.
Damit der Mensch in Zukunft tatsächlich zum eigentlichen Träger der Intelligenz des Planeten werden kann, sollen mit diesem Buch nicht nur eine neue Sichtweise, sondern auch praktische Ideen vermittelt werden, wie durch die grundlegende Veränderung unseres Verhältnisses zur Natur und zum ganzen Planeten, die oben genannte Getrenntheit überwunden werden kann.
Weil im Schönbuch, Weihnachten 2024
1 Fußnoten im Text verweisen auf die Anmerkungen ab Seite →.
1. DAS ANTHROPOZÄN UND DAS VERHÄLTNIS DES MENSCHEN ZUR ERDE
Die Entstehung der ökologischen Bewegung
Das Verhältnis der Menschheit zur Erde hat sich in den letzten Jahrhunderten und insbesondere im 20. und 21. Jahrhundert deutlich wahrnehmbar verändert. Der niederländische Klimaforscher und Chemiker Paul Crutzen hat deshalb im Jahre 2000 vorgeschlagen, ein neues geologisches Erdzeitalter mit dem Namen Anthropozän einzuführen, dessen Beginn er und seine Kollegen auf das Jahr 1950 festgelegt haben. Denn seit diesem Jahr sei bis in die Geologie hinein feststellbar, dass sich der Mensch zu einem entscheidenden Faktor der Erdentwicklung entwickelt hat.2
Und tatsächlich können wir an zahlreichen Problemen deutlich bemerken, dass die Menschheit durch ihre technologische und kulturelle Entwicklung einen ganz entscheidenden, zumeist aber negativen Einfluss auf den Zustand unseres gesamten Planeten genommen hat. So hat die Meeresbiologin Rahel Carson in ihrem 1962 erschienenen Buch Der stumme Frühling als eine der ersten darauf hingewiesen, welche gravierenden Auswirkungen die in der Landwirtschaft verwendeten Pestizide auf die Tier- und Pflanzenwelt haben und begründete damit die weltweit tätige Umweltschutzbewegung.3
Seither wurden der Menschheit immer wieder die Grenzen des Wachstums aufgezeigt.4 Dennoch nahm die Zerstörung unserer natürlichen Umwelt vor allem durch die extensiv betriebene Landwirtschaft seit der Mitte des 20. Jahrhunderts immer mehr zu. Die Folgen sind mit dem von Rahel Carson geprägten Ausdruck eines stummen Frühlings sehr gut beschrieben. Denn die hauptsächliche Konsequenz dieser Art von Landwirtschaft ist ein heute praktisch für jeden Menschen wahrnehmbares globales Artensterben.5 In Folge der in der Landwirtschaft nach wie vor verwendeten Pestizide und anderer Insektenvernichtungsmittel sowie der auch weiterhin verwendeten Kunstdünger werden aufgrund der seit der Begründung der Umweltschutzbewegung bekannten ökologischen Zusammenhänge immer mehr Tier- und Pflanzenarten ausgerottet.6
Am deutlichsten wird seit dem Ende des 20. Jahrhunderts der sogenannte Klimawandel wahrgenommen.7 An ihm zeigt sich nun der negative Einfluss der Menschheit auch auf das Klima unserer Erde. Denn die Temperaturen von Luft und Wasser haben sich im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts immer mehr erhöht und dadurch zu Naturkatastrophen, zu Austrocknung, Wassermangel und Hungersnöten, ja zu einer weltweiten Flüchtlingsbewegung beigetragen.
Als Hauptursache für diese Erwärmung wird von der Klimaforschung der weltweite Ausstoß von Kohlendioxyd, kurz CO2 genannt, ausgemacht, weshalb sich die Klimaschutzbewegung weltweit auf eine weitest gehende Reduktion des nun mehr als Klimagas bezeichneten Kohlendioxyds fixiert hat.8 Ob das CO2 aber tatsächlich der einzige nennenswerte Klimafaktor ist, wird heute kaum hinterfragt. Wir werden auf die Problematik einer solchen Ursachenreduktion später noch zurückkommen.
Zusammengefasst kann jedoch gesagt werden, dass die heutige Naturwissenschaft davon ausgeht, dass die Menschheit seit dem 20. Jahrhundert einen entscheidenden Einfluss auf die Evolution der Erde als eines organischen Lebewesens genommen und diesen Organismus dadurch in gravierender Weise geschädigt und zu mehr oder weniger großen Teilen bereits zerstört hat.
Diese Betrachtungsweise erweist sich zugleich als ein deutliches Symptom für das grundsätzliche Problem dieser Wissenschaft. Denn praktisch jeder heutige Naturwissenschaftler betrachtet sich und damit den Menschen immer als getrennt von der von ihm beobachteten Natur. Der Mensch als Subjekt beobachtet und untersucht die von ihm getrennt erlebte Natur und steht dieser durch diese Art der Betrachtung als fremd gegenüber. Dieses Erleben haben wir oben bereits als das Gefühl der Getrenntheit bezeichnet.9
Wie anders aber würden wir die Evolution der Erde begreifen, wenn wir die Erde nicht als ein vom Menschen getrenntes Objekt, sondern als ein mit ihm verbundenes und sich mit ihm gemeinsam entwickelndes Subjekt betrachten würden? Wenn wir die Evolution also nicht erst seit dem 20. Jahrhundert, sondern von Beginn an als eine gemeinsame Evolution von Menschheit und Erde anschauen würden? Wenn der Mensch also kein Einsiedler, sondern ein integraler Bestandteil der Erde und mithin des ganzen Kosmos wäre, und wir folglich zu der Auffassung kommen würden, dass es die Erde ohne den Menschen gar nicht geben würde, so wie es den Menschen ohne Erde nicht geben kann.
Ein solcher Perspektivenwechsel könnte zugleich auch einen Methodenwechsel bewirken, durch den sich der Beobachter nicht mehr als fremd seinem Beobachtungsgegenstand gegenüber verhalten würde. Denn wenn Mensch und Erde – also alle Naturreiche über die Mineralien, Pflanzen und Tiere bis zum Menschen – eine gemeinsame Entwicklung durchgemacht haben, dann könnte sich der Naturwissenschaftler als nur scheinbar von der Erde getrennt erleben und versuchen, diese Getrenntheit durch eine andere Methode zu überwinden. Die Wirklichkeit hinter dem Schein der Getrenntheit wäre eine innige Verbundenheit und Einheit!10
Eine solche Betrachtungsweise mag zunächst als eine bloße Illusion ohne jegliche Grundlage erscheinen. Die Anthroposophie Rudolf Steiners zeigt jedoch, dass es sich bei dieser Vorstellungsart um eine geistige Realität handelt, deren Entwicklung wir im Folgenden genauer betrachten wollen.11
Die gemeinsame Entwicklung der Naturreiche, der Erde und des Menschen
Die Anthroposophie beschreibt die Evolution kurz gefasst und in eigenen Worten des Verfassers so: Im Ursprung waren Mensch und Erde ein kosmisches Wesen, in dem sämtliche Naturreiche in nuce enthalten waren. Im Laufe mehrerer Evolutionsphasen entstanden die Naturreiche, also Mineralien, Pflanzen und Tiere, durch eine Art Ausgliederung. Zunächst sonderte sich aus der ursprünglichen Einheit das Mineralreich ab. Mit ihm wurde die Grundlage für den späteren physischen Leib des Menschen gelegt. Physischer Leib und Mineralreich entstammen also derselben Stufe der Evolution.
Danach entstand durch eine zweite Ausgliederung das Pflanzenreich und mit ihm der Äther- oder Lebensleib des Menschen. Beide haben sich folglich ebenfalls auf einer gemeinsamen Evolutionsstufe entwickelt. Auf einer dritten Stufe entstand dann durch eine weitere Ausgliederung das Tierreich und mit ihm der Astral- oder Seelenleib des Menschen, also auch auf einer gemeinsamen Stufe der Evolution.
Erst auf der vierten Stufe der Evolution, unserer heutigen Erde, entwickelte sich dann als höchstes Wesensglied das Ich des Menschen, das nur er alleine besitzt, und durch das er sich nun von den anderen Naturreichen unterscheidet. Die Natur dieses Ich aber besteht in der Freiheit.
Die drei anderen Naturreiche wurden dieser Freiheit wegen aus dem ursprünglichen Menschenkosmos ausgegliedert. Sie haben sich in gewisser Weise für die Freiheit des Menschen geopfert. Das heißt, sie haben auf die Freiheit zugunsten einer jeweils spezifischen Festlegung verzichtet. In Mineralien, Pflanzen und Tieren können wir daher die Einseitigkeiten erblicken, an die der Mensch ohne die beschriebene Ausgliederung gefesselt worden wäre.
An einem Beispiel können wir uns diesen Zusammenhang leicht veranschaulichen: Wenn wir die Hand des Menschen12 mit den entsprechenden Gliedmaßen der Säugetiere vergleichen, so sehen wir, dass nur der Mensch in der Lage ist, seine Hand universell, das heißt in freier Weise zu gebrauchen. Ein Vogel kann mit seinen Flügeln nichts anderes tun als zu fliegen. Der Mensch kann mit seinen Händen einen Garten anlegen, Geige spielen oder schreiben. Diese Fähigkeiten aber muss der Mensch erst erlernen, wobei er aber weitestgehend frei darin ist, welche dieser Fähigkeiten er mit seinen Händen erlernen will.
Den Vögeln ist die Fähigkeit des Fliegens weitestgehend angeboren, sie können mit ihren Flügeln fliegen, aber eben nicht Geige spielen. Nur die Menschen verfügen über eine von ihnen selbst entwickelte Kunst, während die Vögel von Natur aus Künstler sind, darin aber eben nicht frei, sondern festgelegt.
So verfügt der Mensch also über die vier bezeichneten Wesensglieder, weil er die Evolution der Erde von Anfang an mitgemacht und auf jeder Stufe der Erdenentwicklung eines seiner Wesensglieder entwickelt worden ist. Genauer betrachtet zeigt sich an diesen Wesensgliedern und dem Grad ihrer Vollkommenheit auch ihre Entwicklungsstufe. Denn die Vollkommenheit des physischen Leibes, der Wunderbau unseres Gehirns und des Nerven-Sinnessystems, die Funktionsweise und Zusammenhänge unserer inneren Organe, die Bewegungsvielfalt unserer Gliedmaßen, all das lässt den physischen Leib eindeutig als das vollkommenste und mithin älteste Wesensglied des Menschen erscheinen.
Im Vergleich dazu ist unser Astral- oder Seelenleib, der erst auf der dritten Stufe der Evolution entstanden ist, sehr viel weniger entwickelt. Denn wie unvollkommen zeigen sich häufig unsere Gefühle und die Beherrschbarkeit unserer Emotionen, Triebe und Begierden. Bereits an den alltäglichsten Erscheinungen unseres Seelenlebens lässt sich dessen relative Unvollkommenheit gegenüber dem Wunderbau unseres physischen Leibes leicht erkennen, auch wenn bestimmte psychosomatische Erscheinungen häufig als sehr komplex erscheinen.
Der Zusammenhang der bezeichneten Wesensglieder mit den entsprechenden Naturreichen kann nun anhand zahlreicher Phänomene weiter erläutert werden. Hier sollen nur einige Beispiele genannt werden, wobei wir auf das große und komplexe Gebiet der Geologie und der Verwandtschaft des physischen Leibes mit den geologischen Zusammenhängen der Erde hier nicht weiter eingehen können.13
Den Äther- oder Lebensleib, der den physischen Leib lebendig und gesund erhält, hat der Mensch mit den Pflanzen gemeinsam. Durch die Natur- und die anthroposophische Medizin wissen wir, dass es in der Natur zahlreiche Heilpflanzen gibt, deren Eigenschaften dem Ätherleib des Menschen helfen, den erkrankten physischen Leib wieder gesund zu machen. Diese Zusammenhänge waren in den alten Kulturen der Menschheit den dafür besonders geschulten Heilkundigen immer bekannt. In der heutigen Heilpflanzenkunde ist dieses alte Wissen zum Teil immer noch anwesend. Bei eingehender Betrachtung der Heilpflanzen zeigt sich auch dem heutigen Heilpflanzenkundler eine enge Verwandtschaft in der Charakteristik, der Erscheinungsform und den Wachstumsgesetzmäßigkeiten einer Heilpflanze mit ihren heilenden Wirkungen und den diesen entsprechenden Erkrankungen des Menschen.14 Diese für den heutigen Heilpflanzenkundler und Arzt offensichtlichen Zusammenhänge entstammen jedoch keinem Zufall, sondern eben dem evolutionären Zusammenhang des Pflanzenreichs mit dem Ätherleib des Menschen.
Ebenso verhält es sich mit dem Astral- oder Seelenleib des Menschen. Seine seelischen Eigenschaften, Instinkte, Triebe und Begierden hat der Mensch mit den Tieren gemeinsam, auch wenn diese weit über das hinausgehen, was die Tiere an Begierden entwickeln können. So hat der Mensch mit den Tieren den Nahrungstrieb und die Begierde nach Nahrung gemeinsam. Beim Menschen geht dieser Trieb jedoch über das Bedürfnis den Hunger zu stillen hinaus. Sowohl an der Verfeinerung der Essgewohnheiten wie an dem häufig maßlosen und ungesunden Konsum von Nahrungsmitteln zeigt sich, dass der Mensch noch über ein höheres Wesensglied als die Tiere verfügt, nämlich über ein Ich. Die nicht nur verfeinerten, sondern zum Teil auch maßlos gesteigerten Ernährungsgewohnheiten des Menschen unterscheiden sich dadurch von denen der Tiere. In seinem Grundcharakter aber entspricht der Nahrungstrieb des Menschen dem der höheren Tiere.
Beim Tier erscheinen Instinkte, Trieb und Begierden aber immer als festgelegt und nicht veränderbar, während der Mensch durch sein Ich in der Lage ist, die Triebe und Begierden nicht nur zu beherrschen und zu steuern, sondern auch weiter zu entwickeln. Nur der Mensch hat zum Beispiel den Trieb oder den Wunsch, ein Konzert oder eine Ausstellung zu besuchen oder ein Buch zu lesen, also den Bildungstrieb, während die Tiere auf ihre jeweilig angeborenen Triebe eindeutig festgelegt sind, sowohl was ihre Nahrung, wie auch ihre Fortpflanzungsgewohnheiten und die Pflege ihres Nachwuchses betrifft. Hieran zeigt sich einerseits also die Verwandtschaft des menschlichen Seelenleibes mit den Tieren, anderseits aber zugleich dessen Unterschiedlichkeit aufgrund des den Astralleib dirigierenden vierten Wesensgliedes, des Ich, über das die Tiere nicht verfügen.
Die anthroposophische Evolutionsanschauung zeigt an dieser Stelle, dass die anderen Naturreiche deshalb früher in Erscheinung getreten sind als der Mensch, weil sie zugunsten des Menschen auf eine Höherentwicklung verzichtet und sich dadurch jeweils einseitig entwickelt und festgelegt haben. Der Mensch war jedoch an der Entwicklung der Naturreiche von Anfang an beteiligt, denn auf ihm beruht sozusagen der eigentliche Bauplan der Evolution. Damit der Mensch als freies Wesen erscheinen konnte, gliederten sich die übrigen Naturreiche auf jeweils einer Stufe der Evolution aus der Einheit des Ganzen aus und ermöglichten dadurch die Universalität des jeweiligen Wesensgliedes des Menschen.
An dem Gesamtzusammenhang dieser vier Wesensglieder des Menschen zeigt sich also, wie diese auf das höchste Wesensglied, das Ich, und damit auf die Freiheit des Menschen hin organisiert sind. Wenn man diesen evolutionären Zusammenhang einmal verstanden hat, dann ergibt sich daraus für jeden Menschen zugleich eine ungeheuer große Verantwortlichkeit. Weil sich nämlich anhand der beschriebenen Phänomene, die durch zahllose weitere Phänomene ergänzt werden könnten, zeigt, dass der Mensch diese Freiheit nicht umsonst erhalten hat. Sondern dass diese Freiheit aus der Sicht der drei anderen Naturreiche einen sehr hohen Preis gehabt hat, nämlich den Verzicht auf eine eigene Höherentwicklung, die dem menschlichen Ich vorbehalten blieb.
Aus dieser Perspektive muss sich notwendigerweise die Frage ergeben, wozu denn diese Freiheit nun genutzt werden soll. Denn bei jeglichem Freiheitsverständnis lässt sich immer zweierlei unterscheiden: Erstens die Freiheit von etwas und zweitens die Freiheit zu etwas.
Wozu also hat der Mensch aus evolutionärer Sicht seine Freiheit erhalten? Bekommt dadurch das von Paul Crutzen eingeführte Anthropozän nicht einen völlig neuen Hintergrund? Verbindet sich damit nicht notwendigerweise die Frage nach der Verantwortlichkeit des Menschen für diese Evolution, das heißt also vor allem für die Weiterentwicklung der Erde, der Naturreiche und natürlich des Menschen selber? Dieser Frage wollen wir nun im Folgenden weiter nachgehen.
2. DIE ZERSTÖRUNG DER ERDE ALS FOLGE DER MENSCHLICHEN FREIHEIT
Der Materialismus der modernen Naturwissenschaften
Am Beginn des naturwissenschaftlichen Zeitalters wurde sich die Menschheit der oben beschriebenen Freiheit, vor allem durch die geistige Strömung des Humanismus, als einer Freiheit von göttlicher Führung und Bestimmtheit, von religiösen Autoritäten, aber auch von sozialen Bindungen bewusst.15 In den Naturwissenschaften meinte man damit die Natur beherrschen und sich diese unbeschränkt verfügbar machen zu können.16 Der Hauptrepräsentant dieses Herrschaftsdenkens gegenüber der Natur war der englische Begründer der modernen Naturwissenschaft Francis Bacon (1561 – 1626).17
Sein Ausspruch Wissen ist Macht hat der modernen Naturwissenschaft bis in die Gegenwart das Gepräge gegeben. Seine Darstellung der naturwissenschaftlichen Methode, bei der es darum geht, der Natur auf dem Untersuchungstisch des Labors ihre Geheimnisse zu entlocken, beherrscht die Untersuchungsmethoden der Naturwissenschaft bis heute.
Mit dieser Methodik stellte sich Bacon vor allem den bis in seine Zeit herrschenden Grundsätzen der mittelalterlichen Scholastik entgegen, die alles Wissen von religiösen Grundsätzen und Dogmen abgeleitet hatte. Diese Art des Wissens war vor allem durch die revolutionären Entdeckungen von Kopernikus, Galilei und Kepler ins Wanken geraten, die durch genaue Sinnesbeobachtung festgestellt hatten, dass nicht die Erde, wie bisher angenommen, sondern die Sonne im Mittelpunkt unseres Planetensystems steht.