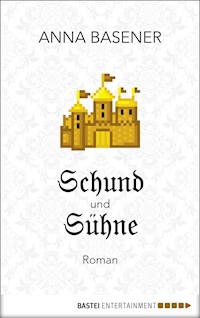9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die juten Sitten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Die Goldenen Zwanziger, wie sie schmutziger nicht sein könnten – der Roman zum erfolgreichen Audible-Hörspiel, das über Nacht zum Nr.1-Bestseller wurde
Berlin, 1927: Die achtjährige Hedi wächst im berüchtigten Bordell »Ritze« auf. Ihre Großmutter Minna, die das zwielichtige Etablissement betreibt, die strenge Domina Natalia und die bildschöne Hure Colette sind die einzige Familie, die Hedi je kannte. Von ihnen lernt sie alles, was sie fürs Leben braucht.
Drei Jahrzehnte später ist Hedi eine gefeierte Hollywood-Diva – und eine zum Tode verurteilte Mörderin. Kurz vor ihrer Hinrichtung erzählt sie einem Journalisten der New York Times die ganze ungeschminkte Wahrheit über ihr Leben. Eine Wahrheit, die sie unsterblich machen wird ...
Willkommen in der »Ritze«, dem verruchtesten Bordell Berlins!
»Die juten Sitten« entführen uns in eine Welt, die schockiert, mitreißt und erregt. In unserer Vorstellung sind die Zwanzigerjahre fast nichts als Nachtleben – aber wem gehört die Nacht? Es wird Zeit, sie denen zu schenken, die sonst kaum zu Wort kommen: den Prostituierten.
»Verachtung und Erniedrigung sind nicht dasselbe.«
Natalia, strenge Domina mit großem Herzen
»Angst vor Konkurrenz? Moi? Ich bitte dich, hast du mich mal angesehen?«
Colette, schönste Hure Berlins
»Meine Damen sind jute, starke Frauen, und ick kann mir keine besseren Vorbilder für ‘n kleines Mädchen vorstellen als uns.«
Minna, Bordellbesitzerin
»Sie wollen einen Skandal? Können Sie haben!«
Hedi, Minnas Enkelin und Hollywood-Star
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Ähnliche
Buch
Los Angeles, 1954: Hedi Belle hat es weit gebracht – von einem Bordell in Berlin bis auf die Leinwand in Hollywood. Doch nachdem sie aus unerklärlichen Gründen einen Mann erschossen hat, wartet sie im Gefängnis auf ihre Hinrichtung. Ihr einziger Besucher ist Noah Goldenblatt von der New York Times, der berichten soll, wie die Diva zur Mörderin wurde. Aber Hedi erzählt ihm lieber von ihrer Kindheit im Berlin der Zwanzigerjahre: Von ihrer Großmutter Minna, der Besitzerin der berüchtigten »Ritze«, die das Herz am rechten Fleck hatte. Von Colette, der schönsten Hure der Stadt, die von Paris träumte. Und von der Domina Natalia, die versehentlich ihren besten Kunden umbrachte und sie alle ins Verderben stürzte …
Autorin
Anna Basener schreibt Bücher und Hörspiele, Theaterstücke und Drehbücher. Ihr Debütroman »Als die Omma den Huren noch Taubensuppe kochte« gewann 2018 den Putlitzer Preis und hatte 2019 als musikalische Komödie Premiere am Schauspiel Dortmund. Essays, Kolumnen, Nachrufe und Reportagen von Anna Basener erschienen bei NEON, Business Punk und auf ZEIT ONLINE. Ihr Hörspiel »Die juten Sitten« schoss über Nacht auf Platz 1 bei Audible.
Weitere Informationen unter www.annabasener.de
Anna Basener
Die juten Sitten
Goldene Zwanziger.
Dreckige Wahrheiten
Roman
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Dieser Roman basiert auf dem gleichnamigen Hörspiel, das bei Audible erschienen ist.
Originalausgabe November 2020
Copyright © 2020 by Anna Basener
Copyright © 2020 dieser Ausgabe
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotive: Grafischer Rahmen: FinePic®, München;
Frau: Sylwia Makris/Trevillion Images
Redaktion: Bärbel Brands
LS · Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-26104-7V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Denkste denn, denkste denn,
Du Berliner Pflanze,
Denkste denn, ick liebe dir,
Nur weil ick mit dir tanze?
Denkste denn, denkste denn,
Det ick um dir weene?
Wenn de mir nicht lieben tust,
Denn lieb ick mir alleene.
Berliner Volkslied
Die Ritze
Los Angeles, 1954
Hedi war selten im Besucherraum. Auf dem Weg dorthin öffnet sich eine Tür nur, wenn sich eine andere zuvor geschlossen hat. Das ist der Deal. Tür um Tür, Auge um Auge, Zahn um Zahn – und Leben um Leben. Es ist ein langer Weg, viele Gänge, Treppe hoch, Treppe runter. Die Wände sind eierschalfarben, es zieht. Denn die Luft ist frei. Sie kann rein und raus und braucht keine Türen, selbst hier nicht. Im Königreich der Ritzen, die keiner abdichtet. Ist ja kein Palast. Die Frauen hier haben keinen Palast verdient. Jede Tür quietscht. Erbärmlich.
Türen, die klagen … gibt es auch nur hier. Hör auf zu jammern, denkt Hedi. Siehst du mich jammern? Eben.
Hedi jammert nicht, sie schweigt und schreitet. Trotz Handschellen. Ihr grauer Gefängniskittel schlackert um die schmalen Schultern. Sie ist blass, das Rot ihrer Haare wächst raus, aber sie hält den Kopf hoch erhoben, wie der Filmstar, der sie war. Sie ist kein Star mehr, alles, was je an ihr geglänzt hat, ist stumpf geworden. Dennoch: Du kriegst die Frau vielleicht aus Hollywood raus – aber Hollywood nicht aus der Frau. Sie mag nur noch ein Schatten ihres großen Ruhms sein, aber solange etwas einen Schatten wirft, ist es noch da.
Durch das Gitterfenster erblickt Hedi ihn zum ersten Mal. Er hat dunkle Haare und dunkle Augen, sein Jackett hängt über der Rückenlehne des Stuhls, sein Hut liegt vor ihm auf dem Tisch. Die Manschettenknöpfe sind golden, sie reflektieren die kalifornische Sonne, die durch die Oberlichter scheint. Es sind teure Knöpfe, nicht die allerbeste Qualität, aber gut genug für die New Yorker Society.
Hier drin sind sie gar nichts wert.
Bert schließt Hedi auf und lächelt. Er lächelt meistens, denn er mag sie. Weil er das Kino mag. Sie zwinkert ihm zu, tritt ein – und die Tür hinter ihr schließt sich, ohne dass sich eine andere öffnet. Hedi ist am Ziel. Weiter kommt sie nicht. Nie mehr.
»Hedi Belle …«, sagt der Besucher. »Guten Tag.«
Er spricht Deutsch. Hat er Hedi auf Deutsch angeschrieben? Sie weiß es gar nicht mehr. Wie lange hat sie diese Sprache nicht mehr gehört?
»Ich hab, was Sie verlangt haben«, sagt er jetzt und holt Geschenke aus seiner Tasche. »Zigaretten, Puder von Chanel …«
»Sie sind Deutscher.«
Er nickt und dreht die Puderdose um, sodass Hedi das Markenlogo lesen kann. CC Powder. »Ich war es mal«, sagt er. »So wie Sie.«
»Sie sind nicht wie ich.«
»Offensichtlich nicht.«
Er ist kein Star, will er damit sagen. Seine Augen betrachten Hedi, wie Filmstars immer betrachtet werden, wie sie betrachtet werden wollen. Auch Hedi. Scheiß auf das Sonnenlicht, das durch das schmale Oberlicht gleißt. Wenn sie etwas wiederhaben könnte, dann die Scheinwerfer. Dieses Licht will sie zurück, dieses Strahlen. Wer will schon ein Schatten sein? Niemand, der zum Film geht jedenfalls. Hedi schon gar nicht. Das wollte sie nie. Und doch ist sie hier gelandet, ohne Scheinwerfer. Ohne die unzähligen Blicke wie der von ihm. Aber erstens kriegt sie nichts zurück, gar nichts, und zweitens meinte sie nicht ihren Ruhm, der sie von ihm unterscheidet. Dieser junge Mann von der Ostküste ist aus ganz anderen Gründen nicht wie Hedi. Das sieht sie auf den ersten Blick. Seit sie acht war, kann sie das binnen Sekunden erkennen.
Er kramt noch einmal in der Tasche. »Und ich hab natürlich auch die Lösungsmittel.«
Er stellt zwei Glasfläschchen auf den Tisch. Hedi starrt sie an, die alten Freunde, die Erinnerung, die Vergangenheit, die Lösungsmittel.
»Und die Rosen«, sagt er.
Hinter seinem Stuhl steht ein großer Korb, aus dem er die Blumen holt. Es muss ihn ein Vermögen gekostet haben, das alles hier reinzubekommen. Aber was interessiert das Hedi? Sie interessiert sich allein für die Fläschchen mit der klaren Flüssigkeit. Die hübschen kleinen Flaschen, die hin und her schwappende Flüssigkeit, die Wellen des Damals, die Gezeiten des Rauschs … Ihr Mund wird trocken, die Handflächen werden feucht, ihr Herz rast …
Er stemmt die Hände in die Hüften, betrachtet die Lösungsmittel und schüttelt leicht den Kopf. »Sie müssen Ihre ganze Zelle desinfizieren wollen, wenn Sie für jedes Treffen je eine Flasche Äther und eine Flasche Chloroform verlangen.«
Hedi antwortet nicht und setzt sich an den Tisch. Sie zieht sein leeres Wasserglas zu sich und öffnet beide Flaschen. Sie schüttet aus jeder etwas in das Glas, gleichzeitig, keine Zeit mehr verschwenden, aber auch keinen Tropfen. Vorsichtig. Schnell und vorsichtig.
»Wollen Sie den Besucherraum auch desin…«, beginnt er und hält inne. Er betrachtet sie, scheint auszurechnen, wie viel Fläche man mit dem Inhalt eines Glases desinfizieren könnte. Offensichtlich kommt er auf kein befriedigendes Ergebnis. »Was machen Sie denn da?«
Sie stellt die Flaschen ab und streckt die Hand aus. »Die Rosen!«
Er reicht ihr den Strauß. Sein Blick wird immer verständnisloser, aber sie schaut ihn nicht an. Sie will es mehr, als sie dachte. Sie braucht es. Seit einem Jahr ist sie clean. Seit zwölf Monaten. Zwölfeinhalb eigentlich. Das hier sollte nur eine Kleinigkeit sein. Nur das Tüpfelchen auf dem i. Aber es ist der ganze Buchstabe, es ist ein Wort, das einzige, das Hedi noch aussprechen will.
»Ich dachte, pfirsichfarben könnte Ihnen gefallen.« Seine Stimme lächelt.
»Sie müssen weiß sein.« Sie streicht über die Blüten, umfasst sie mit der ganzen Hand und reißt sie vom Stängel. Sie lässt sie auf den Tisch rieseln. Blüte für Blüte, ein kleiner Rosenberg.
»Das tut mir leid, das hatten Sie nicht geschrieben, ich … Was machen Sie denn da?«
»Ich brauche nur die Blüten«, sagt sie, als wäre das eine Antwort.
»Wollen Sie die Blüten desinfizieren?«
»Sie müssen die Welt für sehr schmutzig halten«, murmelt Hedi.
»Natürlich tue ich das.« Er zeigt aus dem Fenster. »Der Dreck in den Städten, die Fabriken vor den Städten, überall rauchende Schlote … Haben Sie sich diese Welt in letzter Zeit mal angesehen?«
»Ich sitze im Gefängnis«, antwortet sie.
»Richtig. Verzeihung. Dann vertrauen Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass die Welt ein Saustall ist.«
»Ich vertraue niemandem.«
Es ist wie Fahrradfahren. Äther und Chloroform mischen, dann das Blütenblatt mit spitzen Fingern halten und eintauchen, bis es sich zur Hälfte vollgesogen hat. Hedis Körper erinnert sich an alles. Jede Bewegung liegt ihr im Blut. Sie klopft das Blütenblatt leicht gegen den Glasrand, die überschüssige Flüssigkeit tropft ab. Kleine Perlen fallen zurück ins Gemisch und bilden Lösungsmittelringe auf der Oberfläche.
»Was machen Sie da?«, fragt er erneut.
»Frühstücken.«
»Was? Das können Sie nicht essen, das …«
Sie hört ihn gar nicht. Sie beißt in das Blütenblatt. Scharfer Geruch, noch schärferer Geschmack. Wie Nadelstiche auf ihren Schleimhäuten. Hedi liebt es.
»Okay«, murmelt er. »Offensichtlich können Sie das sehr wohl …«
»Man isst nur den getränkten Teil«, erklärt sie. »Wollen Sie den Rest?«
»Äh … Nein danke.«
»Sie waren damals nicht in Berlin, oder? In den Zwanzigern?«
»Doch, aber ich … Wir waren Kinder damals. Sie auch.«
»Ich denke nicht, dass ich je ein Kind war.«
Das Glück ist am schönsten, wenn es überraschend kommt. Das ist das Gute an der Abstinenz hier drinnen, sie hat Hedi sensibilisiert. Als sie um die Zutaten für all das gebeten hat, hat sie nicht damit gerechnet, dass er sie wirklich mitbringt. Die anderen haben es nicht getan. Und jetzt, da das Frühstückselixier wirkt, ist es fast wie beim ersten Mal. Alles ist leicht und schön und strahlt.
»Sie bekommen nichts ab«, haucht Hedi in den Raum.
»Damit kann ich leben.«
Sie lacht in sich hinein. »Wenn Sie das ›leben‹ nennen …«
»Vielleicht sollten wir vorn anfangen. Mein Name ist Noah Goldenblatt, ich schreibe für die New York Times.«
»Sie machen den Klatsch.«
»Und Filmkritik.«
Aber das hier ist kein Film. Es ist Hedis Leben. Das sie im Gefängnis verbringt. Weil sie jemanden erschossen hat. Hedi ist jetzt Klatsch.
»Sie haben Louis Mercier umgebracht. Das Gericht urteilte: ›kaltblütig‹«, erklärt Noah, als wär sie nicht dabei gewesen.
Sie lacht wieder. Kaltblütig. Als würde die Temperatur ihres Blutes eine Rolle spielen …
»Die meisten Frauen benutzen Gift«, sagt er weiter. Er scheint in dieser Hinsicht recherchiert zu haben.
»Gift … Was ist schon Gift?« Hedi beißt in ein weiteres Blütenblatt. »Die Dosis macht das Gift.«
Er beugt sich zu ihr. »Wollen Sie mir erzählen, warum Sie ihn erschossen haben?«
»Nein.«
Hedi hat Hunderte Anfragen bekommen. Journalisten aus dem ganzen Land und einige aus Europa wollen diese Geschichte aufschreiben. Sie wollen wissen, warum sie Louis erschossen hat. Sie hat ein Leben beendet, und ihre Karriere. Sie hat gestanden und sonst nichts gesagt. Ein Mord ist keine Filmrolle, davon kann sie nicht erzählen.
»Aber ich erzähle Ihnen von Berlin damals«, bietet sie ihm an.
»Ich bin selbst in Berlin geboren«, sagt Noah. »Ich denke, ich kenne mich …«
»… aus?« Sie unterbricht ihn. »Sie kennen sich aus? Wo? In der Grunewald-Villa Ihrer Eltern?«
Noah muss jetzt auch lachen. »Eins zu null für Sie. Wo sind Sie aufgewachsen?«
»Zwischen Schnaps und Chloroform.«
»Wie bitte?«
»In der Mulackstraße. Scheunenviertel. Friedrichstadt.«
Er nickt, als verstünde er. »Im Osten.«
»Ja, im dreckigen Arbeiterosten.«
Seine Stirn ist gerunzelt. »Arbeiter lassen ihre Kinder mit Schnaps und Chloroform spielen?«
»Nein, das waren die Huren.«
»Huren? Prostituierte?«
Sie hat das noch nie erzählt. Fans halten bei ihren Stars nur ein gewisses Maß an Freizügigkeit aus. Sie kommen vielleicht mit einem unehelichen Kind zurecht, sie verzeihen einem zwei, manchmal drei Scheidungen. Sie empfinden Sympathie, wenn man von ganz unten kommt. Ganz unten stehen Arbeiter und Tagelöhner. Das ist das Fundament des Hauses, das unsere Gesellschaft errichtet hat. Wenn die schöne Diva von noch weiter unten kommt, quasi aus dem Kellerloch, dann hört die Bewunderung auf. Dann überwiegt die Scham, die Moral, die geheuchelte Christlichkeit …
Aber was hat Hedi zu verlieren? Sie kann nur noch gewinnen. Zum Beispiel erscheint Noah ihr wie jemand, den ihre Geschichte tief erschüttern wird. Und sie hat doch keine Freude mehr im Leben, außer Chloroform und die Möglichkeit, einen braven jüdischen Reporter von der Ostküste zu schockieren.
Hedi lächelt ihn an. »Ja, bei ihnen bin ich aufgewachsen. Bei Prostituierten, Fosen, Dominas, Strichern, Burschen, Kontrollmädchen, Stiefeldamen. Huren eben.«
»Sie haben als Kind unter Huren gelebt?«
»Sie sagen das, als sei es etwas Schlechtes.« Sie legt den Kopf schief und betrachtet ihn, während er nach Worten sucht.
»Na ja, ich …«
»Sie, Noah …« Hedi lehnt sich vor und flüstert: »Sie haben keine Ahnung.«
Berlin, 1927
Das Bett wackelt. Zwischen den Kissen nackte Haut, Schweißtropfen und ein einzelner Seidenstrumpf. Ein Stöhnen wälzt sich über die Matratze, dann noch eins, eins ist dunkel, eins hell. Sie werden immer lauter. Sie ringen miteinander um den Sieg. Er gewinnt, sie tut so. Eigentlich hat sie gewonnen. Sie gewinnt immer.
»Colette, Colette … das war …«
»Für mich auch, mon loup.« Colette hat einen französischen Akzent. Jedes Wort, das über ihre Lippen kommt, tanzt in die Welt, erobert und verführt sie.
Der Mann neben ihr lacht. »Das sagst du nur, weil du Trinkgeld willst.«
»Mais non. Ich will, dass mein Lieblingsfreier glücklich ist.«
Seine Augen leuchten. »Ich bin dein Lieblingsfreier?«
Ein empörter Augenaufschlag. »Wusstest du das denn nicht, mon loup?«
»Na ja, ich dachte …«
Sie stupst seine Nase mit dem Zeigefinger an. »Aber bei mir sollst du doch nicht denken.«
Die erste Hure, die ein Mann kennenlernen sollte, ist Colette. Sie ist übrigens die erste, die jeder kennenlernen sollte. Colettes Zimmer ist das hellste im Haus. Es ist eigentlich nur eine Dachkammer, aber sie ist ausgebaut. Zwei kleine Gauben mit Fenstern nach Süden raus. An der Wand über dem schmalen Holzbett hängen Colettes Lieblingszeichnungen von Zille. Sie mag nur die Bilder, für die sie selbst Modell gestanden hat, und zwar erst nachdem sie ihnen den letzten Schliff verpasst hat. Sie malt sich immer schönere Locken, als Zille es getan hat, bevor sie die Zeichnungen an die Wand heftet. In ihren Augen hat Zille keinen Blick für Frisuren und kann ihre Hilfe gut gebrauchen. Zille malt sie tatsächlich immer räudiger, als sie ist. Er malt alles räudiger. Die Wirklichkeit ist nicht so hässlich. Und Colette schon gar nicht.
Sie hält alles immer sauber. Sie fegt ihre Kammer jeden Tag und parfümiert sich selbst und das ganze Zimmer mehrmals pro Schicht. Sie ist die schönste Frau, die Hedi je gesehen hat. Und Hedi kennt Monroe und Kelly persönlich. Kannst du alle vergessen. Colette sieht aus wie ein Engel, ihre Haare sind tausend kleine goldene Wölkchen und ihre Augen ein riesiger Himmel. Umkränzt von dichten rußschwarzen Wimpern. Sie hat den aufregendsten Augenaufschlag Berlins. Ach was, von ganz Deutschland. Ihr Körper ist das blühende Leben, er ist rosa Baiser. Alles an ihr ist süß und köstlich. Sie ist wie französische Patisserie. Jeder will ein Stück, aber mehr als eins kann keiner vertragen oder gar bezahlen.
Der Mann neben ihr bildet sich ein, dass er es doch könnte. Er will noch etwas mehr Geld auf ihren Nachttisch legen, und vor allem will er, dass sie zurück ins Bett steigt. Aber sie steht nackt mit einem einzelnen Strumpf bekleidet mitten im Zimmer und zeigt durch die Dachluke in den Himmel.
»Verlockend, aber die Sonne geht schon auf, und du musst zum Frühstück bei deiner Alten sein, bevor es zur Arbeit geht, n’est-ce pas?«
Er verdreht die Augen. »Ach, die …«
»Sie lässt dich sonst nicht mehr raus, mon loup. Dann kommst du nicht mehr vorbei.« Sie legt eine Hand auf ihre nackte Brust. »Und das würde mir das Herz brechen.«
Er richtet sich etwas auf und schiebt die Decke weg. »Das Herz?«
»Naturellement. Ich hab ein großes Herz. Und es schlägt allein pour toi.«
Die Füße des Freiers fallen müde auf die Holzdielen, seine Augen lächeln geschmeichelt. »Das sagst du nur so.«
»Wenigstens sagt es irgendeine Frau zu dir. Raus mit dir, mon loup. Los, mach schon! Dépêche-toi!«
Er nickt und angelt seine Hose vom Boden. »Warte, vorher muss ich noch etwas auf diesen Stapel legen.«
Er legt noch mehr Geld auf den Nachttisch. Dort liegen bereits sechzehn Mark, denn Freier müssen immer im Voraus zahlen. Jetzt bekommt Colette fast zwanzig, ohne dass sie noch einmal in die Kissen gehüpft ist. Sie schlingt die Arme um ihn und drückt ihre nackten Brüste an seinen Bauch.
»Das wär doch nicht nötig gewesen.«
Er seufzt, er ist geil, aber nicht dumm. »Du bist so ein Fuchs, Colette.«
Sie knabbert an seinem Ohrläppchen. »Dein Fuchs allein, mein Großer. Dein kleiner Fickfuchs.«
Sie löst sich aus der Umarmung und zieht ihm sein Hemd an. Es ist eine einzige Bewegung, er fließt in seine Kleidung hinein, und ehe er sich’s versieht, ist er aus der Tür.
Colette ist allein. Sie zieht einen Lederkoffer unter ihrem Bett hervor und legt die neuen Scheine auf einen der vielen Stapel. Hier drückt sich Schein an Schein, das Geld kuschelt sich ihrem Traum entgegen. Colette lässt den Koffer wieder verschwinden, zieht das Bett ab und ihren Strumpf aus. Alles wie immer, wie nach jedem Kunden. Sie legt die Wäsche in einen geflochtenen Korb zwischen Bett und Tür. Gähnend geht sie zum Waschtisch. Dort hängt ein Spiegel über dem Porzellankrug und der Emailleschüssel. An einer Stange daneben hängen frische Tücher. Fließendes Wasser gibt es nur im Erdgeschoss, nicht unterm Dach. Colette steht nackt vor dem Spiegel. Sie nimmt den Wasserkrug, die Seife schon in der anderen Hand, und hebt ihn an. Aber die Schicht war lang, der Krug ist leer.
»Merde.«
»Ich hab kein frisches Wasser mehr oben.«
Minna hebt den Kopf nur kurz. »Wieso biste denn schon fertig?«
»Schon?«, fragt Colette. »Was soll das denn heißen? Arbeitet hier in diesem Haus sonst noch wer?«
»Ja, icke«, antwortet Minna, lehnt sich zurück und zündet sich einen Zigarillo an. »Oder denkste, det ick hier zum Spaß allein im kalten Rauch von gestern sitze?«
Colette hebt eine Augenbraue und sieht die Puffmutter durch die Dunstschwaden an, die frischen und die alten. »Oui, der Rauch scheint dich sehr zu stören.«
»Der von anderen schon.Ist aber nicht halb so schlimm wie die Kackbücher hier.« Minna schiebt die Abrechnungen von sich weg über den klebrigen Tisch.
Colette geht hinter die Theke, tritt ans Spülbecken und dreht das Wasser auf. Es plätschert leise in ihren Krug. Sie gähnt. »Ich mach dir die Abrechnung nachher, Minna.«
»Inner halben Stunde muss ick Hedwig wecken, da kann ick jenauso jut noch wat arbeiten.«
Hedwig. Das ist Hedis richtiger Name, aber den kann in Amerika keiner aussprechen. Und es klingt auch nicht nach einem Star. Ohnehin sind Namen Schall und Rauch. Wer sich neu erfindet, erfindet ohne Weiteres auch neue Namen. Hedwig hat Minna nie Großmutter genannt. Oder Oma. Bis sie in die Schule kam, wusste sie gar nicht, dass es Großmütter gibt oder Minna ihre war.
Minna will keine Großmutter sein. Sie wollte nicht mal Mutter sein, aber auch als kluge Frau kannst du die Natur nicht immer austricksen. Und schon gar nicht in diesem Gewerbe. Sie trägt ihr graues Haar mit Stolz, aber mehr noch den Haarknoten. Wie eine Krone in einer Republik voller Bubiköpfe. Ihr Busen ist schwer, ihre Arme stark, sie selbst noch stärker. Sie hat einen goldenen Schneidezahn und raucht Zigarillos, die die meisten Männer umhauen.
»Du kannst mein Bett machen«, schlägt Colette jetzt vor. »Wenn du unbedingt was arbeiten willst. Da machst du nicht so viele Fehler wie mit deinen Büchern.« Sie seufzt. »Beaucoup d’erreurs.«
»Hey, det ist immer noch mein Haus, ja?«, mahnt Minna mit Zigarillo im Mundwinkel. »Vergiss nicht, für wene arbeitest.«
»Oui, Madame.«
»Oui oui …«, äfft Minna sie nach, und Colette lacht.
Die Ritze heißt das Etablissement. Es ist ein schmales Haus in der Mulackstraße, Scheunenviertel. An dieser Stelle steht überhaupt nur deshalb ein Haus, weil irgendein Architekt sich im Jahr 1895 gedacht hat, er müsse der Welt beweisen, dass eine vier Meter breite Spalte zwischen zwei Gebäuden sehr wohl genug Platz für ein weiteres Haus bietet. Also hat er es gebaut. Wenn man im Hinterhof steht, sieht man nur Häuserwände. Die Fenster der angrenzenden Gebäude gehen jeweils zu anderen Höfen raus. Die Ritze ist da, aber die Nachbarhäuser schauen weg.
Egal, der Name ist jedenfalls Programm: oben Hurenstuben, unten Gaststube. Ein Tresen mit Hungerturm, Buletten und Eiern. Die abgegriffenen Zapfhähne aus Messing, dahinter im Regal die Gläser. Alle blind. Von der Decke hängen ein paar Lampen, auf den Tischen klebt das Kerzenwachs pfundweise. Macht nie jemand weg. Es riecht nach Schweiß und Alkohol. Es gibt zwei schmale Fenster zur Straße, aber den Gestank kann man nicht rauslüften. Der Gestank will immer bleiben. Wie der letzte Freier der Nacht, den du ums Verrecken nicht loskriegst. In Hedis Erinnerung ist die Gaststube riesig. Als Kind konnte sie zwischen Tischen und Stühlen toben. Aber später blieb ihr nur eine Fotografie von dem Raum, und wenn sie die als Erwachsene betrachtet hat, wurde ihr jedes Mal bewusst, wie winzig die Gaststube war.
»Und warum soll ick überhaupt dein Bett machen?«, fragt Minna. »Willste nicht schlafen?«
Colette ist schon fast wieder im Treppenhaus. »Heute nicht. Später vielleicht.«
»Wo soll’s denn so eilig hingehen?«
»Nur’n bisschen raus!«, ruft sie aus dem Flur.
»Warte mal, Colette! Komm mal zurück.«
Colette seufzt und kommt zurück in die Gaststube, den Wasserkrug in der Hand. Sie ist immer noch nackt. Sie hält den Krug vor sich wie einen Schild in der Schlacht, ihre Brüste liegen auf dem Ausguss auf, ihre Füße kleben am Boden und möchten schnell nach oben. Sie wollen diese Schlacht nicht kämpfen.
Minna lehnt sich zurück und nimmt den Zigarillo aus dem Mund. »Sieht mir ein bisschen so aus, als hätteste ein Geheimnis vor mir.«
»Geheimnis? Ich kann tun und lassen, was ich will, n’est-ce pas? Ich arbeite auf eigene Rechnung, zahl pünktlich meine Miete und mach deine Buchhaltung. Ich muss dir nicht alles sagen.«
»Natürlich nicht. Ick dachte nur: Wir sind doch Freundinnen.«
»Freundinnen?« Colette zieht die Nase kraus.
»Oder siehste hier irgendwelche anderen Frauen, denen ick vertraue?«
»In dem Qualm seh ich gar nichts. Rien. Und als Freundin muss ich dir sagen, dass du dir diese Haare auch färben könntest.«
»Niemals.«
»Schneiden? Wenigstens schneiden. Kinnlang würde dir gut stehen … « Colette lächelt. »Ich schneid sie dir.«
Minna übergeht das Angebot. »Der Freier vorhin hätte dich bis nach ’m Frühstück gevögelt und bis Mittag bezahlt. Ach wat, bis zum Abend.«
»Ich bin wund, und der stinkt aus dem Maul.«
»Er hat mir gesagt, er ist dein Liebling.«
»Sie sind alle meine Lieblinge, Minna.«
Minna sitzt rauchend an dem kleinen Tisch neben dem Tresen. Sie betrachtet Colette und deren unruhige, nackte Füße. Die Zehennägel sind rot lackiert. Beine, Achseln und Muschi sind rasiert. Das haben damals nur die Huren gemacht. Die Idee, sich zu rasieren, kommt aus dem Bordell. Minna hat Colette schon tausend Mal nackt gesehen, sie hat hier in der Ritze schon jeden nackt gesehen. Alle Huren, alle Freier, Hedwig … Sie ist die Einzige in der Ritze, die nichts mehr zeigt. Sie raucht und betrachtet die blonde Schönheit.
»Warum haste ihn weggeschickt?«
»Was geht’s dich an? Fragst du Natalia auch so aus?«
Minna lacht und zeigt mit dem Zigarillo auf Colette. »Weißte, wat dein Problem ist? Det du Antworten gibst. Det du alles zu Ende bringen willst, det du Unordnung nicht erträgst.«
»Natalia wird also nicht ausgefragt, weil sie eh keine Antworten gibt?«
»Und weil ick Angst hab, det se mich totschlägt«, sagt Minna. »Sie hat jetzt eine Drahtbürste und eine Schablone, und sie schlägt dir Zahlen und Formen ins Fleisch. Wenn du willst.«
»Will ich nicht.«
»Dann haste eine Drahtbürsten-Zwölf auf’m Arsch.« Minna gackert vor Lachen und raucht. »Blutrot.«
»Ja, ulkig«, stimmt Colette zu und dreht sich wieder in Richtung Treppenhaus. »Jedenfalls muss ich …«
»Du lässt dir registrieren«, sagt Minna und begreift es im selben Augenblick. »Natürlich …«
»Was?«
»Heute ist der Erste. Dit Scheißjesetz tritt in Kraft.«
»Ich hätt’s dir nachher schon noch gesagt.«
»Biste bescheuert?«
»Das ist ein Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten.« Colette reckt das Kinn. »Und ich hätte gern keine Geschlechtskrankheiten, Minna.«
»Berufsrisiko.«
»Was?«
»Ach, det meiste ist doch heutzutage irgendwie heilbar. Und du wäschst dir doch nach jedem Freier. Ganz zu schweigen von den Fromms in deinem Zimmer.« Minna zieht an ihrem Zigarillo. »Du hast mehr Gummis als Fromm in seiner Fabrik.«
»Das Gesetz ist gut für uns, Minna.«
Minna schüttelt den Kopf. »Nein, det sollen wir nur denken. Die wollen uns verzeichnen und kontrollieren.«
»Du hast nur Angst um dein Geld.«
»Natürlich.« Minnas Zigarillo zeigt auf Colette. »Und det solltest du auch haben. Wenn wir legal sind, sind wir nämlich vor allem eins: Steuerzahler.«
»Na und? Wenigstens erkennen sie an, dass das hier Arbeit ist, dass ich schufte, dass ich gut in etwas bin.« Colette zeigt mit dem Finger auf sich selbst und bohrt ihn mit Nachdruck in ihre Brust.
Minna runzelt die Stirn und raucht. »Det du jut bist? Sagen dir die Kerle doch jede Nacht.«
»Das heißt nicht, dass sie uns nicht trotzdem verachten.«
»Und wann hat ein Gesetz jemals wat anner Achtung der Männer geändert?«, fragt Minna. »Männer waren 1895 Tiere, und sie sind heute Tiere.«
Es war nicht alles schlecht damals, denkt Minna, aber Colette sieht es anders. Huren waren schon immer Verbrecherinnen, höchstens geduldet. Immer mit der halben Muschi im Gefängnis. Auch Minna, als sie damals angefangen hat in dem feinen Bordell in Charlottenburg.
Colette schüttelt den Kopf, ohne das Kinn auch nur einen Deut zu senken. Sie reckt sich nach dem Himmel. Ganz nach oben. Da oben gehören ihre Wolkenhaare hin, und sie selbst will auch hoch hinaus. Nach oben, immer höher. Niemals zurück nach unten. »Wir sind ab heute keine Verbrecher mehr, Minna. Der erste Oktober 1927 ist ein historischer Tag für uns. Eigentlich müssten wir das feiern. Je veux fêter.«
»Ick feier nicht, det hier bald der Reichsfinanzhof vor der Tür steht wie so’n dreckiger Zuhälter«, widerspricht Minna.
»Wenigstens musst du die Bullen dann nicht mehr schmieren.«
»Det hasse wohl jeträumt.«
»Non! Das steht so in der Zeitung.« Colette verdreht die Augen. Minna liest nie Zeitungen oder überhaupt irgendwas. Und dann denkt sie, dass sie sich trotzdem auskennt. Lächerlich. »Keine polizeilichen Maßnahmen mehr gegen uns, Minna. Was, wenn die Welt sich zur Abwechslung wirklich verändert und du’s nicht mitkriegst? Nicht, dass du Bruno umsonst Geld in den Rachen schiebst.«
Am Ende ist es stets das Geld, das Minna zum Schweigen bringt. Über das Geld muss sie immer erst mal nachdenken. Colette nutzt die Chance und eilt davon.
Minna zündet sich einen neuen Zigarillo an und raucht. Und dann weckt sie Hedwig. Zu spät natürlich. Das Kind bekommt kein Frühstück, weil die Zeit nicht reicht. Und Zeit ist Geld. Zeit und Orgasmen. Aber das darf Hedwig in der Schule nicht erzählen. Bringt ihnen allen nur Ärger ein.
Hedwig mag den Spielplatz nicht, sie kann mit den Kindern dort nichts anfangen. Minna holt sie fast nie von der Schule ab. Und wenn, dann muss sie immer auf den Spielplatz, damit Minna ein reines Gewissen hat. Wegen ihrer Fürsorge für das Kind. Heute ist so ein Tag.
Hedwig sitzt in ihrem gestreiften Kleid mit dem Matrosenkragen und dem gefütterten Leinenmantel auf der Schaukel. Bald ist Zeit für die langen Strümpfe, aber noch trägt sie Kniestrümpfe. Der Wind bläst ihr durch die kinnlangen Haare. Sie sind dunkelblond, sehen immer etwas schmutzig aus. Hedwig hätte gern aufregende Haare so wie Natalia. Könnte man färben, aber sie ist zu jung dafür, sagt Minna.
Hedwig schaukelt, erträgt es aber nur, wenn Minna zusieht. Sie applaudiert Hedwig immer, wenn die höher und höher schaukelt. Keiner schaukelt so hoch wie Hedwig, keiner kommt dem Himmel so nah. Nicht hier in der Friedrichstadt. Aber Minna kümmert sich heute nicht um das Mädchen. Es gibt keinen Applaus. Eine Mistfürsorge ist das heute.
Minna steht drüben am Kiosk und kauft eine Zeitung. Sie liest lieber Zeitung, als Hedwig zuzuschauen. Hedwig hasst Zeitungen.
Minna hasst Zeitungen auch. Das Einzige, was sie gern liest, sind die schwarzen Zahlen in ihren Büchern. Stehen unten rechts auf jeder Seite und machen sie glücklich. Das, was sie jetzt liest, hingegen macht sie weniger glücklich.
Sie liest über dasGesetz zur Eindämmung der Geschlechtskrankheiten Syphilis, Tripper und Schanker. Sie liest, dass Prostitution soziale Ursachen habe, die nicht unter Strafe gestellt werden dürften, ginge es nach der Kommunistischen Partei. Minna grunzt belustigt und raucht.
»Idioten«, sagt sie und liest weiter.
Es gebe nun ein amtlich genehmigtes Merkblatt für ärztlich untersuchte, geschlechtskranke Personen. Sie will schon aufhören zu lesen, es langweilt sie maßlos, als es endlich um Bordelle geht, aber diese Worte machen sie nun doch sehr unglücklich. Ausgesprochen unglücklich.
»Scheiße!«
Der Tag scheint für Colette immer mehr Stunden zu haben als für alle anderen. Oder sie braucht einfach weniger Schlaf. Sie sitzt in ihrer Matrosenhose im Schneidersitz auf Minnas Platz in der Gaststube und studiert die Bücher. Vorn in den blonden Locken stecken die Klammern für die Wasserwellen, die Colette am Abend haben möchte – und die sie am Abend haben wird. Man sagt über Locken gern, dass sie schwer zu bändigen sind. Das mag für alle Locken dieser Welt gelten, aber nicht für Colettes kleine Haarwölkchen. Colette hat sie im Griff.
Zwischen dem Buch und dem Berg aus Kerzenwachs auf dem Tisch liegt ihre Matrosenmütze. Sie tut gern so, als wäre die von einer der Modistinnen aus dem KaDeWe, aber sie ist das Geschenk eines Matrosen. Colette hat nicht so viel Geld für Mode, wie sie ihrer Meinung nach bräuchte. Sie kaut an einem Bleistift, während Natalia gähnend hinterm Tresen steht und das Regal mit den Schnapsflaschen betrachtet.
»Minna hat dir schon wieder zu wenig berechnet«, sagt Colette. »Und moi aussi.«
»Du bist dümmste kluge Mensch, den ich kenne.« Natalia ist zu müde für der, die oder das, ihr russischer Akzent klaut ihr immer wieder die Artikel. Natalia lässt sie ziehen, Artikel sind ihr egal. Auch sortiert sie Wörter gern anders. Ihre Welt besteht aus Subjekten und Objekten, nicht aus all dem unnützen Kram dazwischen.
»Du kennst Menschen? Seit wann kennst du irgendwen außer Hedwig?«, fragt Colette. »Du kannst dir nicht mal die Namen deiner Stammkunden merken.«
»Ich verdien mehr, wenn ich ihnen gebe Nummern«, sagt Natalia und zuckt mit den Schultern. Sie füllt zwei Gläser mit Wodka und stellt eines neben den Wachsberg vor Colette.
Der blonde Lockenkopf schüttelt sich knapp. »Non, merci.«
»Gut. Mehr für mich. Za zhenshhin.«
Natalia stürzt beide Gläser runter. Sie ist nicht schön. Nicht im klassischen Sinne. Sie ist zäh und kalt und meistens besoffen. Wäre sie jetzt gerade in Amerika, sie würde die Prohibition nicht überleben. Andererseits hat die Prohibition ja nicht mal sich selbst überlebt. Natalias Haare sind schwarz. Sie trägt sie vorn kinnlang, mit Pony, und hinten kürzer. Ihre Frisur ist ein Helm. Als hätte sie keine Haarspitzen, sondern nur eine Kante, die um ihren Kopf herumläuft – und an der man sich schneiden kann. Ihre Lippen sind ein schmaler Strich, rot angemalt. Sie ist furchtbar blass, aber wahrscheinlich würde sie nicht halb so gut verdienen, wenn sie schön wäre.
»Ich war beim Arzt«, verkündet Colette.
»Warum?«
»Ich hab mich untersuchen und registrieren lassen.«
»Und ich dachte schon …«
»Non. Ich bin jetzt offiziell.«
»Offiziell was?«
»Hure. Putain.«
»Wenn’s hilft«, sagt Natalia.
Sie ist eine Stiefeldame. Man sieht sie selten ohne ihre Lacklederstiefel. Auch schwarz. Ehrensache. Alles an ihr ist schwarz. Jetzt gerade, am Tag, trägt sie einen Seidenmorgenrock für Herren. Nachts schlüpft sie in Leder. Schwarzes Lackleder. Manchmal darf Hedwig mit ihrer Peitsche spielen.
»Ja, tut es.« Colette nickt, wie man nicht überzeugter nicken kann. »Mir und uns und der Prostitution allgemein.«
»Aha.«
»Geht ganz schnell. Du musst nur zur Gesundheitsbehörde.«
»Colette, ich bin nicht mal Deutsche. Oder überhaupt legal hier.«
»Ja, das ist auch nicht in Ordnung.«
Natalia reibt sich die Nasenwurzel und geht zurück zum Tresen, wo die angebrochene Flasche steht. »Ordnung macht mir Kopfschmerzen.«
»Non. Das macht der Wodka«, widerspricht Colette und zeigt mit dem Bleistift auf eine Zahl in dem Buch vor ihr. »Und wo wir gerade bei Ordnung sind: Du schuldest Minna noch dreißig Mark.«
»Jaja. Sie kriegt schon noch.« Natalia schenkt sich ein. »Wo ist eigentlich meine Hundeleine?«
Colette notiert eifrig noch etwas in einem anderen Buch. »Quelle Hundeleine?«
Natalia leert das Schnapsglas. »Die, die seit gestern verschwunden ist aus meinem Zimmer. Hängt immer zwischen Kreuz und Hurenbock.«
Colette steht auf und schlägt das Buch zu. »Immer? So ordentlich bist du nicht. Hast sie wahrscheinlich verlegt.«
»Nein. Wahrscheinlich hast du sie.«
»Ich hasse Hunde. Was sollte ich mit einer Hundeleine?«
»Mann anleinen.«
»Erstens brauche ich für keinen Mann eine Leine. Die rennen mir auch so nach.« Colette stemmt die Hände in die Hüften. »Und zweitens: Ich will nicht, dass die bleiben. Die sollen schön weiterziehen. Wenn die einmal bleiben, wollen die, dass ich aufhöre zu arbeiten.«
Colette will gehen, aber Natalias Stimme peitscht durch den Raum, als wolle sie die Glasscheiben im Hungerturm in kleine Dreiecke zerschneiden und an Colettes Kehle drücken. »Wo ist Hundeleine?«
Colette bleibt und antwortet: »Ich hab sie nur geliehen. Ich dachte, das ist ein Lederriemen zum Auspeitschen.«
»Peitschen sind zum Peitschen.«
»Wofür ist dann die Leine?«
»Zum Anleinen von Männern«, sagt Natalia langsam, als rede sie mit einem Kind, dem man die Bedeutung einzelner Worte zum ersten Mal erklärt.
»Du hast Angst, dass ich dir Konkurrenz mache … Ich könnte es nämlich, tu sais«, sagt Colette, wie um sich selbst zu überzeugen. Sie ist immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ihr Angebot zu erweitern und ihrem Traum näher zu kommen. »Schmerzen bereiten und quälen, ich kann das.«
»Nein, du kannst nicht. Ist sie in deinem Zimmer? Ich hol sie selbst.« Natalia seufzt und macht sich auf den Weg zur Treppe. Sie nimmt den Wodka mit und trinkt im Gehen einen großen Schluck.
Colette läuft ihr nach. »Ich kann jemanden schlagen, bis er kommt. Bei all dem Scheiß, den ich mache, ist das mit Sicherheit ein Kinderspiel.«
»Du denkst, Schmerz ist leicht verdientes Geld? Lächerlich.«
»Sie spritzen doch eher von einer Berührung der Peitsche ab, n’est-ce pas?«, fragt Colette und bleibt Natalia auf den Fersen. Sie passen nicht nebeneinander ins schmale Treppenhaus. »Oder muss man sie dafür richtig blutig schlagen?«
»Manche ja. Aber du musst so schlagen, dass bleiben keine Striemen. Männer haben schließlich Ehefrauen.«
»Ohne Striemen? Also eher kitzeln?«, fragt Colette und wünscht sich, sie hätte ein Blatt Papier von Minnas Block gerissen, um sich Notizen zu machen.
Natalia öffnet die Tür zu Colettes Kammer, ohne die Flasche abzusetzen, und durchsucht einhändig die Kommode neben dem Waschtisch. »Nein. Schlagen. Feste schlagen.«
Sogar die Schlüpfer sind Kante auf Kante gefaltet, Natalia verdreht die Augen, trinkt noch einen Schluck und stellt den Wodka auf der Kommode ab. Sie bringt alles durcheinander und lässt die Schublade halb offen stehen, als sie sich der nächsten zuwendet. Sie trinkt wieder und sucht und findet ihre Leine.
Natalia hält sie hoch, ihr Blick ist gelangweilt davon, dass sie recht hatte und nicht mal lange suchen musste. »Weißt du, warum du nicht könntest?«
»Nein«, antwortet Colette. Sie ist sicher, dass sie alles kann oder lernen kann.
»Du könntest nicht, weil du denkst, dass es nur geht ums Schlagen. Das hier ist tatsächlich Leine. Damit leine ich Männer an.« Natalia geht Gassi mit ihnen oder setzt ihnen einen Sattel auf und reitet sie. Jeder Kunde ist anders, jede Geilheit ist anders. Sie rollt die Leine zusammen. »Und der Grund, warum du nicht könntest, ist: Du respektierst Kunden nicht. Du verachtest sie.«
»Aber genau da stehen die doch drauf.«
»Eben nicht.« Natalia seufzt und trinkt.
»Du hast deine Kunden durchnummeriert, Natalia.«
»Verachtung und Erniedrigung sind nicht dasselbe.« Natalia zeigt mit der gerollten Leine auf Colette. »Und wenn du noch einmal klaust aus meinem Zimmer, dann ich dich nagle an mein Kreuz.«
Natalia geht an Colette vorbei und die Treppe wieder runter. Ihre Stiefel klackern auf dem Holz.
Colette folgt ihr hastig. »Du hast doch gar keine Nägel. Oder?«, fragt sie lachend, aber es klingt hohl. Sie beugt sich über das Geländer. »Und du nagelst auch niemanden fest. Oder? Also nicht richtig durch die Hand. Du bindest die doch nur an. Oder? Natalia? Oder?«
Los Angeles, 1954
Noah legt den Stift ab. Sein Finger ist blau von der Tinte, mehrere Seiten seines Notizbuchs sind vollgeschrieben.
»Ich weiß nicht, was ich mit all diesen Geschichten anfangen soll, Mrs Belle«, sagt er.
Weiß er das wirklich nicht? Hedi stützt ihr Kinn auf die Hand. »Gefallen sie Ihnen nicht, Mister Goldenblatt?«
»Darum geht es nicht. Ich habe den Auftrag, über Ihre Tat zu schreiben. Über Louis Mercier. Mein Chefredakteur will doch nichts über Huren aus Berlin wissen.«
»Sind Sie sich da so sicher?«
»Ziemlich.«
»Verstehe.«
Er lächelt Hedi unsicher an und dreht den Ehering an seinem Finger. Ihre Hände sind schmucklos. Ihr grauer Kittel ist aus Leinen und härter als die gestärkten Tischdecken, die Minna an Feiertagen extra hat mangeln lassen. Das Kleid kratzt, am Schlüsselbein hat Hedi Ausschlag davon, der nie mehr weggehen wird. Außer sie schicken hier mal einen Dermatologen rein, aber warum sollten sie? Todgeweihte Haut braucht keine Cremes. Auf dem Tisch vor ihr liegt die Puderdose. Vielleicht hätte sie Noah in ihrem Brief um eine Creme bitten sollen.
Hedi angelt sich noch ein Rosenblütenblatt aus dem Blumenberg und taucht es ins Ätherglas. Sie knabbert daran. Der beißende Geruch steigt ihr in die Nase. Es ist der beste Geruch der Welt. Er erinnert sie an ihre Jugend und an Berlin. Daran, was Berlin war, bevor es untergegangen ist. Bevor die Lust gestorben und die Freiheit verreckt ist, besonders die der Frauen. Von dem anderen Mist ganz zu schweigen.
Hitler kann zehnmal tot sein, Berlin ist längst nicht da, wo es 1927 war. Auch heute nicht, siebenundzwanzig Jahre später. Schön war es, wild und schön, aber Hedi ist die Letzte, die sagt, dass die Freiheit damals keinen Preis hatte. Und sie haben ihn alle bezahlt: Minna und Colette, Natalia und Hedi. Hedi zahlt noch immer.
Jetzt trägt sie graue Slipper, deren Gummisohlen über eierschalfarbene Fliesen quietschen, wenn sie durch die zugigen Gänge geht, was sie meistens gar nicht darf. Meistens sitzt sie auf einer Pritsche. Ihre Matratze ist mit Lumpen gefüllt, was leichter zu ertragen wäre, wenn sie nie in Seide geschlafen hätte. Je tiefer der Fall, desto härter der Aufprall. Reich sein ist hier drin ein Schicksalsschlag. Pardon, reich gewesen zu sein.
Noah steht auf und zieht das Jackett von der Lehne. Er schlüpft hinein. »Ich muss telefonieren.«
»Sie müssen um Erlaubnis bitten, bei mir bleiben zu dürfen?«
Noah seufzt. »Das sagen Sie nur, um mich zu ärgern.«
»Und es hat funktioniert.« Hedi lässt das angebissene Blütenblatt auf den Tisch zu den anderen fallen. Es segelt nach unten, früher waren ihre Bissspuren an diesen Blüten rot von Lippenstiftresten, heute sind sie nackt.
Er sieht sie genervt an, nimmt seinen Hut und geht zur Tür, durch die er für immer verschwinden könnte. Dort draußen wartet eine ganze Welt auf ihn. Auf Hedi wartet niemand. Nicht hinter der Tür, durch die sie nicht mehr gehen darf, und auch nicht hinter der zu ihrer Zelle. Nicht mal Bert ist noch wirklich fasziniert von ihr. Auch er hat verstanden, dass sie nur ein Mensch ist. Das darfst du die Fans nie spüren lassen.
Es reicht, wenn dein Opfer es weiß.
Das Gesetz
Los Angeles, 1954
Noah kehrt zurück, sein Blick ist noch immer finster. »Ich habe niemanden in der Redaktion erreicht. Zeitverschiebung.«
Er legt seine Zigaretten auf den Tisch und seinen Hut daneben. Hedi nimmt sich eine Zigarette, während er das Jackett auszieht und sich setzt.
»Und was machen wir jetzt?«, fragt sie und zündet sich die Zigarette an.
»Sie können ja erst mal weitererzählen, Mrs Belle.«
»Sie wissen, dass das nur ein Künstlername ist, oder?«, fragt sie.
»Ja.«
»Nennen Sie mich Hedi.« Sie lässt sich von ihrem eigenen Qualm einhüllen. »Und sollten Sie je wieder nach Berlin kommen, schauen Sie für mich in der Mulackstraße vorbei.«
»In der Unterwelt?«
»Halbwelt«, verbessert Hedi.
Noah schüttelt leicht den Kopf. »Warum hängen Sie so an einem verdammten Puff?«
Wenn er wirklich wissen möchte, warum sie so an der Ritze hängt, müsste er Hedi weiter zuhören. Aber das sagt sie ihm nicht. Hedi Belle muss überhaupt nicht viel sprechen, sie kann fast alles mit Blicken ausdrücken. Sie schaut Noah an.
Er seufzt. »Das kriege ich nie bezahlt.«
»Nur Huren kriegen immer alles bezahlt, Noah.«
Er schweigt und schließt die Augen. Es ist nicht einfach für ihn, aber für wen ist es schon einfach? Du musst der Welt immer wieder beweisen, dass du keine Hure bist. Außer du bist eine, dann hast du es in vielerlei Hinsicht leichter.
Noah schlägt sein Notizbuch wieder auf. Hedi bietet ihm eine seiner eigenen Zigaretten an, er greift zu und gibt sich selbst Feuer. All der Rauch färbt die hässlichen Wände grau, es sieht jetzt ein bisschen nach Leben und Feiern aus. Nur ein Hauch Kneipenluft in dieser Eierschalenhölle.
Berlin, 1927
Für jemanden, der nie in einer Kirche war, hat Natalia ihr Zimmer sehr sakral eingerichtet. Der Hurenbock gleicht einem Altar – über dem Zeichnungen von Schuljungen hängen, die mit nacktem Hintern im Klassenzimmer knien und ausgepeitscht werden. Sie tragen Blau wie die Jungfrau Maria und schauen auch genauso unschuldig drein. Natürlich sind sie nicht unschuldig. Wer ist das schon? Der Hurenbock ist ein massiver, kleiner Tisch mit kräftigen Beinen, die auch den fetten Bezirksbürgermeister tragen, wenn er den Arsch versohlt haben will. Er legt seine Wampe auf das dunkle Holz und beugt sich vor, und dann zischt die Peitsche so laut durch die Nacht, dass die kleine Hedwig sie nebenan in ihrem Bett hören kann.
Um den Hurenbock herum stehen Kerzen, deren Wachs Nacht für Nacht kurzen Schmerz auf der Haut von Natalias Kunden hinterlässt. Links neben dem Hurenbockaltar hängen die Leinen und Peitschen, Paddel und Gerten. Der Größe nach sortiert baumeln sie an der Wand. Rechts daneben hängt das Kreuz, es ist mannshoch, mit einer kleinen Emailleschale, die das Blut auffängt. Emaille kann man sehr gut reinigen.
»Enger«, befiehlt Natalia.
»Aber du kannst doch jetzt schon nicht mehr atmen.«
»Hauptsache, ich kann trinken.«
Colette müht sich mit den Ösen und Schnüren ab. »Du wirst noch in die Geschichte eingehen, als die letzte Frau der Welt, die ein corset getragen hat.«
»Enger«, sagt Natalia nur wieder. Sie hält sich mit beiden Händen am Kreuz fest und atmet nicht, während Colette hinter ihr schnürt und keucht.
Minna keucht ebenfalls, als sie ins Zimmer stürmt. Sie baut sich im Türrahmen auf und wedelt mit der Zeitung. »Hurerei ist jetzt erlaubt, Colette?! Ab sofort sind wir legal? Ihr vielleicht. Hast du det mal jelesen?«
»Natürlich.«
»Enger!«, ruft Natalia.
Minna schnaubt vor Empörung und Erschöpfung und spricht weiter. »Ihr Huren könnt euch registrieren lassen und straffrei eurem Jewerbe nachgehen. Aber Kuppelei ist immer noch verboten. Und weißt du, wat hier steht?«
»Colette, ich bin nicht aus Zucker, zieh an den Schnüren endlich!«, verlangt Natalia.
»Oui, warte …«, sagt Colette, zieht, dass die Schnüre ihr in die Finger schneiden, und rutscht ab. »Au!«
»Nicht loslassen, verdammt!«, schimpft Natalia und sieht Colette kopfschüttelnd an. »Amateurin.«
»Dann mach deinen Scheiß doch allein.«
»Hedwig!«, ruft Natalia.
Das Mädchen steht hinter Minna auf dem Flur und hat Mühe, an ihr vorbei in Natalias Schmerzkathedrale zu schlüpfen. Das hier ist viel besser als der Spielplatz. Es ist eigentlich auch ein Spielplatz, nur dass er aufregend ist und keinen Sandkasten hat. Sandkästen sind für Babys.
Colette schüttelt ihre schmerzende Hand und streckt sie dann in Minnas Richtung aus. »Gib mir die Zeitung.«
Minna hält ihr das Blatt vor die Nase. »Hier steht: ›Als Kuppelei gilt insbesondere die Unterhaltung eines Bordells oder eines bordellartigen Betriebes.‹ Also det, wat ick mache. Verboten. Det ist aus dem Jesetz zitiert. Wort für Wort.«
Das Kind quetscht sich derweil ins Zimmer und strahlt Natalia an.
»Hedwig, endlich.« Natalia strahlt zurück, die losen Schnüre ihres Korsetts in der Hand. »Rybka, kannst du das bitte machen richtig?«
Rybka ist russisch. Es bedeutet Fischchen. In Natalias Augen gibt es nichts Schöneres, als ein kleiner, silberner, kalter Fisch zu sein. Und Hedwig hat so tolle große Augen. Graue Fischaugen. Natalia liebt sie sehr. Manchmal formt sie ihr kleine Blumen aus Wachsresten. Hedwig hat sie alle in ihrem Zimmer auf der Fensterbank stehen. Ihr Zimmer geht nach Norden raus, das Wachs schmilzt nie. Auch nicht im Hochsommer. Abgesehen von den Blumen ist Hedwigs kleine Kammer langweilig. Es passt kaum mehr als ein Bett rein. Sie ist lieber hier bei Natalia.
Hedwig betrachtet die Schnürung an Natalias Rücken und schüttelt den Kopf. »Wer hat das denn eingefädelt?«
»Colette.«
Die Kleine seufzt. »Miserable Arbeit.«
Colette nimmt Minna die Zeitung weg und schlägt Hedwig auf den Hinterkopf. »Frauen sollten sich überhaupt nicht einschnüren, Mademoiselle. Das ist Unterdrückung. Und außerdem ist es furchtbar unmodisch.«
Minna ringt die Hände. »Ick muss schließen. Ick werde schließen müssen. Die Ritze wird die Schanklizenz verlieren. Ick werde allet verlieren.«
»Einatmen«, sagt Hedwig zu Natalia, und die wendet sich mit angehaltener Luft an Minna: »Warum? Die Ritze war gestern Kneipe, und sie ist heute Kneipe. Offiziell machen wir hier oben gar nichts, außer schlafen.«
Hedwig kichert, denn sie weiß ganz genau, was hier nachts passiert. Sie ist kein Baby mehr. Sie kennt sich aus.
»Mhm, ja«, sagt Minna zynisch und funkelt Colette an. »Det könnte funktionieren, außer natürlich unser französisches Fräulein Jesetzestreu hat sich bereits beim Amt gemeldet und dieses Haus hier als ihren Arbeitsort angegeben.«
»Oh«, macht Natalia. Sie sieht beunruhigt aus. Vielleicht liegt das aber auch nur an der Atemnot. Hedwig schnürt sehr gut.
»Und als wüssten die Bullen nicht sowieso, wat hier passiert«, wettert Minna. Sogar die Schweißperlen auf ihrer Stirn scheinen in Panik zu sein, sie laufen ganz schnell. »Wenn die wollen, dann muss ick nicht bloß schließen, dann steh ick vor Gericht. Dann muss ick ins Zuchthaus. Det Jesetz wird mir ruinieren. Und wat mach ick dann mit Hedwig?« Sie zeigt auf das kleine Mädchen. »Soll sie zu ihrer Nutte von Vater? Da kann ick sie ja gleich umbringen.«
Hedwig starrt Minna fassungslos an. »Was?«
»Nicht hinhören«, sagt Natalia zu ihr. »Minna ist gerade nicht sie selbst. Ich werde mich immer kümmern um dich, Rybka. Immer.«
»Und wer kümmert sich um mich, wenn ick im Arbeitslager sitze?«
»Jammern steht dir nicht, Minna.«
Colette schlägt die Zeitung zusammen. »Das ist schlecht zusammengefasst. Außerdem fehlt eine entscheidende Information.«
»Ja? Welche? Det Bordellbetreiber an den Pranger jestellt werden? Det sie den für uns extra wieder einführen?«
»Ich hab noch einen«, sagt Natalia und zeigt unter ihr Bett. »Da unten.«
»Nicht witzig!«, zischt Minna.
»Minna, der Zusatz zu Paragraph 180 gilt nicht für Frauen«, erklärt Colette. »Frauen, die Bordelle betreiben, gelten nicht als Kupplerinnen.«
»Wat?«, fragt Minna.
Colette nickt. »Oui, sie wollen den Alphonses und Fiesels den Garaus machen. Nicht den Frauen. Weil les femmes gleichberechtigt werden müssen und eh nicht so grausam sein können.«
Minna sinkt auf Natalias Bett. »Dann ist die Ritze sicher?«
»Ja. Wir sind jetzt alle anerkannte Geschäftsfrauen. Mehr oder weniger. Ihr müsstet euch nur noch reg…«
Minna unterbricht Colette. »Die Ritze ist sicher«, jubelt sie. »Die Ritze ist sicher!«
»Darauf sollten wir anstoßen«, schlägt Natalia vor.
»Darf ich auch?«, fragt Hedwig.
»Ja«, sagt Natalia, und Minna sagt gleichzeitig: »Nein.«
Überall in Berlin sind die Häuser riesig. Fünf Stockwerke in Charlottenburg und fünf in Pankow. Zwei, manchmal drei Hinterhöfe. Im Scheunenviertel aber sind es höchstens drei Stockwerke, eher zwei. Die Mulackstraße ist niedrig bebaut und schmal, zwei Autos können gerade so aneinander vorbeifahren. Das Kopfsteinpflaster ist dreckig, die Fassaden sind schmucklos. Und inmitten dieser engen, schlichten und dreckigen Straße steht die Ritze und ist noch schmaler, schmuckloser und schmutziger – und stolz darauf.
Minna steht am anderen Ende der Straße vor einem Lokal, das sich Hundegustav nennt. Sie trägt einen Glockenhut und hält einen Einkaufskorb in der Hand. Sie redet auf ein paar Frauen ein, die unter ihren Mänteln wenig Kleidung tragen.
»Jedenfalls habt ihr nur Vorteile davon. Glaubt mir. Ist nur’n kurzer Gang zur Behörde. Kleinigkeit. Wat zu rauchen? Du? Na, wer nicht will, der hat schon«, sagt sie und zündet sich einen Zigarillo an. Das sei eine politische Sache, und das sei gut für alle Frauen. Sie meint vor allem Kitty. So wie die sich immer an der Möse kratzt, müsste sie eh dringend mal einen Arzt aufsuchen.
Minna raucht und schaut auf Kittys Hände. »Herrgott, Mädchen, jetzt lass doch mal die Finger vonner Pussy, wir stehen mitten auf der Straße. Jedenfalls musst du jetzt keine Anzeige bei der Sitte mehr fürchten, wenn du einforderst, wat dir zusteht: ärztliche Behandlung. Ick rede hier von …«
»Minna.« Gustav steht plötzlich in der Tür seiner Kneipe und schneidet ihr das Wort ab. Er hat die Hemdsärmel aufgekrempelt. An seinem rechten Hosenträger baumelt ein Küchentuch. Minna mustert seinen Bauchansatz und den Schnurrbart. Er ist so grau wie ihre Haare.
»Rein mit euch, Mädchen!«, sagt Gustav. »Wat steht ihr hier draußen rum in den dünnen Fetzen? Ihr werdet mir noch krank und steckt alle Kunden an.«
Verglichen mit der Ritze ist der Hundegustav riesig. Die Hurenstuben sind richtige Zimmer, und er hat acht davon. Drei neben der Kneipe und fünf in der Wohnung im ersten Stock. Es gibt sogar Stuck. Minna hat eine Hurenstube und eine Hurendachkammer. Stuck kann sie sich nicht leisten, so leid es ihr tut.
Gustav klemmt die Daumen unter seine Hosenträger und baut sich vor Minna auf. »Biste unter die Politiker gegangen?«
»Mir geht’s um die Frauen. Um uns alle«, sagt sie und pustet ihm Rauch ins Gesicht.
»Willste mir nicht auch wat zu rauchen anbieten?«
»Nein.«
»Wenn det der Kaiser hören würde, wie du hier die neue Zeit lobst.«
»Dem würd ick Colette auf den Schoß setzen, und dann wär der so schnell überzeugt, so schnell kannst du nicht mal deinen traurigen Versuch von nem Kratzfuß machen.«
Gustav grunzt. »Der Kaiser würde den Kammerdiener seines Kammerdieners nicht in deine Dreckshöhle lassen.«
»Interessant. Wo ick doch damals jenau den zwischen meinen Schenkeln hatte.«
»Den Kammerdiener des Kammerdieners?«
Sie verdreht die Augen. »Nein, den vom Kaiser, Justav. Ick hab auch Standards.«
»Und jetzt ist deine Muschi alt und vertrocknet, und du könntest keinen Pfennig mehr mit ihr machen.«
»Meine Rede seit Siebzig.« Sie untermalt ihre Worte schwungvoll mit ihrem Zigarillo. »Ick bin jetzt Geschäftsfrau. Mit politischen Interessen.«
»Ha!« Er lacht und reißt den Mund auf. Seine dicken Backen zittern, sein Schnäuzer steht wie eine Eins, kein Haar bewegt sich. »Politik interessiert dich’n Scheiß. Dich interessiert nur, det einzige Bordell inner Mulackstraße zu sein.«
»Wat soll ick tun, Justav?« Minna schmunzelt. »Von Männern betriebene Häuser sind nun mal ab jetzt verboten. Es ist det Jesetz, die neue Zeit. Wir müssen alle mit der Zeit gehen.«
»Du hasst die neue Zeit.«
Minna raucht und lächelt. Sie hasst die neue Zeit nicht. Sie will nicht noch mal jung sein. Sie freut sich über jede Falte, die wie ein kleiner Schutzwall gegen die Blicke der Männer ist. Falte für Falte sehen die weniger hin. Und für jede Mark mehr, die in ihrer Geldkassette landet, hören sie ihr besser zu. Das ist Macht.
»Justavchen«, säuselt sie, »sollte die Polente durch die Registrierung eins deiner Mädchen drauf gestoßen werden, det du dich der Kuppelei schuldig machst, dann kann ick dafür doch nüscht.«
Er fixiert sie. »Hältst du mich für bescheuert?«
»Aber ja. Ist det in den letzten zehn Jahren nicht deutlich geworden?«
»Verschwinde.«
»Vonner Straße? Werd mal nicht größenwahnsinnig, Justavchen. Die Straße jehört dir nicht.« Minna zeigt mit ihrem Zigarillo die Mulackstraße hoch und runter, ihr Handgelenk tanzt dabei. »Jenau jenommen jehört dir ja nicht mal dein schlecht vergoldeter Fickschuppen. Du hast den Hundejustav nur jemietet.« Sie seufzt. »Steht alles auf so wacklige Beene, nicht wahr?«
Er löst einen Daumen aus dem Hosenträger, das Gummi schnalzt zurück und prallt gegen seinen Bauch, während er ihr den Zeigefinger unter die Nase hält. »Hör mal zu, du dreckige Schlampe. Du stehst hier gleich auf wackligen Beinen, wenn du dir nicht verpisst. Hier ändert sich gar nichts.«
»Det werden wir ja sehen. Jetzt muss ick erst mal den Champagner kühlen. Als Frau hat man heute schließlich wat zu feiern!«
Im Weggehen hört sie, wie er ihr nachruft: »Mein Kratzfuß ist perfekt!«
Sie winkt ihm, ohne sich umzudrehen. »Genieß die Nacht, Justav. Wer weiß, wie viele du in diesem Jewerbe noch hast …«