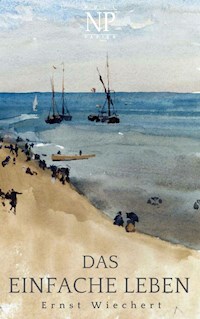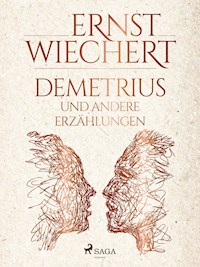Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Recht muss Recht bleiben auf der Welt... Der kleine Johannes hat kein leichtes Leben. Er leidet unter seinem jähzorningen Vater, der seine Mutter schlägt und drangsaliert, und seinem Stiefbruder Theodor. Er flüchtet sich in Träumereien, ist verschlossen und findet Trost in der Natur. Doch Johannes ist ein guter Schüler und findet schließlich seine Berufung...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Wiechert
Die kleine Passion - Geschichte eines Kindes
Saga
Die kleine Passion - Geschichte eines Kindes
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1929, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726927368
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
1
Der Pfarrer sagte, daß Gott sie zusammengefügt habe. Pfarrer pflegen das allerorten zu sagen, und Gottes Meinung oder Wille pflegen sich viel später zu offenbaren, etwa bei den Kindern oder gar bei den Kindeskindern, im dritten und vierten Glied. Mitunter bricht die Offenbarung aus wie eine Flamme aus einem nächtlichen Dach, weithin leuchtend und erschreckend. Mitunter ist sie nur ein rätselhaftes Lächeln am Tage der silbernen Hochzeit, eine Träne bei einem Lied aus der Jugendzeit, eine nicht gelöschte Falte in einem Antlitz auf dem Kissen des Sarges.
Aber hier meinten schon die Menschen jener Landschaft, daß der Pfarrer das nicht hätte zu sagen brauchen. Denn der Bräutigam habe einfach eine feine Nase gehabt, und ob sie von Gott sei, könne auch der Pfarrer nicht wissen. Und Ottomar Karsten, der Bruder des Brautvaters, Großbauer aus der Niederung, saß streng und aufrecht im Kirchenstuhl und sah mit jener schweren Unbestechlichkeit auf das junge Paar, mit der er auf ein Paar Wagenpferde zu blicken pflegte, ob es Passer seien oder nicht. Er sagte nichts und verzog keine Miene, aber seine Augen hoben sich über das freundliche Gesicht des Geistlichen hinaus wie über einen weiten Acker, und es war nicht alles gut, was er auf diesem Acker sah.
Der weite Blick war ein Erbgut der Karstens. Nicht etwa, daß er nach dem Zeitpunkt voraussah, wo man den Weizen am besten verkaufte oder wo man am besten zufaßte, um einen Acker, einen Wald, ein Grundstück zu erwerben. Sondern es war ein Blick, der sich nicht an der Erscheinung genügen ließ, an der Form des Seienden. Er ging rückwärts bis ins Graue und vorwärts bis ins Dunkle. Die Kinder pflegten ihr Spielzeug auseinanderzunehmen und grübelnd davorzusitzen. Die Greise pflegten das Leben der Menschen und vor allem ihr eigenes auseinanderzunehmen. Und beide versuchten es anders wieder zusammenzusetzen, als es gewesen war. Denn ihre Ideen von den Menschen und Dingen waren anders als die Ideen Gottes oder der Fabriken.
Sie waren von der Nordsee gekommen und saßen nun in dieser Landschaft auf Einzelhöfen. Sie waren alle noch ein wenig fremd, mit der Gemessenheit ihrer Sprache und ihres Ganges, mit der Strenge ihres Christentums und der Unbestechlichkeit ihres Denkens. Ihre Söhne gerieten gut, und die Bewegtheit und Aufgeschlossenheit der Landschaft und des neuen Blutes, in das sie durch ihre Heiraten wuchsen, schien die Starre ein wenig zu mildern, in die ihre Wurzeln noch immer tauchten. Aber was sie hingaben, schienen die Töchter wie in einer dunklen Schale zu sammeln und zu bewahren, als ob eine streng messende Hand über dem Erbgut wachte und wohl eine Verteilung zuließ, aber keine Vergeudung. In diese Schale tropfte als schweres Blut, was bei den Söhnen als ernste Frucht im Lebensbaume wuchs. Gefaßtheit wurde zu Entsagung, die Weite des Blickes wendete sich nach innen und wandelte sich zum Tiefsinn, Schwerfälligkeit wurde zum Unbeholfenen, Rechtlichkeit zum Empfindlichen einer überzarten Waage, und die leise Linie der Trauer um die festen Lippen jener bebte bei ihnen um die Demut ihres Mundes und gab ihren Gesichtern das Rührende hilfloser Kinder und die wehe Abgeschiedenheit enttäuschter Frauen. Sie waren nicht wehende Birken, um deren Stamm man im Übermut Hände des Tanzes legen konnte, sondern gleich den dunklen Bäumen, unter denen man niedersaß, um einem hohen und leisen Rauschen zu horchen, aus denen eine sanfte Trauer floß und an deren kühle Rinde man die Wange legte.
Die Menschen sagten von den Karstentöchtern, daß sie kein Glück hätten. Vielleicht hätten sie Geistliche heiraten sollen, in Gemeinden, in denen die wunden Seelen in der Mehrzahl waren. Oder einen jener Dorfschullehrer, die wie einsame Kerzen leuchteten und verbrannten, an nicht erfüllter Menschenliebe, an einem ewig stümperhaften Geigenspiel, an nie gedruckten Gedichten. Aber es war, als ob eine dunkle Hand sie unwiderstehlich hinwegschiebe von Scholle und Stille, in die kleinen Städte jener armen Landschaft, in die kümmerliche Enge kleiner Beamtenheime, auf verlassene Kleinbahngeleise sozusagen, über denen eine müde Lampe schwelte und der Rost unendlicher Nebeltage. Sie gebaren Kinder, in denen das edle Gut ihres Geschlechtes versank und über deren Gesichter sie sich beugten wie ein Künstler über den Gipsabguß eines edlen Marmors. Sie waren demütige Frauen, aber die Schmach ihrer Demut war, daß sie ihre Stirnen neigen mußten vor dem, was geringer war, und die Männer aller Karstentöchter waren geringer als sie selbst. Sie neigten sich vor dem Geiz wie vor der Vergeudung, vor der Beschränktheit muffiger Sittlichkeit wie vor der Frechheit der Schamlosen, vor dem Bohrer der hämischen Nörgler wie vor der Peitsche der Tyrannen.
Und einmal vor ihrem Tode suchten sie den Hof der Kindheit noch einmal auf. Sie überwanden mit ihrer letzten Lebenskraft ein dumpfes Gefühl der Scham und sprachen von ihrem Leben wie von einem ruhigen Strom mit festen Brücken. Aber ihre Augen glitten mit einer schweren Zärtlichkeit über den dunklen Hausrat ihrer Jugendtage, über die Wiesen und Felder, die Herden und Gespanne. Und um den Feierabend saßen sie auf der Ofenbank, ein Tuch um die frierenden Schultern, und baten, daß man erzähle, alles erzähle, »alles was gewesen sei, von jenem Tage ab …«
Sie kamen immer allein, ohne Mann, ohne Kind, und wenn sie wieder fortfuhren, sahen sie sich um, solange die Ahornwipfel zu sehen waren, und dann setzten sie sich zurecht und falteten ihre Hände wie nach einem Abendmahl.
Alle Karstentöchter hinterließen ein Testament. In ihm wurde nicht nur über jedes Stück verfügt, das ihnen erb- und eigentümlich zugehörte, sondern es enthielt immer einen Abschnitt, in dem sie eine innere Rechenschaft ablegten, mitunter nichts als ein paar Sätze – »Ich habe ein schweres Leben gehabt. Gott verzeihe mir und meinen Bedrückern!« –, mitunter eine ganze Beichte. Es war, als hätten sie im Tode erkannt, daß sie nun genug geschwiegen hätten und daß sie dem Geschlecht der Karstens, das in ihnen mißhandelt worden sei, schuldig seien, noch in der Tür sich ein wenig umzuwenden und zu zeigen, daß auch sie einen tapferen Kampf gekämpft hätten.
Und alle Karstentöchter bestimmten den Friedhof ihres Hofes als ihre letzte Ruhestätte. Zu ihren Begräbnissen pflegte sich eine Reihe seltsamer Menschen zu versammeln, die abseits der Familie standen, mit ernsten, mitunter verzweifelten Gesichtern: irgendwie Geschlagene und Entehrte, Verirrte und Verurteilte. Da war keine Grenze des Lebensalters, des Geschlechtes oder Standes, nur eine dumpfe Gemeinsamkeit eines unerhörten Verlustes. Niemand kannte sie oder wußte um ihre Verbundenheit mit der Toten, aber jedesmal gingen der Bauer und die Bäuerin nach der Feier zuerst zu diesen Gesandten unbekannter Reiche, gaben ihnen die Hand und dankten ihnen voller Achtung für die Ehre, die sie der Toten erwiesen hatten.
Und dann wurde in die Familienbibel Kreuz und Todestag gesetzt und über das erloschene Leben der Vorhang gezogen. Von Mann und Kindern war nichts verzeichnet. Sie traten hinter ihre Grenzen zurück. Ihr Name war ein Schall und ihr Sein ein Schatten des Gewesenen.
Gina Karsten, von der der Pfarrer soeben gesagt hatte, daß Gott sie mit ihrem Verlobten zusammengefügt habe, unterschied sich in nichts von den schmerzenreichen Vorfahren ihres Blutes. Nur war es, als habe die Natur, am Ende einer langen und gleichmäßigen Reihe des ernsten Bewahrens müde, der Lust zum Spiel ein wenig nachgegeben und an Kleid und Gebärde geändert, was dem Unabänderlichen keinen Abbruch tun konnte. Sie gab dem Kinde schöne, schmale Hände, die der Bauer ratlos in den seinen hielt und mit denen Gina zu spielen liebte als mit einem seltsamen Geschmeide, das ein fremder Gast im Hause zurückgelassen hatte. Sie versagte ihr das Geschenk der Tränen, so daß von Kind an nichts als ein trockenes Schluchzen ihren schmalen Körper erschütterte, wenn der Schmerz an seine Tore klopfte, und sie gab ihr als einen lächelnden Ausgleich eine seltsame Verschiedenheit in der Färbung ihrer ernsten Augen. Das rechte war von einem hellen Blau, geheimnisvoll schimmernd wie ein Opal, wenn es sich zum blauen Himmel aufschlug, das linke von einem sanften Braun, immer ein wenig umschattet und in sich selbst ruhend, als bedürfe es der Bilder der Welt nicht. Dies Spiel der Natur, weit davon entfernt, lächerlich oder als eine krankhafte Entartung zu wirken, gab ihrem strengen Gesicht eine rätselhafte Unergründlichkeit, schied sie von den Menschen aus auf eine besondere Straße, quälte sie durch Fragen und Verwunderung, die sich daran knüpften, und gab ihrem Blick jenes Scheue und zur Erde Gerichtete, mit dem sie durch das Leben ging.
Sie wuchs so still in sich auf wie eine Blume. Man sah, daß sie blühte, sich öffnete und verschloß. Aber sie bot nichts dar als ihr Dasein, Farbe und Duft und eine sanfte Wendung zur Sonne. Wenn das welke Laub auf ihrem dunklen Scheitel lag, wußte man, daß sie im Walde gewesen war. Wenn Erde an ihren Schuhen war, wußte man, daß sie hinter dem Pfluge hergegangen war. Wenn sie hinter dem Ofen kauerte, mit zitternden Schultern, die Hände vor den trockenen Augen, wußte man, daß sie litt. Aber mehr wußte man nicht, und es war der Segen ihrer Kindheit, daß man nicht zu wissen verlangte. Sie brauchte keine Gedichte aufzusagen und keine Märchen zu erzählen, seit sie ihre Hände in Qualen gefaltet hatte. In ihrem Bett war immer ein Tier: ein Hund, eine Katze oder ein junges Reh. In ihren Büchern lag immer ein Zeichen, und die Mutter ging mitunter mit sehr stillen Augen fort, wenn sie hineingesehen hatte. Sie liebte nicht, Gemeinsames zu tun in einem großen Kreise, selbst nicht in dem der Familie. Aber sie liebte es, ein paar Schritte hinter dem Vater herzugehen, wenn er über die Felder ging, stumm, einen Grashalm in den Händen. Er wußte, daß sie da war, und von Zeit zu Zeit wandte er sich um und nickte ihr schweigend zu. Beide waren es so zufrieden.
In ihrem zwanzigsten Jahr sah man sie zuweilen mit dem jungen Lehrer des Nachbardorfes über die Felder gehen. Er war ein froher, fast knabenhafter Mensch, mit vielerlei einfachen Begabungen, der seine Augen etwas zu viel um sein eigenes Leuchten spielen ließ. Er wußte wahrscheinlich gar nicht, daß er sein Wesen und seine Worte nicht in ein freundliches und teilnehmendes Schweigen, sondern in ein heiliges Schweigen warf. Er bedurfte nur eines vielfachen Echos, ohne sich sonderlich um den Wald zu bekümmern, der es zurückwarf. Und als die Leute gerade ein wenig zu reden begannen, verlobte er sich mit der Tochter vom Nachbarhof. Gina kauerte nicht mehr im Ofenwinkel. Sie zeigte keine Veränderung, nur lehnte sie es ab, an der Hochzeitsfeier teilzunehmen. Als sie hinter ihrem Vater an dem Weizenschlag entlang ging, der vom Hagel etwas gelitten hatte, beugte sie sich über die hellen Flecken an den getroffenen Halmen und sagte über das Feld hinweg: »Er wird es überwinden, Vater …« Er strich mit der Hand behutsam über ihr dunkles Haar. »Ja, Gina«, erwiderte er. Und dann war es gut.
Fünf Jahre später tauchte Albert Zerrgiebel in ihrem stillen Leben auf. Man mußte von ihm sagen, daß er auftauchte wie ein Maulwurf in einem dämmernden Garten. Leise und unheimlich hob sich die Erde über ihm, ein kurzes, bedrückendes Schweigen, und dann war er da. Sie nahm sofort Anstoß an seinem Namen. Die Karstens hatten etwas Herbes und Stolzes im Klang ihres Namens, etwas, das an einen Spaten und ein steiniges Feld erinnerte, in das er blitzend stieß. Aber das war etwas Zerreißendes, Krankes und Verzerrtes, das noch verstärkt wurde durch die weichliche Formlosigkeit des Vornamens. Er hatte durch den Gendarm sagen lassen, daß er sich einmal »die Ehre geben« wolle, da er an seinem Witwertum schwer leide. Dietrich Karsten, der Vater, hatte den Überbringer schweigend angesehen und dann gesagt: »Merkwürdig, was jetzt alles Ihres Amtes ist.« Weiter wurde nichts gesprochen.
Aber schon am nächsten Tage nach dieser seltsamen Ankündigung erschien er. Plötzlich, wie ein Maulwurf, stand ein Mann mittleren Alters auf der Hofstätte, in einem grünen Lodenmantel und weichen Filzhut, mit hohen Stiefeln und Knotenstock, als habe er es für zweckmäßig gehalten, sich in seiner Kleidung ein wenig dem Lande anzupassen, dessen Grenzen er überschreiten wollte. Aber es war irgendwie ein leiser Widerspruch zwischen seinem Kostüm und seinem Gesicht, ein sozusagen theatralischer Widerspruch, der Spott oder Unbehagen herauszufordern angetan war. Denn es war, was man ein Bürogesicht nennen konnte, nicht nur in seiner Blässe und leichten Dumpfheit, die einen Widerschein von Tinte und Aktenstaub zu enthalten schien, sondern auch in der schiefen Ergebenheit des Blickes, der sich ständig nach einer unsichtbaren Türe richtete und bereit war, einen abweisenden, fast tauben Hochmut zu zeigen, sobald es nur »Publikum« war, das durch die Türe eintrat. Und der hochgebürstete blonde Schnurrbart stand wie ein Etikett in diesem Gesicht, war sozusagen hineingeklebt von einer gleichgültigen, überlegenen Hand, die keine andere Aufgabe hatte, als Registraturvermerke aufzunehmen und den Träger dieses in einem ewigen Schubfach unterzubringen.
Eine stille Resignation schien von der Krempe seines nicht mehr ganz neuen Filzhutes über seine Schultern herabzufließen und ihn wie ein Mantel einzuhüllen. Aber durch die Ritzen dieses Mantels flogen sehr schwache Blicke zu den Dingen der Welt, zu den offenen Türen der Ställe, den Strohschobern, den Ackergeräten, so daß ein Hauch der Verschwörung ihn zu umwittern schien, als trage er Waffen unter seinem harmlosen Kleid und man wisse nicht, wohin sie zielten.
Es stellte sich heraus, daß er zunächst eine Kuh kaufen wollte. Die Karstensche Herde, das sei im ganzen Kreise bekannt, und so weiter. Wozu er sie denn brauche? Zum Milchgeben natürlich. Milch sei von Jugend an seine Begeisterung gewesen – er sagte: sein Ideal –, und da er ein Siedlungshaus besitze, dicht am Bahnhof und am Staatsforst, Herrn Karsten sei das ja bekannt, er habe ihn oft genug vorübergehen sehen, einen echten Sohn dieser Landschaft, und auch ein Stall dazugehöre, so sei er dem Gedanken nähergetreten. Er habe bereits eine Kuh besessen, aber als seine Frau gestorben sei, habe er sie verkauft. Er habe es einfach nicht ertragen, den klagenden, sozusagen menschlichen Blick dieses Tieres jeden Morgen auf sich gerichtet zu fühlen, den Blick, der zu fragen schien, wo denn die Herrin des Hauses bleibe.
Der Handel wurde abgeschlossen und Herr Zerrgiebel höflich zum Kaffee gebeten. In dem Gespräch, das er sorgfältig, behutsam und mit leicht ergriffener Aufgeschlossenheit führte, stellte sich Weiteres heraus. Er war Gerichtssekretär in der Kreisstadt, wie er leicht beleidigt versicherte, eine geachtete Stellung, durchaus geachtet. Die Verantwortung sei groß, denn der Amtsrichter, nun, man kenne ja diese studierten Herren, die Praxis fehle eben doch und die Kenntnis des Gesetzbuches allein mache es auch nicht. Er könne wohl sagen, daß die Urteile der letzten zehn Jahre gewissermaßen von ihm gesprochen worden seien. Das Siedlungshäuschen, ja, das habe er erworben, weil die Stadt ihn töte, Menschen, dumpfe Luft und so weiter. Und wenn man Tag für Tag im Elend und der Zuchtlosigkeit der Menschheit herumwühle, sei es gut, zu Gottes schöner Natur zurückzukehren, wo die Bäume in die Fenster rauschten und der Kuckuck von der Jugend riefe.
Bei diesen verständigen und wohlgesetzten Ausführungen richtete er seine trüben, nahe zusammenstehenden Augen unverwandt auf Gina, und es konnte niemandem entgehen, daß ein froher, fast verklärter Schimmer auf seinem matten Gesicht stand, gleich dem Widerschein einer fernen Sonne auf einem blinden Fensterglas.
Gina hörte zu und schwieg. Nur einmal hob sie ihre seltsamen Augen zu seinem Gesicht und sagte leise: »Bitte, müssen Sie das tun?« Es hatte Herr Zerrgiebel nämlich die peinliche Gewohnheit, ab und zu seine langen und sehr knochigen Finger auf eine unangenehme Weise ineinander zu verflechten und eine Reihe knackender Geräusche hervorzubringen, als breche er Glied für Glied einzeln auseinander. Dann legte er alle zehn Fingerspitzen sorgfältig zusammen und betrachtete sie liebevoll, als wolle er sich ihres unversehrten Zustandes versichern.
Er errötete ein wenig bei Ginas Worten, und eine kleine Querfalte, schnell gelöscht, war zwischen seinen spröden Augenbrauen erschienen. »Verzeihen Sie«, sagte er demütig, »eine Unsitte meiner Einsamkeit, eine stumme Bitte zu Gott gewissermaßen, wenn in den Akten die Abgründe der Menschen sich vor meinen erschütterten Augen enthüllen …«
Und dann empfahl er sich zu passender Zeit, dankte für die außerordentliche, ihn mit einer gewissen Hoffnung erfüllende »Loyalität« beim Abschluß ihres Geschäftes, für die so freundliche Aufnahme und die schöne Stunde in einem so harmonischen Familienkreise, die, ja, man müsse sagen, wie eine Art Balsam in die Wunden seines Lebens geträufelt sei. Daß Herr Karsten ihm die Kuh zuführen lassen wolle, finde er besonders taktvoll. Er brauchte genau dieses Wort.
Als er in der Tür stand, drehte er sich noch einmal um, nahm das Bild des dunkelnden Raumes noch einmal andächtig in sich auf, nickte Gina fast vertraulich zu und verabschiedete sich mit der etwas rätselhaften Wendung: »Nun … vielleicht … man kann nie wissen …«
Gina stand am Fenster und sah ihm nach. Der Lodenmantel wehte im Winde, der Knotenstock schwang unternehmend in der Luft, und der Atem eines neuen Glückes schien seine Füße zu beflügeln.
Von diesem Tage ab erschien Zerrgiebel in bescheidenen Abständen auf dem Hof der Karstens. Es lagen immer zwingende Gründe vor, und die gekaufte Kuh entwickelte eine solche Fülle problematischer Eigenschaften, daß er nie fertig werden konnte, um einen Rat zu bitten. Man glaube, pflegte er sinnend zu sagen, solch eine Kreatur sei nichts als ein dummes Tier, aber sie sei wie ein Mensch, geradezu wie ein Mensch, und er hätte schon drei Aktenbündel von ihr schreiben können.
Wenn er mit Gina allein blieb, was sich ab und zu ergab, sprach er von seiner Seele, dem Heiligsten, was Gott dem Menschen gegeben habe, und wie sie Leid trage um das Leere der Zukunft. Gina sah ihn dann von der Seite mit ihren Augen an, über deren Seltsamkeit er aufgehört hatte, begeisterte Bemerkungen zu machen, sobald er ihr Unbehagen erkannt hatte. »Ist das alles wahr?« fragte sie einmal, und die Mühe, hinter die Riegel seiner Seele zu kommen, erfüllte ihr Gesicht mit dem Ausdruck eines körperlichen Schmerzes. Zerrgiebel war verletzt, beteuerte, beschwor, und schließlich führte er mit tragischer Gebärde sein Taschentuch vor die Augen. Schreck, fast Entsetzen malte sich in ihren Zügen, und ohne ein Wort der Erwiderung oder des Trostes wandte sie sich und ging nach dem Hofe zurück.
Es war nicht gut, daß Ginas Mutter tot war, und für das Kauern im Ofenwinkel war sie nun zu groß. Mitunter saß sie am Küchenherd, wenn die Großmagd die Abendsuppe kochte. Der große Raum war dunkel, und nur der rote Schein des Feuers spielte lautlos mit dem Leben der Wände. Es war, als begrabe sich hier friedenvoll der laute Tag und um das Haus wüchsen nun die Wächter der stillen Stunden schweigend aus den Schatten der Bäume. Um diese Zeit löste sich unmerklich die kalte Angst in Ginas Herzen. Sie faltete die schönen Hände in der roten Glut, schob die Füße unter den warmen Körper des Hundes und blickte müde, aber ohne schwere Trauer in das Spiel der Flammen. Es würde nun nichts mehr kommen, Zerrgiebel nicht und der lange, leere Lauf der Tagesstunden, nicht der sorgenvolle Blick des Vaters und nicht die beglänzte Weite der Landschaft, aus der sich nichts erhob als die Gestalt des Briefträgers, ein ackerndes Gespann oder ein dunkler Krähenschwarm. Aus der Wohnstube klang der Schritt des Vaters herüber, das Vieh brüllte in den Ställen, und nach hundert Jahren um dieselbe Stunde würde es ebenso sein. Nur die Menschen würden andere sei, aber das Ewige und ganz Ruhige war ja außerhalb der Menschen.
»Jetzt gehen die Sterne auf, Margret«, sagte sie leise.
»Ja, Gina.«
»Es müßte immer Abend sein, Margret. Die Menschen sind dann alle besser, stiller, und man sieht ihre Gesichter nicht mehr so deutlich. Und die Tiere gehen schlafen und die Sterne sind so freundlich. Gott ist viel näher als am Tage.«
»Ja, Gina. Wer müde ist, der ist immer gut.«
»Glaubst du … glaubst du, daß er auch müde wird am Abend?«
Schweigen.
»Sag es, Margret.«
»Er spricht ja wohl ein bißchen viel, Gina …«
»Ja, schrecklich viel … er ist wie das Schilf am Graben, weißt du.«
»Die aus der Stadt, Gina, die sind eben anders. Das machen die vielen Fenster und die Steine. Aber auch da gibt es ja Gute.«
»Glaubst du … glaubst du, daß er weinen kann, Margret?«
»Ja, das ist so eine Sache, Gina. Der Bauer, wo ich früher war, der war aus Stein, und die Leute nannten ihn den Würger! Der hatte einen Prozeß mit dem Großknecht, weil er ihm Lohn einbehalten wollte. Er wurde verurteilt, und wir waren alle als Zeugen auf dem Gericht. Und als er die fünf Taler bezahlen mußte, da weinte er. Vor allen Leuten. Das ist so eine Sache, Gina. Und du weinst ja auch nicht?«
»Ich weine viel, Margret, aber ohne Tränen.«
»Das ist ein schweres Leid, Gina.«
»Ja.«
»Manchmal will Gott etwas von uns, Gina, und wir verstehen es bloß nicht. Dann kommt er bis an unser Bett und bis in unsere Träume.«
»Ich möchte hier immer sitzen bleiben, Margret, bis mein Haar grau ist.«
»Das kommt alles von deinen Augen, Kind. Das eine will lachen und das andere will weinen. Und dann ist es wie mit einem Kind, das nicht leben und nicht sterben kann … aber jetzt geh man, denn nun kommen sie gleich zum Essen.«
Dann stand Gina auf und ging mit gebeugten Schultern durch das Spiel des Lichtes und der Schatten. Der Hund ging mit ihr, und wenn sie sich an der Tür zu ihres Vaters Stube noch einmal umwandte, sah es immer so aus, als werde sie niemals mehr wiederkehren.
Vier Wochen später empfing Zerrgiebel Ginas Jawort. Am Abend saß sie wie sonst vor dem Herdfeuer und sah mit ernsten, fast drohenden Augen zu, wie die Kanzleiblätter in den Flammen verglühten, auf denen er sie gebeten hatte, seine Frau zu werden. Es war ein langer Brief, von einer für Gina betäubenden Länge, und ebenso betäubend war die dramatische Eindringlichkeit seiner Beschwörungen. Sie gipfelte in zwei düsteren Drohungen. Die Grundlage der einen war das bisher verborgene Bekenntnis, daß er ein Kind habe, von seiner verstorbenen Frau, einen unendlich zarten und reizenden Knaben, der in der Stadtpension verkümmere gleich einer Blüte im Keller, der seine Augen klagend auf ihn richte, ob er seinem verwaisten Herzen nicht bald eine Mutter geben wolle, und der schweigend gleich einem kranken Tier sterben werde, wenn Gina dem Rufe Gottes nicht folgen werde. Die zweite Drohung besagte klipp und klar, daß er selbst, Albert Zerrgiebel, von dieser Welt zu scheiden entschlossen sei, bevor der Wurm des Grames sein Herz zernage. Sein alter Vater, ein Ehrenmann von altem Schrot und Korn, eine deutsche Eiche sozusagen, werde an der Schwelle des Grabes eben auch lernen müssen, sein Kind von einem Balken herabzunehmen und ihm die gebrochenen Augen mit seiner Greisenhand zuzudrücken.
Das erste, was Gina beim Lesen dieser schön geschwungenen Handschrift empfand, war ein klares und nicht mißzuverstehendes Gefühl des Ekels. Aber daß sie dies empfand, war auch ihr Verhängnis. Denn das Schwerste konnte nur Gott verlangen. Ja, er würde bis an ihr Bett und bis in ihre Träume kommen und würde sprechen: »Wahrlich, ich sage dir, was du dem Geringsten unter diesen tun wirst, das wirst du mir getan haben. Und was du dem Geringsten unter diesen versagen wirst, das wirst du mir versagt haben.« Und während sie die eiternde Wunde eines Hundes wusch und verband, den sie herrenlos gefunden und zu sich genommen hatte, erschien ihr alles dies als eine Fügung, und als sie den Kopf des wimmernden Tieres an ihre Brust drückte, wußte sie, daß sie entschieden hatte.
»Die Karstentöchter haben kein Glück«, sagte sie unten zu ihrem Vater, »aber wenn sie nicht wären, würden andere vielleicht noch weniger Glück haben. Gott braucht sie wohl für die Glücklosen.«
»Auch den Weizen braucht der Mensch zu seinem Glück«, sagte Dietrich Karsten mit seiner ruhigen Stimme. »Aber er schneidet ihn und drischt ihn und dann ißt er ihn auf. Aber es soll nun so sein, wie du es willst.«
Am letzten Sonntag im Oktober zeigte Zerrgiebel seiner künftigen Frau sein Heim. Sie war zu Fuß gekommen und stand nun vor der Tür des kleinen Vorgartens, die Hände auf dem Rücken zusammengelegt und ihre beiden Hunde neben sich. Sie sah aus wie eine Frau aus den großen Wäldern, die zu schwerer Botschaft oder Buße zu den Menschen gekommen war und nicht wußte, ob sie jemals zurückkehren werde. Ihre Augen gingen um die fast bedrohliche Sauberkeit des Gartens, in dem außer ein paar Gilken keine Blume stand, um das kleine, abweisend blickende Haus und über sein Dach zu den Fichten des Waldrandes, der gleich einer unüberwindlichen Mauer hinter diesem letzten Leben stand. Sie versuchte mit blassen Lippen zu lächeln, als Zerrgiebel aus der Haustür stürzte. Aber es gelang ihr nicht. Er warf einen sorgenvollen, von Unmut nicht freien Blick auf die beiden Hunde und führte Gina ins Haus.
»Dies sind meine Hufen«, sagte er stolz, auf die zur Hälfte schon abgeernteten Beete weisend. »Bitte, tritt nicht auf die Kohlblätter«, unterwies er sie mit leiser Strenge. »Sie sind Gottes Geschöpfe, und jedes Blatt ist immerhin ein Löffel Suppe. Vergeudet wird hier nicht … Du brauchst nicht gleich bekümmert auszusehen, es war natürlich nur ein Scherz.«
Gina war weit davon entfernt, bekümmert auszusehen, sie hatte nur ihre Augen mit einer großen Frage auf ihn gerichtet.
Dann traten sie in das Haus. ›Es riecht nach Tinte‹, dachte Gina müde, ›aber es schadet ja nichts, es könnte ja nach Schlimmerem riechen.‹
Unten lag die Küche, das Wohnzimmer und eine Art von Salon, oben das Schlafzimmer und eine kleine Kammer. Alles war von peinlicher Sauberkeit, mit Decken vor der Sonne geschützt und mit Gaze vor den Fliegen behütet. Alles war auch von erschreckender Wesenlosigkeit. Kein menschlicher Atem hing in den Räumen, und sie hätten auch seit zehn Jahren leer gestanden haben können. Es war nicht vorstellbar, auf keine Weise, daß hier jemals ein Mensch gelacht oder geweint hatte. Die Wände waren tot, der Fußboden, die Ecken, die Türen, und dicht unter den Dielen mußte ein abgrundtiefer Keller liegen, wahrscheinlich mit Fässern voller Tinte, unter Spinngeweben vergraben, und der angehaltene Atem seiner Geheimnisse stieg durch die Fugen der Dielen empor, und wenn Gina lauschte – und sie lauschte die ganze Zeit mit einer schrecklichen Angespanntheit –, glaubte sie Tropfen fallen zu hören, irgendwo im Dunklen, in einen tiefen Schacht, um dessen grauenvolles Geheimnis Zerrgiebel allein lächelnd wußte.
Gina mußte Kaffee trinken, und Zerrgiebel erzählte. Er sprach unaufhörlich, und seine amtlich korrekten Perioden liefen kreisend wie ein Treibriemen durch die Dumpfheit des umgebenden Schweigens. ›Er schüttet Erde auf mich‹, dachte Gina, ›immerzu, immer mehr, um mich lebendig zu begraben …‹
»Wo ist das Kind?« fragte sie mitten in seine Worte hinein.
»In der Stadt«, erwiderte er mit leisem Vorwurf. »Der Knabe soll nicht wiederkehren, bevor die Mutterliebe ihn empfängt.« Er sagte nie anders als »der Knabe«.
Dann stand Gina auf und sagte, daß sie nun gehen müsse. Nein, sie wolle nicht, daß er sie begleite. Der Vater werde ihr entgegenkommen.
»Also Weihnachten?« fragte er an der Gartentür.
»Wie du es willst.«
»Es ist ein Ros entsprungen …«, sagte er feierlich.
Dann ging sie.
Sie kreuzte die Schienen, blieb einen Augenblick stehen und sah die glänzenden Bänder entlang, deren Verbundenheit und Unendlichkeit sie schmerzlich berührten. Dann war sie zwischen den Feldern, und das lautlose Land, von der müden Sonne beglänzt, trug seinen Frieden bis an ihre Füße. Die Vogelbeeren leuchteten, Wildgänse zogen, und der Ruf des Hähers erfüllte den leeren Wald. Sie sah die Bäume des Hofes in der Ferne und blieb so stehen, die Hände auf den Köpfen der Hunde, die Augen nach jener Küste des Glückes gerichtet. Aber die ganze Zeit über fühlte sie die Augen Gottes zwischen ihren Schultern, und sie wußte, daß er in ihrem Rücken irgendwo in den Wäldern stehen müsse, die Füße vielleicht in jener Gartentür und die leuchtende Stirn über die sich entlaubenden Wipfel gehoben. Und sie wußte, daß man Gott gehorchen müsse.
Auf der letzten Anhöhe stand der Bauer, auf seinen Stock gestützt, schwerer als sonst, wie es Gina schien, und sah ihr entgegen. Sie stieg langsam den sandigen Weg hinauf, und es war ihr, als schleppe sie ein ungeheures Kreuz zur Stätte der Marter empor, aber immer noch leuchte die strenge Stirn über den Wipfeln und prüfe den Schritt ihrer Füße.
Dann standen sie beide oben und sahen nach dem Hof hinüber. »Es ist ganz hübsch«, sagte Gina endlich. Und dann legte sie die Arme um ihres Vaters Hals und weinte ohne eine Träne.
Um dieselbe Stunde saß Zerrgiebel an seinem Schreibtisch und schrieb an seinen Vater, die »deutsche Eiche«, daß die Hochzeit auf Weihnachten festgesetzt sei, und daß er also nicht ganz so dumm sei, wie man immer angenommen habe. Auch verbreitete er sich in wohlgesetzten allgemeinen Ausführungen über das Verhältnis zwischen Vätern und Söhnen.
Nicht überall kam er in den entscheidenden Punkten der Erkenntnis nahe. Die Zerrgiebels hatten den Schatz der Sprache in reichlichem Maße in die Wiege gelegt bekommen, aber sie waren Händler und Artisten dieses Gutes, und sie spannten die Seile und Brücken ihrer Perioden über alle Abgründe, deren Tiefe ihnen irgendwie unbehaglich war. Sie hatten nicht Felder, Wolken und Sterne in ihrem Blut. Sie waren ein Kleinbürgergeschlecht mit ungelüfteten Seelen aus ungelüfteten Stuben. Sie hatten alle einen dumpfen Trieb nach irgendeinem warmen Ofen des Lebens, wo man wußte, daß der Holzvorrat reiche und niemand die Fenster ins Kalte aufmachen dürfe. Und deshalb waren sie alle Beamte, mit Pensionsberechtigung natürlich, und zu Beginn jedes Jahres berechneten sie, wieviel Sechzigstel ihnen nun schon zuständen. Da waren Pförtner und Briefträger, Weichensteller und Aktuare, und die Großen des Geschlechts saßen hinter Schaltern oder Amtspulten, aber mit demselben schiefen Blick einer tückischen Ergebenheit, grob gegen das Publikum, gebändigt gegen die Vorgesetzten, pünktlich, korrekt, mit schöner Handschrift, nie krank, nie Urlaub verlangend, zuverlässig, schweigsam und bestaubt wie Aktenschränke. Es waren keine Seefahrer unter ihnen, keine Lehrer, keine Künstler, keine Landstreicher. Sie rollten aus dem Brutofen des Geschlechts wie Eier, gleich groß, gleich geformt, gleich gefärbt, und man hätte ihren Stammbaum als eine Reihe von Schränken darstellen können, an einer unendlichen Wand aufgereiht, perspektivisch sich verkleinernd, Serienarbeit einer unheimlichen Fabrik, die sich nicht genug an ihnen tun konnte.
Immer waren ihre Türen geschlossen. Es sprach aus ihnen, mit der gespenstischen Stimme einer Sprechplatte, aber niemand sah ihre Mechanik. Sie hatten bei ihrer bürgerlichen Solidität etwas Rattenhaftes an sich, die Unzugänglichkeit ihrer Wohnung, das Lauern trüber Blicke, das Tasten fahler, böser Hände, das Huschen um Unrat und Tod. Sie warteten immer auf die Nacht. Da war ein Geldbriefträger, der Geldbriefe geöffnet hatte, ein Kreisausschußsekretär, der Bestechungsgelder angenommen hatte, ein Aktuar, der Winkelgeschäfte betrieb. Aber keinem Zerrgiebel war etwas zu beweisen gewesen, niemals. Man pensionierte sie, und sie verschwanden lautlos in ihren Höhlen. Sie arbeiteten im Dunklen weiter, aber Geheimnis lag um ihr verborgenes Leben. Sie waren Verschwörer der Seele, aber sie lüfteten ihre Maske nicht. Keines ihrer Häuser war ohne Fensterladen, keine ihrer Türen ohne Schlüssel, keiner ihrer Wege ohne Umwege, keine Abmachung ohne schriftlichen Vertrag. Und alle hatten sie im Sarge eine kleine, böse Querfalte zwischen ihren spröden Augenbrauen, über die die Hand des Todes keine Gewalt hatte.
So war das Blut der beiden beschaffen, die Gott am Weihnachtstag zusammenfügte. Es war keine frohe Hochzeit, und der Schatten der Glücklosen lag schwer über dem weißen Tafeltuch. Es gab nur ein belebendes Ereignis: als der Geiger vom Musikantenpult an den Tisch trat und das Zehnmarkstück vor Zerrgiebels Teller legte, das dieser in edelmütiger Aufwallung der Kapelle geschickt hatte, damit sie »etwas Lustiges« spiele. »Dat's woll'n falschen, Herr«, sagte der Alte und ließ es auf den Tisch fallen. Es klang nach Blech, und ein peinliches Stillschweigen folgte.
Zerrgiebel prüfte den Tatbestand, mußte ihn anerkennen und geriet sofort in den Zustand aufgeregter Entrüstung. Seine Finger knackten hörbar, und sein Schnurrbart hatte etwas böse Gesträubtes und Gereiztes.
»Das ist das Menschengeschlecht«, sagte er drohend, »das ist es in seinem wahren Glanze. Otterngezücht, böse von Jugend auf. Was sind die Zuchthäuser dagegen? Skorpionenhäuser müßte man für sie bauen. Und bei den Ausgaben, die ich in diesen Tagen gehabt habe, erschreckend hohen Ausgaben, leider Gottes, weiß ich nicht einmal, bei wem ich es eingewechselt habe. Aber ich kriege es heraus, bei Gott, ich kriege es heraus! Zuchthaus nicht unter zwei Jahren, mein Lieber, jawohl! Und Zerrgiebel bekommt eine Belohnung!«
Schweigen lag um den Tisch, und sie fühlten alle ein dumpfes Unbehagen bei dem Anblick dieses Gerechten und bei dem Klang seiner drohenden Worte. »Hei kiekt as'n Hamster«, sagte der Großknecht leise.
Gina winkte ihrem Vater bittend mit den Augen, und er gab dem Musikanten, der noch immer unbeholfen wartend dastand, mit einem gezwungenen Scherzwort ein anderes Goldstück. Zerrgiebel tat nicht ohne Erfolg, als sähe er es nicht.
Als Gina sich zur Fahrt umzog, war nur die Großmagd bei ihr. Sie sprachen nicht. Das Zimmer war schon ausgeräumt und unfreundlich, und von unten drang die Unruhe des Festes herauf. Dann drückte Gina die Pelzmütze über ihren dunklen Scheitel und sah sich um, wie man sich vor einer langen Reise umsieht. »Gott wird nun still sein, Margret«, sagte sie dann. Sie mußte gestützt werden, als sie die Treppe hinunterstieg. Unten stand der Vater, und sie legte für eine Weile den Kopf an seine Brust. Von den Brüdern hatte sie schon Abschied genommen.
Dann stiegen sie in den Schlitten. Der Großknecht fuhr sie. Die Luft war still, und das Land schimmerte unter den hohen Sternen. Auf allen Höfen brannten die Weihnachtslichte, und das Gebell eines fernen Hundes sprang von Hügel zu Hügel. Gina wandte den Kopf nach ihm, als müßte sie die Hirten auf den Feldern sehen und den Stern von Bethlehem, aber es war nur eine weißliche Dämmerung, und die Sterne waren einer wie der andere. Noch nie waren sie ihr so hoch und so kalt erschienen.
Und dann hielt der Schlitten vor der Gartentür und fuhr wieder davon. Da war der Weg zwischen den beschneiten Beeten und die drei Treppenstufen. Gina setzte einen Fuß vor den andern, und bei jedem Schritt erwartete sie den Abgrund, der sich öffnen und in den sie ohne Schrei stürzen würde. Aber die Haustür tat sich auf, und unter der Lampe des schmalen Flurs stand ein vielleicht zehnjähriges Kind, eine böse Querfalte zwischen seinen spröden Augenbrauen, die Hände auf dem Rücken und sah tückisch von unten her an Gina herauf und dann über die Schulter zurück ins Dunkle, und es war Gina, als suche es unter der Dielenleiste das Loch, aus dem es lautlos aufgestiegen sei und in dem es wieder verschwinden werde, in die abgrundtiefen Keller, wo die Spinngewebe schaukelten und die Tropfen in den Schacht des Bodenlosen fielen.
»Dies ist der Knabe«, sagte Zerrgiebel lächelnd und stieß den Riegel vor die Tür. Das Haus schien zu dröhnen bis tief in die Keller hinein bei diesem Ton, und Gina hob die Hände mit geöffneten Fingern, als wollte sie die stürzende Decke auffangen. Aber dann beugte sie sich und küßte das Kind auf die Stirn, und es war ihr, als lächle es heimtückisch unter diesem Kuß und schiebe verstohlen die Hand in die Tasche, um etwas vor ihre Füße zu schleudern, ein kaltes, feuchtes, vielgliedriges Ungeziefer vielleicht, das auch Zerrgiebel heißen würde.
Und dann beugte sie sich unter Gottes Hand.
2
Vom ersten Tag dieser Ehe aber geschah das Erschreckende, daß Gott nicht still war. Und es schien nicht nur ein harter, eifriger Gott zu sein, sondern auch ein listiger Gott, der sein Opfer bis an das Tor der Schmerzen lockte, aber nun erst in Wahrheit mit ihm zu spielen begann, weil er erkannt hatte, daß er ohne Mühe mit ihm spielen könne.
Gina hatte gedacht, daß es genug sei, Frau Zerrgiebel zu werden und dem Kinde eine Mutter zu sein. Auch hatte sie gewußt, daß sie eines neuen Lebens Mutter würde werden müssen. Aber alles andere hatte sie nicht gewußt, und in diesen ersten Monaten konnten ihre Augen mit einer harten Drohung in Gottes Augen blicken. Sie beugte sich, aber Gott mußte sie schlagen, damit sie sich beuge. Niemals in ihrem Leben war sie geschlagen worden, und das Furchtbare des Erlebnisses traf wie ein Hammer auf ihr nacktes Herz. Sie war ungezwungen und unentstellt durch ein ruhiges, wenn auch ein wenig trauriges Leben gegangen. Sie hatte lachen und weinen, schweigen und reden dürfen, wenn ihre Seele es ihr befahl. Niemand verschloß den Wald vor ihr, den Ofenwinkel, den Regen, die Sterne. Sie war ein Vogel gewesen. Der Habicht stand wohl ab und zu über ihr, aber sie hatte ihr Nest, die Hecken, die Zweige, das Unsichtbare, die unbetretenen Heiligtümer.
Nun aber richtete man sie ab. Das Zugeteilte war ihr Los: der Raum, die Nahrung, der Atem, die Freude. Und vor allem anderen das Alleinsein. Ihre Stimme wurde ihr verhaßt, ihr Lächeln, der Blick ihrer Augen, das Gefühl ihres Körpers. Sie war wie ein Kind, dem man eine widerwärtige Speise in den Mund preßt. Die Lippen schließen sich gehorsam, aber der Blick der verzweifelten Augen geht über die Härte der zuschauenden Augen in eine ganz weite Ferne, bis in die Hände eines unbekannten Gottes.
Es begann im Dunkel der Frühe, wenn der schneidende Ton des Weckers die Wände des Schlafes zusammenstürzte und das Bewußtsein des Lebens wie ein Gewölbe auf ihre Stirne niederbrach. Dann setzte ihr Herzschlag aus, und ihr Körper lag fremd und gelähmt um das schreckliche Schweigen. Und jedesmal vernahm sie auf dem knirschenden Schnee der Straße einen zögernden Schritt, und jedesmal dachte sie, daß es Gott sei, der nun von ihrem Bett in die großen Wälder gehe, wo er bis zum Abend die hungernden Tiere füttere.
»Etwas lebhafter, wenn ich bitten dürfte«, sagte Zerrgiebel und drehte sich behaglich auf die andere Seite. Sie kleidete sich im Dunkeln an, weil das Licht ihn störte, machte Feuer in der Küche und kam dann wieder herauf, um Theodor anzuziehen. Er lag wie ein kleines, böses Tier in seiner Kammer, und das erste, was sie von ihm sah, sobald die Lampe brannte, war die Querfalte zwischen seinen Augenbrauen. Er sprach kein Wort am Morgen, aber seine eng zusammenstehenden Augen funkelten wie die einer Ratte, und sein Körper war ein einziger, geballter Widerstand. »Sei liebreich zu dem Knaben«, rief Zerrgiebel mit milder Mahnung durch die Tür. Der Knabe lächelte höhnisch und ließ die Zahnbürste in seine Waschschüssel fallen. Er steckte den rechten Fuß in den linken Schuh, den sie ihm entgegenhielt, und den rechten Arm in den linken Ärmel seiner Jacke. Es war sein Morgenvergnügen, ihm wie ein Erbrecht zustehend, und das Lächeln um seine Mundwinkel ließ unmißverständlich erkennen, daß er sich die ganze Zeit darauf freue.
Gina hatte nicht die Kraft, ihn zu schlagen. Ein dumpfes Grauen erfüllte sie vor diesem runden, blassen Gesicht, und jeden Morgen erwartete sie mit krankhafter Spannung, daß über Nacht auch ihm der blonde steile Schnurrbart Zerrgiebels gewachsen wäre. Sie hatte die jungen Tiere auf dem Karstenhofe geliebt, mit ihren klagenden Augen, die nichts als Spiegel waren, ihren feuchten, hungrigen Lippen und ihren hilflosen Gliedern, die ihnen immer irgendwie zu viel waren. Und sie hatte gedacht, daß Kinder etwas seien, auf deren Stirne noch der Atem Gottes hafte. Aber nun dachte sie, daß dieses Kind sicherlich in dem furchtbaren Keller geboren worden sei, dessen Atem bis an ihr Bett stieg, und die Mutter wohl dort gelebt habe, immerdar, und vielleicht noch dort lebe und gar nicht gestorben sei, wie Zerrgiebel gesagt habe.
Sie sah scheu von der Seite auf seine lautlosen Bewegungen, mit denen er sich über seine Büchertasche beugte, und daß er wie immer die rechte Hand in seiner Tasche hielt, gleichsam um etwas Verborgenes geklammert, das er aufheben könne zum Wurf oder zum Stoß, wenn man ihn reizen sollte.
Und dann kam der Kaffeetisch. Alle Zerrgiebels aßen hastig und leise, mit den Blicken eines Vogels, der eine Beute gerettet hat, und immer stand in ihren Zügen ein Mißvergnügen, daß auch andere aßen. Ihre Hände glitten nicht wie in einem schönen Spiel um die Speise, sondern griffen sie an wie in einem Kampf, und in ihrem Sieg lag etwas Rohes, fast Blutiges.
Zwischendurch fragte Zerrgiebel seinen Sohn nach seinen Tagesaufgaben. Er erhielt mürrische, sehr unvollkommene Antworten. Dann schüttelte er bekümmert den Kopf.
»Der sittliche Kern des Geschlechtes welkt dahin«, sagte er leise, den trüben Blick auf Gina gerichtet. »Die Pfeiler wanken, Pflichtgefühl, Fleiß, Strebsamkeit. Ich werde mit Gram in die Grube fahren. Sag du es, Gina: zwölf mal dreizehn, wieviel?«
»Einhundertsechsundfünfzig«, erwiderte sie mit starrem Gesicht.
»Brav, meine Liebe, sehr brav. Und da sagt man, daß die Bauern keinen Verstand haben. Wiederhole, Theodor, mein Liebling. Wieviel?«
Aber Theodor schwieg bisweilen auf solche Fragen. Dann führte Zerrgiebel lächelnd mit der Rechten die Kaffeetasse zum Munde, und mit der Linken drückte er Theodors Oberarm langsam zusammen. Es sah aus, als spiele er, aber die Falte zuckte zwischen seinen Brauen, und das Kind biß die Zähne in die blasse Unterlippe. Und dann sagte es tonlos, mit geschlossenen Augen die Antwort. »Siehst du wohl«, meinte Zerrgiebel, die Augen lächelnd auf Gina gerichtet.
Mitunter las er aus der letzten Abendzeitung eine Skandalnotiz, die er rot angestrichen hatte, und tauchte sie Zoll für Zoll in die Säure seiner Betrachtung. »Tja, die Gebildeten …«, sagte er freundlich, und er zerlegte das Leben seiner Vorgesetzten und aller Honoratioren des Städtchens sauber und kunstgerecht wie ein Präparat. »Ich kenne sie«, sagte er bescheiden, »ihre Frauen, ihre Söhne, ihre Töchter, ihre Dienstboten. Alles gebucht, belegt und beglaubigt. Ich bin ein einfacher Mann, aber wenn sie wüßten, würden sie zittern … Auch du zitterst, meine Liebe, aber du brauchst es nicht … Tue recht und scheue niemand! Das ist die Devise. Wiederhole, Theodor, mein Liebling … ja, so war es richtig.«
Gina zitterte wirklich. War er nicht zur Nacht in den Kellern gewesen und lagen dort nicht aufgehäuft die Bücher aller dieser Menschen, die er nun aus dem Gedächtnis ablas? Hatte er sie nicht in Ketten geschlossen, in kleinen Nischen, an verrostete Ringe in der feuchten Mauer? Und ging er nicht von einem zum andern, die Hand um ihren Arm legend wie um den seines Sohnes, bis sie bekannten, alles und mehr als alles? Und dann saß er wohl irgendwo an einem steinernen Tisch und schrieb es auf, Geständnis um Geständnis, mit seinen klaren, geschwungenen Buchstaben, und kein Wort fiel aus der ehernen Kammer seines Gedächtnisses.
»Laßt uns beten«, sagte Zerrgiebel feierlich zum Abschluß.
Theodor mußte einen Psalm lesen, und Zerrgiebel faltete die knochigen Hände, den lächelnden Blick auf seine Frau gerichtet.
Das erstemal hatte Gina fassungslos in dieser Szene gesessen, deren Verruchtheit sie unbewußt fühlte. Die Stimme des Kindes hatte die leise Drohung einer lose gespannten Stahlsaite, und es spielte mit diesem Instrument in einer Bosheit, die in einem schrecklichen Gegensatz zu den einfachen Worten des Buches stand. Die Wehrlosigkeit des Frommen und Schönen war in seine Hände gegeben, und es war, als spiele ein Unhold mit dem entstellten Leichnam eines schuldlosen Tieres.
Sie war aufgestanden, hatte das Buch aus seinen Händen gerissen und war zur Türe gegangen. Aber sie war so lautlos und unwiderstehlich ergriffen und zu ihrem Platz zurückgeführt worden wie von dem Treibriemen einer verborgenen Maschine. »Derartiges ist hier nicht üblich«, klang es aus der Tiefe stählerner Abgründe. »Lies zu Ende, mein Liebling.« Und sie verleugnete Gott und weinte nicht einmal darum.
Dann gingen sie den kurzen Weg zum Bahnhof. Zerrgiebel legte Wert darauf, daß Gina sie begleite und ihnen zum Abschied winke. »Die Leute sollen sich auch ein wenig an unsrem Glück freuen.« Sie sah Vater und Sohn einsteigen, wußte nach der Zahl ihrer Herzschläge, wie lange der Zug hielt und sah dann die beiden Gesichter noch einmal im Fenster. Dieses Nebeneinander war die letzte Hypnose, der man sie unterwarf, eine Lähmung, die nicht aus einer Addition zweier Erscheinungen floß, sondern aus einer unendlichen Potenz, zu der ihre Ähnlichkeit stieg. ›Wenn auch er einen Schnurrbart hätte‹, dachte sie beim letzten Blick auf das Kind, ›das wäre der Tod, ganz gewiß …‹
Im Hause, ohne den Mantel abzulegen, sank sie auf den ersten Stuhl und saß so, die Hände gefaltet, mit geschlossenen Augen, wohl eine Stunde lang. Und dann begann sie an ihre Arbeit zu gehen. Es war ihr, als höbe sie die einzelnen Stunden auf eine kaum merklich geneigte Ebene, ließe sie ablaufen und blickte ihnen nun nach, wie sie als drohende Kugeln zu Tale rollten, ein leeres Echo aus leeren Wänden rufend und in einer unmeßbaren Ferne verhallend. Sie konnte dabei lächeln gleich einer Maske und plötzlich still erschrocken vor einen Spiegel gehen und sich, immer noch lächelnd, betrachten, und die vier geheimnisvollen Augen versanken ineinander, starr und verständnislos wie die Augen eines Tieres in seinem Spiegelbild.
Um die Mittagszeit kam Theodor, der sein Erscheinen durch einen Schneeball anzukündigen liebte, den er gegen das Fenster warf. Mitunter auch erschien sein bleiches Gesicht lautlos vor der Fensterscheibe, wie aus dem Keller emporwachsend, und starrte regungslos in den dämmernden Raum, unter wimperlosen Lidern, die böse wie die eines Greises erschienen.
Er saß und kauerte dann in einer Ecke, mit seinen Schulaufgaben beschäftigt, die rechte Hand in der Tasche, aber seine Augen waren gleich Messern hinter einem Vorhang, und es war, als halte er die Hand in unaufhörlicher Wachsamkeit an seiner Schnur. Er antwortete, wenn sie fragte, und tat bisweilen, was sie wünschte, aber er lächelte dabei, ein erschreckend unkindliches, ein gleichsam zeitloses Lächeln, und keinen Augenblick lang konnte jemand im Zweifel sein, daß er die Freiheit besaß, nicht zu antworten und nichts zu tun.
In der Dämmerung kam Zerrgiebel. Sie mußten im Flur sein, wenn die Haustür sich bewegte, ihm Hut und Mantel abnehmen, die Hausjacke, die Hausschuhe anziehen, des Winkes seiner Augen, des Zuckens seiner Querfalte stets gewärtig sein. Nach dem Essen verschwand er für eine Stunde, die Aktentasche in der Hand, man wußte nicht wohin. Gina lauschte zwischen ihren schmerzenden Herzschlägen, und das Kind saß in seiner Ecke und starrte sie an. Es erriet aus ihrer Haltung die Wege ihrer Angst, und einmal sagte es lächelnd:
»Sicher ist er im Keller.«
Nach seiner Rückkehr war Zerrgiebel heiter, fast aufgeräumt, und schlug ein Spiel im Familienkreise vor. Lesen und Spazierengehen fand er dumm. Niemand kam, niemand schrieb, niemand verlangte nach ihnen. Der Wind rauschte drohend im Fichtenwald, ein Schritt kam die Straße entlang, wurde leiser, erstarb, ein Hund bellte, das Läutesignal am Bahnhof schlug mit seinem Hammer in das erschreckte Schweigen, und die Flamme der Petroleumlampe sang ihre sterbende Klage vor sich hin.
Dann aßen sie, und dann kam das Grauen des Schlafzimmers und der Nacht.
Gina kannte niemanden in der Siedlung. Man grüßte sie, achtungsvoll, mit einer fast schmerzlichen Ergebenheit, der Bahnhofsvorsteher, der Lehrer, der Kaufmann, vom Sehen Gekannte und ganz Fremde. Sie dankte wie in einen Wald hinein, aus dem die Vögel riefen. Aber sie kannte niemanden. Sie ging nicht auf den Karstenhof, und sie wollte nicht, daß jemand zu ihr komme. Aber am Vormittag, zuerst nur hin und wieder, dann regelmäßig, ging sie den Weg jenes Oktobersonntags bis zu der Höhe, von der man die entlaubten Wipfel über den Giebeln zu sehen vermeinen konnte. Hier saß sie auf einem der großen Feldsteine am Wegrande, die Hände im Schoß gefaltet, und sah mit tränenlosen Augen über die beschneiten oder im Nebel versinkenden Felder nach jener Stelle des Horizontes, aus der Gottes Hand sich hob. Und dann ging sie, ohne sich umzublicken, den Weg zurück.
Schon nach dem ersten Monat ihrer Ehe war Gina sehr still geworden. Sie erkannte ihr Leben, sie erkannte es sogar mit unheimlicher Schärfe, aber sie vermochte es nicht auszusprechen. Auch ihre Gedichte und Märchen hatte sie gekonnt, Wort für Wort, mit schönen und ergreifenden Worten, aber sie hatte sie nicht zu sprechen vermocht. Sie wußte, daß sie betrogen worden war, von Gott und Menschen auf eine schreckliche Weise betrogen, aber sie konnte es nicht sagen. Daß sie geschändet und erwürgt wurde von einem Mann und einem Kinde, daß sie sich scheiden lassen müßte, daß sie eher sterben müßte, als so zu leben. Aber sie konnte es nicht sagen. Es war ihr, als ginge sie den Weg dieser Tage und Nächte mit geschlossenen Füßen, die nebeneinander herglitten, durch eine kurze Kette verbunden und in einen grauenvollen Nebel geschoben, in dem ein fernes Wasser brauste. Sie nahm, wie die Kinder und Greise des Karstengeschlechts zu tun pflegten, ihr Leben auseinander, aber ohne es wieder zusammenzusetzen. Sie hielt die einzelnen Teile in der Hand, rieb sie an ihrem Herzen blank und legte sie wie in einen Sarg. Da waren Puppen und Tiere, Blumen und Weizenfelder, Bibelstellen und das Herdfeuer in der Küche. Törichtes und Sinnvolles war, Verbundenes und Auseinanderfallendes. Aber über allem war ein Duft wie über einer gemähten Wiese nach einem Abendregen, und über allem standen die Sterne des Unauslöschlichen.
Es war das Blut, das sie hielt. Keine Hoffnung, keine Pflicht, kein Gesetz. Nur das Blut. Und als sie die erste Regung des neuen Lebens unter ihrem Herzen fühlte und die Hände mit den geöffneten Fingern weit von sich streckte im namenlosen Entsetzen vor dem, was in ihr geschah wie in einem fremden Keller, hielt das Blut sie davon ab, sich zu zerstören, bevor es wüchse und sich von ihr nährte, dieses Fremde mit den eng zusammenstehenden Augen, das ein Dämon in sie hineinverborgen hatte, damit er sich freue an seiner Macht und seinem Spiegelbild.
Doch wurde nach der ersten Erschütterung dies Wissen um ein Lebendiges wie eine Kammer des Friedens für sie. In der toten Welt war es ein leiser Atem, nur ihr vernehmlich; in dem schrecklichen Schweigen ein leises Sprechen, nur ihr hörbar; unter der ständigen Lauer der vier Augen ein ganz Verborgenes, nur ihr sichtbar. Und so wob sich das Gewebe des neuen Lebens unter den Händen des Hasses und der Liebe, geknüpft und zerrissen, beleuchtet in stumpfem Grau, und die beiden seltsamen Augen standen wie ein Symbol verbundener Fremdheit über der Tiefe, in der Gott in eine neue Offenbarung wuchs.