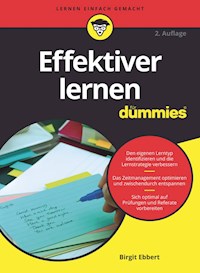12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein spannender biografischer Roman über eine der großen Frauen des Ruhrgebiets: Margarethe Krupp
November 1902. Als ihr Mann Friedrich überraschend stirbt, ist Margarethe Krupp einen Moment wie erstarrt. Dann ergreift sie die Initiative. Denn es gilt, das Unternehmen des Verstorbenen vor den Begehrlichkeiten der Verwandten zu bewahren. Es geht um nicht weniger als das Krupp-Imperium im Herzen des Ruhrgebiets, die gigantische Produktion, Tausende Mitarbeiter. Erst in vier Jahren wird ihre Tochter Bertha, die Firmenerbin, volljährig und geschäftsfähig sein. So lange soll Margarethe als ihre Treuhänderin regieren. Sie weiß, dass diese Zeit nicht ausreicht, um sich in der Firmengeschichte zu verewigen, doch sie hat eigene Pläne - und ist entschlossen, sie zum Wohle ihrer Arbeiter umzusetzen. Kann sie, der als Frau so wenig zugetraut wird, an die Stelle Ihres verstorbenen Mannes treten?
Birgit Ebbert widmet Margarethe Krupp ein ebenso einfühlsames wie überraschendes Porträt und erzählt von der Entstehung der weltbekannten Margarethenhöhe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumPROLOGKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29KAPITEL 30KAPITEL 31KAPITEL 32KAPITEL 33KAPITEL 34KAPITEL 35KAPITEL 36KAPITEL 37KAPITEL 38KAPITEL 39KAPITEL 40KAPITEL 41KAPITEL 42KAPITEL 43KAPITEL 44KAPITEL 45KAPITEL 46KAPITEL 47EPILOGNACHWORTDANKSAGUNGHistorische Daten aus dem Leben Margarethe KruppsVerwendete LiteraturÜber dieses Buch
Ein spannender biografischer Roman über eine der großen Frauen des Ruhrgebiets: Margarethe Krupp
November 1902. Als ihr Mann Friedrich überraschend stirbt, ist Margarethe Krupp einen Moment wie erstarrt. Dann ergreift sie die Initiative. Denn es gilt, das Unternehmen des Verstorbenen vor den Begehrlichkeiten der Verwandten zu bewahren. Es geht um nicht weniger als das Krupp-Imperium im Herzen des Ruhrgebiets, die gigantische Produktion, Tausende Mitarbeiter. Erst in vier Jahren wird ihre Tochter Bertha, die Firmenerbin, volljährig und geschäftsfähig sein. So lange soll Margarethe als ihre Treuhänderin regieren. Sie weiß, dass diese Zeit nicht ausreicht, um sich in der Firmengeschichte zu verewigen, doch sie hat eigene Pläne – und ist entschlossen, sie zum Wohle ihrer Arbeiter umzusetzen. Kann sie, der als Frau so wenig zugetraut wird, an die Stelle Ihres verstorbenen Mannes treten?
Birgit Ebbert widmet Margarethe Krupp ein ebenso einfühlsames wie überraschendes Porträt und erzählt von der Entstehung der weltbekannten Margarethenhöhe.
Über die Autorin
Birgit Ebbert ist freie Autorin und lebt im Ruhrgebiet. Als Diplom-Pädagogin schreibt sie Ratgeber und Lernhilfen sowie Kinderbücher und Erinnerungsgeschichten für die Arbeit mit Seniorinnen und Senioren. Seit ihrer Dissertation über Erich Kästner ist sie fasziniert von der deutschen Geschichte, was sich in ihrer Literatur widerspiegelt. In Kurzgeschichten und Romanen zeigt sie, dass hinter Geschichte immer auch Leben und Geschichten stecken.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2023 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Lektorat: Dr. Stefanie Heinen
Textredaktion: Dr. Frank Weinreich, Bonn
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4828-5
luebbe.de
lesejury.de
PROLOG
»Und das hier ist unser Schmuckstück, eure Majestät.« Friedrich Alfred Krupp breitete beide Arme aus, um Kaiser Wilhelm die Halle zu präsentieren, mit der sich sein Unternehmen auf der Industrie- und Gewerbeausstellung in Düsseldorf vorstellte.
Erst auf Drängen des Direktoriums war der Unternehmer aus Capri angereist, wo er in jeder Hinsicht freier atmen konnte. Schon als Kind hatte er unter Atemproblemen gelitten, in den letzten Jahren waren diese häufiger geworden, sodass er immer öfter auf die Insel im Golf von Neapel floh. Dort war er für das Direktorium stets erreichbar und hatte ein oder zwei Sekretäre an seiner Seite, die ihm die Arbeit erleichterten. Seit jeher blieb er Repräsentationspflichten wie dieser lieber fern, und auch diese hätte er gern seiner Frau überlassen. Am Ende hatte das Direktorium ihn jedoch überzeugt, wusste er doch um Margarethes zwiespältiges Verhältnis zum Kaiser. Sie sah in Wilhelm auch nach fünfzehn Jahren Regentschaft noch jenen Schüler, mit dem sie in Kassel Tennis hatte spielen müssen, weil sie als Tochter des Regierungspräsidenten eine halbwegs ebenbürtige Partnerin für den Sohn des angehenden Kaisers war. Dass dessen Vater nach dem Tod des ersten Wilhelm nur wenige Monate regieren und der exaltierte Kronprinz im Drei-Kaiser-Jahr bereits mit 29 Jahren zum Kaiser gekrönt werden würde, hatte damals in Kassel niemand voraussehen können.
Friedrich unterdrückte ein Seufzen. Vor allem war er aus Capri angereist, weil seine Berater nicht müde wurden zu betonen, dass es für das Geschäft besser sei, wenn ein Krupp persönlich den Kaiser durch die Ausstellungshalle führe. Frauen gehörten nun einmal ins Haus und nicht in öffentliche Repräsentationsräume, und so freundlich und liebenswürdig seine Frau auch auftrat, konnte sie diesen Makel, eine Frau zu sein, doch nicht ablegen. Im Prinzip war Friedrich da ganz auf der Seite des Direktoriums, er konnte sich ebenfalls nicht vorstellen, einer Frau wichtige unternehmerische Entscheidungen zu überlassen, heute wäre er trotzdem lieber auf Capri.
Nur diesen einen Empfang des Kaisers, so viel hatte Friedrich sich ausbedungen. Er sah sich um. Wenigstens machte die Halle etwas her, die seine Architekten und Ingenieure für die Industrie- und Gewerbeausstellung gebaut hatten. Mit 4.280 Quadratmetern Grundfläche, einer Länge von 134 Metern, einer Breite von 35 Metern und einer Höhe von 18,5 Metern war der imposante Bau aus Krupp-Eisen ein einzigartiger Beweis der Leistungsfähigkeit seines Unternehmens. Von außen wirkte das Gebäude mit den Türmchen und Verzierungen wie eine Kathedrale, und das war die Halle in gewisser Weise auch, eine Kathedrale für seine Produkte. Obwohl der Ursprung der Firma, die sein Vater Alfred groß gemacht hatte, in stählernen Eisenbahnrädern lag, zeichnete sich bereits ab, dass Kanonen ihre Zukunft darstellen würden.
Friedrich schmunzelte bei dem Gedanken, dass die Besucher die Halle »Kanonenburg« nannten.
Kaiser Wilhelm nickte wohlwollend, als er die vier Geschütze im Zentrum der riesigen Halle bemerkte, und betrachtete sie eingehend. Er beugte sich vertraulich zu Friedrich herüber. »Ich glaube, da kommen wir ins Geschäft.«
Friedrich verzog keine Miene, obwohl er sich freute. Die Geste des Kaisers zeigte mehr als alles andere, welche Rolle er im Deutschen Reich spielte. Ohne ihn und die Firma ging wenig in dieser Zeit.
KAPITEL 1
November 1902
Margarethe blieb nur diese eine Nacht zur stillen Trauer. Schon morgen würde das Protokoll die Hände nach ihrem Mann ausstrecken und die Tage bis zur Beerdigung genauso bestimmen wie die vielen Wochen und Jahre, seit sie und Friedrich gemeinsam am Grab seines Vaters gestanden hatten. Die Leitung des Imperiums war mehr als ein Beruf, sie war eine Bestimmung, und die hatte Friedrich und sie vereinnahmt, seit Alfred Krupp im Juli 1887 verstorben war. Ihr Schwiegervater hatte seinem Sohn die Herrschaft über sein Stahlimperium nur nach langen inneren Kämpfen hinterlassen und diesem erst auf dem Totenbett vergeben, dass er gegen seinen Willen Margarethe von Ende geheiratet hatte. Die letzten Worte, die der alte Mann von sich gegeben hatte, lauteten gar: »Beste Marga!«
Margarethe stützte sich auf die Fußlehne des großen Bettes, in dem ihr Mann gestorben war und nun aufgebahrt lag. Am Ende hatte er dem Unternehmen sein Leben geopfert, so oder so.
Ein Rascheln an der Tür zwischen den Wänden mit der grünen Seidentapete mahnte zum Aufbruch. Nicht einmal diese Stunde hatte sie für sich allein; der Bestatter, die Prokura, das Hauspersonal – alle warteten darauf, dass sie ihre Routinen fortführen konnten.
Sie tat, als hätte sie nichts gehört. Es war immer schwer, dem Tod eines geliebten Menschen ins Auge zu sehen und ihn zu begreifen; die Ereignisse der letzten Wochen aber hatten ihr dies fast unmöglich gemacht. Dass sie ihren Mann, mit dem sie seit Langem zwar keine stürmische Liebe, aber doch eine tiefe Zuneigung verband, in seiner letzten Stunde nicht begleitet hatte, würde sie nicht verzeihen. Ihm nicht, den Ärzten nicht, die sie vor zwei Wochen zwangsweise in eine Klinik nach Jena geschickt hatten, und ihrem Bruder Felix nicht, der sie unter dem Einfluss all dieser Menschen zur Abreise überredet hatte. Vor allem aber verzieh sie sich selbst nicht, dass sie sich nicht stärker gewehrt hatte. Denn sie war immer stark gewesen, hatte sich gegen ihre Eltern durchgesetzt und dadurch ihren Schwestern einen guten Start ins Leben ermöglicht. Die ungeheuerlichen Angriffe auf Friedrich, die ihr vor Wochen anonym zugesandt worden waren, hatten jedoch ihren Geist vernebelt und ihre Kräfte aufgezehrt.
Wieder nahm sie ein Rascheln hinter sich wahr. Eine Bewegung der Türklinke war nicht zu hören, dafür aber der Rock des Dienstmädchens.
Margarethe wandte nur leicht den Kopf, und schon wurde es ruhig. Die Zeit lief dennoch unerbittlich weiter. Dabei hatte sie so viele Fragen, auf die sie nie eine Antwort bekommen würde. So viele Gerüchte, die sich wie Stachel in ihr Herz bohrten …
»Warum?« Margarethe sah ihren Mann an und entdeckte in seinem Gesicht jenen Zug von Traurigkeit, der ihr schon bei ihrer ersten Begegnung aufgefallen war. Damals, als sie noch ein Backfisch gewesen war.
Ein wehmütiges Lächeln stahl sich in Margarethes Antlitz. An jenem Nachmittag hatte sie, mit gerade mal achtzehn Jahren, ihren Vater bei seinem Antrittsbesuch bei Alfred Krupp begleitet. August von Ende war soeben Regierungspräsident in Düsseldorf geworden, und er wäre fehl an diesem Platz gewesen, hätte er nicht gewusst, wer der wichtigste Mensch in seinem Revier war: der Stahlmagnat, der reichste und mächtigste Industrielle aus Essen, von ihm »Ruhrkönig« genannt. Daher hatte ihn sein erster Weg auf den Hügel geführt, wo der Industrielle mit seiner Frau Bertha und ihrem Sohn Friedrich in einem Gutshaus residierte.
Margarethe erinnerte sich noch gut an ihre Verwunderung über die verkehrte Welt.
Die Krupps lebten auf einem Anwesen, das sich leicht mit dem Grundbesitz eines Grafen, Herzogs oder Fürsten messen konnte, während ihre Eltern, auf deren weitreichende Adelsgeschichte vor allem ihre Mutter so stolz war, in vergleichsweise nahezu beengten Verhältnissen wohnten.
Die Kutsche, die sie mit ihren Eltern zum Haus brachte, war auf einen Feldweg eingebogen, der einen kahlen Hügel hinaufführte, an dem sich Äcker und Felder befanden. Sie hielt vor einem zweistöckigen weißen Haus mit einem Giebeldach, das in ein einstöckiges Gebäude mit Uhrenturm überging.
»Wie schön, dass Sie uns im Klosterbuschhof gefunden haben.« Eine gut aussehende Frau begrüßte sie mit warmer Stimme. Bertha Krupp, die Dame des Hauses, hatte es zeit ihres Lebens verstanden, den Menschen um sie herum ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Sie war freundlich, liebenswürdig und an ihrem Gegenüber interessiert. Ihr Gesicht war ebenmäßig, wie von einem Bildhauer aus Marmor gemeißelt, das dunkle lange Haar trug sie zurückgekämmt, wie es sich für eine Frau in den mittleren Jahren in jener Zeit gehörte, und die braunen Augen blickten freundlich auf die Gäste. Nun, ihre Nase war vielleicht ein bisschen zu lang geraten, aber das fiel für Margarethe nicht ins Gewicht, da sie selbst unter einer weitaus gröberen Dreiecksnase litt, wie sie auch ihr Vater besaß. Wie oft hatte sie sich gewünscht, ein Mann zu sein und mit einem Schnurrbart die Wirkung des dominanten Dreiecks inmitten ihres sonst zarten Gesichts zu verändern.
»Bitte verzeihen Sie, dass wir Sie nicht in unserem neuen Domizil empfangen.« Bertha Krupp zeigte auf das imposante Gebäude nebenan. »Es sollte längst fertig sein, aber das kann mein Mann Ihnen besser erklären. Bitte kommen Sie herein.«
Margarethe konnte sich kaum vom Anblick Bertha Krupps lösen, die so hinreißend aussah und sie so freundlich begrüßt hatte, und sie spürte, dass auch ihre Eltern von der Frau des Industriellen verzaubert waren.
Beim Essen berichtete Alfred Krupp, dass die Bauarbeiten an der Villa durch den Krieg ins Stocken geraten seien. »Das Kellergeschoss war bereits fertiggestellt, da mussten die Franzosen die Baustelle verlassen, als Frankreich uns den Krieg erklärte. Die deutschen Steinmetze wurden eingezogen, und schon war keiner mehr da, um die Villa fertigzustellen. Ausgerechnet da brach auch noch das Mauerwerk, weil das Haus über einem Stollen errichtet worden war. Der Erker hat sich komplett vom Gebäude gelöst. Die reine Schlamperei! Ich sage Ihnen, diese Architekten und Techniker sind Kretins!«
Friedrich hätte sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können, um sich zu seinen Eltern und den Gästen zu gesellen. Der junge Mann mit dem kurzen braunen Haar und den freundlichen Augen in einem runden Gesicht sprach nicht viel. Er wirkte zwischen der gewandten Mutter und dem dominanten Vater fehl am Platz. Vielleicht war es das, was Margarethe für ihn einnahm. Noch heute, nach so vielen Jahren, konnte sie die Beklemmung bei Tisch spüren und sah Friedrichs erstarrte Miene bei Alfreds Ausbruch vor sich.
Kaum hatte der junge Mann sich hingesetzt, sagte sein Vater wie aus dem Nichts: »Mein Sohn Friedrich will auch so ein Techniker werden! Er hat sich in den Kopf gesetzt zu studieren. Am Polytechnikum in Braunschweig. Was halten Sie davon?«
Er musste August von Ende nicht ansehen, um deutlich zu machen, wem die Frage galt. Die Frauen am Tisch hatten in der Konversation keine Rolle gespielt, sie waren schmückendes Beiwerk und lächelten einander allenfalls zu; mal freundlich, mal wohlwollend, manchmal besorgt.
Vielleicht hatte sich August von Ende durch das freundliche Wesen Bertha Krupps zu wohl gefühlt, womöglich hatte er auch einmal zu oft nach dem Weinglas gegriffen und die Fallstricke der Frage dadurch nicht bemerkt. Jedenfalls äußerte er freimütig: »Das ist ein gutes Ansinnen. Kinder sollten ihre Berufung erkennen, und Eltern sollten sie dabei unterstützen. Haben Sie bereits mit den Studien begonnen, Herr Krupp?«
Friedrichs Miene spiegelte Staunen und Interesse wider, während das Gesicht seines Vaters einfror. Jeder am Tisch spürte, dass dies das Ende einer nicht einmal begonnenen Beziehung zwischen dem politischen Beamten und dem Unternehmer war.
Friedrich rettete die Situation, indem er Margarethe ansprach. »Wie gefällt es Ihnen in Düsseldorf? Haben Sie sich bereits eingefunden? Wo haben Sie vorher gelebt?« Fragen, die Fremde stellen, wenn sie einander das erste Mal begegnen. Aber aus dem Mund des bis dahin schweigsamen 18-Jährigen entfalteten sie in dieser Situation eine besondere Wirkung.
Margarethe reagierte bewusst oder unbewusst klug, indem sie die Region pries und einiges von dem wiedergab, was ihr Vater während der Fahrt in der Kutsche über das Ruhrgebiet erzählt hatte. Sie spürte, dass Friedrich sie als intellektuell ebenbürtig ansah, obwohl sie sich neben seiner Mutter wie ein hässliches Entlein fühlte. Sie wusste, dass sie nicht hübsch war, aber sie besaß einen scharfen Verstand, war offen für Neues und hatte durch die ständigen Umzüge der Familie von Breslau über Kassel und Schleswig nun nach Düsseldorf viel zu erzählen, was sie in dieser Minute aber zurückhielt. Jetzt galt es, zuerst den Frieden am Tisch zu sichern.
Margarethe erinnerte sich noch gut an Berthas wohlwollenden Blick beim Abschied. »Besuchen Sie uns gerne wieder einmal«, hatte sie vorgeschlagen und mit einem warmherzigen Lächeln unterstrichen, dass dies nicht nur eine Floskel war. Bis heute fragte Margarethe sich, ob ihre Schwiegermutter sie damals bereits als mögliche Ehefrau für ihren Sohn ins Auge gefasst hatte oder einfach nur einer jungen Frau den Einstieg in die Gesellschaft ermöglichen wollte. Vielleicht hatte sie aber auch nur eine Gesprächspartnerin gesucht, die nicht wegen ihres Mannes auf den Hügel kam wie die unzähligen anderen Gäste, die ständig bewirtet werden mussten.
»Warum?« Die Erinnerung an die Anfänge ihrer Beziehung brachte Margarethe zurück in die Gegenwart, zu der Frage, die sie beschäftigte, seit sie das Telegramm mit der Nachricht über einen schweren Anfall ihres Mannes erreicht hatte. Sobald der unternehmenseigene Salonwagen in Jena eingetroffen war, hatte sie sich auf die Rückreise gemacht, in der Hoffnung, ihrem Mann bei seiner ernsten Krankheit beistehen zu können. Als Johanna Brandt, ihre Gesellschafterin, und Friedrichs Hausarzt Dr. Vogt sie auf dem Bahnsteig in Trauerkleidung erwarteten, war sie zusammengebrochen. Wie immer, seit sie auf den Hügel gezogen war, hatte die Dienerschaft schon geahnt, was geschehen könnte, und so war ein Stuhl zur Stelle, in dem man Margarethe den Hügel hinauftrug. Hinter dem Hut mit schwarzem Schleier, den Johanna Brandt ihrer Herrschaft mitgebracht hatte, versuchte Margarethe, ihre Fassung zurückzugewinnen. Sie hatte sich mit einem Fächer, den sie in den letzten Jahren stets bei sich trug, um Hitzewellen wegzuwedeln, frische Luft zugefächelt, um die Tränen zu trocknen, die ihr angesichts der Trauer und der schwierigen Situation über die Wangen rannen. Ihrem Mann konnte sie nicht mehr helfen, sie konnte nur Abschied nehmen und ihren Töchtern Bertha und Barbara beistehen. Noch im Reisemantel war sie an das Totenbett geeilt.
»Ihre Töchter brauchen Sie jetzt!«
Margarethe hatte nicht wahrgenommen, dass Johanna Brandt neben sie getreten war. Jetzt sah sie auf. »Ich komme gleich!«, versprach sie.
Nachdem die junge Frau, die in den letzten zehn Jahren von der Hauslehrerin zur Gesellschafterin und Vertrauten geworden war, den Raum verlassen hatte, stellte Margarethe sich neben Friedrichs Bett und legte eine Hand auf seine kalte Rechte. Sie versuchte beiseitezuschieben, was die Zeitungen in den vergangenen Wochen über ihn geschrieben hatten. Stattdessen klammerte sie sich an die Worte seines letzten Telegramms, das sie am Tag zuvor erhalten hatte: Innigen Dank für lieben Brief, hoffe, morgen oder übermorgen schreiben zu können. Herzlichen Gruß, Fritz. Sie waren der Versöhnung so nah gewesen. Das Telegramm widersprach zudem den Gerüchten und Mutmaßungen, Friedrich habe seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Er mochte seit einigen Jahren in anderen Sphären schweben, aber seine Versprechen hatte er immer eingehalten.
Sein letzter Gruß war für Margarethe das wahre Vermächtnis ihres Mannes. Dies und sein häufig geäußerter Wunsch, das Lebenswerk der Familie sicher in der Hand seines Kindes zu wissen. Mit ihren gerade sechzehn Jahren war Bertha zu jung, um diesen Wunsch zu erfüllen. Aber sie, Margarethe Krupp, geborene von Ende, würde dafür sorgen, dass alles nach Friedrichs Vorstellungen geschah und dass sein Name und der Name seines Werkes von den Schatten der letzten Wochen befreit wurden und fortan heller strahlten als je zuvor. Und dennoch …
»Warum?« Sie musste es wissen und schüttelte Friedrich an den Schultern, als könnte sie ihn aufwecken. Die Tränen, die vorher nur vereinzelt über ihre Wangen gelaufen waren, flossen jetzt in Sturzbächen. Sie konnte sie nicht zurückhalten, obwohl Johanna Brandt leise neben sie trat.
»Friedrich! Warum?« Sie warf sich auf ihren Mann, ihr Körper wurde geschüttelt von der Trauer, die sie bis dahin mit der Disziplin, die ihr von klein auf beigebracht worden war, zurückgehalten hatte.
Widerwillig ließ sie sich von Johanna Brandt vom Bett wegzerren.
»Sie können nichts mehr für ihn tun, Frau Krupp«, flüsterte die junge Gesellschafterin ihr zu, während sie sie in das Ankleidezimmer führte.
Margarethe drückte ihr dankbar die Hand. »Ich möchte ein paar Minuten allein sein.«
Johanna Brandt ging zur Tür.
Margarethe sah, dass sie sie einen Spalt weit offen ließ, um jederzeit zur Stelle zu sein.
Sie richtete sich so weit her, dass sie sich im Haus zeigen konnte. Sie kämmte die Haare zurück, die sich während der Fahrt und bei ihrem Abschied von Friedrich gelöst hatten, und befestigte sie zu einem straffen Knoten. Sie wusste, dass diese Haartracht auf viele Menschen streng und unnahbar wirkte, aber so sah sie stets gepflegt aus und musste sich den Tag über nicht darum kümmern, ob ihre Frisur noch saß. Angesichts der Aufgaben, die sie jetzt zu bewältigen hatte, schien ihr dies auch heute die beste Lösung zu sein.
Auf dem Weg in die obere Halle, die sie nach Alfreds Tod für die Familie und ihre Gäste als gemütlichen Treffpunkt eingerichtet hatte, fiel ihr Blick auf zwei Bilder. Bruno Piglheim hatte sie vor einigen Jahren in Friedrichs Auftrag gemalt; eine der vielen Gesten, durch die ihr Mann Künstlern geholfen hatte, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Als hätte Piglheim die Zukunft der Familie vorausgeahnt, war auf dem einen Bild Friedrich zu sehen, wie er am Schreibtisch stand und ernst auf die Zukunft seines Unternehmens schaute. Auf dem zweiten Gemälde hatte der Maler Margarethe, Bertha und Barbara eingefangen. Wie jung sie damals gewesen war! Ihre Nase hatte das eigentlich zierliche Gesicht auch da schon dominiert. Der Maler war nicht auf die Idee gekommen, etwas zu beschönigen, und nur der Mund wirkte nicht ganz so breit, wie er ihr vorkam, wenn sie sich selbst im Spiegel betrachtete. Fast sah es aus, als hätte sich ein Lächeln hinter ihren Lippen versteckt. Woran sie beim Modellstehen gedacht hatte, wusste sie nicht mehr genau. Hatte eines der Mädchen vielleicht einen Scherz gemacht? Die sechsjährige Bertha in ihrem Lieblingskleid mit der rosa Schärpe schaute den Betrachter des Bildes wohlwollend an. Sie war sich ihrer Rolle als älteste Tochter des Ruhrbarons sehr wohl bewusst, auch wenn Margarethe Wert darauf legte, dass diese nicht zu Privilegien führte. Sie hatte viel Wert darauf gelegt, dass ihre Töchter bodenständig aufwuchsen. Die kleinere Barbara klammerte sich an die rechte Hand ihrer Mutter und drückte mit der anderen ihre Lieblingspuppe an sich. Ihr Blick wirkte eher skeptisch.
Margarethe lächelte. Erstaunlich, wie Piglheim ihre Kinder eingefangen hatte, obwohl das Bild ein Gemälde und kein Foto war! Sie wusste, dass ihre Töchter dennoch nicht wirklich richtig getroffen waren. Eigentlich war Bertha die Nachdenkliche, die vieles kritisch beobachtete, während Barbara offen und neugierig durch die Welt stolperte und manchen gesellschaftlichen Patzer mit ihrem Liebreiz ausglich. Das war also nun der Rest ihrer Familie.
Margarethe schüttelte die Gedanken ab und ging mit großen Schritten in die Halle, in der die beiden Mädchen blass und verunsichert mit Johanna Brandt in einer Ecke saßen und stickten.
Bei ihrem Anblick ließen Bertha und Barbara ihre Handarbeiten fallen, rannten zu ihrer Mutter und fielen ihr von rechts und links um den Hals. Ihre Tränen zerzausten das straff gekämmte Haar und hinterließen Flecken auf Margarethes untadeligem Kleid.
»Gestern hat Papa noch mit uns gespielt!«, stießen die 16-jährige Bertha und ihre knapp zwei Jahre jüngere Schwester Barbara gleichzeitig hervor. »Es war ein so schöner Abend. Und heute Morgen …«
»Als wir hochgingen, hat er mich untergehakt und ist mit mir die Treppe hinaufgehüpft.« Barbara schluchzte. »›Komm, Bärbchen‹, hat er gesagt. Das kann er nun nie wieder.«
Trauer und Tränen überwältigten beide Mädchen. Margarethe und Johanna Brandt führten sie zurück auf ihre Plätze und drückten ihnen Taschentücher in die Hände.
»Es ist doch schön, dass ihr euren Vater so fröhlich in Erinnerung behaltet, wie ihr ihn gekannt habt«, versuchte Johanna Brandt, ihre Zöglinge zu trösten.
Bertha brachte ein trauriges Lächeln zustande. »Das stimmt.«
Barbara trauerte stumm um ihren Vater.
»Nachdem die Mädchen im Bett waren, hat er wie immer im Treppenhaus gesessen«, berichtete Johanna Brandt. »Er müsse noch einen Brief an den Kaiser schreiben, hat er mir erklärt, als ich fragte, ob er sich nicht auch zur Ruhe begeben wolle. Ich bin dann in mein Zimmer gegangen und war kurz davor einzuschlafen, als ich Geräusche im Haus hörte. Das war gegen elf Uhr.«
Margarethe blieb neben Johanna Brandt stehen und senkte die Stimme. »Herr Herms hat mir erzählt, dass mein Mann nach seinem Kammerdiener geläutet hat. Als dieser eintraf, schien es ihm wieder gut zu gehen.«
»Mir hat man morgens gesagt, dass er schwer krank sei. Ich habe dann entschieden, dies den Kindern erst einmal zu verheimlichen. Jetzt mache ich mir Vorwürfe. Hätte ich Bertha und Barbara zu ihm schicken sollen?«
»Sie haben alles richtig gemacht, Fräulein Brandt.« Margarethe legte ihre Hand auf den Arm der Gesellschafterin. »Die Mädchen haben ihren Vater so in Erinnerung, wie er immer war, wenn sie zusammen waren: fröhlich, zu kleinen Späßen bereit und erfüllt von tiefer Liebe zu ihnen. Dr. Vogt hat mir erklärt, dass mein Mann einen Gehirnschlag erlitten hat und die meiste Zeit nicht bei Bewusstsein war. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie den Kindern den Anblick ihres sterbenden Vaters und auch die Unruhe erspart haben.«
»Frau Krupp!« Einer der Diener hatte sich den Frauen leise genähert. »Der Pfarrer möchte wissen, was Sie wünschen.«
Margarethe sah ihn an. »Ich komme gleich.« Sie schaute von einem Mädchen zum anderen. »Wie möchtet ihr Abschied nehmen von Papa? Wollen wir allein sein oder inmitten der vielen Menschen, die ihm das letzte Geleit geben?«
Ihr kam die Trauerfeier für ihren Schwiegervater in den Sinn. Damals, vor fünfzehn Jahren, waren die Straßen der Stadt gesäumt von Menschen, und sie war gemeinsam mit Friedrich dem Sarg an der Spitze des Zuges gefolgt. Sie schüttelte den Kopf. Das würde sie in dieser Situation nicht durchstehen. Erst recht nicht, wo sie damit rechnen musste, dass die Leute hinter ihren Trauermienen nur darauf lauerten, was sie sagte und wie sie sich bewegte. Jedes unbedachte Wort von ihr und den Kindern würden sie auf die Goldwaage legen, diese Hyänen, die Friedrich wie auch immer in den Tod geschrieben hatten.
Ehe sie es ihren Töchtern erklären konnte, sagte Bertha: »Ich möchte nicht bei einem großen Umzug dabei sein wie bei Großvaters Begräbnis. Können wir Papa nicht nur mit Oma Ende, Onkel Felix und den Direktoren beerdigen?«
Margarethe lächelte kurz. Bertha war damals zu klein gewesen, um sich an die Trauerfeier für ihren Großvater zu erinnern, aber sie kannte die Fotos und hatte sich mehr als einmal staunend darüber geäußert, dass so viele Menschen ihren Großvater auf seinem letzten Weg begleitet hatten.
Barbara nickte, sie hatte sich wieder in eine Stickarbeit vertieft. Nur die über ihre Wangen rinnenden Tränen, die sie gelegentlich wegwischte, verrieten, dass sie sehr wohl wusste, was geschehen war, aber nicht darüber sprechen mochte.
»Ich kümmere mich darum, dass alles in eurem Sinne geschieht«, versprach Margarethe und erhob sich, um dem Bestatter, dem Pfarrer und den Vertretern des Unternehmens, die vor der Tür warteten, ihre Entscheidung bekannt zu geben.
»Wir werden uns im kleinsten Kreis von meinem Mann verabschieden«, verkündete sie wenig später vor den versammelten Herren und gab sich Mühe, trotz ihrer Trauer stark und gefestigt zu wirken. Sie sollten nicht denken, sie hätte sich nicht unter Kontrolle und wäre besser in der Klinik geblieben. Dabei war ihre körperliche und geistige Konstitution für ihr Alter ausgezeichnet; sie hatte allenfalls gelegentlich mit Hitzewellen und anderen Beschwerden der Wechseljahre zu kämpfen. Vielleicht waren ihre Gefühle auch deshalb stärker durcheinandergeraten, als sie es von sich selbst nach allem, was sie bisher schon erlebt hatte, jemals erwartet hätte.
Margarethe sah in die Runde. »Ist seine Durchlaucht bereits vom Tod meines Mannes in Kenntnis gesetzt worden?«
Die Männer nickten. Selbstverständlich hatte einer der Direktoren längst an den kaiserlichen Hof in Berlin gekabelt, dass Friedrich verstorben war. Der Kaiser war in den letzten Wochen zu eng in den Skandal um den Ruhrkönig verwickelt gewesen, als dass er nicht umgehend hätte informiert werden müssen.
»Der Kaiser wird an der Trauerfeier teilnehmen«, berichtete Ernst Haux, Friedrichs engster Vertrauter im Direktorium.
Margarethe wusste, dass ihr Mann Ernst Haux als Testamentsvollstrecker bestimmt hatte, eine Entscheidung, die nicht mit ihr abgesprochen war. Aber sie war in ihrem Sinn. Sie vertraute dem Schwaben, der 1896 eine verantwortungsvolle Position im Stuttgarter Finanzministerium aufgegeben hatte, um an die Ruhr zu ziehen, wo er sich seither nahezu unentbehrlich gemacht hatte.
Margarethe wusste, was die Teilnahme des Kaisers an der Beisetzung bedeutete. Sie würde allen Missgünstigen den Wind aus den Segeln nehmen, und das war eine Erleichterung. Seit sie Mitte Oktober das anonyme Schreiben aus Capri bekommen hatte, war kein Tag vergangen, an dem nicht ein vermeintlicher Freund nachfragte, was denn mit Friedrich los sei, oder ein Feind mehr oder minder verdeckt das Ende des »kleinen Kanonenkönigs« heraufbeschwor.
Niemand wusste, was wirklich auf der Felseninsel geschehen war. Hatte Friedrich dort tatsächlich Orgien mit jungen Männern gefeiert? Oder wollten sich nur diejenigen rächen, die er nicht in seinen engeren Freundeskreis aufgenommen hatte?
Margarethe seufzte. Die Wahrheit würde nie mehr ans Licht kommen. Friedrich war gestorben, bevor das Verleumdungsverfahren, das er mit einer Anzeige in Gang gesetzt hatte, zur Verhandlung gekommen war. Ein weiterer Beweis dafür, dass Friedrich nicht freiwillig den Tod gewählt hatte. Niemals wäre er gegangen, bevor sein Ruf wiederhergestellt war. Oder war doch etwas an den Gerüchten, und er hatte keinen anderen Ausweg gesehen, um das Unternehmen und seine Familie zu beschützen? Sie sog hastig Luft ein und atmete wieder aus. Diese Frage würde sie ihr restliches Leben beschäftigen. Trotzdem … Sie würde ihre Hand dafür ins Feuer legen, dass Friedrich nicht aus freiem Willen aus dem Leben geschieden war.
Die Gewissheit, dass sie niemals gänzlich Klarheit über den Tod ihres Mannes bekommen würde, lag schwer auf ihrer Seele. Es gelang ihr nicht, diese trüben Gedanken zu verbergen, als sie zurück in die Halle ging.
»Was hast du, Mama?« Bertha sah ihre Mutter besorgt an.
Margarethe suchte das Lächeln, das jedes Mal in ihr aufstieg, wenn sie ihre Töchter betrachtete. Sie war stolz darauf, dass es ihr gelungen war, Bertha und Barbara zu natürlichen Mädchen zu erziehen, denen der Reichtum des Vaters nicht zu Kopf gestiegen war.
Sie blickte Bertha besonders lange an. Ob ihr bewusst war, dass sie nun vermutlich das reichste Mädchen Deutschlands war? Friedrich hatte in seinem Testament festgelegt, dass das Krupp-Imperium nicht zerschlagen werden durfte, sondern an das älteste Kind übergehen sollte.
»Ich war nur in Gedanken«, beruhigte Margarethe ihre Tochter. »Ich bin traurig, dass Papa nicht mehr ist, und erinnere mich an die schönen Zeiten mit ihm.«
Dass sie gerade an die weniger schönen Zeiten gedacht hatte, mussten die Mädchen nicht wissen. Auch nicht, dass sie nun lächelte, weil ihr Schwiegervater sich vor seinem Tod als liberaler erwiesen hatte, als er es im Leben je gewesen war. Niemals hätte er zu Lebzeiten zugelassen, dass eine Frau an der Spitze seines Lebenswerks das Sagen hatte. Dabei waren es seine Urgroßmutter Helene Amalie und seine Großmutter Therese gewesen, die den Grundstein für den Erfolg der Krupps gelegt hatten. Hätte Helene Amalie nach dem Tod ihres Mannes zu dem von ihm einst gegründeten Kolonialwarengeschäft nicht die Eisenhütte »Gute Hoffnung« hinzugekauft, hätte ihr Enkel Friedrich sicher nie sein Faible für Metall entdeckt. Und ohne seine Mutter Therese hätte Alfred aus dem kleinen Unternehmen seines Vaters niemals ein Weltunternehmen entwickeln können. Schließlich war er bei dessen Tod gerade mal vierzehn Jahre alt gewesen.
Margarethe setzte sich zu ihren Töchtern. Vielleicht war ihrem Schwiegervater dies ja erst beim Abfassen des letzten Willens klar geworden. Er wusste, dass das älteste Kind seines einzigen Sohnes und Erben ein Mädchen war, und hatte dennoch bestimmt, dass der jeweils erste Nachkomme das gesamte Werk übernehmen und dieses nicht aufgeteilt werden sollte. Margarethe hatte ihm immer zugutegehalten, dass die Zeiten den Frauen nun einmal weniger erlaubten und sie vor allem viel geringere Rechte hatten als die Männer. In den letzten Jahren hatte sich zwar manches geändert, aber nur langsam.
Wieder seufzte Margarethe. Wieder sahen die Mädchen von ihren Handarbeiten auf.
»Ich dachte nur gerade daran, welches Glück im Unglück wir haben«, erklärte Margarethe. »Wäre euer Vater vor drei Jahren gestorben, hätte die Stadt einen Vormund für euch bestellt, weil Frauen diese Aufgabe damals noch nicht übernehmen durften.«
Bertha und Barbara sahen einander an. »Dann hätte ein fremder Mann über unser Leben bestimmt?«
»Vermutlich hätte man Onkel Felix oder Herrn Haux bestellt«, mutmaßte Margarethe. »Vielleicht auch Papas Cousin Arthur. Immerhin geht es nicht nur um euer Leben, sondern auch um die Fabrik.«
»Entschuldigen Sie bitte, Frau Krupp, da ist ein Herr, der Ihnen kondolieren möchte.«
Die Frauen hatten nicht mitbekommen, dass ein Diener den Raum betreten hatte.
Margarethe schaute auf die an der Hosennaht liegenden Hände des Bediensteten. Keine Visitenkarte? Kein Gruß? Wer mochte der Besucher sein? Die Direktoren hatten ihre Anteilnahme bereits entboten. Ihre Mutter und ihr Bruder würden einen Tag für die Anreise benötigen.
»Wer ist es?«
Obgleich der Diener sich um einen neutralen Gesichtsausdruck bemühte, erkannte sie, dass es kein Gast war, den sie gern beherbergte.
»Herr von Keimsdorff.«
Margarethe stand auf. Sie hatte damit gerechnet, dass die Schmarotzer aus den Löchern kommen würden. Zwar wusste niemand außer Friedrichs engsten Vertrauten, dass ab heute sie die Herrscherin über das Krupp-Imperium war, aber man würde damit rechnen, dass sie in der Stunde der Trauer keine Kraft zur Gegenwehr hatte.
»Ich komme!«
Für einen Moment hatte sie den Eindruck, als husche ein verschmitztes Lächeln über den Mund des sonst so auf Contenance bedachten Dieners.
»Ich denke, wir möchten den Herrn nicht in unserer familiären Runde empfangen, auch wenn er der Neffe meiner Mutter ist.«
Bertha nickte heftig. Barbara stickte weiter an dem Deckchen, das sie begonnen hatte, als sie vom Tod ihres Vaters erfuhr.
Bevor sie zur Eingangshalle weiterging, prüfte Margarethe in ihrem Ankleidezimmer ihr Aussehen. Sollte ihr Cousin ruhig warten. Sie verteilte mit einer Quaste Puder im Gesicht, um die Spuren der Tränen zu überdecken. Waldemar von Keimsdorff sollte nicht sofort erkennen, wie traurig und verletzt sie war. Ihr Blick fiel auf den Hut, den Johanna Brandt ihr am Bahnhof überreicht hatte. Der schwarze Schleier würde den unangenehmen Mann auf Abstand halten, durch den Stoff konnte er den Schmerz in ihren Augen nicht lesen.
Margarethe schob die Haarsträhnen, die sich bei der Umarmung ihrer Töchter aus dem Knoten gelöst hatten, zurück und zählte langsam bis zwanzig, um weitere Zeit verstreichen zu lassen. Dann schob sie die Schultern nach hinten, um sich selbst Halt zu geben und eine größere Unnahbarkeit auszustrahlen.
Auf dem Weg in die Eingangshalle kam sie erneut an dem Gemälde von Friedrich an seinem Schreibtisch vorbei. In ebendieser Haltung schritt sie langsam, Stufe für Stufe, nach unten.
»Margarethe!« Waldemar von Keimsdorff kam ihr mit weit ausgebreiteten Armen entgegen, als wollte er sie umarmen.
Das hatte Margarethe vorausgesehen. Daher blieb sie auf der untersten Treppenstufe stehen, eine Hand auf dem Holzknauf am Ende des Geländers. Fast bereitete es ihr Vergnügen, auf ihren Cousin herabzusehen, der zwar ihre Körpergröße hatte, aber nun eine Stufe unter ihr stand. Innerlich dankte sie den Modeschöpfern dafür, dass sie für verheiratete Frauen Kleider mit weit ausgestelltem Rock vorsahen, sodass auf der schmalen Treppe kein Platz für eine zweite Person war.
Margarethe sah, dass Waldemar schluckte. Auch ihm war die Symbolik des Augenblicks wohl bewusst. Sie ärgerte sich bereits, dass sie nicht gleich drei Stufen höher oder auf dem Zwischenabsatz stehen geblieben war. Nicht dass er noch auf den Gedanken kam, er stünde nur eine einzige Stufe unter ihr!
»Es tut mir so leid! Wir alle trauern mit dir um den lieben Friedrich. Unser Schmerz ist unendlich. Er wird uns so sehr fehlen.« Das Tempo seiner Worte verriet, wie aufgesetzt sie waren. In Wahrheit hofften er und die Seinen darauf, mehr vom Reichtum der Krupps abzubekommen, als Friedrich zugelassen hatte.
Fast hätte Margarethe geantwortet: »Sag doch, dass euch sein Geld fehlen wird.« Aber sie zwang sich zu einem höflichen: »Danke schön. Du wirst verstehen, dass wir in diesem Augenblick keine fremden Menschen um uns haben können.«
Waldemars Gesicht nahm eine rötliche Farbe an, als hätte Margarethe ihm eine körperliche und keine verbale Ohrfeige gegeben. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch seine Cousine kam ihm zuvor.
»Die Verwaltung wird dir mitteilen, wann Friedrich beerdigt wird«, sagte sie. »Vielen Dank, dass du eure Anteilnahme persönlich übermittelt hast. Jetzt entschuldige mich bitte, es gibt viel zu tun.«
Sie wandte sich um und stieg ebenso langsam, wie sie heruntergekommen war, die Treppe wieder hinauf. In ihrem Rücken spürte sie den zornigen Blick ihres Cousins. Sie konnte sich dennoch sicher fühlen, hatten doch während des kurzen Gesprächs zwei Diener bereitgestanden, um Waldemar von Keimsdorff von einem Übergriff auf die Hausherrin abzuhalten.
Als Margarethe an Friedrichs Bild vorbeiging, wirkte sein Gesicht plötzlich nicht mehr ernst, es schien ihr vielmehr, als hätte sich der Mund zu einem zufriedenen Lächeln verzogen. Auch Margarethe erlaubte sich hinter dem schwarzen Schleier ein Lächeln. Trotz der Trauer, die sie mit jeder Faser ihres Körpers verspürte, machte sich ein sanfter Hauch von Freude breit. Durch Friedrichs Tod hatte sie an Macht gewonnen, wenigstens bis zu Berthas Volljährigkeit, und bis dahin waren es immerhin vier Jahre. Vier Jahre, in denen sie dafür sorgen konnte, dass ihre Tochter sich mit diesen Schmarotzern nicht weiter beschäftigen musste.
KAPITEL 2
November 1902
Margarethe versuchte, die Begegnung mit ihrem unverfrorenen Cousin abzuschütteln. Ihre wichtigste Aufgabe bestand nun darin, ihrem Mann durch eine würdige Beisetzung ein erstes, rasches Denkmal zu setzen. Friedrich musste wieder wegen seines Wirkens in die Köpfe der Menschen gelangen, damit die Diskussion über seinen Tod zurückgedrängt wurde …
»Frau Krupp, die Direktoren möchten Sie sprechen!« Eines der Hausmädchen kam ihr entgegen und hatte Ernst Haux und Gustav Hartmann im Schlepptau.
Margarethe unterdrückte ein Seufzen. Lieber hätte sie Zeit für sich und ihre Töchter gehabt. Doch es musste geklärt werden, wie die Arbeiter der Werke, die Geschäftspartner und die Öffentlichkeit vom Tod ihres Mannes in Kenntnis gesetzt wurden und wie die Beisetzung vonstattengehen sollte. Vermutlich hatte längst irgendjemand eine Indiskretion begangen und die Meldung an die Presse durchgestochen.
Ernst Haux hielt ihre Hand und sah sie voller Mitgefühl an. Gustav Hartmann, der nicht nur ein Vertrauter ihres verstorbenen Mannes, sondern auch der Schwager ihres Lieblingsbruders war, legte seine Hand auf ihren Arm, als wollte er ihr dadurch Kraft geben.
Margarethe blieb in der Halle stehen, um den beiden zu zeigen, dass sie keine langen Diskussionen wünschte. »Ich überlasse es Ihnen, den Weg und das Prozedere der Bestattung festzulegen. Beachten Sie aber, dass Bertha nicht derart auf dem Präsentierteller der Öffentlichkeit stehen möchte, wie es meinem Mann und mir bei Alfreds Begräbnis zugemutet wurde. Wir werden uns also im kleinsten Kreis der Angehörigen hier auf dem Hügel von Friedrich verabschieden. Ich werde meinen Bruder bitten, die Familie beim öffentlichen Leichenbegängnis zu vertreten.«
»Seien Sie versichert, dass alles in Ihrem Sinne vorbereitet wird.« Ernst Haux nahm noch einmal ihre Hand.
»Daran habe ich keinen Zweifel.« Margarethe verabschiedete sich von den Direktoren, um ein letztes Mal in das Schlafzimmer des Toten zu gehen, ehe dieser im Sarg aus dem Haus getragen werden würde.
Den Abend verbrachten die Frauen zusammen mit dem Werdener Pfarrer Geibel. Er hatte schon die Mädchen konfirmiert und würde bei der Beisetzung das kirchliche Zeremoniell übernehmen.
»Ich werde wie besprochen die Abläufe mit Herrn Haux abstimmen«, versprach der Pfarrer, ehe Johanna Brandt ihn zur Haustür begleitete.
Als Johanna danach die Halle betrat, hielt sie einige Briefe in der Hand. »Ein Bote hat gerade die ersten Kondolenzschreiben gebracht. Sehen Sie hier, ein Telegramm des Kaisers.«
Margarethe nahm das Schreiben mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie war dankbar, dass das Staatsoberhaupt offenbar umgehend auf die Nachricht reagiert hatte. Aber in ihr saß noch der Schmerz über die Abfuhr fest, die sie bekommen hatte, als sie Wilhelm vor Friedrichs Tod um Hilfe gebeten hatte. »Soeben erhalte ich die erschütternde Nachricht, dass Ihr Gemahl für uns alle unerwartet entschlafen ist«, las sie ihren Töchtern vor.
Wir erinnern uns gut an unseren Besuch bei Ihnen und Ihrem Mann im Sommer. Die Kaiserin und ich trauern tief erschüttert mit Ihnen um den Verewigten, welcher so jäh aus dem Streben gerissen ist, der ihm vom Schicksal übertragenen gewaltigen Aufgabe in strengster Pflichterfüllung gerecht zu werden. Möge Gott der Herr Ihnen und Ihren Töchtern die Kraft geben, das Schwere, das er Ihnen auferlegt hat, zu tragen.
Margarethe stiegen die Tränen in die Augen, als sie die Worte las und die persönliche Erinnerung des Kaisers an den letzten Besuch auf dem Hügel sie überwältigte. Wilhelm hatte darum gebeten, den Schießstand zu besuchen, als er zusammen mit seiner Frau zwei Tage bei ihnen gewohnt hatte. Es kam ihr so vor, als hätte sie erst gestern mit Auguste Viktoria darüber gescherzt, dass es typisch war, dass die Männer sich mit den zerstörerischen Waffen beschäftigten, während die Frauen in den Gewächshäusern begutachteten, wie neues Leben und Schönheit heranwuchsen.
An Schlaf war in dieser Nacht nicht zu denken, zu viel schwirrte Margarethe durch den Kopf: schöne Momente aus der Vergangenheit, aber auch die Bilder, die jene Gerüchte in ihr hervorriefen. Was kam jetzt alles auf sie zu? Würde sie es schaffen, ihren Töchtern Mutter und Vater zugleich zu sein? War sie den Aufgaben gewachsen, die im Unternehmen auf sie warteten? Wie sollte sie allein die Verantwortung über das Imperium tragen?
Margarethe drehte sich von einer Seite auf die andere auf der Suche nach Antworten. Sie war durchaus in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, das hatte sie in ihrer Jugend und während ihrer Anstellungen bewiesen. Aber da waren ihr die Menschen, für die sie verantwortlich war, vertraut gewesen. Das Krupp-Imperium jedoch umfasste mehr als 40.000 Beschäftigte, nur wenige davon kannte sie von ihren Wohltätigkeitsaktionen und aus Sprechstunden persönlich. Was erwarteten sie und die anderen? Und was war gut für sie?
Ihr Schwiegervater war als Herrscher über sein Reich gefürchtet gewesen. Aber die Leute hatten ihn auch respektiert, weil er nie das Wohl seiner Arbeiter aus den Augen verlor. Nachdem sich seine Frau von ihm im Unfrieden getrennt hatte, war die Organisation des Hügellebens Margarethe zugefallen. Obwohl er sich gegen ihre Hochzeit mit Friedrich gestellt hatte, hatte er stillschweigend akzeptiert und gefördert, dass seine Schwiegertochter die neue Herrin des Hügels wurde. Friedrich hatte das hiesige soziale Geflecht sowieso nicht durchschaut und ihr diesen Part bereitwillig überlassen. Stattdessen hatte er Geld in Wissenschaft und Forschung investiert und wohl auch in die Unterstützung junger Männer, wenn Margarethe glauben durfte, was sie in den letzten Wochen gelesen hatte.
Sie schüttelte die Gedanken ab, stand auf und holte eines der Fotoalben, in die sie mit viel Liebe die Fotos von ihren Reisen eingeklebt hatte. Wie oft war sie belächelt worden, weil sie selbst eine Kamera in die Hand nehmen und ihre eigenen Aufnahmen machen wollte! Dabei hatte sie die Fotografie immer fasziniert, besonders die Vorstellung, die Zeit festzuhalten und beim Betrachten der Fotos heraufzubeschwören. Sie hatte deshalb zu den Ersten gehört, die eine Kodak Nr. 1 besaßen, und sich damit das Fotografieren selbst beigebracht. Bertha und Barbara waren damals drei oder vier Jahre alt und glucksten vor Vergnügen, sobald Margarethe rief: »Hier kommt das Vögelchen!«, ehe sie auf den Auslöser drückte. Seither war kaum ein Staatsbesuch oder Familienfest, keine Ruderpartie auf dem Parkteich und kein Schlittschuhrennen der Mädchen auf der Eisbahn vergangen, ohne dass sie sie im Bild eingefangen hätte. Sämtliche Pferde waren abgelichtet worden, dazu unzählige Blüten aus der Orchideenzucht, die ihren Obergärtner Friedrich Veerhoff über die Stadt hinaus bekannt gemacht hatte.
Margarethe strich über ein Foto von ihrer Familienreise nach Capri. Friedrich und die Mädchen lagen bäuchlings an Deck ihrer Yacht, während diese im Golf von Neapel ankerte, und spielten Karten. Die Fotografien bewiesen, dass die schöne Zeit, die sie in ihrem Herzen spürte, kein Traum, sondern Wirklichkeit war.
Eine Wirklichkeit, die sich nie wieder einstellen würde. Aber die letzte, an die sie sich gern erinnerte.
Endlich war der Tag der Trauerfeier gekommen. Margarethe begrüßte ihn mit gemischten Gefühlen. Einerseits hieß es nun, endgültig Abschied von Friedrich zu nehmen. Andererseits war sie erleichtert, dass die Unruhe im Haus bald ein Ende haben würde. Kein Tag war vergangen, an dem nicht jemand kam, um ihr persönlich seine Anteilnahme auszusprechen. Ihre Mutter, ihr Bruder Felix mit seiner Frau und ihre Schwester Irene mit Ehemann hatten sich auf dem Hügel einquartiert, um ihr in dieser schweren Stunde beizustehen. Sie, das Direktorium und viele weitere Weggefährten Friedrichs erwarteten sie, als sie die obere Halle betrat.
Der sonst so heimelige Raum hatte sich in eine Trauerkapelle verwandelt. Wie überall im Haus waren auch hier zahlreiche Trauerschleifen angebracht. An den Wänden standen große Töpfe mit Farn, Gummibäumen und Zimmerlinden. Margarethe traten Tränen in die Augen beim Anblick der exotischen Pflanzen, die sie mit Friedrich von ihren ersten Reisen mitgebracht hatte. Sie war froh, dass ihr Bruder sie untergehakt hielt und sanft an ihren Platz vor dem Sarg führte, in dem ihr Mann aufgebahrt war.
Warum? Sie versuchte, diese Frage beiseitezuschieben, um sich an die schönen Zeiten zu erinnern und Friedrich für all das zu danken, was sie gemeinsam erlebt und was er ihr ermöglicht hatte. Sie musste nicht hinter sich blicken, um zu sehen, wie viele Menschen von ihrem Mann Abschied nahmen. Vertreter der Stadt, des Reiches und des Adels hatten sich eingefunden, um Friedrich eine letzte Reverenz zu erweisen, aber auch, um ihr zu zeigen, dass sie nicht nur in frohen Stunden an ihrer Seite standen.
»Wir nehmen heute Abschied von Friedrich Alfred Krupp, den der Herr viel zu früh zu sich gerufen hat«, begann der Pfarrer seine Ansprache. »Die meisten von Ihnen trauern um Herrn Krupp als Unternehmer, als Gönner, als Geschäftspartner. Aber das war nur eine Seite seines Daseins.« Der Pfarrer sah Margarethe, Bertha und Barbara lange an. »In erster Linie war Friedrich Alfred Krupp Mensch, Ehemann und Vater. Daher gestatten Sie mir, dass ich hier in diesem Raum nicht an seine Werke im Namen Krupp erinnere, sondern an sein Leben als Friedrich.«
Margarethe tupfte ein um die andere Träne aus dem Gesicht. Neben sich hörte sie Bertha und Barbara schluchzen.
»Wir verabschieden uns von Friedrich Alfred Krupp und überantworten ihn in die Hände Gottes«, drangen irgendwann die letzten Worte des Pfarrers an ihr Ohr, dann sang der Werkschor begleitet vom Krupp-Orchester Wie sie so sanft ruh’n.
Das gab Margarethe Zeit, sich zu sammeln und einen letzten Blick auf Friedrich zu werfen. Ich sorge dafür, dass dein Werk fortgesetzt wird, versprach sie ihm in Gedanken.
»Komm, Margarethe.« Felix beugte sich zu ihr und legte seine Hand unter ihren Ellbogen. Er leitete sie so, dass sie die Beileidsbekundungen der Trauergäste entgegennehmen konnte, ohne dabei auf Friedrichs Leichnam zu sehen.
Nach der Trauerfeier zog Margarethe sich gemeinsam mit ihren Töchtern und Johanna Brandt in ihre Privaträume zurück. Schlafen konnte keine der Frauen. In Gedanken waren sie bei Friedrich, der ins Stammhaus überführt wurde, wo die Werksangehörigen von ihm Abschied nehmen konnten. Margarethes Bruder Felix von Ende und Friedrichs Cousin Arthur würden dort die Familie vertreten.
In der Villa wurden Bertha und Barbara nicht müde, den letzten Abend mit ihrem Vater Revue passieren zu lassen.
»Wir haben zu Abend gegessen wie immer«, berichtete Bertha, und ihre Schwester Barbara und Johanna Brandt sprangen ihr mit der Schilderung der Speisen, die aufgetischt worden waren, zur Seite.
»Papa hat mit uns Domino gespielt«, erinnerte sich Barbara und strich traurig über die Schachtel mit den Dominosteinen auf ihrem Schoß. »Das ist das Letzte, was Papa in der Hand hatte. Er wird nie wieder seinen letzten Stein anlegen und sich über seinen Sieg freuen. Er wird mich nie wieder in den Arm nehmen und Bärbchen nennen.« Margarethe brach es fast das Herz, ihre jüngere Tochter so verzweifelt zu sehen. Sie ahnte, dass ihre Tochter sich sogar nach dem tadelnden Blick ihres Vaters sehnte, der sie immer dann traf, wenn sie wieder einmal über die Stränge geschlagen hatte. Sollte er doch tausendmal darauf verweisen, dass sich solches Verhalten für ein Krupp-Mädchen nicht gehörte, wenn er nur wieder bei ihnen wäre!
Immer wieder schwiegen die vier Frauen, und immer wieder schluchzte eine von ihnen unvermittelt auf.
»Herr Herms hat gesagt, dass er mit Herrn Donnier an Papas Bett gestanden und seine Hand gehalten hat«, sagte Barbara auf einmal. »Warum haben sie uns nicht geweckt?« Sie brach in Tränen aus. Die Vorstellung, dass ihr Vater nur wenige Meter von ihrem Schlafzimmer mit dem Tod gerungen hatte, während sie friedlich schlief, war für sie offensichtlich kaum zu ertragen.
»Euer Vater wollte euch Leid ersparen«, versuchte Johanna Brandt, die Mädchen zu trösten. Sie hatte Margarethe bereits berichtet, dass Friedrich Krupp seine Kinder nicht hatte sehen wollen, weil ihm die Kraft fehlte, ihre Trauer zu ertragen und ihnen Mut für ein Leben ohne den Vater zuzusprechen.
Margarethe blickte ihre Gesellschafterin eindringlich an. Sie wusste, dass ihr Mann noch mehr gesagt hatte. Aber auch das würde die Mädchen nur verwirren und belasten. Selbst sie verstand ja nicht, warum er im Todeskampf davon gesprochen hatte, dass er doch keinem etwas zuleide und niemandem Unrecht getan hatte. Wohin mochten die Gedanken Friedrich geführt haben? Kurz zuvor hatte er noch einen Brief an den Kaiser geschrieben und dafür gesorgt, dass dieser am gleichen Abend auf den Weg gebracht wurde. Wer würde um eine Audienz bitten, wenn er sich anschließend das Leben nehmen wollte?
Ihr Blick fiel auf die New York Times, die jemand mitgebracht hatte. Zwei Tage nach Friedrichs Tod hatte sie getitelt: »Herr Krupp did not kill himself«. Sie seufzte. Wer hätte gedacht, dass amerikanische Zeitungen mehr Verständnis für ihn zeigen würden als die Presse seines Heimatlands?
Kurz nachdem Friedrich den Auftrag erteilt hatte, den Brief unverzüglich nach Berlin zu expedieren, hatte er den ersten Anfall erlitten. Um elf Uhr hatte er nach seinem Kammerdiener geläutet, der wiederum seinen Vorgesetzten und Majordomus der Villa Theodor Herms gerufen hatte. Auf der Bettkante sitzend hatte Friedrich den beiden Männern erklärt, dass ihm auf unbestimmte Weise unwohl sei. Dennoch waren die Diener auf Friedrichs Wunsch schließlich schlafen gegangen. Irgendwann danach, so hatte es Dr. Vogt Margarethe erklärt, musste Friedrich in der Folge den todbringenden Gehirnschlag erlitten haben. Am Morgen hatte eine Kampfer-Injektion ihn noch einmal zu Bewusstsein kommen lassen, allerdings nur kurz.
Ob es stimmte, dass Friedrichs letzte Worte ihr und den Kindern gegolten hatten? Der Doktor hatte gesagt, dass Friedrich wusste, dass er im Sterben lag, und dass er ihn gebeten habe, seiner Frau zu versichern, dass er sie liebe und immer geliebt habe. Sie wiederholte in Gedanken, was der Doktor ihr noch berichtet hatte: Ich gehe ohne jeglichen Hass und Groll aus dieser Welt und verzeihe all denen, die mir so wehgetan haben.
Margarethe zog unwillkürlich die Schultern hoch. Die Worte passten zu Friedrichs letztem Telegramm. Sie passten nicht zu den Anschuldigungen auf den Titelseiten des Vorwärts. Ganz gleich, was auf dem Totenschein stand: Ihr Mann war an gebrochenem Herzen gestorben. Ihn, der so viel Gutes für seine Arbeiter und die Stadt getan hatte, hatten Missgunst und Neid getötet, die sich in Form von Gerüchten und Verleumdungen ihren Weg gebahnt hatten.
Erst spät in der Nacht gelang es Margarethe und Johanna Brandt, die Mädchen ins Bett zu schicken und sich selbst für wenige Stunden auszuruhen.
Am nächsten Tag sammelte sie früh alle Kräfte, um den Kaiser im Stammhaus zu begrüßen. Die Fenster waren schwarz verhangen, um der Trauer von Familie und Firma Ausdruck zu verleihen. Margarethe hob den Schleier ihres Hutes, als der Kaiser ihr gegenüberstand. Sie starrte auf die schwarze Schärpe, die sich von seinem schlichten, in der Taille gegürteten grauen Uniformmantel abhob.
»Eure Majestät, ich danke Ihnen, dass Sie meinem Mann diese Ehre erweisen.« Es fiel ihr schwer, ruhig zu sprechen, während Tränen in ihren Augen standen.
»Das ist doch selbstverständlich, verehrte Frau Krupp«, antwortete der Kaiser und reichte ihr die Hand.
»Bitte verzeihen Sie mir, dass Sie diesen Weg ohne mich gehen müssen.« Sie tupfte mit einem Taschentuch die Tränen ab, die ihr nun doch über die Wangen liefen.
»Das verstehe ich gut«, unterbrach Wilhelm sie. »Der Weg ist lang und schwer. Wir werden Sie auf dem Weg zu seiner letzten Ruhestätte würdig vertreten.« Er drückte noch einmal Margarethes Hand, ehe er sich mit ihren Brüdern, den Direktoren und Friedrichs Cousin auf den Weg machte, um dem Verstorbenen das letzte Geleit vom Stammhaus zum Krupp’schen Friedhof zu geben.
Obwohl Margarethe mit ihren Töchtern bewusst entschieden hatte, dass sie dem langen Trauerzug und der Beisetzung fernblieben, nagte der Zweifel an ihr. Wäre es nicht besser gewesen, sich deutlicher zu Friedrich zu bekennen? Und dann kam ihr wieder der Abschied von ihrem Schwiegervater in den Sinn. Der Gang vom Stammhaus zum Friedhof hatte nicht enden wollen. Das hätte sie nicht durchgestanden.
»Vielleicht hätten wir doch mitgehen sollen.« Offensichtlich wurde auch Bertha von Zweifeln gequält. Margarethe beruhigte sie. »Das war schon richtig, es nicht zu tun. Der Pfarrer hat doch gesagt, euer Vater hatte zwei Leben. Ein öffentliches und ein privates. Wir haben uns hier in seinem privaten Umfeld von ihm verabschiedet. Nun nimmt die Öffentlichkeit Abschied.« Sie öffnete eines der auf dem Tisch liegenden Kondolenzschreiben. »Wir werden später allein und in Ruhe das Grab besuchen.«
Bertha nickte. »Du hast recht.« Auch sie nahm einen der Briefe vom Tisch.
Am frühen Nachmittag ließ sich Ernst Haux anmelden. Margarethe schaute ihn verwundert an. »Ist etwas geschehen?«
»Keine Sorge, gnädige Frau«, beruhigte der Finanzrat sie, doch sie sah in seinem Blick, dass er nicht ohne Grund direkt nach der Grablegung auf den Hügel geeilt war.
»Der Kaiser hat sich in seiner Rede deutlich hinter Ihren Mann gestellt. Am besten lesen Sie selbst, sein Sekretär hat mir eine Abschrift der Ansprache für Sie überreicht.«
Margarethe lief ein Schauer über den Rücken, als sie die Rede las:
Die besonderen Umstände, welche das traurige Ereignis begleiteten, sind mir zugleich Veranlassung gewesen, mich als Oberhaupt des Deutschen Reiches hier einzufinden, um den Schild des deutschen Kaisers über dem Hause und dem Andenken des Verstorbenen zu halten. Eine Tat ist in deutschen Landen geschehen, so niederträchtig und gemein, dass sie aller Herzen erbeben macht. Diese Tat und ihre Folgen sind weiter nichts als Mord.«
Sie schluckte. Genauso empfand sie es auch. Friedrich hatte sich nicht selbst getötet, er war in den Tod getrieben worden von der Meute seiner Gegner. Sie schämte sich für jegliches Ressentiment, das sie gegen Kaiser Wilhelm gehegt hatte. Er war ein wahrer Freund, der sich in dieser schweren Zeit deutlich hinter sie und Friedrich stellte. »Vielleicht hilft dies ja, Friedrichs Ruf zu retten«, sagte sie schließlich.
»Ihr Mann ist tot, nichts wird ihn zurückholen.« Ernst Haux legte ihr eine Hand auf den Arm und sah sie an. »Wir können nur alles dafür tun, dass sein Werk und seine Person nicht mit weiterem Schmutz beworfen werden.«
Margarethe lächelte ihm zu. »Ab morgen werden wir um sein Werk und Berthas Erbe kämpfen. Haben Sie Dank für Ihr Bemühen.«
Sie verabschiedete den Finanzrat, den Friedrich ihr immer als vertrauenswürdigen Mann empfohlen hatte und der nun ihr engster Berater werden sollte. Sein leicht schwäbischer Akzent erinnerte sie an die Wochen, die sie als junge Frau auf der Burg der Hohenzollern verbracht hatte, und an ihre Freundin Carmen da Silva. Es war eine schöne Zeit gewesen – vielleicht sollte sie dies als gutes Omen nehmen.
KAPITEL 3
Dezember 1902
Margarethe blieben nur wenige Tage, um sich auf das neue Leben einzustellen. Sie wusste, es würde nicht leicht werden, aber ihr war auch klar, dass sie sich den Herausforderungen stellen musste. Sosehr sie die Kompetenz von Max Rötger, Ernst Haux, Otto Budde, Ludwig Klüpfel, Max Dreger und den anderen Direktoren, die Friedrich in den letzten Jahren viel abgenommen hatten, auch achtete, ahnte sie doch, dass ein jeder der Herren sein eigenes Ziel verfolgte und das Unternehmen als Gelegenheit betrachtete, persönliche Wünsche und Ideen umzusetzen. Keiner von ihnen würde für Bertha kämpfen, wie Margarethe es für nötig hielt.
Seit Friedrich so viel Zeit in Italien verbracht hatte, war die Macht der Herren gewachsen. Sie hatten ihm regelmäßig Bericht erstattet, ob sie ihn aber wirklich über alle Vorgänge im Unternehmen in Kenntnis gesetzt hatten, konnten nur die Männer selbst wissen. Sie jedenfalls würde sich nicht mit einem dekorativen Platz am Katzentisch der Firma begnügen. Frauen mochten aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden, es mochte sein, dass ihnen die Mitgliedschaft in Parteien oder Vereinen untersagt war, und von einem eigenen Wahlrecht waren sie – anders als die Neuseeländerinnen und selbst die Frauen auf einigen Südsee-Inseln – noch weit entfernt. Aber kein Gesetz verbot, dass eine Frau ein Unternehmen leitete. Beispiele dafür, dass Frauen ihren Mann stehen konnten, gab es genug, allen voran Queen Victoria oder Margarethes Freundin Elisabeth von Wied, die rumänische Königin. In deren Familie hatte sie auch von einer Namensvetterin gehört, Margarete Steiff, die auf der schwäbischen Alb trotz einer körperlichen Behinderung ihr eigenes Unternehmen aufgebaut hatte.
Das Krupp-Unternehmen musste nicht erst aufgebaut werden, es existierte bereits, drohte jetzt allerdings durch vermeintliche Eskapaden ihres verstorbenen Gatten – eines Mannes! – Schaden zu nehmen. Schlimmere Auswirkungen konnte die Herrschaft einer Frau auch nicht haben, da mochte Friedrich noch so dezidiert darauf verwiesen haben, dass Frauen einer solchen Aufgabe nicht gerecht werden könnten. Sie würde der Welt zeigen, dass Frauen mehr konnten!
Margarethe lächelte sich im Spiegel kampfeslustig zu, während sie die Haare zu einem Knoten band. Wie oft hatte sie in ihrem Leben gehört: »Ein Mädchen kann das nicht. Ein Mädchen braucht das nicht.« Immer hatte sie ihre Brüder beneidet, die lernen und alles tun durften, wonach ihnen der Sinn stand. Sie hingegen war schon früh mit Haushaltspflichten betraut worden, die ihr bis heute keine Freude bereiteten. Das Kochen, Waschen, Bügeln und Anleiten der Hausmädchen sowie die Betreuung jüngerer Geschwister mochten eine gute Schule für ihre Aufgabe als Herrin vom Hügel gewesen sein, wo sie zeitweise über fünfhundert Bedienstete instruieren musste. Befriedigt hatte sie diese Tätigkeit allerdings nie – als junges Mädchen nicht und nicht als Frau.
Als Backfisch hatte sie dafür gekämpft, eine Schule besuchen und eine Ausbildung als Lehrerin beginnen zu dürfen. Es war ein ständiges Ringen gewesen, vor allem mit ihrer Mutter, die offenbar gern Kinder bekam, aber kein Interesse an der Leitung des damit verbundenen Haushaltes hatte. Schon immer war es Eleonore von Ende wichtig gewesen, sich in der Gesellschaft zu zeigen, in die sie ihrer Meinung nach als geborene von Königsdorff und damit Nachfahrin einer alten schlesischen Adelsfamilie gehörte. Wann immer die Mutter ihre Launen bekam, hatte sie Margarethe nach Hause beordert, bis die vielen Töchter in ihrem Haus sie plötzlich störten und sie diese ziemlich unsanft vor die Tür setzte. Zum Glück waren in jener Zeit in England händeringend deutsche Lehrerinnen und Erzieherinnen gesucht worden. Vielleicht weil man am Beispiel des deutschstämmigen Königspaares Victoria und Albert gesehen hatte, wie gut die Erziehung im Deutschen Reich funktionierte. So war es Margarethe gelungen, über Referenzen ihres Lehrers, ihrer künftigen Schwiegermutter Bertha Krupp und der Baronin von der Leyen, die sie nach dem Rauswurf aus dem Elternhaus bei sich aufgenommen hatte, eine Stelle in Nordwales zu finden. Dort, auf Holy Island, durfte sie die beiden jüngsten Töchter eines Admirals im Ruhestand betreuen. Dabei hatte sie nicht nur nebenbei ihre Englischkenntnisse verbessert, sondern von ihrem Einkommen ihren Schwestern eine gute Ausbildung ermöglicht. Wenn Margarethe also eines konnte, dann war es kämpfen.
Ihr scharfer Verstand war die zweite Gabe, von der die Männer im Unternehmen bisher wahrscheinlich wenig wussten; anders als die Bediensteten, die unter Margarethes Anleitung so manches große Fest und einige diplomatische Herausforderungen bewältigt hatten.
Sie schmunzelte. Wenn die Herren Direktoren wüssten, wie viele Entscheidungen sie hatten umsetzen müssen, weil Friedrich vorher den Rat seiner Gattin eingeholt hatte!
Nachher würde sie den Herren mitteilen, wie sie sich die Zusammenarbeit künftig vorstellte. Zunächst aber wollte sie in Ruhe die Kondolenzbriefe durchsehen, die sie in den letzten Tagen zur Seite gelegt hatte. Nur einige wenige hatte sie ihren Töchtern vorgelesen, um ihnen zu zeigen, dass Friedrich – was auch immer sie in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren über ihn hören würden – ein von vielen Menschen geschätzter Mann gewesen war.
Als sie Friedrichs Büro betrat, erwarteten seine Privatsekretäre Franz Otto Müller, Otto Marotz und Rudolf Korn sie bereits.
Einen Moment lang betrachtete Margarethe den großen Schreibtisch mitten im Raum, an dem sie ihren Mann vor einigen Wochen zum letzten Mal gesehen hatte. Dann nahm sie auf dem Stuhl hinter dem Tisch Platz. Nein! Den würde sie austauschen lassen, er war hart und unbequem. Die vielen Andenken an die Reisen ihres Mannes, die überall auf dem Tisch standen, störten ihren Sinn für Ordnung, auch die würde sie wegräumen. Auf jeden Fall aber mussten die Gardinen geöffnet werden, damit sie einen Blick nach draußen hatte. Wie hatte Friedrich, dem die Natur so wichtig gewesen war, in diesem Raum arbeiten können!
Margarethe drückte den Rücken durch. Es war einiges zu tun, um das Arbeitszimmer zu ihrem zu machen. Heute aber war vor allem wichtig, zu zeigen, dass dieser Platz hier von nun an der ihre war. Ab jetzt war sie die Herrscherin über das Unternehmen.
Ihr Blick fiel auf den Stapel von Briefen und Telegrammen zu ihrer Rechten. Die konnte sie unmöglich alle durchlesen und beantworten.
»Sortieren Sie bitte die Briefe aus, die an das Unternehmen oder an das Direktorium gerichtet sind«, bat sie Otto Marotz und Rudolf Korn. »Ich werde mich zunächst um die Kondolenzgrüße kümmern, die an mich oder an die Familie geschickt wurden.«
Während die beiden Herren näher traten, um die Briefe an sich zu nehmen, sprach Margarethe bereits weiter: »Herr Müller, Sie würde ich gern unter vier Augen sprechen.«
Die anderen beiden sahen sie erstaunt an, und Margarethe war bewusst, dass sie noch aus allen Wolken fallen würden, wenn sie ihnen später mitteilte, dass sie ausschließlich Franz Otto Müller als Privatsekretär an ihrer Seite haben wollte. Vielleicht war es ein Fehler, die beiden nicht enger an sich zu binden. Schließlich waren sie oft mit Friedrich auf Capri gewesen und, wie sie inzwischen wusste, ebenfalls Mitglieder der seltsamen Bruderschaft, der Friedrich angehört hatte. Der Vorwärts würde sich die Finger nach Kronzeugen wie ihnen lecken. Sie war allerdings nicht unvorbereitet und hatte zusammen mit Max Rötger und Ernst Haux für beide Männer neue interessante Aufgabenfelder als Referenten in anderen Abteilungen des Unternehmens gefunden, die mit einer Beförderung und einem höheren Gehalt verbunden waren.
»Herr Müller, ich frage Sie ganz direkt: Wären Sie bereit, als mein Privatsekretär zu arbeiten?«, fragte Margarethe, sobald sich die Tür zum Arbeitszimmer hinter den beiden geschlossen hatte.
Franz Otto Müller sah sie erstaunt an. »Bin ich denn nicht zu alt dafür? Die beiden«, er deutete mit dem Kopf auf die Tür, hinter der seine Kollegen verschwunden waren, »kennen sich mit allem besser aus. Ihr Mann hat sie wegen ihrer Fremdsprachenkenntnisse sogar mit nach Capri genommen.«