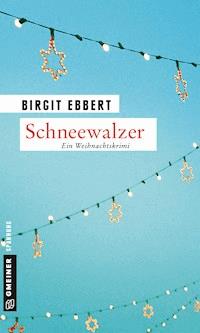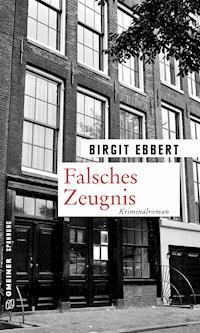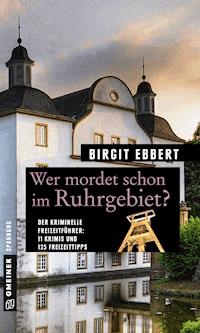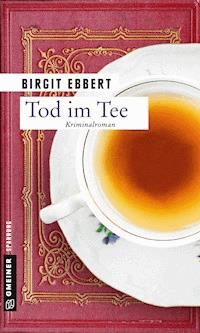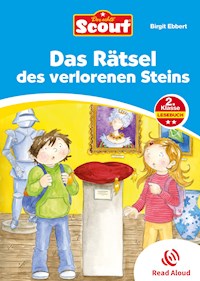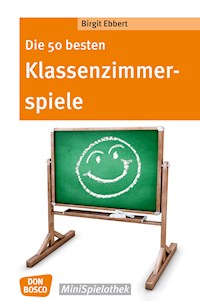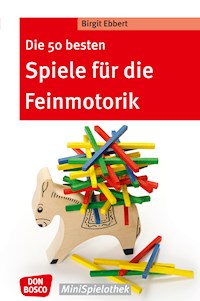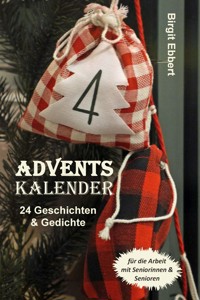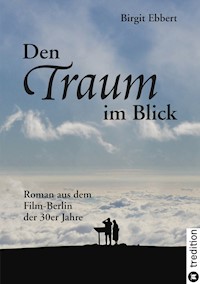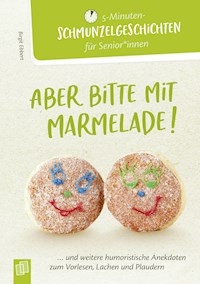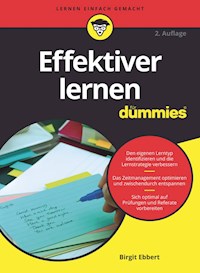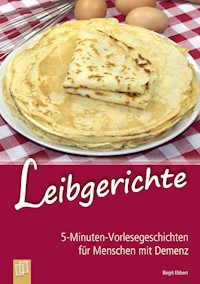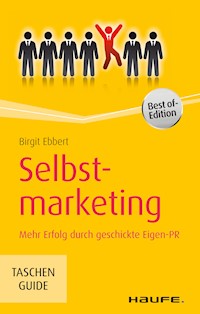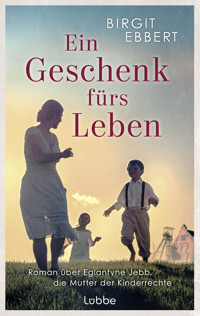
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie kämpfte für die Rechte der Kinder und machte mit ihrem Engagement so vielen ein Geschenk fürs Leben: Eglantyne Jebb
1926. Säuglingsschwester Anni reist aus dem Ruhrgebiet nach Genf, um einer Spenderin den Dank ihres Heims zu übermitteln. Von ihrer Wohltäterin Eglantyne Jebb weiß sie nur, dass ihre Hilfe nach dem Großen Krieg auch in Deutschland unzähligen Kindern das Leben rettete. Schnell merkt sie: Die Lebenswelt ihrer berühmten Gastgeberin könnte sich von ihrer eigenen nicht deutlicher unterscheiden. Eglantyne Jebb ist Akademikerin, stammt aus einer vermögenden britischen Familie und kämpft seit Jahren für die Rechte der Kinder. Anni selbst ist ein Bergarbeiterkind, für das die Ausbildung zur Säuglingsschwester schon ein unglaublicher Aufstieg ist. Eins aber eint sie: der Wunsch, etwas zu bewegen, damit die Welt ein besserer Ort wird ...
Das lebendig geschriebene Porträt einer fast vergessenen Frau, von deren Wirken noch heute Millionen Kinder profitieren
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Epilog
Nachwort
Historische Daten des Lebens von Eglantyne Jebb
Dank
Über das Buch
1926. Säuglingsschwester Anni reist aus dem Ruhrgebiet nach Genf, um einer Spenderin den Dank ihres Heims zu übermitteln. Von ihrer Wohltäterin Eglantyne Jebb weiß sie nur, dass ihre Hilfe nach dem Großen Krieg auch in Deutschland unzähligen Kindern das Leben rettete. Schnell merkt sie: Die Lebenswelt ihrer berühmten Gastgeberin könnte sich von ihrer eigenen nicht deutlicher unterscheiden. Eglantyne Jebb ist Akademikerin, stammt aus einer vermögenden britischen Familie und kämpft seit Jahren für die Rechte der Kinder. Sie selbst ist ein Bergarbeiterkind, für das die Ausbildung zur Säuglingsschwester schon ein unglaublicher Aufstieg ist. Eins aber eint sie: der Wunsch, etwas zu bewegen, damit die Welt ein besserer Ort wird …
Über die Autorin
Birgit Ebbert ist freie Autorin und lebt im Ruhrgebiet. Als Diplom-Pädagogin schreibt sie Ratgeber und Lernhilfen sowie Kinderbücher und Erinnerungsgeschichten für die Arbeit mit Seniorinnen und Senioren. Seit ihrer Dissertation über Erich Kästner ist sie fasziniert von der deutschen Geschichte, was sich in ihrer Literatur widerspiegelt. In Kurzgeschichten und Romanen zeigt sie, dass hinter Geschichte immer auch Leben und Geschichten stecken.
Weitere Titel der Autorin bei Lübbe:
Die Königin von der Ruhr
BIRGIT EBBERT
Ein
Geschenk
fürs
Leben
Roman über Eglantyne Jebb, die Mutter der Kinderrechte
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Birgit Ebbert wird vertreten durch Agentur Schuldes
Copyright © 2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Dr. Frank Weinreich, Bochum
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Covermotiv: © Elisabeth Ansley – trevillion.com; © jakkapan – stock.adobe.com; Bildagentur Zoonar GmbH – shutterstock.com
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-7517-7467-3
Sie finden uns im Internet unter http://luebbe.de/
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de/
If we want the world to be a better place, obviously the first necessity is that the children should have what is essential for their physical, mental and moral wellbeing.
Wenn wir wollen, dass die Welt ein besserer Ort wird, ist zweifellos von höchster Notwendigkeit, dass die Kinder alles bekommen, was sie für ihr körperliches, geistiges und moralisches Wohlbefinden brauchen.
Eglantyne Jebb
Kapitel 1
1926 Gelsenkirchen – Buer – Genf
Anni klebte mit ihrem Kopf fast an der Scheibe des Zugabteils. Sie konnte sich einfach nicht sattsehen an den hohen dunkelgrünen Tannen, den Bergen und putzigen kleinen weißen Häuschen, die zwischen den Bäumen hervorblitzten. Seit die Morgensonne sie in ihrem Sitz durch das kleine Fenster aus dem Schlaf gekitzelt hatte, in den sie trotz der ungewohnten Geräusche des Zuges gefallen war, starrte sie in die Landschaft hinaus. Die hellen, freundlichen Fassaden der Häuser entlang der Bahnstrecke waren ganz anders als die Wände, die sie aus ihrer Heimat kannte. Zwar behauptete ihre Großmutter, dass sie in ihrer Kindheit noch helle Häuser in der Gegend erlebt hatte, aber das war für Anni bisher nicht vorstellbar gewesen. Für sie waren Häuser grau, selbst die Villen, in denen die wohlhabenden Bürger lebten, wiesen nicht dieses strahlende Weiß auf, das hier im Süden des Reiches zwischen den Fachwerkbalken hervorstrahlte.
»Entschuldigung, gnädiges Fräulein, unser nächster Halt ist Basel.«
Anni sah den Schaffner verwundert an. Die Zeit war wie im Flug vergangen, während sie immer neue Dinge vor dem Fenster entdeckte. »Das ist schon in der Schweiz, oder?« Sie gab sich Mühe, hochdeutsch zu sprechen, wie es ihr die Oberschwester eingetrichtert hatte. Auch wenn sie erst einundzwanzig Jahre alt war, verstand sie, was es hieß, das Säuglingsheim, die Pflegeschule, die Stadt, ja alle Menschen des Ruhrgebiets im Ausland zu vertreten. Es kam schließlich nicht oft vor, dass eine von ihnen, kein Politiker, sondern eine Säuglingsschwester, in das Land der Schokolade und Uhren reiste, um einen Gruß von der Ruhr zu übermitteln.
Der Schaffner nickte Anni freundlich zu. »Genau. Das ist der erste Halt in der Schweiz. Dort werden die Grenzbeamten zusteigen, und wir haben Aufenthalt, bis alle Papiere geprüft sind. Bitte halten Sie Ihre Pässe bereit.«
Anni wurde heiß. Das war also jetzt der Moment, vor dem sie bangte, seit Schwester Reinhild sie gebeten hatte, im Namen des Heims ein Dankschreiben nach Genf zu bringen, um es einer völlig unbekannten Frau zu überreichen. Sie spähte zu dem Koffer über sich im Gepäcknetz. War die Karte mit dem kleinen Gemälde des Säuglingsheims und den Unterschriften noch dort? Hatte der Koffer nicht anders dagelegen, bevor sie eingenickt war? Sie sprang auf.
»Was ist denn? Haben Sie Ihre Papiere vergessen?« Der Schaffner sah Anni besorgt an. »Dann sagen Sie es lieber sofort, damit wir nicht Ihretwegen einen längeren Aufenthalt haben.«
Kam es Anni nur so vor, oder wurde der Ton schärfer? »Nein, nein … ich meine, ja. Ja, ich habe meine Papiere dabei.« Sie blickte weiterhin wie gebannt auf das Gepäcknetz, als könnte sie damit ihren Koffer beschützen und einen möglicherweise lange vorher begangenen Diebstahl ungeschehen machen. »Mir ist nur … die Papiere sind im Koffer.« Was redete sie für einen Unsinn? Sie wusste doch, dass der Pass in der Umhängetasche bei der Fahrkarte war!
Das freundliche Lächeln erschien wieder auf dem Gesicht des Schaffners, und er wandte sich dem älteren Mann zu, der in Freiburg zugestiegen war. »Sie kennen sich ja aus. Vielleicht können Sie dem Fräulein etwas behilflich sein. Beim ersten Mal schüchtern Zollformalitäten doch ein bisschen ein.«
Anni reckte sich, um den Koffer aus dem Netz zu holen. Obwohl sie sich auf die Zehenspitzen stellte, was laut ihrer Mutter nicht gut für die neuen Schuhe war, konnte sie den Griff nicht erreichen. Hätte sie beim letzten Umsteigen doch nur diesem jungen Mann mit dem schelmischen Grinsen nicht erlaubt, den Koffer ins Netz zu heben. Der Junge war längst ausgestiegen, und der Koffer lag unerreichbar im Gepäcknetz.
»Warten Sie!« Der Schaffner kam zurück und hob mit einer Leichtigkeit, über die Anni nur staunen konnte, den Koffer aus dem Netz. »Die Grenzbeamten werden ohnehin nachschauen wollen, ob Sie nichts schmuggeln.«
Wieder sammelte sich Schweiß auf Annis Stirn und unter den Achseln. Niemand hatte ihr gesagt, dass sie ihren Koffer vor wildfremden Menschen öffnen musste. Sie ging in Gedanken durch, was sie eingepackt hatte. Die Reise war für eine Woche geplant, zwei Tage im Zug für die Hinfahrt, zwei Tage für die Rückfahrt und drei Tage in Genf bei der Cousine der Oberschwester. Die Dame war nicht das Ziel der Reise, aber Schwester Reinhild fand es nicht angemessen, Frau Jebb, die eigentliche Adressatin des Dankschreibens, mit dem Wunsch nach Logis für die Botin zu belästigen. Und die Übernachtung in einem Hotel schickte sich für eine alleinreisende 21-Jährige nicht. Es war ohnehin erstaunlich, dass das Komitee Annis Reise zugestimmt hatte. Die Oberschwester hatte ihr verraten, dass niemand sich Gedanken gemacht hatte, dass eine so junge Teilnehmerin den ersten Preis gewinnen könnte. Aber der war nun einmal die Reise nach Genf, um Eglantyne Jebb, der Gründerin der Stiftung Save the Children, die den Aufbau des Säuglingsheimes mit Nahrungsmittelspenden unterstützt hatte, einen Dank zu überbringen. Alle aktuellen und ehemaligen Schwestern des Heims, alle Lehrkräfte der Säuglingspflegerinnenschule, sogar Mütter, deren Kinder vor fünf Jahren in den Genuss der gespendeten Lebensmittel gekommen waren, durften einen Aufsatz zum Thema »Wie verschaffen wir unseren Babys eine friedliche Welt?« einreichen, und dazu gehörte Anni nun einmal.
»Fräulein! Könnten Sie sich vielleicht endlich hinsetzen, ich muss meinen Koffer auch herunterholen.« Der Mann, der bis eben ruhig in seinem Sitz gesessen hatte, stand vor Anni und funkelte sie wütend an. »Sie stehen hier schon ein paar Minuten. Sind Sie eingeschlafen? Diese Jugend von heute!«
Anni ließ sich auf ihren Platz fallen. Der Mann hatte ja recht. Der Hinweis auf die Kontrolle des Koffers hatte sie durcheinandergebracht. Das hätte ihr wirklich jemand sagen können. Dann hätte sie das Stückchen Kohle, das Ferdinand ihr zusammen mit einer Taube aus Papier am Bahnhof zugesteckt hatte, nicht angenommen. Sie hatte sich ohnehin geärgert, dass ihr Freund überhaupt erschienen war, um Abschied zu nehmen. Sonst hatte er nie Zeit für sie, weil er andauernd mit seinen Brieftauben herumturtelte. Aber für ihre Abreise konnte er sich auf einmal von diesen Viechern trennen! Sie seufzte. Natürlich tat sie ihm unrecht. Dass er vor der Spätschicht extra zum Bahnhof gehetzt war, sollte ein Zeichen seiner Zuneigung sein. Und dann noch das Kohlestückchen, das er selbst aus dem Flöz geholt hatte. Das alles machte es nicht leichter, in der Ferne darüber nachzudenken, ob er wirklich der Mann war, mit dem sie eine Familie gründen wollte. Sie war ihm von Herzen zugetan, aber bis heute hatte sie oft den Eindruck gehabt, bei ihm stünden die Tauben an erster Stelle. Die Reise nach Genf war ihr als gute Gelegenheit erschienen, sich über ihre Gefühle klar zu werden. Zu Hause arbeitete ihre Mutter ja bereits an der Aussteuer, die ersten Monogramme waren in Handtücher gestickt, und wenn sie meinte, Anni bekäme es nicht mit, häkelte sie an einer filigranen Tischdecke für die künftige gute Stube ihrer mittleren Tochter.
»Grenzkontrolle! Ihre Papiere bitte!«
Obwohl Anni die Grenzbeamten erwartet hatte, zuckte sie zusammen. Die ganze Fahrt hatte sie geschlafen oder aus dem Fenster gesehen und nicht an zu Hause gedacht. Ausgerechnet hier, wo ihre volle Aufmerksamkeit gefordert war, schlichen sich ihre Gedanken fort in die Heimat. Mit einem Ruck zog sie den Pass, der extra für die Reise ausgestellt worden war, aus der Umhängetasche, die ihre ältere Schwester Maria ihr für die Fahrt genäht hatte. Sie hielt dem Mann den Ausweis und das Schreiben der Schweizer Stiftung hin, die sie besuchen würde.
»Das brauche ich nicht!« Der Grenzer gab ihr den Brief zurück und schlug das Ausweisdokument auf. Er verglich das Foto darin mit Anni und fragte dann: »Haben Sie etwas zu verzollen?«
Anni wurde blass. Was wollte der Mann von ihr? War das so etwas wie Bestechungsgeld? Sie hatte in einem Roman davon gelesen. »Was heißt das?«
Der Grenzbeamte lächelte nachsichtig. »Das ist wohl Ihre erste Reise in ein fremdes Land, was?«
»Ich war schon in Holland!«, berichtete Anni stolz. Aber das war ihre Abschlussfahrt in der Volksschule, und da hatte die Klassenleitung sich um alles gekümmert.
»Dann wissen Sie ja, dass man beim Übertritt von einem Land in das andere mitteilen muss, wenn man wertvolle Fracht im Gepäck hat.« Der Beamte blieb freundlich. »Was haben Sie denn in Ihrem Koffer?«
Anni zerrte an den Lederschnallen, mit denen sie zu Hause den Pappkoffer geschlossen hatte.
»Lassen Sie nur!« Der Zollbeamte winkte ab. »Sagen Sie mir einfach, was darin ist.«
Anni sah sich verschämt um, ehe sie flüsterte: »Unterwäsche, zwei Kleider, ein zweites Paar Schuhe, ein Buch und ein Bild, das unsere Oberschwester Reinhild vom Säuglingsheim gemalt hat.«
»Ach, sind Sie Krankenschwester? Meine Frau auch. Das ist ja so ein wichtiger Beruf! Da wünsche ich Ihnen eine angenehme Weiterreise.« Damit wandte sich der Grenzbeamte dem Mann zu, der die ganze Zeit gebannt zugehört hatte. Anscheinend hatte er tatsächlich mehr Erfahrung mit Grenzübertritten als sie, denn eine Minute später waren sie wieder allein im Abteil und verstauten gleichzeitig ihre Papiere.
»Sie verreisen wohl zum ersten Mal, junges Fräulein, gell?«, fragte der Mann, während er seinen und ihren Koffer wieder im Gepäcknetz verstaute.
Es war Anni unangenehm, dass der Mann sie ansprach, zumal seine seltsam singende Sprache so ganz anders klang als die Melodie ihrer Heimat. Ob Frau Jebb auch so redete? Sie wusste kaum etwas über die Frau, wegen der sie die lange Reise unternahm, nur, dass sie nach dem Krieg in Gelsenkirchen gewesen war, um dem Säuglingsheim Nahrungsmittel zu schenken. Wie alt mochte sie sein? Wenn sie Essen spenden konnte, musste sie Geld haben. Waren ihre Eltern reich? Hatte sie einen Mann? Und Kinder? Je mehr sie über diese Frau nachdachte, umso größerer wurde ihre Unsicherheit. Sonst waren immer Menschen um sie herum, die sie kannte und die ihr Sicherheit gaben. Nun war sie ganz auf sich gestellt. Sie wandte sich zum Fenster, wo Bäume viel zu schnell vorbeiflogen. In der Ferne meinte sie sogar Schnee oben auf den Bergen zu sehen.
»Ja, schauen Sie nur.« Der Mann ließ sich von ihrem Schweigen nicht an seinem Versuch hindern, mit ihr ins Gespräch zu kommen. »Die Schweizer Berge sind etwas anderes als die Hügel im Schwarzwald, gell?«
Anni musste lachen. Was der Mann Hügel nannte, war sicher zehnmal so hoch wie die Halden in ihrer Heimat, selbst die Fördertürme ragten dort höher hinaus als die kleinen Erhebungen nördlich der Ruhr. Sie wollte sich eigentlich nicht auf ein Gespräch einlassen, aber sie war neugierig, was es mit dem schwarzen Wald auf sich hatte. Der Zug war bisher nur durch grüne Bäume gefahren; keine Spur von schwarzen Baumkronen. »Was ist der Schwarzwald?«
»Die Gegend, durch die wir zuletzt gefahren sind, heißt Schwarzwald.« Er lächelte. »Zu dem Namen gibt es eine schöne Geschichte. Man sagt, dass vor zweitausend Jahren die Römer im Schwarzwald waren, und weil sie nur dunkle Bäume vorfanden, haben sie die Gegend ›silva nigra‹ genannt. Das ist Lateinisch und heißt schwarzer Wald. Aber den haben wir längst hinter uns gelassen. Nun liegen rechts der Bahnstrecke die Schweizer Alpen, und die sind zwei- bis dreimal so hoch wie der höchste Berg im Schwarzwald.«
»Und wie hoch ist der?«
»Der Feldberg ist der höchste Berg im Schwarzwald, er misst 1492 Meter.«
Anni spürte einen Stolz in der Stimme des Mannes, als hätte er den Berg höchstpersönlich in diese Region versetzt, und zeigte sich beeindruckt. »Das sind 30 Fördergerüste.«
»Fördergerüste?« Der Mann sah Anni erstaunt an. Sie freute sich ein wenig, dass auch er nicht alles wusste, obwohl er ihr mit seinem Anzug, der Krawatte, den glatten Haaren, die wie angeklebt wirkten, und dem Monokel wie ein kluger Professor vorkam.
»Das sind die Gerüste, mit denen die Förderkörbe unter Tage gebracht werden«, erklärte Anni und wandte sich wieder den Bergen vor dem Fenster zu, um zu prüfen, ob das Weiße auf den Gipfeln nicht doch Schnee war.
»Woher kommen Sie?« Der Mann, der zuvor so selbstsicher wirkte, war sichtlich verwirrt.
»Aus Buer«, antwortete Anni, ohne den Blick von der Umgebung zu wenden.
»Das habe ich noch nie gehört«, gab der Mann zu.
Anni sah ihn an. »Dann steht es jetzt eins zu eins. Ich habe auch noch nie vom Schwarzwald gehört.«
»Eins zu eins? Das gibt es doch nur im Fußball!« Der Mann runzelte die Stirn.
»Damit kenne ich mich aus«, erklärte Anni und entschied, dass sie die restliche Fahrzeit ebenso gut im Gespräch verbringen konnte, denn vor dem Fenster änderte sich nichts an der Landschaft. Auf Dauer wurde das eintönig und bot ihr nur Gelegenheit, ihren Gedanken freien Lauf zu lassen, die dann gleich wieder zu dieser unbekannten Frau sprangen, mit der sie die nächsten Tage verbringen sollte. Sie spürte, wie ihr Magen knurrte, und fragte sich sofort, was es bei Frau Jebb wohl zu essen gab. Ihre Mutter versuchte, möglichst Speisen zuzubereiten, die ihre Kinder mochten. Sie war froh, dass ihr Mitfahrer sie mit seinem Geplapper ablenkte.
»Danke, das interessiert mich nicht besonders. Ich erzähle dir aber gerne etwas über die Berge hier, auch wenn ich im Schwarzwald lebe.« Der Mann holte ein flaches silbernes Etui aus der Tasche und bot Anni eine Zigarette an. Sie schüttelte den Kopf. Wie sollte sie ihm höflich beibringen, dass sie keinen Rauch in dem Abteil haben wollte? In der Schule hatten sie gelernt, dass der Rauch und der Teer aus Zigaretten für Babys gefährlich waren. Sie war zwar kein Baby, aber der Doktor, der den Unterricht gegeben hatte, meinte, Zigaretten könnten auch Erwachsenen schaden und überhaupt all denen, die den Rauch einatmeten. Erleichtert stellte sie fest, dass der Mann mit einem bedauernden Blick auf sie das Etui wieder einsteckte.
»Wie hoch ist denn so ein Fördergerüst?«, knüpfte er an das Gespräch vor dem Fußballvergleich an.
»Etwa 50 Meter!«, antwortete Anni wie aus der Pistole geschossen. Das hatten sie in der Schule auswendig lernen müssen. Jedes Fördergerüst hatte eine andere Höhe, manche maßen nur dreißig, andere waren sogar sechzig oder siebzig Meter hoch, aber als Mittelwert mussten sie fünfzig Meter kennen.
Der Mann lachte. »Dann ist der Feldberg tatsächlich so hoch wie dreißig Fördergerüste. Und in die Schweizer Berge würden mindestens neunzig passen!«
Anni nickte. So viel rechnen konnte sie, auch wenn sie kein Monokel trug. Aber wenn der Mann ihr schon das Gespräch aufzwang, wollte sie wenigstens eine Sache wissen. »Wieso sind die Bergspitzen so weiß?«
»Das sind die Gletscher. Dort oben liegt das ganze Jahr Schnee auf dem Eis.«
Anni versuchte, eine solche Stelle draußen ausfindig zu machen. »Unglaublich. Ganz weiß«, murmelte sie. »Ich kenne keinen weißen Schnee!«
»Was?« Der Mann starrte sie an. »Schnee ist doch immer weiß.«
»Nicht bei uns!«, widersprach Anni. Sie musste es schließlich wissen. Wenn der Schnee im Winter durch die Schicht aus Kohlenstaub in der Luft auf der Wiese landete, war er bereits leicht grau und manchmal sogar dunkelgrau geworden. Weißen Schnee kannte sie nur aus den Beschreibungen in Märchen.
»Meine Damen und Herren! In wenigen Minuten erreichen wir Bern! Mesdames et Messieurs. En seulement quelques minutes nous atteignons Bern.«
Die Stimme aus dem Lautsprecher schreckte den Mann auf. »Schade, ich muss mich leider verabschieden, meine Fahrt endet hier. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Weiterreise.« Sprach’s, packte seinen Koffer und war durch die Abteiltür verschwunden.
Anni seufzte. Vor dem Fenster waren Felsen, Berge, Bäume und Häuser zu sehen, aber inzwischen war ihr Kopf voll davon, und sie hätte sich gerne mit jemandem unterhalten, der ihr mehr über den Schwarzwald oder die Schweiz erzählte. Während sie sich ausmalte, ob sie lieber einen jüngeren oder älteren Mann oder eine jüngere oder ältere Frau neben sich hätte, fielen ihr die Augen zu. Die unruhige Nacht forderte ihren Tribut. Anni wachte erst auf, als der Schaffner sie an der Schulter berührte und darauf hinwies, dass sie beim nächsten Halt aussteigen müsse.
»Das ist dann Genf! Die Stadt des Völkerbundes, auf die in dieser Zeit die ganze Welt schaut.« Er reckte sich und holte mit Schwung Annis Koffer aus dem Gepäcknetz.
»Danke schön!« Anni lächelte. Zu gerne hätte sie nachgefragt, wie der Völkerbund aussah und ob sie ihn besichtigen konnte, aber der Zug wurde bereits langsamer, und sie musste mit ihrem Koffer noch ein Stück durch den Gang gehen, auf dem viele Reisende mit Zigaretten standen.
Rasch stand sie auf und zog die leichte Jacke über ihr weit ausgestelltes Baumwollkleid, dessen Saum in den Kniekehlen kitzelte. Sie wäre ja ohne Jacke gefahren, schließlich war die Augustsonne warm und größere Ausflüge waren in den drei Tagen wohl kaum vorgesehen. Ihre Mutter hatte jedoch darauf bestanden, dass sie die Jacke mitnahm, da man nie wissen könne, wie das Wetter im Ausland sei und was Frau Jebb für sie geplant hatte. Als sie damit kämpfte, das Gleichgewicht zu behalten, während die Eisenbahn weiter an Geschwindigkeit verlor und schließlich mit leichtem Schlenkern in den Bahnhof einfuhr, entdeckte sie einen Spiegel. Einige Strähnen hatten sich über Nacht aus dem Kranz gelöst, den sie aus ihren lockigen kastanienroten Haaren um den Kopf gebunden hatte. Sie liebte es, wenn der Wind um ihre kleinen Ohren, auf die sie so stolz war und die Ferdinand so mochte, wehte. Noch schöner stellte sie es sich vor, wenn die Böen die Haare um den Kopf bliesen. Aber ihre Mutter war der Meinung, dass diese neue Frisur, die jetzt die Filmschauspielerinnen trugen, nicht zu einer kleinen, unbedeutenden Säuglingspflegerin aus Buer passte.
Der Ruck, der durch den Zug ging, schleuderte Anni nach vorne. Sie konnte sich im letzten Moment fangen. Ohne darauf zu achten, ob ihr Kleid knitterfrei unter der Jacke lag, schnappte sie ihren Koffer und fühlte, ob die Umhängetasche mit den Papieren weiterhin an ihrer Seite hing, das Trageband diagonal über Brust und Rücken gespannt, sodass sie ihre Hände frei hatte. Die brauchte sie, wenn sie den Brief von Frau Jebb aus dem Reisepass nehmen wollte. Wie hieß noch diese Organisation, die einen Fahrer zum Bahnhof schicken würde? Und wieso hatten sie keinen festen Treffpunkt vereinbart? Ihre Sorge wuchs, als sie durch das Guckloch an der Ausstiegstür auf den Bahnsteig blickte. Auf dem Hauptbahnhof in Gelsenkirchen war viel los, vor allem da dort auch acht Jahre nach Kriegsende noch immer Flüchtlinge eintrafen, die durch den großen Krieg Heim und Heimat verloren hatten. Aber das war nichts gegen das Gewusel, das hier entlang der scheinbar unzähligen Gleise herrschte.
Endlich stand der Wagen, und Anni gelang es, sich mit dem Koffer bis zum Ausstieg zu lavieren. Sie wartete, bis die Tür von außen geöffnet wurde, und nahm dankbar die Hand des Schaffners, der ihr beim Betreten der beiden Gitter half, die als Stufen dienten.
»Kommen Sie zurecht?«, wollte der Mann wissen, war aber verschwunden, ehe Anni antworten konnte. Unsicher ließ sie ihren Blick über den Bahnsteig schweifen, bis sie eine Treppe entdeckte. Zielstrebig marschierte sie mit dem Koffer in der Hand darauf zu. Ehe sie in der Unterführung abtauchte, fielen ihr zwei Gleise weiter Menschen mit weißen Schildern auf. Womöglich standen darauf die Namen der Herrschaften, die abgeholt werden sollten, dann musste in deren Nähe der Ausgang sein.
Anni kam es so vor, als würde der Koffer immer schwerer, je mehr Stufen sie hinunterstieg. Ein paar Schritte lief sie durch einen Tunnel, und dann ging es Stufe für Stufe wieder ans Licht. Jetzt konnte sie auch die Schilder erkennen. Dort standen tatsächlich Namen. Sie seufzte. Schwester Reinhild hatte ihr aufgetragen, eine Droschke zur Promenade du Pin 1 zu nehmen, wo sich neben der Zentrale des Internationalen Roten Kreuzes auch das Büro der Stiftung von Frau Jebb befand. Für diese Fahrt hatte sie extra einen Fünfer bekommen. Dabei hatte die Oberschwester im selben Atemzug die Hoffnung verkündet, dass in Genf, der Stadt des Völkerbundes, ganz sicher alle Droschkenfahrer Deutsch verstehen und sprechen würden. Das fiel Anni wieder ein, und schon war auch das letzte Wort Französisch, das sie vorbereitet hatte, aus ihrem Kopf verschwunden. Einfach weg. Nicht einmal »Bitte« oder »Danke« hatte sie in der fremden Sprache mehr parat. Umso größer war ihre Erleichterung, als sie auf einem Schild ihren Namen entdeckte. Ihr fiel ein Stein vom Herzen. Erst jetzt wurde ihr bewusst, welche Angst sie vor dieser Ankunft gehegt hatte. Große Städte schüchterten sie ein, da fühlte sie sich gleich wieder wie damals auf der Kirmes, als sie ihre Eltern verloren hatte und nicht wusste, was sie tun sollte.
»Sind Sie Fräulein Schlinkert?« Anni hatte Mühe, den Mann in Livree zu verstehen, für den es sicher ebenso ungewohnt war, Deutsch zu sprechen wie für sie Französisch. Aber ihren Namen verstand sie, und auf dem Schild stand unverkennbar: »Fräulein Schlinkert! Save the Children heißt Sie herzlich willkommen.«
Sie lächelte den Mann an und nickte. »Ja!« Fieberhaft versuchte sie, sich zu erinnern, was die Kolleginnen ihr eingetrichtert hatten. Was hieß im Französischen ja? Yes? Si? Oui? Genau, das war es. Hastig schob sie ein »Oui« nach und entnahm dem Lächeln im Gesicht des Mannes, dass sie ins Schwarze getroffen hatte. Er griff mit der linken Hand nach ihrem Koffer und gab ihr mit der rechten Hand ein Zeichen, ihm zu folgen.
Vor dem Bahnhof staunte Anni nicht schlecht. Dort fuhren Pferdedroschken und Automobile friedlich hinter- und nebeneinanderher. Ein rotbraunes Pferd wieherte, als sie sich einer Kutsche näherten. Der Mann hob den Koffer auf deren Sitzbank und hielt Anni seinen Arm hin, damit sie sich beim Einsteigen aufstützen konnte. Dann schwang er sich auf den Kutschbock, schnalzte mit der Zunge, und sofort setzte sich das Pferd in Bewegung. Anni war beeindruckt, das hätte ein Automobil nicht schneller geschafft. Im Gegenteil, sie sah doch, wie sich manche Fahrer abmühten und erst lange eine Kurbel drehten, bis so ein motorisiertes Vehikel einen Mucks von sich gab. Dann mussten sie auch noch die Kurbel verstauen, ehe sie losfahren konnten. Zu dem Zeitpunkt hatte sich ihr Kutscher längst in den Verkehr eingefädelt.
Gerne hätte Anni die Häuser und Menschen, Pflanzen und Denkmäler am Straßenrand genauer betrachtet, je näher sie jedoch ihrem Ziel kamen, desto nervöser wurde sie. Bisher war sie halbwegs entspannt gewesen, nachdem sie vor ihrer Abreise einen wunderbaren Reisebericht über die Schweiz aus der neuen Bücherei gelesen hatte. Zu Hause hatten sie außer der Bibel und einem Universallexikon keinerlei Bücher, aber Herr Wohlgemuth, der die Bücherei leitete, hatte ihr den Band beschafft. Doch jetzt, wo die Häuser und Straßen so nah waren, fragte sie sich, worauf sie sich da eingelassen hatte.
Kapitel 2
1881 Ellesmere
Die rotblonden Locken der vierjährigen Eglantyne flogen um ihren Kopf, als sie zwischen der Veranda des Landhauses, in dem sie mit ihren Eltern und vier Geschwistern lebte, und dem Bett der Mutter im großen Schlafzimmer hin und her rannte. Beide Orte im Haus übten an diesem 3. März ihren ganz besonderen Reiz aus. In der Kammer der Eltern wurde minütlich die Ankunft des neuen Geschwisterkindes erwartet, und auf der Veranda waren die Hausmädchen und ihre älteren Schwestern Em und Lill dabei, die Bücher aus Vaters Bibliothek zu entstauben. Nicht dass es Eglantyne, den beiden Schwestern und ihrem Bruder Richard, den alle nur Dick nannten, untersagt wäre, nach Herzenslust in der Bibliothek zu stöbern. Beim Entstauben tauchten allerdings immer wieder Bücher auf, die sie nicht kannten, und manchmal fielen Blüten heraus, die sie im Sommer zum Trocknen zwischen die Seiten gelegt und längst vergessen hatten. Alle Kinder von Arthur und Tye Jebb liebten die Natur, was nicht verwunderlich war angesichts des riesigen Gartens rund um das Anfang des Jahrhunderts erbauten Landhauses, das Arthurs Vater 1838 für seine Familie gekauft hatte. Es war umgeben von allen Schönheiten, die die englische Natur bereithielt – Seen, Berge, Wald. Und im Garten boten Bäume und Wiesen auch der Vierjährigen unzählige Gelegenheiten, mit ihrem Bruder zu klettern, zu toben, Cricket zu spielen und mit den Hunden herumzutollen. Die Veranda war jetzt noch kahl, Rosen und Clematis warteten darauf, dass es richtig Frühling wurde, und störten die Entstaubungsarbeiten der Familie nicht.
»Es ist ein Mädchen!«, erscholl die resolute Stimme einer Frau aus dem Haus, die extra für diesen Tag hergekommen war.
Sofort ließ Eglantyne das Buch fallen, das sie gerade hatte ausschütteln wollen. Ihre Schwestern lachten. »Das Baby läuft doch nicht weg«, stellte Em fest und blätterte in dem Buch, das sie gerade in der Hand hielt. Sie sah Lill an und kicherte. »Aber du bist ja selbst noch fast ein Baby. Guck du nur.«
Eglantyne ließ sich davon nicht beirren, sie rannte in das Schlafzimmer der Eltern. Die fremde Frau, von der Em und Lill behaupteten, dass sie auch am Tag von Eglantynes Geburt im Haus gewesen sei, hatte sie vor einer halben Stunde aus dem Zimmer geschickt. Angeblich sei diese Frau, die das Hausmädchen Hebamme nannte, im letzten Jahr, als Gamul plötzlich auftauchte, ebenfalls bei der Mutter gewesen. Das erschien Eglantyne als nicht glaubhaft, weil die Großeltern steif und fest behaupteten, der Storch brächte die Babys. Aber wie ein Storch sah diese Hebamme bestimmt nicht aus. Deshalb hatte Eglantyne unbedingt bei der Mutter bleiben wollen, konnte sie sich doch nicht vorstellen, dass ein Storch durch das kleine Fenster des Zimmers passte.
Als Eglantyne ans Bett der Mutter trat, hatte diese bereits ein Baby im Arm, eingewickelt in eine weiße Decke, und viel kleiner als Gamul, dessen ersten Geburtstag sie gerade erst gefeiert hatten.
»Das ist Dorothy.« Die Mutter strahlte ihre vierjährige Tochter an. »Ist es nicht schön, dass du jetzt auch ein kleines Schwesterchen hast?«
Eglantyne nickte, obwohl sie nicht verstand, welchen Unterschied es für sie machen sollte, ob sie kleine Schwestern oder Brüder hatte. Ältere Schwestern, ja, die waren mit ihren acht und neun Jahren wirklich anstrengend, zumal sie immer zusammenhielten und oft so taten, als dürften sie über die Kleineren bestimmen. Wenn sie zu dritt Vater-Mutter-Kind spielten, war immer klar, wer das Kind sein und sich herumkommandieren lassen musste. Ja, Jungen und Mädchen sahen unterschiedlich aus, wenn sie nackt waren, aber beim Spielen im Garten gab es keinen Unterschied zwischen ihr und ihrem Bruder Dick. Außer dass er etwas älter war und schneller rennen konnte. Aber sie war auch schon ganz schön schnell für ein kleines Mädchen. Tante Bun hatte sie dafür sogar gelobt. Vater war nicht so stolz darauf, er hatte es lieber, wenn sie sich gesittet benahm, aber er war sowieso nicht oft da, weil er zu Gericht musste oder andere wichtige Sachen zu erledigen hatte.
Eglantyne erschrak, als das neue Kind plötzlich quäkte. Hoffentlich hörte es damit auf, bis der Vater nach Hause kam und ihnen die Gute-Nacht-Geschichte vorlas. Beim Gedanken an das abendliche Vorleseritual kamen ihr die Bücher auf der Veranda wieder in den Sinn. Sie drehte sich um und rannte zurück zu ihren Schwestern und den Hausmädchen, die weiterhin Bücher aus der Bibliothek nach draußen trugen, sie ausschüttelten und dann wieder im Haus in die Regale stellten.
»Und? Wie ist das neue Schwesterchen?«, wollte das Hausmädchen wissen, als Eglantyne herauskam.
»Laut«, antwortete Eglantyne. »Es heißt Dorothy.«
»Dorothy ist auch ein schöner Name«, stellte ihre älteste Schwester Em fest. »Jetzt haben wir eine Emily«, sie kicherte, »das bin ich, ich bin nämlich die Älteste von uns allen. Dann gibt es eine Louisa, einen Richard, eine Eglantyne, einen Gamul und eine Dorothy. Das reicht.«
»Dein Name ist am längsten, Doey«, merkte Lill an, »also dein richtiger Name, Eglantyne.«
»Sie heißt so, weil Mama so heißt«, erklärte Emily und sah ihre Schwestern hochnäsig an.
»Mama heißt auch so wie ich.« Lill streckte ihrer älteren Schwester die Zunge heraus. »Eglantyne Louisa!«
»Aber die Namen findet sie wohl so blöd, dass alle sie Tye nennen«, konterte Em. »Ich heiße wie Tante Nonie.«
Lill lachte. »Haha, dann sage ich jetzt Nonie zu dir.«
»Nun ist es aber gut!« Das Kindermädchen hatte sich unbemerkt zu den Mädchen gesellt. »Ihr habt alle schöne Namen! Emily heißt wie die älteste Schwester eures Vaters, auch wenn ihr sie alle Tante Nonie nennt, und Louisa wie die jüngste Schwester eures Vaters, nur dass ihr immer Tante Bun zu ihr sagt. Seid doch froh, dass euer Vater eure Mutter Tye nennt, sonst wüsstet ihr nie, wer gemeint ist, wenn er Eglantyne sagt.«
»Er sagt ja gar nicht Eglantyne, sondern Doey!«, bemerkte Emily trotzig.
Das Kindermädchen ging nicht darauf ein. »Schaut, dass ihr fertig werdet. Wenn euer Vater nach Hause kommt, wollen wir das neue Baby feiern. Der Kuchen ist bereits im Ofen.«
Das ließen sich die Kinder nicht zweimal sagen, und als hätte er das Kindermädchen gehört, tauchte auch Dick plötzlich wieder auf, der sich in der Bibliothek mit einem Buch hinter einem Regal versteckt hatte.
»Na, hast du das Buch ausgelesen?« Das Kindermädchen zwinkerte dem kleinen Jungen zu.
»Bestimmt hat er wieder heimlich lesen geübt!«, spottete Lill. »Das ist so lästig, dass er jetzt mit uns Unterricht bekommt. Ständig müssen wir warten, bis er seine Aufgaben erledigt hat.«
Eglantyne sah ihren Bruder mitleidig an. Sie nahm sich vor, ab jetzt jeden Tag heimlich lesen zu üben, damit sie das gut konnte, wenn sie auch am Unterricht teilnehmen durfte. Jeden Tag bestürmte sie mal den Vater, mal die Mutter, mal das Kindermädchen und mal den Hauslehrer, ob sie nicht endlich wie die anderen in den Schulraum durfte. Einmal hatte sie sich dort nachmittags heimlich hingesetzt, als er leer war, um zu prüfen, wie sich das anfühlte. Seither konnte sie es noch weniger erwarten, Schulkind zu sein. Aber vielleicht hatten ihre Eltern jetzt ein Einsehen, wo zwei Babys im Haus waren, um die die Mutter und das Kindermädchen sich kümmern mussten.
Kapitel 3
1926 Genf
»Herzlich willkommen, Fräulein Schlinkert! Ich bin Eglantyne Jebb. Ich freue mich über Ihren Besuch.« Anni fiel ein Stein vom Herzen, als ihre Gastgeberin sie auf Deutsch begrüßte. Erstaunt betrachtete sie die Frau, von der die Oberschwester mit so viel Ehrfurcht sprach, seit sie sie nach der Eröffnung des Säuglingsheims vor fünf Jahren kennengelernt hatte.
Anni hatte sich die Frau anders vorgestellt, extravaganter. Nicht in diesem braunen Cardigan über einem braunen Glockenrock, von dessen Schnitt ihre Mutter sicher begeistert wäre. Der einzige Schmuck war ein silbernes Kreuz, das auf dem ebenfalls braunen Pullover unter der Strickjacke hervorblitzte. Auffällig war das weiße Haar, das sich stark von der dunklen Kleidung abhob. Aber letztlich waren Kleider und Aussehen nicht wichtig, der Mensch zählte, und wenn sie sich mit diesem Menschen in ihrer Muttersprache verständigen konnte, würde sie die Frau schnell einschätzen können. Sie spürte, wie ihre Neugier erwachte. Neben ihrer Furcht vor der langen Reise und der fremden Stadt hatte sie in den letzten Tagen vor allem die Sorge darüber verunsichert, wie sie sich mit Frau Jebb verständigen sollte. In der Schule hatte der Lehrer zwar versucht, ihnen Englisch beizubringen, aber in der großen Klasse mit den vielen Kindern hatte sie nicht einmal die Wörter richtig verstanden, weil immer eines flüsterte oder raschelte. Schwester Reinhild hatte ihr erzählt, dass Frau Jebb aus England kam, aber gleichzeitig darauf hingewiesen, dass in der Schweiz kein Englisch, sondern Französisch gesprochen wurde. Umso größer war Annis Erleichterung darüber, dass sie in ihrer Muttersprache empfangen wurde.
»Bonjour, Madame Jebb«, stammelte Anni dennoch, wie es die Oberschwester ihr eingetrichtert hatte. Die Begrüßung und ein paar Worte für den Alltag, mehr hatte Anni sich nicht merken können. Deshalb stand sie nach den ersten Worten stumm vor der weißhaarigen Frau, deren Aussehen und aufrechte Haltung ihr denselben Respekt einflößten, den die älteren Säuglingsschwestern in ihren Trachten automatisch erzeugten.
»Sie möchten sich sicher erst einmal frischmachen«, überspielte Eglantyne Jebb die Pause. »Charlene, mein Hausmädchen, wird Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Und wenn Sie Fragen haben, hilft Ihnen meine Hausdame gerne. Sie werden sie später kennenlernen.«
Anni erschrak. Hausmädchen! Hausdame! Außerdem war nie die Rede davon gewesen, dass sie in diesem herrschaftlichen Haus nächtigen sollte. »Äh, ich schlafe bei der Familie Merzenich, sie ist die Cousine von Schwester Reinhild.« Sie merkte, dass sie ihre Muttersprache falsch anwendete. Sofort hatte sie den strengen Deutschlehrer aus der Volksschule vor Augen, der ihr dafür einen Klaps mit dem Stock auf die ausgestreckte Hand verpasst hätte. »Also, die Frau ist die Cousine«, fügte sie rasch hinzu.
Eglantyne Jebb verkniff sich ein Lächeln, das hätte Anni nur noch mehr verwirrt. »Ihre Oberschwester hat kurz nach Ihrer Abreise angerufen, weil Frau Merzenich ihr mitgeteilt hat, dass sie sich den Fuß gebrochen hat und Sie nicht aufnehmen kann.«
Was für ein langer Satz von Frau Jebb in einer fremden Sprache! Anni war beeindruckt von ihrer Gastgeberin und erleichtert, dass sie mit ihr anscheinend ganz problemlos auf Deutsch sprechen konnte. »Das tut mir leid. Aber ich möchte Ihnen keine Umstände machen.« Sie sah sich um. Schon der Eingangsbereich mit den Vitrinen und Regalen, dem Sessel und dem kleinen Tischchen dazwischen war größer als das Schlafzimmer, das sie sich mit ihren Geschwistern teilte. Und alles wirkte so, als sei es nur Zierde, ähnlich wie in dem Heimatmuseum in Buer, das sie mit der Schule besucht hatte.
Eine junge Frau trat hinzu. »Bonjour Mademoiselle, je suis Charlene«, begrüßte sie Anni und griff nach dem Pappkoffer.
Anni wusste nicht, ob sie erfreut sein sollte, weil sie erahnen konnte, was das Hausmädchen gesagt hatte, oder entsetzt darüber, dass es anscheinend ihren Koffer tragen wollte.
»Nein, bitte nicht, ich kann meinen Koffer selbst nehmen.« Was würde ihre Mutter sagen, wenn sie sich den Koffer tragen ließ?
Eglantyne Jebb nickte Charlene zu. »Ich denke, Fräulein Schlinkert muss sich erst einmal an die neue Situation gewöhnen. Führ sie einfach aufs Zimmer. Ich schlage vor, dass wir Sie in einer halben Stunde zum Tee abholen, Anni. Ist es Ihnen recht, wenn ich Sie Anni nenne?«
Anni nickte unsicher. Warum sollte sie Tee trinken? Den bekam bei ihnen nur, wer krank war. Vielleicht fühlte sich Frau Jebb nicht wohl. Sie sah von ihrer Gastgeberin zu dem Hausmädchen und sagte: »Da wünsche ich Ihnen gute Besserung.«
»Danke, aber uns geht es gut, nicht wahr, Charlene. Wie kommen Sie darauf, dass wir krank sind?« Eglantyne lachte und strich über ihre weißen Haare. »Wegen meines Haars? Das war einmal so rot wie das Ihre. Meine Brüder haben mich deshalb immer Feuerteufel genannt. Heute nennen mich die Leute wegen der Haare ›Weiße Flamme‹. Die Farbe hat sich geändert, aber das Feuer ist geblieben, obwohl ich schon fünfzig bin.«
Anni hätte die Frau älter geschätzt wegen der weißen Haare, wenn sie nicht anlässlich ihres 50. Geburtstags nach Genf gereist wäre. Aber sie ließ sich nichts anmerken. »Das war aber frech von Ihren Brüdern. Mein Bruder Johann nennt mich immer Karottenkopf.« Sogar beim Abschied auf dem Bahnhof hatte er ihr nachgerufen: »Pass auf, dass sie keinen Eintopf aus dir machen, Karottenkopf.« Das hatte Anni den Abschied etwas leichter gemacht, und dass sie hier in ihrer Gastgeberin eine Leidensgenossin fand, erleichterte ihr die Ankunft.
»Das ist ziemlich gemein«, fand Eglantyne Jebb. »Aber hier müssen Sie sich nicht um solche Gemeinheiten sorgen. Die Menschen, die mich Weiße Flamme nennen, meinen es gut. Aber davon erzähle ich Ihnen noch in Ruhe. Jetzt gehen Sie erst einmal auf Ihr Zimmer. Sicher haben Sie nach der langen Reise Appetit auf einen Tee mit warmen Scones.«
Scones! Anni wagte nicht zu fragen, was das denn wohl war. Sicher meinte Frau Jebb es gut, aber Tee mochte sie schon nicht, wenn sie krank war, und diese ominösen Scones klangen nicht gerade verlockend. Wie gut, dass ihre Mutter für die Reise mehr als genug Butterbrote eingepackt hatte, von denen sie das letzte eben in der Kutsche noch rasch verzehrt hatte.
Sie folgte dem Hausmädchen, das etwa in ihrem Alter war, durch den Flur. Die Kinderzeichnungen an den Wänden beruhigten sie ein wenig; sie wirkten so freundlich und einnehmend. »Sind die Bilder von Frau Jebbs Kindern?«
Das Hausmädchen blieb stehen. »Ja und nein. Frau Jebb hat keine eigenen Kinder, aber irgendwie sind alle Kinder ihre Kinder. Manche Bilder stammen aus einem Malwettbewerb, den sie vor einigen Jahren organisiert hat. Die anderen sind aus einer Ausstellung, mit der Frau Jebb Spenden gesammelt hat. Am besten fragen Sie sie selbst.«
Anni versuchte, die Motive auf den Bildern zu erkennen, während sie dem Hausmädchen folgte.
»Dies ist Ihr Zimmer, gnädiges Fräulein.« Anni fragte sich, wie sie dem Hausmädchen sagen konnte, dass sie kein gnädiges Fräulein war; eigentlich müsste sie das doch an dem Pappkoffer mit den abgeschabten Ecken erkennen. Ihr Kleid, die Jacke und die Schuhe verrieten es nicht – die hatte ihre Mutter ihr vor der Abreise genäht und gekauft, von dem Geld für die Eier, das sie sparte, um ihren Kindern etwas Gutes zu tun. Von dem Lohn, den ihr Mann als einfacher Bergmann nach Hause brachte, und dem, was sie durch Putzen verdiente, konnten sie sich außergewöhnliche Ausgaben nicht leisten. Deshalb hatte sie einige Hühner angeschafft, die sie im Garten des kleinen Häuschens in der Bergmannssiedlung nahe der Zeche Hugo, wo der Vater arbeitete, hielt. Ob es hier auch Hühner gab?
»Ich hole Sie in einer halben Stunde ab«, versprach das Hausmädchen, deren Anwesenheit Anni völlig vergessen hatte. »Wenn Sie etwas benötigen, sagen Sie es bitte.«
»Merci.« Als sie Charlenes Lächeln sah, war Anni froh, dass Oberschwester Reinhild ihr die fremden Wörter eingetrichtert hatte.
Während die Tür von außen geschlossen wurde, schaute sie sich in dem Zimmer um. Da war ein großes Bett aus dunklem Holz mit einem dicken weißen Federkissen; am liebsten hätte sie sich sofort hineingeworfen. So weiß, so dick und bestimmt ganz weich. Weicher jedenfalls als die Bettdecke, die sie sich mit ihren Geschwistern nachts teilte, dessen war Anni sicher. Neben dem Bett stand ein kleines Tischchen mit einer Petroleumleuchte, und gegenüber befand sich ein Waschtisch mit einem großen Spiegel, in dem sich die mit Blumen verzierte Waschschüssel und die Wasserkanne im selben Muster spiegelten.
Über der Tür hing eine Uhr, die Viertel nach zwei anzeigte. Wann hatte sie das Zimmer betreten? Wann war die halbe Stunde um, die die Frauen ihr gewährt hatten, um sich frischzumachen? Und was sollte das überhaupt sein: frischmachen? Sie kam ja nicht aus dem Flöz und hatte wie ihr Vater, wenn er von der Arbeit kam, trotz Dusche in der Kaue schwarze Ränder unter Augen und Fingernägeln. Erschrocken betrachtete sie ihre Hände. Seit sie denken konnte, hatte ihre Mutter ihr eingeschärft, dass keinerlei Schmutz unter den Nägeln sein durfte. Wenn eines der Kinder nicht daran dachte, klemmte sie die Hand mit festem Griff ein und schabte die schwarzen Ränder mit der Spitze einer Nagelfeile unsanft weg. Aber jetzt waren Annis Nägel schön geschnitten und frei von jeglichem Schmutz. Woher hätte der in der Bahn auch kommen sollen?
Sie blickte in den Spiegel. Auf den Wangen bemerkte sie Sandkörnchen, die sich wohl in die Hautcreme gebohrt hatten, als sie durch das geöffnete Abteilfenster prüfen wollte, ob die Luft zwischen Bäumen und Bergen anders roch als zwischen Förderturm und Kohlehalde zu Hause. Bei dem Gedanken an die frische, reine Luft vergaß Anni die Flecken auf ihrem Gesicht und eilte zu den Fenstern. Hinter dem Gebäude auf der anderen Straßenseite lugten Berggipfel hervor. Sie zerrte an dem Hebel. Endlich konnte sie das Fenster aufziehen. Anni saugte die frische Luft ein, die in das Zimmer drang, und wünschte sich, dass ihre Mutter, die so oft hustete, dies auch erleben konnte.
»Fräulein Schlinkert, sind Sie so weit?«, erklang eine Stimme vor der Tür.
»Moment!«, rief Anni und ging zurück zum Spiegel. Sie rubbelte die Sandkörnchen mit dem Tuch ab und eilte zu dem Koffer. Hastig löste sie dessen Schnallen und stellte die Klappe auf. Zum Glück hatte sie die Karte mit dem Bild des Säuglingsheims und den Unterschriften ganz oben auf ihre Kleider gelegt. Sie nahm das Geschenk heraus und öffnete die Tür.
»Ich hoffe, es ist alles in Ordnung«, empfing das Hausmädchen sie. »Die gnädige Frau erwartet Sie bereits im Salon.« Sie zwinkerte Anni zu. »Und die Scones dampfen noch.«
Anni fasste sich ein Herz. »Was sind Scones?« Wenn diese Scones etwas mit Glibber waren, wie ihre Brüder alles nannten, was in Aspik eingelegt war, musste sie sich innerlich darauf vorbereiten.
Das Hausmädchen zögerte. »Scones sind … äh … Scones. In England, wo Frau Jebb aufgewachsen ist, werden sie zum Tee gereicht.«
Das half Anni nicht weiter. »Wie werden sie zubereitet?«
»Im Ofen gebacken«, antwortete das Hausmädchen verwundert. »Der Teig wird aus Mehl, Butter, Eiern, Zucker und Milch gerührt.«
Scones waren also ein Gebäck! Anni fiel ein Stein vom Herzen. Nach der aufregenden Reise brachte sie nichts herunter, was glibberte oder was sie sonst nicht mochte. Befreit folgte sie dem Hausmädchen in den Salon, wo Eglantyne Jebb sie erwartete. Sie saß an einem Tisch, der mit hübschen Tassen, Tellern, einer dampfenden Schüssel voller Teigkugeln und einer bauchigen Kanne auf einem Stövchen, wie Anni es einmal beim Pfarrer gesehen hatte, gedeckt war.
Ehe Anni sich auf den Stuhl setzte, den ihre Gastgeberin ihr zuwies, stellte sie sich vor der weißhaarigen Frau auf. »Ich bin gekommen, um Ihnen im Namen des Säuglingsheims an der Wörthstraße in Gelsenkirchen für Ihre Wohltaten ganz herzlich zu danken.« Diesen und die folgenden Sätze hatte sie mit Schwester Reinhild geübt. »Ohne Ihre Spende und die Nahrungsmittel wären viele Babys gestorben. Das Säuglingsheim besteht weiterhin, und eine Säuglingspflegerinnenschule ist hinzugekommen. Im letzten Jahr fand in Gelsenkirchen sogar die erste Kinder-Gesundheitswoche im Ruhrgebiet statt.« Anni war so erleichtert, als sie ihre Sätze aufgesagt hatte, dass sie stumm vor Eglantyne Jebb stehen blieb.
Charlene trat von hinten an sie heran und flüsterte: »Das ist doch ein Geschenk, oder?«
Anni wurde rot. »Oberschwester Reinhild hat Ihnen ein Bild von unserem Heim gemalt, und wir haben alle auf der Rückseite unterschrieben. Alle Schwestern und Schülerinnen und sogar die Mütter, deren Babys gerade bei uns sind.«
»Das ist wirklich ein schönes Geschenk.« Eglantyne nahm die Karte entgegen und betrachtete das Haus, dem sie vor fünf Jahren selbst einen Besuch abgestattet hatte. Sie erinnerte sich gut daran, wie grau und trist die Stadt drei Jahre nach Kriegsende gewirkt hatte. Anders als hier in der Schweiz und zu Hause in England waren in der Region kaum grüne Wiesen, Bäume, geschweige denn Kühe und Kornfelder zu sehen gewesen. Für sie hatte sofort festgestanden, dass sie dort mit Lebensmitteln und finanziellen Spenden helfen mussten. Sie betrachtete die junge Frau, die in dem hübschen Kleid aus dieser tristen Gegend kam. Ein wenig erinnerte sie diese Anni an ihre Freundin Margaret, die sie bei der ersten Begegnung mit ihrer Schüchternheit für sich eingenommen hatte. Auch wenn die beiden Frauen nicht unterschiedlicher hätten sein können, weckte Annis Verhalten bei Eglantyne doch denselben Impuls, sie zu unterstützen, wie damals Margaret.
»Setzen Sie sich doch.« Sie deutete erneut auf den Stuhl ihr gegenüber, der vor einem hübschen Teller und einer ebenso hübschen bauchigen Tasse stand, die Anni an die Sammeltasse erinnerte, die Großmutter ihr zur Konfirmation geschenkt hatte. Im Gegensatz zu den Tassen hier stand ihr Erinnerungsgeschenk allerdings in der Vitrine im Wohnzimmer neben denen, die Maria und Johann bekommen hatten.
Anni setzte sich auf die vordere Kante des Stuhls, der auf sie nicht sehr stabil wirkte im Vergleich zu den robusten Sitzgelegenheiten in der Küche ihrer Eltern. Überhaupt: Dass sie in so einem schönen Raum bewirtet wurde, fand sie unpassend. Das Wohnzimmer in ihrem Elternhaus war für Sonntage und besondere Gelegenheiten reserviert, und ihr Besuch war nun wirklich keine besondere Gelegenheit.
Eglantyne stand auf und stellte das Gemälde auf eine niedrige Kommode mit Schubladen, auf der weitere Bilder standen. Als sie sah, wie Anni eingeschüchtert auf der Stuhlkante saß, lächelte sie. »Nicht dass Sie denken, ich hätte immer in solchen schönen alten Möbeln gewohnt.« Sie lachte auf. »Als ich am Lady Margaret College studierte, habe ich sogar einmal alle Möbel aus dem Apartment räumen lassen.« Sie setzte sich wieder an den Tisch. »Und diese Möbel gehören auch gar nicht mir, sondern meiner Freundin Suzanne. Sie stammt aus einer alteingesessenen Schweizer Familie und besitzt deshalb viele alte Möbel.«
Anni entspannte sich ein wenig. Sie und ihre Eltern hatten immerhin eine eigene Wohnung und mussten nicht bei Freunden oder Verwandten wohnen. Das hätte sie von dieser Frau Jebb, die alle so verehrten, nicht gedacht.
Als hätte Eglantyne Annis Gedanken gelesen, verriet sie: »Ich hatte natürlich auch schon eigene Wohnungen, als ich studiert habe und später als Lehrerin und Redakteurin. Aber irgendwann hat es sich so ergeben, dass ich in England bei meiner Mutter wohnte, weil es ihr nicht gut ging und ich ohnehin immer viel unterwegs war. Seit ich mit meiner Schwester Dorothy Save the Children gegründet habe, reise ich zwischen Genf, London und Crowborough hin und her. Crowborough ist ein kleines Dorf in Sussex, das ist auch in England, dort hat Mutter ein Haus namens Forest Edge gebaut. Die meiste Zeit bin ich auch heute noch in der Welt unterwegs, um Spenden zu sammeln und unsere Projekte zu besuchen. Da lohnt es sich kaum, eine Wohnung zu mieten, zumal ich bei Dorothy, meiner Mutter und hier bei Suzanne immer ein Zimmer und viel Platz zum Arbeiten und Leben habe.«
Eglantyne schüttelte den Kopf. »Aber Sie sind ja nicht hergekommen, um über meine Wohnungen zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie die lange Reise unternommen haben, um uns Ihren Dank zu überbringen. Gerade aus Deutschland.«
»Wieso freuen Sie sich über Besuch aus Deutschland?«, fragte Anni und schob sich etwas weiter nach hinten auf dem Stuhl, um Abstand zu Teller und Tasse zu gewinnen.
Ihre Gastgeberin nickte. »Das ist eine gute Frage. Als ich vor sieben Jahren begonnen habe, Spenden zu sammeln, weil ich hörte, dass viele Kinder in Deutschland nach dem Krieg verhungern, dachte ich, ich tue etwas Gutes. Dann haben mich zuerst meine Landsleute beschimpft, weil ich dem Feind helfen will. Trotzdem habe ich Geld zusammentragen können und Lebensmittel nach Deutschland gebracht. Dort wurde ich dann beschimpft, weil meine Landsleute den Kaiser und seine Truppen besiegt hatten.«
Anni wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Sie war in der dritten Klasse gewesen, als der Krieg ausbrach. Kein Tag war damals vergangen, an dem der Lehrer nicht von den Soldaten schwärmte und von dem Sieg an der Front. Dieses Wort würde sie ihr ganzes Leben nicht vergessen. Ostfront, Westfront, Heimatfront. Wobei Heimatfront nichts anderes bedeutete als das Leben in der Heimat mit dem täglichen Kampf um das Essen, den die Mütter ausfechten mussten. Im letzten Kriegsjahr wurde sie dreizehn Jahre alt, doch ihre Mutter hatte weder Butter noch Mehl, um ihr den sonst üblichen Geburtstagskuchen zu backen. Da verstand sie, was Krieg bedeutete, und hasste mit einem Mal alle Soldaten. Schließlich waren sie es, die mit ihren Waffen in den Krieg zogen. Einmal hatte sie es gewagt, das in der Schule zu sagen. Zur Strafe wurden ihr nicht nur die Hände wund geschlagen, sie durfte auch eine Woche nicht am Unterricht teilnehmen und musste stattdessen den Hof fegen und andere, noch ekligere Arbeiten erledigen.
»Fräulein Schlinkert? Ist alles in Ordnung mit Ihnen?« Anni sah die Schale mit Gebäck vor ihrer Nase. Wie lange diese Frau Jebb sie wohl schon hielt? Aus der Tasse dampfte es bereits, ohne dass sie bemerkt hätte, wie jemand den Tee eingeschenkt hatte.
»Trinken Sie Ihren Tee mit Milch oder ohne?« Das Hausmädchen sah sie erwartungsvoll an.
Anni starrte hilflos zurück. Die Frage, ob sie Tee mit Milch trinken wolle, überforderte sie, weil es Tee in ihrer Familie nur bei Krankheiten gab. Aber wenn sie zu Hause Kaffee trank, tat sie immer viel Milch hinein.
»Mit Milch«, antwortete sie und nahm mit den Händen einen dieser Scones aus der Schale. Sie bemerkte, wie Eglantyne und das Hausmädchen einen Blick wechselten, allerdings sagten sie nichts. Erst, als Eglantyne mit der kleinen Zange, die neben der Schale lag, ein Gebäckstück herausnahm, wurde Anni klar, welchen Fehler sie begangen hatte. Dabei hatte ihr die Mutter eingeschärft, einfach den anderen alles nachzumachen, sobald sie unsicher war. Sie hatte leicht reden; wenn sie die Erste war, konnte sie nichts nachmachen. Hoffentlich war das mit der Milch im Tee wenigstens richtig. Erleichtert beobachtete sie, wie Eglantyne Milch in ihre eigene Tasse goss.
Anni wartete, ob ihre Gastgeberin den Tee umrührte und wie sie ihn trank. Erst danach hob sie die Tasse zum Mund. Dann sah sie zu, wie Eglantyne Jebb von dem Gebäck abbiss und den Rest auf den Teller legte, und verfuhr ebenso. Langsam entspannte sie sich. Die Frauen waren freundlich, und wenn sie sich an den Ratschlag ihrer Mutter hielt, würde sie sich schon richtig benehmen.
»Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch können?« Anni war von sich selbst überrascht, dass sie diese Frage zu stellen wagte. Doch Frau Jebb schien das zu gefallen.
»Charlenes Mutter stammt aus dem deutschsprachigen Teil der Schweiz«, antwortete Eglantyne. »Ich habe mich schon immer für Sprachen interessiert. Als ich klein war, hatten wir ein Kindermädchen, das deutsch sprach. Heddie kam aus dem Elsass, das gehörte zeitweise zu Frankreich und zeitweise zum Deutschen Reich, deshalb redeten die meisten Menschen dort deutsch. Die Kindermädchen sollten uns immer die Sprache ihrer Heimat beibringen, das war unseren Eltern wichtig. Meine Schwester hat sogar ein halbes Jahr in Deutschland gelebt, in Dresden. Da haben wir uns in Ihrer Sprache Briefe geschrieben.«
»Waren Sie auch schon einmal in Deutschland?« Die Frage war Anni wie von selbst über die Lippen gegangen; die weißhaarige Frau vermittelte ihr ein Gefühl der Sicherheit. Gleich danach ärgerte sie sich. Sie wusste doch, Frau Jebb in Gelsenkirchen gewesen war, darüber hatte die Oberschwester gesprochen. Sie war erleichtert, dass ihre Gastgeberin nicht darauf einging.
»Oh ja, mehrmals. Vor fünfundzwanzig Jahren zum ersten Mal. Damals habe ich mit einem Onkel ein paar Tage in Bad Kissingen verbracht. Und später natürlich für Save the Children. Eine der ersten Städte in Deutschland, in denen wir Kindern geholfen haben, war Leipzig. Bald nachdem wir die Stiftung gegründet hatten.« Eglantyne lachte. »Das war eine abenteuerliche Geschichte. Der Name Emily Hobhouse sagt Ihnen vielleicht nichts, aber sie war bei Save the Children für die Länder Mitteleuropas zuständig. Was wir in England an Spenden sammelten, sollte ja verteilt werden. Aber wir konnten die Lebensmittel schlecht mit einem Flugzeug abwerfen und brauchten Ansprechpartner vor Ort.« Sie wusste, dass sie die Verdienste dieser einzigartigen Frau damit schmälerte. Emily Hobhouse hatte sich immer für Minderheiten eingesetzt und dafür gekämpft, dass Frauenrechte mehr als die Rechte wohlsituierter Damen waren. Leider hatte sie das Komitee der Internationalen Stiftung verlassen, weil sie fand, dass ihre Kinder in Leipzig zu wenig Spenden bekämen, nachdem die Stiftung eine Hilfsaktion in Saratov begonnen hatte. Dennoch war sie eine engagierte Frau gewesen. »Emily ist vor zwei Monaten verstorben, mit ihr hat Save the Children eine der engagiertesten Frauen verloren.«
Anni hatte sich keine Gedanken darüber gemacht, wie Frau Jebb die Gelder und Lebensmittel verteilt hatte. In Gelsenkirchen hatte sie mit der Stadtverwaltung und der Heinrich-Mönting-Stiftung zusammengearbeitet, wenn sie sich richtig erinnerte.
»Emily Hobhouse war ständig unterwegs in der Welt. Sie hatte vorher in einer Bergarbeitersiedlung geholfen und war später im Burenkrieg in Südafrika. Für uns war diese reisefreudige Frau, die so gut mit den Menschen umgehen und sie begeistern konnte, ein Glücksfall.« Anni bemerkte erstaunt, dass Eglantynes Wangen glühten. Plötzlich wirkte sie trotz ihrer weißen Haare gar nicht mehr alt, sondern fast wie eine junge Frau, die am liebsten gleich aufspringen und etwas unternehmen wollte. »In Bern hat Emily einen Professor aus Leipzig kennengelernt.« Eglantyne schmunzelte. »Da hatten sich zwei Menschenfreunde nicht gesucht und doch gefunden. Er hat Emily überredet, nach Leipzig zu kommen und sich selbst ein Bild von der Lage der Schulkinder zu verschaffen.«
Anni nippte an ihrer Tasse und schob sich die zweite Hälfte des Scones in den Mund. Obwohl oder weil Eglantyne von Hunger sprach, verspürte sie plötzlich einen so großen Appetit, dass sie nicht darauf warten konnte, dass ihre Gastgeberin weiteraß. Während sie der Geschichte lauschte, nahm sie ein weiteres Scone aus der Schale, und auf einen fragenden Blick des Hausmädchens in Richtung der bauchigen Teekanne nickte sie freudig. Der Tee schmeckte zwar völlig anders als die Tees, die ihre Mutter bei einer Krankheit aus frischer Minze oder getrockneten Kamillenblüten aufbrühte, aber er passte gut zu dem Gebäck.
»Beim dritten Besuch habe ich sie begleitet. Der Professor hat in Leipzig alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine Kinderspeisung ins Leben zu rufen. Wenige Wochen nach Emilys zweitem Besuch wurde bereits ein Komitee zur Speisung unterernährter Schulkinder gegründet, und im Januar 1920 war ich dabei, als die ersten zweihundert Kinder in vier Leipziger Schulen von unserem Geld ein Mittagessen bekamen.« Das Strahlen auf Eglantynes Gesicht faszinierte Anni. Was war das für eine Frau, die sich so über Mittagessen für fremde Kinder zu freuen vermochte?
»Danach war ich in Berlin, als wir die erste Kakaostube eröffnet haben, und in Nürnberg, wo wir die Patenschaft für zweihundert Kinder übernommen, denen wir alle drei Monate Liebesgaben geschickt haben. Apropos Liebesgaben. Finden Sie nicht auch, dass diese Scones echte Liebesgaben sind?« Eglantyne legte mit der Zange ein weiteres Gebäckstück auf ihren Teller. »Frau Hämmerle hat sie wieder einmal mit Hingabe gebacken. Aber ich habe viel zu viel erzählt. Sie wollten doch nur wissen, ob ich schon in Deutschland war. Ja, war ich: in Leipzig, Nürnberg, Berlin, Köln und einigen anderen Städten wie Gelsenkirchen.«
»Gelsenkirchen ist eine wichtige Stadt, sie liegt direkt neben Buer, wo ich herkomme. Dort gibt es die meisten Zechen in der Region, und die Männer holen Kohle aus der Erde für das ganze Reich. Mein Vater arbeitet auch unter Tage.« Anni dachte an ihre Stadt und ihren Vater und spürte einen Kloß in ihrem Hals. Das war alles so weit weg; fast zwei Tage war sie mit der Bahn unterwegs gewesen. Die Rückfahrt würde ebenso lange dauern.
»Es ist schön, dass Sie so stolz auf Ihre Heimat sind.« Eglantyne sah Anni nachdenklich an. Sie beneidete die junge Frau um das Gefühl, das sie mit ihrer Stadt verband. Welcher Ort ihrer Kindheit würde diese Sehnsucht hervorrufen? Das Landhaus in Ellesmere mit den hohen Decken und lichtdurchfluteten Räumen, seinen unzähligen Zimmern und dem Flügel für die Bediensteten, der es wie ein kleines Schloss erscheinen ließ? Dort hatte sie die meiste Zeit mit ihren Eltern und Geschwistern gelebt; oft zusammen mit ihrer Tante Carrie, die gerne die Mädchen der Familie ihres Bruders unter ihre unkonventionellen Fittiche nahm. Oder war Tydraw ein solcher Sehnsuchtsort? Das imposante Steinhaus in den Waliser Bergen von Denbigshire, in dem sie jedes Jahr einige Wochen zwischen grünen Wäldern und blühenden Feldern verbrachten, mit einfachem Essen, das sie selbst kochen und backen mussten, aber mit viel Freude am Miteinander.
Kapitel 4
1885 Ellesmere – Denbigshire
»Nein, Doey, deine Fahnen und Karten bleiben hier!« Tye nahm ihrer Tochter den Stapel aus Papier und Stoff aus der Hand, den diese soeben in ihren kleinen Koffer packen wollte.
»Ich brauche die aber!« Mit ihren neun Jahren wusste Eglantyne genau, was sie wollte und zu tun hatte. Und jetzt musste sie sich auf den Beruf als Soldat vorbereiten, auch wenn ihr Großvater meinte, Mädchen könnten nicht Soldaten werden. In dem Buch The Charge of the Light Brigade von Alfred Tennyson, das sie im Unterricht gerade gelesen hatten, wurde erzählt, wie wichtig die Soldaten waren. Außerdem hatte sie ihren Großvater begleitet, als er in Shropshire die Armee der Freiwilligen betreute. Seit die englischen Truppen Birma erobert hatten, berichteten alle, dass es nichts Schöneres gab, als für sein Land zu kämpfen. Mit neun Jahren war sie zu jung dafür, aber sie konnte mit Fahnen ihre Solidarität zeigen und die Erfolge der letzten Jahre auf einer Landkarte markieren.
»In Tydraw wird nicht gekämpft und Krieg gespielt!« Tye unterbrach die Minute des Schweigens, in der Eglantyne sie nur mit zusammengekniffenen Augen unter ihren roten Haaren angestarrt hatte. Meist gelang es ihr, mit diesem Gesichtsausdruck ihren Willen durchzusetzen. Bei den jüngeren Geschwistern klappte das jedenfalls sehr oft. Gamul und Dorothy ließen sich kommandieren, besonders wenn sie als Captain, Sergeant, Lieutenant oder Officer tituliert wurden. Nur Em und Lill weigerten sich, als Brigadier oder Colonel von ihrer kleinen Schwester, die natürlich General oder Major war, herumgeschubst zu werden. Sie standen über diesen Spielen, von denen sie fanden, dass sie nicht zu jungen Damen passten. Aber Dick ließ sich schnell überreden.
»Der Gärtner hat sich schon wieder beschwert, dass ihr ihn in eurem Spiel draußen eingekesselt und von der Arbeit abgehalten habt. In Tydraw haben wir nur zwei Hausmädchen, und ich will es mir nicht mit ihnen verscherzen.« Die Mutter nahm Eglantynes Kinn und drehte es so, dass diese sie ansehen musste. »Du ganz bestimmt auch nicht, denn dann müssen wir dort oben nicht nur selbst kochen, sondern auch putzen, Holz holen, Feuer anfachen, Wasser erhitzen und was sonst in dem Häuschen anfällt. Wenn du hier in der Lyth einen der Bediensteten vergrätzt, fällt das bei den zwölf Kräften nicht auf, sofern du nicht gerade die Köchin gegen uns aufbringst. Aber in Tydraw möchte ich die Waliser Landschaft in Ruhe und Frieden genießen.«
Eglantyne erkannte, dass sie diesen Kampf verloren hatte. Sie warf ihr Papier-Stoff-Bündel auf das Bett. »Bücher darf ich aber mitnehmen, oder?«
Sie sah zufrieden, dass ihre Mutter lächelte. Wenn die Eltern ihnen eines immer und überall erlaubten, war es das Lesen. Auch wenn die Großeltern ihnen ab und an vorwarfen, dass sie zu wenig auf die Inhalte der Lektüren achteten, die Eglantyne und ihre Geschwister in die Finger bekamen. Doch Mutter und Vater waren sich darin einig, dass man nicht zu viel lesen konnte und auch nichts Falsches. Falls also keine Schmeichelei funktionierte, war es immer gut, Bücher ins Gespräch zu bringen. Und davon gab es in der großen Bibliothek des Vaters genug.
»Was hast du dir denn ausgesucht?« Tye betrachtete den Stapel Bücher, die Eglantyne ausgewählt hatte. Ganz oben lag der Roman Ivanhoe von Walter Scott, ihrem Lieblingsautor. Dass sie darunter Tennysons