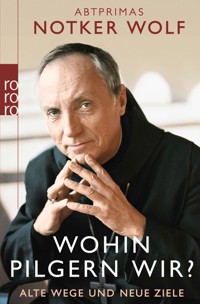9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
«Menschen kann man nicht managen. In dem Augenblick, in dem Vorgesetzte Führungsangelegenheiten wie Finanz- oder Produktionsfragen behandeln, werden sie zu Schreibtischtätern. Doch ist die Kunst, Menschen zu führen, überhaupt erlernbar? Wobei sie sich nicht auf Wirtschaftsunternehmen beschränkt, denn Führungsfragen stellen sich genauso in der Politik, in der Schule und in der Familie ... Jeder kann sein Charisma missbrauchen, jeder kann seine Autorität gegen seine Mitarbeiter oder Schüler richten, deshalb muss jeder klare Vorstellungen von seiner Verantwortung haben und sehr genau wissen, welche Ziele er als Führender verfolgen sollte. Es kann also nicht schaden, Menschen mit Führungsqualitäten die Augen dafür zu öffnen, worauf es ankommt ...» Mit Hilfe ihrer langjährigen Erfahrung in hohen Leitungspositionen gehen Abtprimas Notker und Schwester Enrica Rosanna auf die Suche nach den Grundsätzen einer menschengerechten Führung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Ähnliche
Abtprimas Notker Wolf, Schwester Enrica Rosanna
mit Leo G. Linder
Die Kunst, Menschen zu führen
Inhaltsverzeichnis
01 Das ewig gute Vorbild
02 Die Verlockungen der Macht
03 Man muss die Leute mögen
04 Wer kann, der darf
05 Keine Angst vorm starken Mann
06 Führer müssen Künstler sein
07 Man hört sagen, dass ...
08 Selig, wer ein Sandkorn von einem Berg unterscheiden kann
09 Eine Kultur der zwei Stimmen
10 Rückversicherungsmentalität
11 Eine magische Kraft
12 Mut zum Widerstand
13 An die eigene Autorität glauben
14 Der existenzielle Dialog
15 Reicht es, die gute Fee zu spielen?
16 Das schlummernde Interesse wecken
01
DAS EWIG GUTE VORBILD
Über die Aktualität der Regel Benedikts
Abtprimas Notker Wolf
Es erwartete mich keine leichte Aufgabe, als ich 1977 zum Erzabt von Sankt Ottilien gewählt wurde. Nicht nur, dass mir damit die Sorge für diese Abtei und ihre hundertachtzig Mönche zufiel, gleichzeitig war ich nun auch für unsere Klöster in Afrika und Asien, in Nord- und Südamerika zuständig, denn Sankt Ottilien ist ein Missionskloster. Obendrein trat ich mein Amt in einer Zeit des Umbruchs an. In den deutschen Klöstern (wie in den europäischen ganz allgemein) wurde damals die Autorität des Abtes immer stärker infrage gestellt. Bis dahin in unangefochtener Position, sahen sich die Äbte auf einmal einer permanenten Bewährungsprobe ausgesetzt. Sie mussten ihre Entscheidungen erklären, rechtfertigen, verteidigen und erlebten, dass ihr Führungsstil nicht mehr kommentarlos hingenommen wurde. Und außerhalb Europas brach für viele Klöster ebenfalls eine neue Zeit an, weil wir damals zu gemischten Klöstern übergingen, uns also auf das Zusammenleben von europäischen und einheimischen Brüdern oder Schwestern im selben Kloster umstellten, was vor allem in Afrika nicht reibungslos verlief.
Auf mich als Erzabt kamen seinerzeit wertvolle Lehrjahre in der Kunst der Menschenführung zu, denn überall, im altvertrauten bayerischen Heimatkloster wie in unseren Klöstern außerhalb Europas, ging es nun darum, über die langen Schatten der Vergangenheit zu springen, den alten benediktinischen Gemeinschaftsgeist wiederzubeleben und zu neuen, freieren Formen des Zusammenlebens und Zusammenwirkens zu finden, ohne die Autorität des Abtes im Kern anzutasten. Ich kann von Glück sagen, dass mir in jenen Jahren zwei großartige Lehrmeister zur Seite standen. Der eine war unser Ordensgründer, der heilige Benedikt von Nursia, dessen Regel mir vom ersten Tag an als theoretische Richtschnur für kluge Menschenführung diente. Und der andere war mein damaliger Prior Paulus, dem ich zahllose Beispiele dafür verdanke, wie kluge Menschenführung in der Praxis auszusehen hat. Mittlerweile trage ich als Abtprimas die Verantwortung für den Benediktinerorden als Ganzes, aber von den Erfahrungen mit diesen beiden zehre ich bis heute. Ich möchte deshalb zunächst einmal erzählen, was es für mich von ihnen zu lernen gab.
«Das ewig gute Vorbild bringt mich langsam um…» Der Stoßseufzer stammt von meinem alten Prior, und er war, wie manches aus seinem Mund, nicht ganz ernst gemeint. Denn Prior Paulus brauchte sich nicht sonderlich anzustrengen, um mir – und anderen – ein Vorbild zu sein. Der war so, wie er war, der musste keinem etwas vormachen; und so, wie er war, hätte ich mir meine Mitbrüder alle gewünscht, so unerschütterlich gelassen, so treffsicher despektierlich, so gnadenlos offen (wenn nötig) und so loyal. Doch Prior Paulus war – leider oder gottlob – einmalig: ein Hüne von Gestalt, Bauernsohn aus dem Allgäu, Bürgermeistersohn, ausgestattet mit der unschätzbaren Gabe, niemanden übertrieben ernst zu nehmen und das Leben aus der höheren Warte dessen zu betrachten, der sich selbst am allerwenigsten ernst nimmt. Ich sehe ihn noch beim Chorgebet mir gegenüber stehen, in meinem alten Kloster Sankt Ottilien: Eben noch in einen Psalmentext versunken, zuckte im nächsten Augenblick ein durchaus merkliches Grinsen über sein Gesicht – höchstwahrscheinlich die plötzlich aufflackernde Erinnerung an einen Menschen, der sich ihm gegenüber aufgespielt und einen seiner berühmten Dämpfer abbekommen hatte.
Nicht alles, was ihn als Prior auszeichnete, hatte zu seiner mentalen Grundausstattung gehört. Er hatte früh damit begonnen, an sich zu arbeiten, und schon als Schüler den beinahe sportlichen Ehrgeiz entwickelt, sich so viel Gleichmut anzueignen, dass ihn nichts und niemand mehr zu ärgern vermochte. Der Entschluss dazu ging auf ein Erlebnis Mitte der Zwanzigerjahre am Missionsseminar von Sankt Ottilien zurück, wo er einen Pater als Lehrer gehabt hatte, der es nicht lassen konnte, vor der Klasse über das Kloster und seine Mitbrüder herzuziehen. Er und zwei seiner Freunde schworen sich seinerzeit: Dieser Fehler darf uns niemals unterlaufen – stellten ein Sparschwein in ihrem Schlafraum auf und verpflichteten sich, für jede unkontrollierte Aufwallung von Zorn oder Empörung einen Zehner hineinzutun. «Nach einem halben Jahr», erzählte mir Prior Paulus später, «hatten wir uns im Griff. Seither ist es keinem mehr gelungen, uns in Rage zu bringen.» Alle drei sind dann in ein Kloster eingetreten, und einer wie der andere legten sie zeitlebens eine beeindruckende innere Freiheit an den Tag.
Als ich längst Erzabt von Sankt Ottilien war, besuchte mein Prior eines unserer Klöster in Afrika, und beim Frühstück mit den deutschen Schwestern dort gab er ebendiese Geschichte von seinem Sieg über die Unbeherrschtheit zum Besten. Das, meinten die Schwestern, hätten sie auch längst gelernt. Nichts könne sie mehr aus der Ruhe bringen, nichts aufregen. Nun hatte eine dieser Schwestern ihm freundlicherweise die Schuhe geputzt, weil er schon alt und steif war. Minuten später streift sich mein Prior ächzend einen Schuh vom Fuß, untersucht ihn von allen Seiten, stochert mit einem Messer in der Sohle herum und richtet sich wieder auf. «Schauen Sie mal, Schwester», sagte er mit Engelsmiene, «hier unten ist doch tatsächlich noch etwas Dreck…» Da hätten Sie die Schwestern sehen sollen: Alle gingen gleichzeitig an die Decke. Und mein alter Prior? Er grinste.
Nicht jeder kam mit seiner Art zurecht. Und nicht jeder der vier Äbte, unter denen mein alter Prior dem Kloster fast vierzig Jahre lang gedient hat, wusste ihn zu nehmen. Ihn selbst konnte nichts erschüttern, aber mit seiner Standfestigkeit hat er andere erschüttert, und einige empfanden seine Geradlinigkeit als bedrohlich. Mein Vorvorgänger in Sankt Ottilien setzte ihn sogar als Prior ab, musste diese Entscheidung jedoch gleich wieder rückgängig machen, weil es einen Aufstand im Konvent gab. Erst im Angesicht des Todes kam es zur Aussprache zwischen den beiden. Der Abt, vom Krebs gezeichnet, holte ihn an sein Bett und rang sich zu dem Geständnis durch: «Pater Prior, jetzt glaube ich endlich, dass Sie nicht nach meinem Amt getrachtet haben.» Nein, es war gewiss nicht immer leicht, Abt unter Prior Paulus zu sein.
Dabei hatte er zu keiner Zeit die Ambition, selber Abt zu werden. Das Angebot eines anderen Klosters, ihn dort zum Abt zu wählen, beschied er kurz und bündig mit den Worten: «Ich werde niemals eine Mitra auf meinem Haupt herumschleppen.» Schreckte er vor der Verantwortung zurück? Wohl kaum. Als Prior war er die Idealbesetzung, der perfekte zweite Mann. Aber er scheute den blendenden Glanz des Rampenlichts und die Konzessionen an den frommen Mummenschanz, die das Amt des Abtes von ihm verlangt hätte. In der zweiten Reihe fühlte er sich freier. Als Abt hätte er der hierarchischen Selbstdarstellung mehr Tribut zollen müssen, als sich mit seiner Verachtung für Autoritätsgläubigkeit und Statussymbole vereinbaren ließ. Dieser Mann konnte bis zum Sarkasmus gehen in seinem Widerwillen gegen alles, womit sich die Macht herausputzt, und ich gestehe, dass mir seine Haltung mit der Zeit in Fleisch und Blut überging. Manche seiner Kommentare sind für mich zu wahren Hirtenworten geworden. Und jedes Mal, wenn ich den Vatikan betrete, kommt mir sein Ausspruch in den Sinn: «Wissen Sie, Vater Erzabt, welcher der schwärzeste Tag in der Geschichte der Menschheit war? Der Tag, an dem sich die Bischöfe zum ersten Mal mit den Insignien geschmückt haben (also den ganzen Hoheitszeichen wie Mitra, Kreuz und Krummstab).» Dann hatte der riesige Kerl Luft geholt und war mit größerer Lautstärke fortgefahren: «Aber noch viel, viel schwärzer war der Tag, als die Äbte es den Bischöfen nachgetan haben!»
Das «ewig gute» Vorbild meines Priors hatte jedenfalls größte erzieherische Wirkung auf mich. Was habe ich von ihm gelernt? Dass man mit Humor und Selbstironie sehr weit kommt, gleichgültig, ob man als Abt 180Mönchen vorsteht oder als Abtprimas für fünfundzwanzigtausend Mönche und Nonnen weltweit zuständig ist. Dass man mit Aufrichtigkeit noch weiter kommt. Und dass man ungeahnt weit kommt, wenn man sich weder durch Kardinalspurpur noch Präsidententitel noch Dienstwagen und reservierte Firmenparkplätze gleich neben der Garagenausfahrt beeindrucken lässt. Mit anderen Worten: Prior Paulus hat mir vorgemacht, was Autorität sein könnte und sein sollte. Er hat mir die Augen dafür geöffnet, wie heilsam sich Autorität auswirkt, wenn man die Schale des autoritären Gebarens zerschlägt und das zum Vorschein kommt, was Autorität im Kern bedeutet: Verantwortung und Fürsorge und Dienst. Von dieser Schale befreit, entfaltet die Autorität ihre befreiende, ihre Geist und Seele befreiende Kraft.
So gesehen war Prior Paulus vor allem ein vorbildlicher Christ. Denn eben das ist im Sinne Jesu Christi, und eben das sollte das Christentum deshalb auch immer wieder leisten, nämlich: alle falschen Werte infrage stellen, allen falschen Glanz zerstören, alle angemaßte Autorität als eitel und hohl entlarven. Davon abgesehen war er aber auch eine Führungspersönlichkeit ganz nach dem Herzen unseres Ordensgründers, des heiligen Benedikt von Nursia. Wenn man die Regel studiert, die Benedikt seinen Klöster gewissermaßen als Verfassung mit auf den Weg durch die Jahrhunderte gegeben hat, dann stößt man allenthalben auf eben jene Vorstellungen von Autorität, die mein Prior für uns verkörperte – nur dass Benedikt durchweg ernstere Formulierungen für sie fand, als wir sie von Prior Paulus zu hören gewöhnt waren.
Für Benedikt ist Autorität nur dann gerechtfertigt und gut, wenn sich Amtsgewalt mit der Sorge um jeden Einzelnen paart, wenn sie sich mit dem Respekt vor der Individualität, dem je unterschiedlichen Vermögen und der Besonderheit der persönlichen Bedürfnisse verbindet. Wenn Benedikt den Abt also mit weitreichenden Befugnissen ausstattet, dann nicht nur deshalb, weil einer das letzte Wort haben muss, sondern weil er Autorität als eine Instanz versteht, die weiterhilft, die unterstützt, die ermutigt und ermahnt und jederzeit den Fortschritt und das Wohl derjenigen im Auge hat, die ihr anvertraut sind. Zweck echter Autorität ist es mithin stets, Menschen zu größerer Selbständigkeit zu verhelfen und zu einem umfassenderen Verständnis dessen, was im Bereich ihrer Möglichkeiten liegt – mit anderen Worten: zur Freiheit.
So verstehe ich Benedikt. Seine Regel erscheint mir deshalb menschlich und klug. Aber ist sie auch noch aktuell? Sie wurde vor anderthalb Jahrtausenden verfasst, in einer Zeit des Zusammenbruchs, als mit dem Weströmischen Reich die Antike unterging. Kann man ihr heute wirklich noch entscheidende Anregungen abgewinnen für die Kunst, Menschen zu führen?
Schauen wir uns Benedikts Regel näher an. Sie ordnet eigentlich erstaunlich wenig – praktische Dinge vor allem, den Tagesablauf der Gemeinschaft, den Umgang mit dem Klostereigentum, die Psalmenfolge des Stundengebets. Immer wieder aber kreisen Benedikts Überlegungen um die Fragen: Was qualifiziert einen Menschen dazu, andere zu führen? Wie sollte er an seine Aufgabe herangehen, wie viel Rücksicht nehmen, wie viel Nachsicht üben, wie viel Strenge walten lassen? Und wie kann der Abt seine Autorität so einsetzen, dass im Kloster eine Atmosphäre entsteht, in der sich Menschen frei entfalten können? Kurzum, Benedikt geht es vor allem darum, in seiner Regel unerlässliche Ansprüche an die Persönlichkeit des Führenden zu formulieren und Maßstäbe für eine ebenso sach- wie menschengerechte Führung aufzustellen. Und diese Maßstäbe sind nach meinem Dafürhalten auch deshalb zeitlos gültig, weil sie im Menschenbild der Bibel, in der christlichen Anthropologie wurzeln.
Für mich gibt es kein realistischeres Menschenbild. Keines, das die Conditio humana treffender beschreibt. Warum? Weil die christliche Anthropologie den Menschen in seiner fundamentalen Widersprüchlichkeit begreift. Zum einen nämlich als Geschöpf und Ebenbild Gottes, daher mit Würde, mit Menschenwürde ausgestattet und deshalb unantastbar, ja heilig. Und zum anderen als schwach, als fehlbar und verführbar, kurz: als Sünder. Diese Auffassung vom Menschen hat praktische Folgen für den Umgang mit Menschen, weil mir der christliche Glaube ein ideelles Fundament für den gegenseitigen Respekt liefert und gleichzeitig eine ständige Motivation, diesen Respekt immer wieder neu zu beweisen. Es steht jetzt nicht mehr in meinem Belieben, die Menschenwürde des anderen mal zu achten, mal außer Acht zu lassen. Respekt ist zu einer unwandelbar gültigen Maxime meines Verhaltens geworden, auch gegenüber den unsympathischen Vertretern unserer Gattung. Der Grenzbeamte zum Beispiel, der mich bei meinem letzten Besuch in Nordkorea abfertigte, war nicht liebenswürdig. Er war nicht einmal höflich. Ich hätte sogar allen Grund gehabt, mich über seine Schikanen zu ärgern – und tat es nur deshalb nicht, weil mir rechtzeitig der Gedanke durch den Kopf ging: Dieser Mann ist genauso von Gott geschaffen und genauso von Gott geliebt wie du. Das hilft.
Man muss aber auch wissen: Wir haben es niemals mit Lichtgestalten zu tun. Es gibt Stärkere und Schwächere, und alle sind wir anfällig für Neid, Missgunst, Verschlagenheit oder gar Niedertracht. Diese Einsicht beugt Enttäuschungen vor. Sie macht nachsichtig, aber auch hellhörig und scharfsichtig für die Einzigartigkeit von Menschen und Situationen. Also: keine Gutgläubigkeit, keine Naivität, kein Gutmenschentum, vielmehr die Herausforderung, mit der Unzulänglichkeit des Menschen zu rechnen, ohne ihn deshalb zu verurteilen.
Dieser christliche Realismus durchzieht jene Regel, an der sich das Leben unserer Mönche und Nonnen seit Beginn unserer Ordensgeschichte orientiert. Sie unterwirft die Gemeinschaft deshalb nicht starren Gesetzen zur Bekämpfung des Bösen, sondern weist ihr anhand von Leitlinien die Richtung. Dem Abt kommt dabei die Rolle desjenigen zu, der die Regel auf den konkreten Fall, den konkreten Menschen anwendet, sie gegebenenfalls abwandelt und anpasst. Benedikt versucht eben nicht, Menschen durch peinlich genaue Vorschriften auf Linie zu bringen. Er weiß nur zu gut, dass jeder Mensch einzigartig, aber keiner vollkommen ist und dass daher jede stringente Methode, jede durchrationalisierte Technik der Menschenführung versagen muss. Benedikt hat kein Programm. Umso größere Bedeutung misst er den persönlichen Qualitäten derer bei, die Leitungsfunktionen innehaben. Die können sich eben nicht auf die Regel zurückziehen, wenn’s kritisch wird, die können sich nicht hinter ihren Vorschriften verschanzen, die müssen sich ständig nach ihrer Eignung für ihr Amt fragen lassen, ständig an ihre Verantwortung erinnern lassen, ständig an den Maßstäben messen lassen, die Benedikt aufstellt. Und das alles mit dem Ziel, im Denken, Reden und Handeln das rechte Maß zu finden. Denn darum geht es ihm in allererster Linie: um maßvolle Führer, die mäßigend wirken, Augenmaß besitzen und selbst ihren Maßstäben gerecht werden. Weil es ihnen nur dann gelingen kann, Regel und Lebenswirklichkeit in Einklang zu bringen.
Mit anderen Worten: Benedikts Regel trägt die Handschrift eines Menschen, der von der Bedeutung der Freiheit und dem Wert des Individuums überzeugt ist. Das macht sie unverwüstlich – nicht nur in meinen Augen. Bei Kamingesprächen oder Vorträgen registriere ich immer wieder amüsiert die Verblüffung von Politikern und Wirtschaftsvertretern, wenn ein Benedikt-Zitat so wirkt, als wäre es auf das gerade verhandelte Problem oder die aktuelle Lage gemünzt. Im Übrigen könnten wir Benediktiner nicht auf eine Erfolgsgeschichte von beinahe 1500Jahren zurückblicken, wenn sich diese Regel nicht unter allen Umständen und Verhältnissen bewährt hätte. Ein Benediktinerkloster ist fast nicht umzubringen, es sei denn durch äußere Gewalt. Und heute zeigt sich, dass nicht einmal die Globalisierung der Gültigkeit dieser Regel etwas anhaben kann; in unseren asiatischen, afrikanischen und amerikanischen Klöstern machen wir jedenfalls täglich die Erfahrung, dass sie sich mit dem Selbstverständnis der unterschiedlichsten Kulturen verträgt.
Ich erwarte mir von Benedikt also einiges an Inspiration für dieses Buch – wobei es mir ebenso wenig um den genialen Vorgesetzten, den perfekten Lehrer, die vollkommenen Eltern geht, wie es Benedikt darum zu tun war, aus seinem Kloster eine Kaderschmiede für christliche Idealmenschen zu machen. Niemand ist vollkommen. Auch ich nicht. Delegieren zum Beispiel… Delegieren ist wahrlich nicht meine Stärke. Meinem Sekretär, Pater Henry, überlasse ich es gerade mal, den nächsten Äbtekongress zu organisieren, aber die gesamte Korrespondenz erledige ich selbst. Vielleicht werde ich darum mit der Arbeit nie fertig. (Ich helfe mir so, dass ich alles sofort erledige, umgehend – und den Rest irgendwann.) Nein, man soll den Teufel menschlicher Unvollkommenheit nicht mit dem Beelzebub des Perfektionismus austreiben. Mit vielen Schwächen kann man im Übrigen ganz gut leben, und nicht einmal die Eitelkeit, an der mein alter Prior so gern seinen Spott erprobte, muss einen daran hindern, ein guter Chef zu sein. Ich kannte einen Vorstandsvorsitzenden, der unablässig seinen imaginären Lorbeerkranz liebevoll streichelte. Ständig ließ er in Nebenbemerkungen durchblicken, was das Unternehmen und die Menschheit ihm verdankte. Dabei verdienten seine Leistungen tatsächlich Anerkennung, und der Mann selbst war sehr sympathisch – während die Bescheidenheit seinen Nachfolger auch nicht menschlicher machte.
Dennoch: Fachwissen und Expertentum allein qualifizieren noch niemanden für eine leitende Stellung. Wo immer es in einem Unternehmen um Menschen geht, muss Management zu Führung werden. Menschen kann man nicht managen. In dem Augenblick, in dem Vorgesetzte Führungsangelegenheiten wie Finanz- oder Produktionsfragen behandeln, werden sie zu Schreibtischtätern, und auch der beste Mathematiker kann als Lehrer für seine Schüler zur Qual werden. Natürlich weiß ich, dass niemand eingestellt wird, um es sich an seinem Arbeitsplatz gutgehen zu lassen, sondern damit er seinen Anteil an der Arbeit und am Gewinn erbringt. Man kann diese beiden Aspekte meines Erachtens aber nicht voneinander trennen. Arbeit muss human sein. Ein rein gewinnorientiertes Management zerstört das Arbeitsklima, untergräbt die Motivation der Mitarbeiter und mindert deren Leistung. Echte Humanität hingegen zahlt sich langfristig aus; eine menschengerechte Unternehmenskultur muss also im Interesse jeder Firmenleitung liegen. Es stellt sich allerdings die Frage: Ist die Kunst, Menschen zu führen, überhaupt erlernbar?
Ich glaube nicht. Zumindest lassen sich Führungsqualitäten nicht auf Seminaren systematisch aneignen wie ein beliebiger Wissensstoff, und Defizite an Persönlichkeit sind auch durch einstudierte Gestik nicht zu übertünchen. Es gibt eben keine Methoden, Tricks und Kniffe, die aus einem schlechten Führer einen guten machen könnten, und jeder Untergebene durchschaut sehr bald einen Vorgesetzten, der nach einem Führungskräfteseminar plötzlich den Eindruck zu erwecken versteht, als ob er konzentriert zuhören würde. Natürlich kann die Beherrschung gewisser Techniken von Vorteil sein, auf dem Gebiet des Zeitmanagements etwa oder im Fall von Gesprächsstrategien. Nur nützt das wenig, wenn nicht bestimmte Eigenschaften wie Aufrichtigkeit und Durchhaltevermögen von zu Hause mitgebracht werden, wenn nicht bestimmte seelische Fähigkeiten wie Gelassenheit mit der Zeit und der Erfahrung hinzugekommen sind. Allerdings – auch das ist wahr: Jeder kann sein Charisma missbrauchen, jeder kann seine Autorität gegen seine Mitarbeiter oder Schüler richten, deshalb muss jeder klare Vorstellungen von seiner Verantwortung haben und sehr genau wissen, welche Ziele er als Führender verfolgen sollte. Es kann also nicht schaden, Menschen mit Führungsqualitäten die Augen dafür zu öffnen, worauf es ankommt – und ihnen damit denselben Dienst zu erweisen, den mein alter Prior seinerzeit uns erwiesen hat. So verstehen Schwester Rosanna und ich die Aufgabe, die wir mit diesem Buch übernommen haben – wobei wir den Schwerpunkt im ersten Teil mehr auf Unternehmen und Politik, im zweiten Teil eher auf Schule und Erziehung legen wollen. Es war unser Wunsch, dass auf diese Weise ein Buch der zwei Stimmen, der zwei Perspektiven entsteht, ein Buch, in dem sich meine Erfahrungen als Benediktiner und die Erfahrungen von Schwester Rosanna als Salesianerin und Vizesekretärin der Religiosenkongregation im Vatikan gegenseitig ergänzen.
Übrigens habe ich als Erzabt von Sankt Ottilien auch lernen müssen, zu Prior Paulus nach und nach auf Distanz zu gehen. Wir mochten uns weiterhin, aber auch er hatte seine Grenzen, und mit zunehmendem Alter sträubte er sich immer mehr gegen Veränderungen. «Vater Erzabt», hieß es dann, «jetzt tun S’ net so viel rumwerkeln, das bringt a Unruhe in den Konvent.» – «Pater Prior», war dann meine Antwort, «wenn wir jetzt nichts ändern, gerade dann kommt die Unruhe hinein.» Genau besehen sprachen solche Erfahrungen allerdings ebenfalls für ihn – einfach deshalb, weil ich mich von ihm als Mensch lösen konnte, ohne dass sein «ewig gutes» Vorbild dabei Schaden genommen hätte. Und vielleicht hat mein alter Prior damit das überzeugendste Beispiel für wahre Autorität geliefert.
02
DIE VERLOCKUNGEN DER MACHT
Die Persönlichkeit entscheidet
Abtprimas Notker Wolf
«In großen Unternehmen gibt es vielleicht fünf oder sechs Menschen, die dein Leben sehr stark bestimmen. Und diese Leute können dir unter Umständen jeden Funken Kreativität und Lebensfreude nehmen. Ich erlebe bei uns Vorgesetzte, die keinerlei Vision haben, ziemlich nichtssagende Menschen, ohne jede Leidenschaft für ihre Arbeit, denen es hauptsächlich darum geht, zu zeigen: Ich bin trotzdem jemand – auch wenn ich in meinem Beruf eigentlich ein Niemand bin. Diese Leute haben nur ihre Karriere im Kopf, wollen möglichst viel Geld verdienen und sich möglichst wichtig fühlen dürfen. Sie lieben es, anderen zu zeigen: Ihr seid mir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Sie handeln nach dem Motto: ‹Bilde dir bloß nicht ein, dass du etwas Besonderes bist.› Und sie schaffen es in der Tat, gute Leute kleinzumachen oder zumindest erheblichen Selbstzweifeln auszusetzen.»
Ich gebe diese Klage über ungeeignete Vorgesetzte so wieder, wie ich sie vom Redakteur einer deutschen Rundfunkanstalt gehört habe. Sie ist vielleicht nicht typisch. Aber sie geht auf typische Fehler im Umgang mit Mitarbeitern und Untergebenen ein, und sie benennt in knappster Form die Folgen. Diese bedürfen keiner Erläuterung – jeder wird schon erlebt haben, wie beeinträchtigend sich schlechte Führung auf die Arbeitsfreude (und -ergebnisse) auswirkt, und sei es in seiner Schulzeit am Beispiel schwacher Lehrer. Aber die Ursachen für schlechte Führung verdienen, untersucht zu werden.
Die große, allgegenwärtige Gefahr besteht ohne Zweifel darin, der Verführung durch die Macht zu erliegen. Keiner ist gänzlich dagegen gefeit. In ihrem despotischen Sinn wird die Macht allerdings meist von denen geschätzt, die selber nichts Bedeutendes zustande bringen. Die sich klein vorkommen, unerträglich klein, und Macht ausüben müssen, um eigene Mängel zu kompensieren. Ihr Grandiositätsgefühl wurzelt in einem Minderwertigkeitskomplex, oder sagen wir: in dem beunruhigenden Wissen, lange nicht so stark zu sein, wie sie es von ihrer Position her eigentlich sein müssten. Das beste Beispiel dafür ist der kaltschnäuzige Aufsteiger, der klassische Karrierist, der nie über die nötige Kompetenz, aber immer über die besten Beziehungen verfügte, der sich mit fünfundzwanzig Jahren geschworen hat: «Mit vierzig werde ich ganz oben sein» – und mit vierzig tatsächlich ganz oben ist.
Was bedeutet solchen Menschen die Macht? Auf jeden Fall eine enorme Erleichterung, vermute ich. Denn ihre Stellung in der Hierarchie befreit sie von der ewigen Sorge, übersehen zu werden. Und das ist ihr Problem. Der skrupellose Ehrgeizling ist ja lediglich die rabiate Variante eines Menschentyps, der mir gelegentlich auch in meinem Bereich begegnet: Mit sich selbst nicht im Reinen, leidet er unter einem fast krankhaften Anerkennungsbedürfnis. Ängstlich ist er nur auf sich selbst bedacht. Klopft man ihm auf die rechte Schulter, hält er auch noch die linke hin. Sein unersättlicher Hunger nach Respekt geht so weit, dass er in seiner Selbstachtung allein deshalb steigt, weil er einmal neben dieser oder jener namhaften Persönlichkeit gesessen, ja, womöglich ein paar Worte mit ihr gewechselt hat. Wie oft erlebe ich, dass jemand nur darum das Gespräch mit mir sucht, damit ein Schimmer meines «Glanzes» auf ihn fällt und er anschließend etwas mehr von sich selbst halten darf! Steigen solche Leute auf, bietet ihnen die Macht einen willkommenen Ausweg aus ihrer Abhängigkeit vom Applaus der anderen. Mit einem Male finden sie es ganz erträglich, nicht gemocht zu werden. Ja, sie genießen es, auf ihre Beliebtheit keinerlei Rücksicht mehr nehmen zu müssen. Und sie beweisen sich ihre Macht, indem sie möglichst viele spüren lassen: An eurer Anerkennung liegt mir jetzt nicht das Geringste mehr. Und auch eure Verachtung ficht mich nun nicht mehr an.
Was könnte man diesen Menschen raten? Gar nichts, befürchte ich. Für ihre Zwecke reicht es ja, die Belegschaft säuberlich in Freund und Feind aufzuteilen und die Feinde nach allen Regeln der Kunst gegeneinander auszuspielen – wobei sie allerdings auch ihre Freunde bloß als nützliche Idioten betrachten dürften. Immer werden sie sich in den Vordergrund spielen, werden taktieren und stets mehr ihrer Eitelkeit als der gemeinsamen Sache dienen. Vermutlich kommen solche Machtversessenen erst in dem Augenblick zur Besinnung, wenn das eintritt, was sie am meisten fürchten: der Machtverlust. Ihr Selbstwertgefühl, ihre ganze Identität hängt ja von ihrer Machtstellung ab – und nur, wenn sie ihre Schlachten verlieren, dämmert ihnen vielleicht, wie hohl das Glück ist, das sie verfolgen, wie hohl sie selbst sind. Oder aber sie bäumen sich auf und werden brutal.
Natürlich müssen wir zwischen Karriere und Karrierismus unterscheiden. Karrierismus heißt, auf anderen herumzutrampeln, um selbst höher zu steigen, oder aus demselben Grund zu kuschen und Kopf und Schwanz einzuziehen. Karriere zu machen hingegen ist zunächst einmal weder gut noch schlecht. Und zweifellos: Wer etwas bewirken und mitgestalten will, wen es nach neuen, verlockenden Aufgaben verlangt, der muss und wird aufsteigen. Es ist ja auch befreiend und befriedigend, sich endlich über Beschränkungen hinwegsetzen und Hindernisse aus dem Weg räumen zu können, die einen bislang an der Entfaltung gehindert haben. Vergessen wir auch nicht, dass das eigene Selbstwertgefühl auf dem Spiel steht, wenn die Beförderung auf sich warten lässt. Dann fragt man sich unweigerlich: Was habe ich verbockt? Kann ich etwa nichts? Oder steht mir jemand im Weg? Die wenigsten jedenfalls wollen auf die Bestätigung verzichten, die ein Karrieresprung für sie bedeutet, und ich habe nicht selten Mönche erlebt, die meinten, partout Äbte werden zu müssen. Das ist menschlich, wenn auch nicht unbedingt benediktinisch. Im Übrigen sollte man sich keine Illusion darüber machen, welchen Ansporn Ehrgeiz und auch Eitelkeit darstellen. Beide sind eine starke Triebfeder für außerordentliche Leistungen, kein Zweifel.
Den Verlockungen der Macht erliegen allerdings nicht nur die schwächeren Naturen. Die Gefahr, abzuheben, ist auch für wirklich gute Leute groß. Man kann sich nämlich daran gewöhnen, hofiert zu werden. Und es ist ein glorreiches Gefühl, umschwärmt zu sein. Dann schwillt einem der Kamm, der imaginäre Lorbeerkranz nimmt Formen an, und langsam, aber sicher befreundet man sich mit der Vorstellung, alles selbst geleistet zu haben. Jeder Erfolg wird jetzt auf das eigene Konto verbucht. Von nun an erscheinen dir Selbstgefälligkeit und Eitelkeit als berechtigter Stolz, und schließlich gibt es für dich keinen Zweifel mehr: Du kannst alles besser, und du weißt alles besser. Hinzu kommt, dass man von außen regelrecht in die Selbstherrlichkeit hineingedrängt wird, von Speichelleckern und Claqueuren, die einem unentwegt einzuflüstern versuchen: So großartig wie Sie macht das keiner. Es ist nun einmal so: Wer eine Führungsposition bekleidet und seine Sache gut macht, der kann sich kaum dagegen wehren, über den grünen Klee gelobt zu werden. Mag sich vielleicht auch nicht dagegen wehren. Die Kabinettssitzungen einer verflossenen deutschen Landesregierung fallen mir dazu ein, die unweigerlich mit Huldigungsadressen an den Ministerpräsidenten begannen, regelrechten Anbetungsstunden – sicherlich kein Einzelfall.
Ist die Selbstherrlichkeit erst einmal eingerissen, kann sie katastrophale Auswirkungen haben. Eine davon ist der Verlust des Wirklichkeitssinns. Wenn einen alle anderen überragend finden, dann sieht man eigentlich keinen Grund mehr, sich nicht auch selbst überragend zu finden, und schon beginnt man, jede Kritik für grundsätzlich unangebracht oder das Werk eines böswilligen Einzelgängers zu halten. Irgendwann fällt dann auch die ungeschminkte Lageeinschätzung unter die ungebührliche Kritik, und so verliert der Selbstherrliche allmählich den Kontakt zur Wirklichkeit. Er hat keine Ahnung mehr, was los ist, denn Selbstherrlichkeit isoliert, und Isolierte verfallen leicht dem Argwohn. Da sie nur noch zu hören bekommen, was sie hören wollen, sind sie auf Spione und Zuträger angewiesen, um in Erfahrung zu bringen, was über sie geredet und was tatsächlich gespielt wird. Auf diese Weise zerstören sie bei ihren Mitarbeitern den letzten Rest an Vertrauen und isolieren sich noch weiter. Ich habe da immer diese schönen, kraftstrotzenden deutschen Vorstandsvorsitzenden alten Stils vor Augen, denen keiner mehr die Wahrheit ins Gesicht zu sagen wagt, weil niemand eins aufs Dach bekommen möchte und jeder Angst hat, kaltgestellt zu werden. Sie fühlen sich nur noch den eigenen genialen Inspirationen verpflichtet, nicht selten mit dem Ergebnis, dass sie Millionen oder auch Milliarden in den Sand setzen. Aus Realitätsblindheit.
In früheren Zeiten mag in solchen Fällen ein Hofnarr geholfen haben. Seitdem der aus der Mode gekommen ist, wird von den höheren Rängen erwartet, dass sie Kritik und offene Worte verkraften können, gleichgültig von wem. Damit keiner, der sie vorbringt, sich zum Narren macht. In diesem Zusammenhang fällt mir eine Passage aus unserer Ordensregel ein. Im 61.Kapitel spricht Benedikt über die Gastfreundschaft und die Beherbergung fremder Mönche im Kloster. Wenn so ein Weitgereister, sagt er zunächst, keine unverschämten Ansprüche stellt, darf er so lange bleiben, wie er will. Und dann heißt es weiter: «Sollte er in Demut und Liebe eine begründete Kritik äußern oder auf etwas aufmerksam machen, so erwäge der Abt, ob ihn der Herr nicht vielleicht gerade deshalb geschickt hat.» Das ist klug. Benedikt weiß, wie leicht man betriebsblind wird. Und deshalb sagt er: Überlege dir zweimal, mein lieber Abt, ob der Mann nicht recht haben könnte. Mag ja peinlich sein, diese Kritik eines Außenstehenden, aber begehe nicht die Torheit, sie geflissentlich zu überhören. Wissen Sie was? Ich könnte mir diesen Satz aus der Regel Benedikts gut als Wandschmuck in den Chefetagen vorstellen.
Wer durch Selbstherrlichkeit das Vertrauen seiner Mitarbeiter verspielt, taugt jedenfalls nicht zur Führungskraft – einfach deshalb, weil eine gedeihliche Zusammenarbeit mit ihm unmöglich ist. Es gibt aber noch andere Erscheinungsformen des Machtrauschs. Eine davon ist die Gier, die Topmanager dazu verleitet, sich gegenseitig astronomische Gehälter und gigantische Abfindungen zu spendieren. Ich will bei Managern nicht auf den Cent schauen, sie sollen gut verdienen. Doch ihre Gehälter schließen ohnehin eine ansehnliche Risikoprämie ein – womit also wären Abfindungen in Millionenhöhe noch zu rechtfertigen? Nein, da wird doppelt und dreifach und vierfach kassiert. Wer derartig schamlos absahnt, ist maßlos und lässt damit genau das vermissen, was Benedikt für die entscheidende Tugend einer Führungspersönlichkeit hält: das Augenmaß. Immerhin möglich, dass solche Manager gute Arbeit leisten. Zu Führern allerdings taugen sie nicht, weil sie als Vorbild kläglich versagen und damit verantwortungslos handeln.
Und schließlich, die letzte Verlockung der Macht: das ausgeprägte Standesdenken vieler Manager. Standesdenken, wie es sich in den sattsam bekannten Statussymbolen und all den anderen Bemühungen ausdrückt, sich in eine hoheitliche Aura zu hüllen oder seine Autorität dadurch zu unterstreichen, dass man auf weithin sichtbare Distanz zu seinen Untergebenen geht. Lassen Sie es mich ganz unumwunden sagen: Statussymbole erfüllen allein den Zweck, ihrem Besitzer zu schmeicheln. Sie sind nichts als ein Gerüst, an das sich Menschen klammern, die im tiefsten Inneren um ihre Autorität bangen.