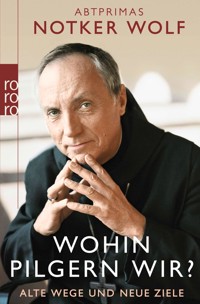8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unvorhergesehene Gedanken zum Leben «In den kleinen Unterbrechungen des Tagesablaufs, in den sogenannten leeren Zeiten, schaue ich mir die Menschen an – und immer fallen dabei kleine Erleuchtungen ab.» Plötzliche Eingebungen in Momenten der Stille oder zufällige Beobachtungen im Alltag, Einfälle des Weitgereisten oder des Abtprimas, dem die Menschen ihre Geschichten und Sorgen anvertrauen: Auf seine ehrliche und erfrischende Art stellt sich Notker Wolf in kurzen Gedankenspielen zu Treue, Meinungsfreiheit, Zwang oder Schönheit den großen und den kleinen Fragen des Lebens. «Ein Menschenfreund, der ohne Scheu klare Worte spricht.» (Münchner Merkur) «Kämpferisch und klug, voller Herzenswärme und Nächstenliebe.» (Bild der Frau)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Abtprimas Notker Wolf
mit Leo G. Linder
Alles Gute kommt von oben
Kleine Wahrheiten für zwischendurch
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Müssen wir wirklich müssen?
Kein Gott – kein Stress mehr?
Papst Benedikt XVI. – ein eiskalter Kirchenpolitiker?
Komasaufen darf kein Ausweg sein
Loslaufen und das Heilige spüren
Warum meckern, wenn man dankbar sein könnte
Ein multikultureller Dialog beim Morgengebet
Traurige Wahrheiten – Missbrauchsfälle in der Kirche
Gastfreundschaft im Treppenhaus
Die Liebe erträgt alles, auch Angst
Mut zur Ehrlichkeit
Der Teufel ist im Kommen
Da behauptet einer, Gottes Sohn zu sein
Schule – ein Ort des Quälens
Kondome und die Macht der Männer
Discountpreise für die Gaben Gottes
Ein starkes Leben mit Geschwistern
Offenheit ist nicht immer ein Segen
Lieben wir unsere Nächsten wirklich?
Tempolimit für Erwachsene
Musizieren gegen die Kräfte der Zerstörung
Das Grauen hat nicht das letzte Wort
Mein persönliches kleines Pfingsten
Der Umgangston, der aus dem Herzen kommt
Faule Eltern sind gute Eltern
Energiebündel und Draufgänger – aus diesem Holz sind Heilige geschnitzt
Verständnis dafür, wenn man aus der Reihe tanzt
Wozu ist der Mensch auf Erden?
Der Aufkleber mit der lachenden Hand
Drei Minuten zu sich selbst zurückkehren
Es gibt keine Garantie für das Leben
Flatrates und das Knausern mit Worten
Einladung an den Bettler mit Pappbecher
«Vergessen Sie das Beten nicht!»
Glücklichsein beim gemeinsamen Unkrautjäten
Schönheit ist keine Nebensächlichkeit
Erfahrungen für Menschen, die nicht zimperlich sind
Das steinerne Herz leuchtet und singt
Nicht einfach: einem Kranken die Treue halten
Schutzengel mit einem Lächeln
Schaffen wir eine Welt, in der nicht alles möglich ist
Die weise Dame und der Melonenverkäufer
Auf der Suche nach dem großen Geheimnis namens Gott
Wenn man sich selbst vergisst . . .
«Zur Hölle mit den Reichen!»
Beten unbedingt erwünscht
Die Tugend der Toleranz – oder ganz schön selbstgerecht
Mit der Isomatte auf den Spuren von Abraham und Sarah
Böse will mittlerweile jeder sein
Frauen, die ihre Männer für Dummköpfe halten
«Dieser Papst hat wieder mal nichts begriffen!»
Haben Sie Vertrauen in die eigenen Kinder
Verrat – auch wenn das eigene Leben nicht auf dem Spiel steht
Eine Hand der Versöhnung aus Stahl
Fleiß und Ordnungsliebe – einst und heute
Wie man moralischen Druck ausüben kann
Ameisen ziehen wie Christen an einem Strang
Meinungsfreiheit heißt auch: Kreuze links liegenlassen
Auf frischer Tat ertappt
Wie aus Wasser Wein wurde
Nicht einmal die Hölle will sie
Glaube – ein billiger Trost für Versager?
Ein Plädoyer für fröhliche Kinderstimmen
Lourdes und die Wunder der Heilung
So schlecht ist unsere Welt nun auch wieder nicht
Gerechtigkeitsliebe oder Gerechtigkeitswahn?
Was Friedhöfe uns sagen
Wir lassen uns zu leicht ins Bockshorn jagen
Bindung kann frei machen
Es wird hell in unserem Leben
Zwei ungeborene Kinder begegnen sich
Die Sache im Stall von Bethlehem – eine Zumutung für den Verstand
Was hat sich Gott nur dabei gedacht?
Hören und Sehen wird uns noch schnell genug vergehen
Manchmal ist das Christentum nicht nur alt, manchmal wirkt es auch so
Vorwort
Wir brauchen für unser Leben, für diese siebzig oder achtzig Jahre, die uns an Lebenszeit vergönnt sind, jede Menge Zuversicht, jede Menge Liebe, jede Menge Vertrauen, genauer: Urvertrauen. Zuversicht, Liebe und Vertrauen gehören zu unserer Grundausstattung als Menschen; wir beziehen die Kraft für ein gelungenes Leben daraus. Natürlich ist auch ein Leben ohne Zuversicht, ohne Liebe und Vertrauen möglich, aber es wäre dann ein Leben in Angst. Es wäre ein Leben, in das sich Misstrauen, Furchtsamkeit, Missgunst oder gar Feindseligkeit einschleichen würde.
Doch woher sollen wir so viel Zuversicht, Liebe und Vertrauen nehmen, dass der Vorrat sich nicht früher oder später verbraucht? Aus unserer Lebenserfahrung? Die belehrt uns eher, dass nichts von Dauer ist, die meisten Träume zerplatzen und Unheil jeden treffen kann. Und auch die Vernunft rät uns zur Kapitulation. Schau dir die Welt doch an, sagt sie, Rücksichtslosigkeit triumphiert, Verlass ist auf die wenigsten, und selbst die besten Ehen scheitern. Sei realistisch – da gibt es nichts zu hoffen! Und haben sie nicht recht, unsere Lebenserfahrung, unsere Vernunft?
Aber wir wollen nicht realistisch sein. Nicht in diesem Sinne. Wir wollen an etwas glauben, das unsere Lebenserfahrung und unsere Vernunft Lügen straft. Wir wollen uns nicht ausreden lassen, dass es das Leben trotz allem gut mit uns meint, dass die Liebe am Ende siegen wird und dass unser Leben entgegen aller vernünftigen Erwartung nicht auf ein endgültiges Verlöschen hinausläuft. Heißt das, sich törichte Illusionen zu machen? Nein. Es heißt, an das Mögliche zu glauben – wider alle Wahrscheinlichkeit. Es heißt, sich mit der Kraft zu verbünden, die uns dazu befähigt, niemals aufzugeben.
«Alles ist möglich dem, der glaubt», sagt Jesus Christus. Wir brauchen nur einen guten Grund für unseren Glauben. Einen besseren Grund als den Glauben an die Wissenschaft, die uns ein Leben im Überfluss, den Triumph über alle Krankheiten und ewige Jugend verheißt. Der beste Grund, den ich kenne, ist der Glaube an Gott, der mich ins Leben gerufen hat, der mich liebt und zu dem ich einmal zurückkehren werde. Dieser Glaube verbraucht sich im Lauf des Lebens nicht. Diese Quelle der Zuversicht, der Liebe und des Vertrauens versiegt niemals.
Im Licht meiner eigenen Lebenserfahrung betrachtet, sind diejenigen die wahren Realisten, die sich vom Realismus der Vernunft nicht einschüchtern lassen und sich mit der göttlichen Kraft der Liebe und des Lebens im Glauben verbünden. Mit den Texten dieses Bandes will ich Sie an den Erfahrungen teilhaben lassen, die man dann macht.
Gott segne Sie.
Ihr Notker Wolf
Müssen wir wirklich müssen?
Wie oft sagen Sie am Tag: «Ich muss…»? «Ich muss dies und das erledigen. Ich muss da- oder dorthin. Ich muss bis dann und dann fertig sein.» Sie haben noch nicht nachgezählt wie oft? Aber – könnte es nicht auch sein, dass «müssen» bei Ihnen häufiger fällt als jedes andere Wort? Und wenn es so wäre – müsste man da nicht erschrecken?
Achten Sie einmal darauf. Die meisten Menschen sagen nicht: «Ich will… noch schnell einkaufen gehen.» Oder: «Ich möchte… meine Tochter von der Schule abholen.» Sie sagen: «Ich muss…». (Auch mir geht es oft so!) Und das ist schon merkwürdig. Denn einerseits sind wir doch überzeugt, in einem freien Land als freie Menschen zu leben. Wir würden protestieren, wenn einer uns sagen würde: «Du bist gar nicht frei!» Und andererseits, wenn man sich anhört, was wir alles «müssen»… Als ständen wir pausenlos unter Zwang. Als würden wir nur noch Anforderungen erfüllen, Aufträge erledigen, kurz: Sachen tun, die andere von uns verlangen. Wie weit ist es also mit unserer Freiheit her? Steht die nur auf dem Papier? Und wir, die wir fest an diese Freiheit glauben – erleben wir sie aber in Wirklichkeit gar nicht?
Da ist das Handy, das klingelt. «Ich muss mal eben dran…» Da ist der Verkäufer einer Obdachlosenzeitung, der uns anspricht. «Nein danke, ich muss weiter…» Da ist die Ehefrau, die am Wochenende mit ihrem Mann etwas unternehmen möchte. «Tut mir leid, ich muss die Steuer erledigen…» Ja, völlig normal, kennen wir. Aber es ist doch verräterisch, dieses «müssen». Wir geben uns nämlich dadurch als Menschen zu erkennen, die nicht frei entscheiden können. Und vielleicht gar nicht frei entscheiden wollen. Denn es ist ja so bequem zu müssen. Es ist ja so praktisch, nicht Herr seiner selbst zu sein. Man vermeidet auf diese Weise jede Diskussion. Man verschanzt sich hinter seiner Arbeit, hinter den Erwartungen anderer – und ist dann nicht mehr verantwortlich. Braucht sich nicht mehr zu rechtfertigen. Und auch nicht mehr zu fragen: Ist das eigentlich sinnvoll und richtig, was ich hier mache? Würde es nicht auch anders gehen? Nein, geht es nicht, weil wir ja müssen. Und basta.
Aber… müssen wir wirklich ans Handy, wenn wir mitten in einer Unterhaltung sind? Müssen wir wirklich weiter, wenn der Obdachlose mit seiner Zeitung uns erwartungsvoll anschaut? Müssen wir wirklich die Steuer erledigen, wenn unser Partner endlich mal wieder eine Radtour mit uns machen möchte? Müssen wir wirklich müssen?
Kein Gott – kein Stress mehr?
Neuerdings wird öffentlich dafür geworben, nicht an Gott zu glauben. In London zum Beispiel fahren Busse durch die Stadt mit der Werbeaufschrift: «Wahrscheinlich gibt es keinen Gott – also genießen Sie das Leben.» Was wohl heißen soll: kein Gott – kein Stress mehr. Aber wieso? Wieso sollten Atheisten die glücklicheren Menschen sein?
Wenn ich die Leute, die diese Kampagne finanzieren, richtig verstehe, wollen sie etwa Folgendes damit sagen: Wer an Gott glaubt, macht sich das Leben unnötig schwer. Denn wer an Gott glaubt, quält sich mit Problemen wie Sünde und Schuld und Verantwortung herum und kann deshalb seines Lebens nicht recht froh werden. Wer hingegen an keinen Gott mehr glaubt, der braucht auch keinen Gedanken mehr an Sünde und Schuld und Verantwortung zu verschwenden, der kann entspannt in den Tag hineinleben. Mit anderen Worten: Das Glück besteht darin, es sich leichtzumachen, und Gott steht diesem Glück im Wege.
Stimmt das? Wenn ich darüber nachdenke, kommen mir Bilder in den Sinn, Situationen aus meinem langen Leben als Mönch. Da ist die schwerkranke Frau, an deren Bett ich gerufen werde. Es steht nicht gut um sie. Stellen Sie sich vor, ich würde zu ihr sagen: «Wahrscheinlich gibt es keinen Gott, also genießen Sie das Leben!» – ob die Kranke das wirklich als frohe Botschaft empfände? Oder der junge Afrikaner, der in einer unserer Werkstätten in Tansania arbeitet und Eltern und Geschwister ernähren muss, weil sein Vater erblindet ist. Wenn ich zu ihm sagen würde: «Wahrscheinlich gibt es keinen Gott, also genieße das Leben!» – ob das wirklich eine frohe Botschaft für ihn wäre? Oder der alte Mann in Sri Lanka, der zu mir kommt. Er hat den Bürgerkrieg erlebt, er hat bei einem Rebellenüberfall eine Tochter verloren. Wenn ich zu ihm sagen würde: «Wahrscheinlich gibt es keinen Gott, also genießen Sie das Leben!» – ob ihn das wirklich trösten könnte? Ob er erleichtert aufatmen würde, so wie sich die Initiatoren der Londoner Werbekampagne das offenbar vorstellen?
Lassen Sie mich ganz offen sagen: Auf uns glückverwöhnte Europäer mag diese Anzeige irgendwie plausibel wirken. Amüsieren kann man sich tatsächlich ohne Gott. Aber sobald wir einen Schritt aus unserer Wohlstandswelt hinausgehen, handelt es sich nicht mehr darum, sich das Leben leichtzumachen, sondern das Leben zu bewältigen. Kraft und Mut und Zuversicht zu sammeln, Trost und Liebe zu erfahren. Sobald es in unserem Leben ernst wird, lautet die wahrhaft frohe Botschaft: Es gibt einen Gott, und er ist gnädig und barmherzig, weil er uns liebt.
Papst BenediktXVI. – ein eiskalter Kirchenpolitiker?
Viele haben sich Anfang 2010 über den Papst erregt. Zu Recht? Hat sich BenediktXVI. wirklich als weltfremder Theologe und eiskalter Kirchenpolitiker geoutet? Nein, das hat er nicht. Die Empörungswelle, die über den Vatikan hinweggerollt ist, war überflüssig – man hätte den Fall nur etwas gründlicher studieren müssen. Offenbar gibt es viele, die nur allzu gern die erste Gelegenheit ergreifen, auf den Papst einzuprügeln.
Was ist geschehen? Eine Gruppe von Bischöfen hatte darum gebeten, wieder in die Kirche aufgenommen zu werden. Sie waren vor vielen Jahren exkommuniziert, also aus der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen worden, weil sie die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils ablehnten. Dadurch war eine Kirchenspaltung entstanden. Jetzt waren die ehemaligen Rebellen zur Versöhnung mit der Kirche bereit. Kein Papst hätte da nein sagen können, denn: Es gehört zu seinen Hauptaufgaben, die Einheit der Christen zu wahren. Der Papst musste die Chance ergreifen, diese Kirchenspaltung rückgängig zu machen. Also hat er die zuständigen Stellen im Vatikan angewiesen, den Versöhnungswunsch der abtrünnigen Bischöfe zu erfüllen.
Nun ist zweifellos richtig, dass diese Bischöfe einer sehr traditionellen Richtung des Katholizismus angehören. Sie werden erst noch beweisen müssen, dass sie ihre starre, engstirnige Haltung aufgeben. Und es stimmt auch, dass sie politisch erzkonservativ sind. Aber politische Meinungen dürfen einen Papst nicht interessieren – weder bei einfachen Gläubigen noch bei Bischöfen. Ihm geht es allein um den Glauben. Ich finde also, dass der Papst grundsätzlich richtig gehandelt hat. Allerdings hatte er die Rechnung ohne den englischen Bischof Williamson gemacht. Der wollte die Versöhnung offenkundig torpedieren – und hat zur rechten Zeit seine absurden Ansichten zum Holocaust veröffentlicht. Er wusste, dass er damit einen Skandal entfachen würde. Ihm war klar, dass er den Papst damit blamieren konnte. Und die Medien sind ihm prompt auf den Leim gegangen.
Denn natürlich teilt der Papst die Ansichten von Bischof Williamson nicht. Jedem denkenden Menschen ist klar, dass BenediktXVI. den Holocaust für ein abscheuliches Verbrechen hält. Nein, geoutet haben sich all diejenigen, die über den Papst hergefallen sind. Und zwar als Leute, denen anscheinend jeder Anlass recht ist, den Papst in Misskredit zu bringen.
Komasaufen darf kein Ausweg sein
Darf das wahr sein? Zwei Drittel der älteren Hamburger Schüler beteiligen sich am Komasaufen, trinken also mehr oder weniger regelmäßig bis zum Umfallen. Rund 20000Jugendliche landen in Deutschland alljährlich mit Alkoholvergiftung auf einer Intensivstation. Und vierzehnjährige Drogenabhängige sind längst keine Seltenheit mehr. So steht es in der Zeitung. Jetzt kann man sich fragen: Stimmt mit den jungen Leuten etwas nicht? Oder mit der Welt, in der sie leben? Oder stimmt mit uns etwas nicht, den Erwachsenen? Den Eltern, Lehrern und Erziehern?
Denn irgendetwas muss doch faul sein, wenn junge Menschen sich massenhaft so gezielt aus der Realität katapultieren. Wenn sie ihr Heil im Alkohol suchen, wenn ihnen Selbstzerstörung als einziger Ausweg erscheint. Bloß nichts mehr mitkriegen! Betäubung um jeden Preis! Aber was ist denn so grässlich an ihrem Leben?
Natürlich ist nichts grässlich an ihrer Welt, sagen unsere Politiker. Alarmiert sind sie aber schon. Sie möchten das Komasaufen gern für eine verrückte Jugendmode halten und wenden sich darum hilfesuchend an Werbeagenturen. Die verstehen was von Mode. Die werden den Jugendlichen schon mit coolen Sprüchen einreden, dass Saufen bis zum Umfallen uncool ist. Und wenn das nichts hilft, versucht man es eben mit Ekelfotos auf Bierdeckeln. Ein bisschen Abschreckung, das muss reichen. Nur nicht nach den Ursachen fragen! Nur nicht den Dingen auf den Grund gehen!
Denn dann käme womöglich heraus: Ja, es ist etwas grässlich an ihrer Welt. Es ist etwas äußerst bedrohlich. Sie haben sich verirrt in einer Welt der tausend Möglichkeiten. Verloren stehen sie an einer Kreuzung mit Wegweisern in alle Richtungen und wissen nicht wohin. Welchen Weg sie einschlagen sollen. Denn Wegweiser nützen nur, solange man weiß, wohin man will. Sie aber sind alleingelassen und ohne Orientierung. Wählt euch euren Weg selbst, haben ihre Eltern ihnen gesagt, wir wollen euch nicht hineinreden. Sucht euch euren Lebenssinn allein, haben ihre Lehrer ihnen gesagt, wir wollen euch nichts vorschreiben. Mit anderen Worten: Niemand hat sie als Kinder auf den Weg gebracht. Kein Elternhaus hat ihnen Starthilfe gegeben, kein Lehrer ihnen die Richtung gewiesen. Jetzt haben sie die Wahl und wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Sie lassen sich auf der Kreuzung nieder und trinken bis zur Bewusstlosigkeit. Der einzige Ausweg. Darf das wahr sein?
Loslaufen und das Heilige spüren
Als unzufriedener Mensch aufbrechen, um als zufriedener Mensch zurückzukehren? Die Frau aus München, die mir ihre Geschichte erzählte, hatte es tatsächlich so erlebt. Vor zwei Jahren hatte sie sich auf eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela gemacht, war mit ihrem Rucksack gleich von München aus losgelaufen und hatte die 2500Kilometer nach Spanien in 103Tagen geschafft. Eine tolle Leistung! Doch um die Leistung war es ihr gar nicht gegangen.
«Ich wollte einfach mal in eine andere Welt kommen», sagte sie. Sie hatte als Abteilungsleiterin in einem Konzern gearbeitet und war mit neunundfünfzig in den Ruhestand versetzt worden. Doch sie fand keine Ruhe. Es fehlte ihr an nichts, aber daheim bei ihrem Mann hielt sie es nicht aus. Da lief sie los. Allein. Ziel: der Wallfahrtsort Santiago de Compostela. Ankunft: irgendwann. Und von den ersten Tagen an fühlte sie sich als Pilgerin. Sie schlief im Stroh oder in Klöstern oder in einfachen Herbergen. Sie nahm an den Abendmessen für Pilger teil. Sie erlebte Pfarrer, die sich hinterher zu ihnen im Speiseraum dazusetzten, ganz selbstverständlich. Und einmal kochte ein Pater für die ganze Gruppe Knoblauchsuppe und teilte sie dann eigenhändig aus. Sie liebte diese Gemeinschaft von Leuten, die nicht um Anerkennung kämpften, mit denen man still und ernst sein konnte. Auch unterwegs kam es ständig zu Begegnungen mit anderen Pilgern, und manchmal lief sie zwei, drei Tage lang in ihrer Gesellschaft. Dann wieder war sie allein – und verlor sich so in Gedanken, dass sie mehrmals vom Weg abkam. «Wenn man allein ist», sagte sie, «läuft die innere Uhr rückwärts. Man fängt bei der Kindheit an, geht alle Stationen seines Lebens durch und überlegt, ob man etwas hätte besser machen können.» Wie eine kleine Lebensreise sei diese Pilgerfahrt für sie gewesen.
Und als sie endlich in Santiago de Compostela ankam, hatte sie manches dazugelernt. Dankbarkeit zum Beispiel. Dankbarkeit für die Gastfreundschaft und für die Begegnungen, zu denen es unterwegs gekommen war. Auch Bescheidenheit, also Verzicht auf die übertriebenen Ansprüche, die sie immer gehabt hatte. Und Ehrfurcht. Ein Sonnenuntergang konnte bei ihr diese Ehrfurcht auslösen oder der dunkle, kühle Innenraum einer Kirche. Sie hatte nun wieder Augen und Ohren dafür, dass es etwas Größeres gab als sie selbst. Sie hatte ein Gespür für das Heilige entwickelt. Und sie kehrte zufrieden heim. War sie Gott begegnet? Zumindest war sie jetzt dazu bereit. Und damit hatte sie das eigentliche Ziel des Pilgerns tatsächlich erreicht.