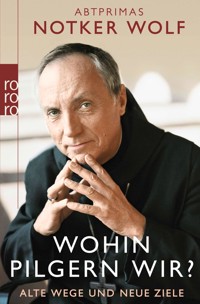16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bene! eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Heimat" – das ist für den vielgereisten ehemaligen Abtprimas Notker Wolf mehr als ein Ort. Es ist ein Lebensgefühl. In seinem Debattenbuch beleuchtet er den vielschichtigen Heimat-Begriff und behandelt die Frage nach einer typisch deutschen Kultur. Denn diese ist für ihn der Schlüssel im Umgang mit dem Fremden, von dem wir uns nicht abschotten können. Was macht für uns Heimat aus? Ist Heimat nur ein Ort? Fühlen wir uns dort heimisch, wo wir eine gemeinsame Sprache sprechen? "Heimat – das sind für mich vor allem die Menschen, mit denen ich sie teile", sagt Notker Wolf. In einem kleinen Ort im Allgäu aufgewachsen, hat sich der ehemalige Abtprimas des Benediktinerordens die Welt zu Eigen gemacht, vielfältige Erfahrungen gesammelt und bis zu 300.000 Flugmeilen Jahr für Jahr hinter sich gebracht. In Tokio hat er vergeblich versucht, im Telefonbuch eine Adresse zu finden, in Togo auf dem Boden von Lehmhütten geschlafen – in Nordkorea sah er sich der Bewachung durch die Behörden ausgesetzt. Notker Wolf weiß, wie es sich anfühlt, fremd und auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Auch deshalb hat er einen anderen Blick auf die Menschen, die als Geflüchtete zu uns kommen. Für ihn steht fest: Wir können uns in Deutschland nicht abschotten, sind längst ein Land der vielen Kulturen und müssen miteinander Wege suchen, wie wir ein friedliches Zusammenleben gestalten können. Aber Notker Wolf ist auch nicht für einen "Kuschelkurs" zu haben, und sieht klare Grenzen für ein gelingendes Miteinander. Wer diese überschreitet, "muss dahin zurück, woher er kommt", bringt Wolf es auf den Punkt. In seinem Buch schreibt der bekannte Benediktiner auch über deutsche Tugenden und Werte. Wo und warum fühlen wir uns geborgen und in unserem eigenen Leben zu Hause? Wie kann mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen ein gutes Leben gelingen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Notker Wolf
Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein
Was Heimat wirklich ausmacht
Mit Bildern von Hans-Günther Kaufmann
Knaur e-books
Über dieses Buch
»Heimat« – das ist für den vielgereisten ehemaligen Abtprimas Notker Wolf mehr als ein Ort. Es ist ein Lebensgefühl. In seinem Debattenbuch beleuchtet er den vielschichtigen Heimat-Begriff und behandelt die Frage nach einer typisch deutschen Kultur. Denn diese ist für ihn der Schlüssel im Umgang mit dem Fremden, von dem wir uns nicht abschotten können.
Was macht für uns Heimat aus? Ist Heimat nur ein Ort? Fühlen wir uns dort heimisch, wo wir eine gemeinsame Sprache sprechen? »Heimat – das sind für mich vor allem die Menschen, mit denen ich sie teile«, sagt Notker Wolf.
In einem kleinen Ort im Allgäu aufgewachsen, hat sich der ehemalige Abtprimas des Benediktinerordens die Welt zu Eigen gemacht, vielfältige Erfahrungen gesammelt und bis zu 300.000 Flugmeilen Jahr für Jahr hinter sich gebracht. In Tokio hat er vergeblich versucht, im Telefonbuch eine Adresse zu finden, in Togo auf dem Boden von Lehmhütten geschlafen – in Nordkorea sah er sich der Bewachung durch die Behörden ausgesetzt.
Notker Wolf weiß, wie es sich anfühlt, fremd und auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Auch deshalb hat er einen anderen Blick auf die Menschen, die als Geflüchtete zu uns kommen. Für ihn steht fest: Wir können uns in Deutschland nicht abschotten, sind längst ein Land der vielen Kulturen und müssen miteinander Wege suchen, wie wir ein friedliches Zusammenleben gestalten können. Aber Notker Wolf ist auch nicht für einen »Kuschelkurs« zu haben, und sieht klare Grenzen für ein gelingendes Miteinander. Wer diese überschreitet, »muss dahin zurück, woher er kommt«, bringt Wolf es auf den Punkt.
In seinem Buch schreibt der bekannte Benediktiner auch über deutsche Tugenden und Werte.
Wo und warum fühlen wir uns geborgen und in unserem eigenen Leben zu Hause? Wie kann mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen ein gutes Leben gelingen?
Inhaltsübersicht
VORWORT
Wenn in diesen Tagen über den Begriff Heimat diskutiert wird, dann schlagen schnell die Wogen hoch. In jedem klingt etwas anderes an, wenn er über das Wort nachdenkt. Dem einen wird es warm ums Herz, weil er an seine Heimatstadt denkt oder an die Berge und das Meer der Region, in der er aufgewachsen ist. Manchmal ist dieses Nachdenken auch mit etwas Wehmut verbunden, weil wir längst woanders wohnen.
Andere können mit dem Wort Heimat überhaupt nicht viel anfangen. Für sie ist ihr jetziges Zuhause einfach der Ort, an dem sie sich wohlfühlen. Heimat hat für sie den Beigeschmack von Kitsch, klingt nach Volksmusik und vorgestern.
Manche haben sich bewusst abgewendet und mit der eigenen Vergangenheit gebrochen. Ja, Heimat ist nicht bei jedem positiv besetzt. In der jüngsten Geschichte wurde der Begriff missbraucht, um Menschen ideologisch zu verführen und Hass auf andere zu schüren. Das sogenannte Dritte Reich hat in dieser Hinsicht eine tiefe Wunde gerissen. Als der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland kürzlich sagte, dass Hitler und die Nazis »nur ein Vogelschiss« in der deutschen Geschichte seien, gingen zu Recht viele auf die Barrikaden. Die nationalsozialistische Schreckensherrschaft und den Tod von Millionen von Menschen derart zu verharmlosen – das macht mich wütend und traurig.
Eines steht fest: Wir müssen uns unserer Vergangenheit stellen, und wir bauen auf dem auf, was uns unsere Väter und Mütter hinterlassen haben. Natürlich ist nicht jeder persönlich schuld an unserer gemeinsamen Geschichte. Das geht zu weit. Aber auch derjenige, der im Jahr 2000 geboren ist, sollte um die Geschehnisse wissen und Verantwortung übernehmen, dass sich Derartiges bei uns nicht wiederholt.
Manche fordern seit einiger Zeit vehement, dass wir »das christliche Abendland« verteidigen und uns abschotten müssen. Andere sehen die Notwendigkeit, dass wir um der Menschlichkeit willen unsere Türen nicht verschließen dürfen. Aber wie viele Geflüchtete können wir aufnehmen?
Während ich diese Zeilen schreibe, tobt gerade wieder einmal die Debatte zwischen den unterschiedlichen Lagern. Angela Merkel hält an ihrer bisherigen Politik fest, und an vielen Orten in Deutschland demonstrieren Menschen für eine Kultur der Offenheit. Horst Seehofer fordert hingegen als Innen- und Heimatminister, die Grenzen jetzt sofort weitgehend dichtzumachen. Und der italienische Premierminister verkündet nahezu zeitgleich, dass man ab sofort alle Schiffe mit Geflüchteten an der Küste seines Landes zurückweisen und weiterschicken wird. Aber wohin sollen die Menschen gehen, die ihre Heimat hinter sich gelassen haben, um ihr Leben zu retten – oder um ihren Kindern eine Zukunftsperspektive zu geben?
Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, fremd und auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Auch deshalb habe ich einen anderen Blick auf die Menschen, die als Flüchtlinge zu uns kommen. Und für mich steht fest: Wir können uns in Deutschland nicht abschotten. Wir sind längst ein Land der vielen Kulturen und müssen miteinander Wege suchen, wie wir ein friedliches Zusammenleben und eine gemeinsame Zukunft gestalten können. Aber ich bin auch nicht für einen »Kuschelkurs« zu haben und sehe klare Grenzen, damit ein Miteinander gelingen kann.
Durch die Flüchtlingssituation sind wir herausgefordert, darüber nachzudenken: Wer sind wir eigentlich? Wir müssen unsere eigenen Werte reflektieren.
Auch durch den Mobilitätswahnsinn – dass man von berufstätigen Menschen eine bis vor wenigen Jahren nicht gekannte Flexibilität mit Blick auf immer wieder wechselnde Arbeitsorte erwartet – entsteht bei manchen eine tiefe Verunsicherung. Wo gehöre ich eigentlich hin, wo ist mein Platz?
Wo und warum fühle ich mich geborgen? Was macht mein Leben in seinem Kern aus? Was sind die Grundpfeiler unserer Demokratie, unseres Glaubens, unserer Kirchen? Und wie kann mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen ein gutes Leben gelingen?
Was bedeutet Heimat für uns? Dieser Frage gehe ich in diesem Buch nach. Ist es nur ein Ort, oder ist es eine Region? Fühlen wir uns dort heimisch, wo wir eine gemeinsame Sprache sprechen? Welche Rolle spielen unsere kindlichen Prägungen, unsere Kultur? Ich kann auch im eigenen Land fremd sein – oder in mir selbst.
Es lohnt sich dabei, über deutsche Tugenden und Werte nachzudenken. Denn wir brauchen Wurzeln, um in einer immer komplexer werdenden Welt einen Halt zu finden. Der Heimatbegriff ist dabei vielschichtig, das merkt man schnell, wenn man sich damit beschäftigt. Und es gibt keine einfachen Antworten.
Einiges sehe ich kritisch in unserer Gesellschaft: wie wir Beziehungen pflegen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen – und auch wie manche ihre Kinder erziehen. Aber ich habe auch Hoffnung für diese Welt, weil ich weiß, wo ich hingehöre und dass es den einen gibt, der alles in seinen Händen trägt, auch wenn wir ihn nicht sehen können.
Nach vielen Jahren in der Fremde bin ich vor einer Weile wieder nach Hause gekommen: nach St. Ottilien, wo meine Reise in die Welt einst begonnen hat. Und ich kann heute sagen: Heimat – das sind für mich vor allem die Menschen, mit denen ich sie teile.
Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass auch Sie für sich ganz persönlich Heimat finden.
Abt Notker Wolf
© Hans-Günther KaufmannIn Indien
DIE FREMDE
Die Fremde verunsichert. Ich habe dies unter anderem in Japan erlebt, als ich auf einer Reise nach Südamerika südlich von Tokio festsaß. Seit einigen Tagen war ich unterwegs, um Klöster in Asien zu besuchen. Anschließend sollte es für mich weiter nach Kolumbien gehen, ins Kloster El Rosal. Auch dort standen Gespräche an.
Ich hatte die Reise, wie meistens, wenn ich allein unterwegs bin, nicht bis in alle Einzelheiten geplant. Denn die Erfahrung lehrt, dass dies in bestimmten Regionen schlicht keinen Sinn macht. Manchmal wird man tagelang irgendwo aufgehalten, weil das Wetter es nicht zulässt, weiterzureisen. Hinzu kommen die Probleme, die man als katholischer Geistlicher in einigen Ländern mit den Behörden bekommt, weil das Christentum dort unerwünscht ist.
Ziemlich abgekämpft und müde stand ich jetzt mit meinem Koffer am Gate. Wie ich weiterkommen sollte, war völlig offen. Zunächst brauchte ich ein Visum für die USA, weil ich über Los Angeles fliegen wollte. Ob ich dies noch heute, an einem Freitagnachmittag, bekommen würde, stand in den Sternen. Bis in die Stadt und auf die Pass-Behörde war es jedenfalls ein sehr langer Weg.
Mit meinem Gepäck lief ich auf dem Flughafen hin und her, auf der Suche nach einer Telefonzelle, um von dort aus meine japanischen Mitbrüder anzurufen. Dummerweise hatte ich vergessen, mir deren Telefonnummer zu notieren – auch weil im Vorfeld noch gar nicht klar war, dass mich mein Weg hierherführen würde. Ich hatte mehrmals umplanen müssen.
Als ich endlich eine Telefonzelle gefunden hatte, schlug ich das Telefonbuch auf – und konnte rein gar nichts lesen. Mich empfing auf den Seiten ein Meer voller fremdartiger Zeichen …
Das war es dann. Ernüchtert stellte ich fest: Jetzt steckte ich wirklich in einer Sackgasse. Zu meinen Mitbrüdern konnte ich jedenfalls nicht fahren, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich sie erreichen und wie ich sie jemals finden sollte.
So etwas ist mir im Laufe der Jahre immer wieder passiert. Letztlich ist es auch dieses Mal gut ausgegangen. Für die Nacht hat sich doch noch ein Quartier gefunden, und am nächsten Tag konnte ich auch ohne ein gültiges Visum über Vancouver nach Mexiko weiterreisen. Zwei Tage später war ich glücklich in Bogotá.
Irgendwo zu stranden und nicht mehr weiterzukommen verunsichert einen total. Und auch all die anderen Fragen, die sich einem unterwegs stellen: Soll ich die Schuhe ausziehen, wenn ich den Raum betrete, oder nicht? Wie begrüßt man einander richtig, ohne unhöflich zu wirken? Und wie isst man das, was einem angeboten wird? Mehr noch: Kann ich das überhaupt essen? Seegurken, Kutteln, undefinierbare Innereien und anderes, scheußliches Zeugs, das es unterwegs zu essen gab.
Es gibt viele Menschen, die fahren in ein anderes Land in Urlaub und wollen dort gerade nichts Neues erleben, sondern möglichst die gleichen Bedingungen vorfinden wie zu Hause.
In den 60er-Jahren, als die Deutschen in Scharen nach Italien gefahren sind, als sie Rimini, Riccione und andere Orte unsicher gemacht haben, da wollten fast alle unbedingt nur Hühnchen, grünen Salat und Kartoffelsalat haben – oder Fritten. Und das musste geliefert werden, damit sie sich dort wohlgefühlt haben. Später fand man es hierzulande interessant, sich auf andere Kulturen einzulassen, und die chinesische, koreanische oder kroatische Küche hat seit Jahren auch bei uns zu Hause Einzug gehalten. Anderes bleibt uns fremd, das wollen wir lieber nicht anrühren und auch auf keinen Fall probieren. Und manch einer besteht auch weiterhin darauf, am griechischen Badestrand eine deutsche Bratwurst zu essen.
Ich bin manches gewohnt. Aber doch jedes Mal gespannt, was es wohl zu essen gibt. Nicht immer ist es reizvoll, wenn man ein Lokal betritt und sich als Erstes eine Schlange aus dem Terrarium aussuchen soll. Die Auswahl habe ich dann meinen Begleitern und Freunden überlassen, denn ich weiß ja nicht, was gut ist. Und es ist schon eine Zumutung, wenn die in Stücke gehackte Schlange auf dem Tischgrill liegt und alles, was man davon auf den Teller gelegt bekommt, nur an einer Ecke etwas aufgeschlitzt ist. Dann hält man die Haut fest und zerrt mit den Zähnen das Fleisch herunter.
Das Schlimmste war bislang für mich das Nackenstück einer Schildkröte. Die sah schon so blau aus … Schlimm! Oder die Konsistenz der Seegurken … Puhh. Bei den Schlangen haben wir uns als Deutsche gegenseitig ermuntert und gesagt: »Das sind Landaale. Und Aale mögen wir ja gerne.« Hunde zu essen, die dort als Delikatesse gehandelt wurden, war für mich auch ganz schlimm.
Als wir in China endlich mit unserem Gesprächspartner einen Vertrag verhandelt hatten, sagte dieser: »So, jetzt gibt es zur Feier des Tages Hund. Wir haben für Sie ex-tra diesen gelben Hund, der da vorhin die ganze Zeit im Hof herumgelaufen ist, schlachten lassen.« Da musste ich herzlich lachen, auch wenn es mich bei dem Gedanken an den Hund gegruselt hat.
Meist habe ich in solchen Momenten zuerst einen Schluck Schnaps in den Mund genommen, dann einen Bissen vom Essen und ein Bier hintendrein, damit das alles verkraftbar war. Der Froschlaich ging ja noch – aber der Froschhoden … Was es genau war, das haben sie uns auch erst hinterher gesagt.
Wie man die Fremde erlebt, beschreibt auch der Philosoph Poseidonius in einem Text aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Viele Jahre war er unterwegs, unter anderem in Spanien, Italien und Frankreich. Seine Berichte zu lesen ist spannend. Seine Erkenntnis lautet, frei übertragen, so: »Mein Gott, was sind das für Barbaren. Während wir da mit goldenen und silbernen Messerchen und Gabeln alles verteilen, gehen die her, hocken um ein ganzes Stück Vieh herum, reißen sich Haxen herunter und beißen da rein. So ein kulturloses Volk!« Man meint, man liest einen Bericht aus dem 19. Jahrhundert über Afrika und »die Wilden«. Und dabei geht es um Europa!
Die Fremde stellt uns infrage, gerade auch durch die anderen Sitten und einen anderen Glauben.
Jahrelang musste ich mich in der Fremde zurechtfinden. Um es mir leichter zu machen, habe ich stets ein Stück Heimat auf meine Reisen mitgenommen. Selbst wenn mein Gepäck nicht groß war: Meine Querflöte war fast immer mit dabei. Früher hatte ich manchmal auch die E-Gitarre im Gepäck, ich trug sie auf dem Rücken. Das wurde dann leider im Laufe der Zeit immer komplizierter. Da ich heute meist nur noch mit doppeltem Handgepäck fliege, kann ich dies so nicht mehr machen. Eine Gitarre wäre schlicht des Guten zu viel. Aber meine Flöte, mein benediktinisches Brevier, ein wenig löslichen Kaffee, meinen Tauchsieder und die Zwischenstecker, damit ich diesen auch in Betrieb nehmen kann, die habe ich dabei. Und dann nehme ich vor allem noch eines aus der Heimat mit: meine Neugier auf Neues.
Vielen geht es so, dass sie etwas Vertrautes mit dabeihaben möchten, wenn sie weit entfernt von zu Hause sind. Und sei es nur ein Foto der Menschen, die man liebt.
Natürlich nimmt man sich auch immer selbst mit, wenn man unterwegs ist. Seine Eigenarten, seine Gewohnheiten und seine Ansichten, wie das eine oder andere »richtig wäre«. Oder der Gedanke, wie es »die anderen« auf jeden Fall machen sollten, damit es besser funktioniert. Warum stellen die sich nicht in eine Schlange wie bei uns zu Hause? Warum reden die hier so lange an der Kasse miteinander, anstatt mich zu bedienen? Weshalb sieht das alles so seltsam aus? So unordentlich, so wenig gepflegt? Wir merken meist schnell, dass wir unsere eigenen Maßstäbe hier nicht anlegen können. Es passt einfach nicht in die Landschaft, zu den Menschen und deren Kultur.
Und was spricht dagegen, dass die Verkäuferin mit ihrer Kundin bespricht, was gerade alles in der Nachbarschaft wichtig ist? Mancherorts ist es die einzig effektive Möglichkeit, Nachrichten schnell zu verbreiten …
Oder dass sich der italienische Gärtner in der brütenden Mittagshitze zwei Stunden unter den Olivenbaum legt, weil derzeit ohnehin nicht ans Arbeiten zu denken ist. Wir kennen das anders. 30 Minuten Mittagspause müssen reichen. Und Zeit ist Geld!
Es ist schwer, über seinen eigenen Schatten zu springen. Und ich merke doch: Es scheint anders zu gehen. Gelassener, ruhiger, freundlicher. Weniger gestresst, weniger ordentlich. Diejenigen, die die fernöstliche Art lieben, sagen: Nur so geht es, mit dieser Art von Gelassenheit und mit deren Weg der Meditation.
HEIMKEHR
Lange war ich fort. Mehr als 16 Jahre. Und ich erinnere mich gut an den Tag, als ich zurückkam. Ein Teil meiner Habseligkeiten passte in den Kofferraum und auf die Rückbank meines Wagens, als mein Begleiter und ich von Rom aus durch die Alpen gefahren sind. Der Großteil war schon von einem VW-Bus nach St. Ottilien transportiert worden, im Wesentlichen meine Büchersammlung, die viele Kisten füllte. Am Ammersee vorbei kurvten wir durch die vertraute Landschaft und bogen wenig später in die Einfahrt des Klosters. Der Platz mit dem Brunnen. Die Klosterkirche. Die Pforte. Ich war angekommen.
»Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh«, singen wir in einem Kirchenlied. Für einen Benediktinermönch endet diese Wanderschaft in der Regel immer dort, wo sie begonnen hat: in seinem Heimatkloster.
Von meinem alten Zimmer hatte ich früher auf die Berge geblickt, das war schön. Aber als ich nun zurückkam, habe ich ein neues Zimmer bekommen, weil das alte zu klein gewesen wäre. Überdies hatte es inzwischen eine andere Verwendung gefunden. Es wurde schon vor einiger Zeit in die Krankenstation des Klosters integriert, um diese zu erweitern. Denn wir haben inzwischen viele Ältere in unseren Reihen, die gepflegt werden müssen.
Von meinem neuen Zimmer aus blicke ich jetzt auf einen Weiher. Das ist auch nicht schlecht. Man kann viel entdecken, wenn man sich Zeit nimmt. So schaue ich den jungen Enten zu, wie sie gerade flügge werden, oder wenn die Schüler dort Floß fahren oder Schlittschuh laufen.
Für Menschen wie Caspar David Friedrich oder für Johann Wolfgang von Goethe wäre der Anblick des Weihers vor der Kulisse des Klosters jedenfalls ein Genuss – ein wunderbar romantisches Vergnügen.
Leider war der Aufzug im Konventgebäude gerade defekt, als ich nach St. Ottilien zurückkam. Monatelang musste ich einige Hundert Stufen zu meinem Zimmer emporsteigen. Man hat mir natürlich beim Schleppen geholfen, als es galt, meine Habseligkeiten nach oben zu schaffen. Aber ich habe die meisten meiner gut 30 Kisten, die ich mitgebracht habe, eine ganze Weile lang nicht ausgepackt. Drei Kisten stehen bis heute ungeöffnet. Den Inhalt brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Viele Bücher habe ich in die Bibliothek gebracht. Als Mönch ist mein privater »Besitz« überschaubar. Eigentlich brauche ich nichts Besonderes. Was mir wichtig ist: mein Schreibtisch, meine Gebetbücher, mein Laptop. Und natürlich die Sprachen und die Theologie. Gerade lese ich von Dietrich Bonhoeffer die »Christologie« – und dies noch einmal mit völlig anderen Augen, als ich es als junger Mann getan habe.
Ich bin wieder ein einfacher Mönch, der zwar den Titel »Abt« trägt, aber im Kloster keine Führungsaufgabe mehr hat. Und ich mache alles selbst, organisiere meine Reisen und Vorträge.
Das Kloster St. Ottilien ist meine Heimat und meine große Familie. Die Mitbrüder haben mich voller Freude wieder in ihrer Mitte aufgenommen. Allerdings fehlen viele Menschen, die mir wichtig waren und die mir am Herzen lagen. Ich sehe die Löcher, die gerissen wurden, stehe an ihren Gräbern.
Ich bin so nicht mehr in die Heimat zurückgekehrt, die das Kloster einmal für mich war. Es ist ein Stück weit nicht mehr das St. Ottilien, das ich kannte.
Ich bin hierhergekommen und habe mich eine Weile lang fremder gefühlt als im Ausland. Das liegt daran, dass ich etwa nur noch die Hälfte derer hier vorgefunden habe, die ich 16 Jahre zuvor verlassen hatte. Menschen, die mir vertraut und wichtig waren. Aber es ist auch schön zu sehen, dass sich die Gemeinschaft verändert hat, dass neue Mitbrüder hinzugekommen sind. Es gibt jetzt eine junge Generation tüchtiger Benediktiner, die das Klosterleben miteinander gestalten.
Auf dem Klostergelände gibt es Herzensstücke, die mir in besonderer Weise etwas bedeuten. Ich denke an die Klosterkirche, die ich damals habe renovieren lassen, den Brunnen, der auf meine Initiative zurückgeht, und manches mehr. Wir haben die Kirche bei der damaligen Renovierung auf den ursprünglichen Plan zurückgeführt, nach dem Vorbild einer belgischen, frühgotischen Zisterzienserkirche. Und die ist einfach in sich so wunderbar stimmig.
Ich hatte nie den Ehrgeiz, alles neu zu machen. Und auch nie so richtig Lust am Bauen. Es war mir meistens egal, auf welche Weise die anstehenden Probleme und Themen letztlich gelöst wurden. Hauptsache, es funktionierte am Ende und es hatte Stil. 23 Jahre habe ich hier gewirkt, in so einer langen Zeit lässt sich manches bewegen.
Erinnerungsorte. Die brauchen wir. Sie tun unserer Seele gut. Wenn die Kirche in der Zwischenzeit schon wieder umgemodelt worden wäre, in einer ganz anderen Art – das wäre nichts.
Für meine Mitbrüder war es natürlich auch spannend, als ich nach so langer Zeit zurückkam. Für sie bin ich immer noch ein bunter Vogel, weil ich ein anderes Leben geführt habe. Und trotzdem bin ich auf meine Weise im Kloster St. Ottilien sehr präsent. Es ist ein gutes Miteinander.
Manche, die sich dafür interessieren, in einem Kloster zu leben, erhoffen sich dabei vor allem Gemeinschaft und gute Freunde zu finden, weil sie sich nach Nähe sehnen. Aber so einfach ist es nicht. Die meisten, die so denken, werden enttäuscht.
Das gemeinsame Leben, Beten und Arbeiten macht das Leben im Kloster aus. Wir freuen uns am Miteinander. Der Mensch braucht die Gemeinschaft mit anderen. Aber es geht nicht um Freundschaft und Beziehung, wenn man im Kloster lebt. Wir wahren bewusst die Distanz, die es als Ordensleute braucht, damit das Kloster als Ganzes funktioniert. Und auch im Kloster gibt es natürlich Auseinandersetzungen. Manchmal geschieht dies unterschwellig und subtil, in anderen Fällen auch offen. Da kann der eine den anderen nicht verstehen, oder man mag sich schlicht nicht leiden. Immer wieder kommen neue Brüder hinzu. Das ist eine bleibende Herausforderung. Ich kann einfach nicht jeden gleichermaßen sympathisch finden.
Weil alle Menschen Schwächen haben und untereinander immer wieder Konflikte austragen, halte ich es mit dem heiligen Benedikt, der sagt: »Die Sonne darf nicht untergehen, bevor man sich wieder ausgesöhnt hat.« Und auch: »Ihre körperlichen und charakterlichen Schwächen sollen sie mit unerschöpflicher Geduld ertragen.«
Nach wie vor bin ich viel unterwegs, reise zu anderen Klöstern, halte Vorträge. Mein Alltag ist insoweit fast derselbe wie früher – nur die Ausgangsbasis ist eine andere. Mit Ende 70 ist manches beschwerlicher geworden, und es fällt mir nicht immer leicht, allen selbst gewählten Anforderungen gerecht zu werden. Aber ich bin dankbar, dass ich nach wie vor scheinbar gebraucht werde und meine Stimme weiterhin gehört wird.
© Hans-Günther Kaufmann
© Hans-Günther Kaufmann
© Hans-Günther Kaufmann
© Hans-Günther Kaufmann
© Hans-Günther Kaufmann
© Hans-Günther Kaufmann
© Hans-Günther Kaufmann
© Hans-Günther Kaufmann
HEIMAT
In einem kleineren Ort im Allgäu, in Bad Grönenbach, sind meine Wurzeln. Sie geben mir Bodenhaftung. Das ist wichtig für einen, der so viel unterwegs war und ist wie ich.
Heimat – das sind für mich Bad Grönenbach und St. Ottilien. In Bad Grönenbach bin ich geboren. Das Aufwachsen dort auf dem Land hat mich geprägt. Bilder meiner Heimat sind das Schloss und die Kirche mit ihrem schönen Turm. Die Wiesen, die nach Frühling duften, der modrige Geruch im nahe gelegenen Wald. Überhaupt die Nähe zur Natur. Am Teich haben wir als Kinder und Jugendliche jeden Sommer ganze Nachmittage verbracht.
Bad Grönenbach liegt auf drei Endmoränen. Der Ort ist an zwei Seiten eng vom Wald begrenzt. Ständig waren wir als Kinder und Jugendliche im Wald unterwegs, haben dort Hütten gebaut oder Tannenzapfen-Schlachten veranstaltet. Wir waren dort mit Herz und Seele zu Hause.
Wenn ich an Heimat denke, sehe ich geschmückte Erntewagen, das Mosaik an der Hauswand und die Krachlederne. Und dann wird mir warm ums Herz …
Man hat sich im Ort gekannt. Die Leute haben sich untereinander getragen. Und bis heute nennen sie mich in Bad Grönenbach oft nur bei meinem Taufnamen, Werner, wie früher. In St. Ottilien ging ich zur Schule, auf das Gymnasium der Missionsbenediktiner, ein Internat. Bad Grönenbach war weit, in den Ferien habe ich mich auf die Heimreise gemacht.
Nach dem Abitur bin ich im Jahr 1961 in den Benediktinerorden eingetreten, dort Novize und später Mönch geworden. Deshalb war dann für sechs oder sieben Jahre Schluss mit dem »Heimfahren«. Bis zur Primiz durften wir dies nicht. Aber als junger Pater bin ich in den Ferien immer wieder in Bad Grönenbach gewesen und habe alle besucht, die mit mir verbunden waren.