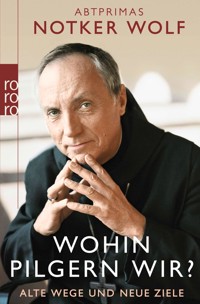
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dem Geheimnis des Pilgerns auf der Spur «Als Mönch bin ich zeitlebens in der Situation des Pilgers, der seine Familie, seine Freunde, seine Verwandtschaft zurücklässt, vieles aufgibt, was einmal zum Leben gehört hat, und täglich aufbricht, um etwas Größeres zu finden. Es fällt mir daher nicht schwer, mein ganzes Leben als Pilgerreise zu verstehen – auch wenn sie heute nicht immer zu Fuß stattfindet.» Tausende von Menschen treten jedes Jahr eine Pilgerreise voller Mühen und Strapazen an. Aber warum? Kann man sich den Glauben erwandern? Ist es Neugier, Abenteuerlust oder Frömmigkeit? Abtprimas Notker Wolf geht der Geschichte des Pilgerns nach, erzählt von eigenen Erlebnissen, räumt mit falschen Vorstellungen auf und diskutiert aktuelle Glaubens- und Gesellschaftsfragen mal provokant, mal unterhaltsam, mal nachdenklich. «Abtprimas Notker – ein Menschenfreund, der ohne Scheu klare Worte spricht.» (Münchner Merkur)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Abtprimas Notker Wolf
mit Leo G. Linder
Wohin pilgern wir?
Alte Wege und neue Ziele
Inhaltsverzeichnis
Zitat (Psalm)
1. «Ich bin aus meinem Jahrhundert ausgetreten»
2. «Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte»
3. «Gott muss nahe bei mir werden und ich nahe bei Gott»
4. «Wie schön und wertvoll ist es, sein Grab zu besuchen!»
5. «Gott möge über die Irrtümer der Pfaffen entscheiden»
6. «Wenn man sie essen sieht, glaubt man, fressende Hunde vor sich zu haben»
7. «Auf den Wegen der Heiligen gibt es Unrecht und Betrug im Überfluss»
8. «Es ist niemand da, dem nicht die Haare zu Berge stehen»
9. «Rom erreichte ich um die Fastenzeit ...»
10. «Dein Leben hat einen Sinn! Du wirst Missionar!»
11. «Bitte komm!» Als Erzabt unterwegs auf Steppenpisten und Bergpfaden
12. «Jeder Tag verlangt nach einer neuen Ich-Anstrengung»
13. «Gäste, die ankommen, empfange man alle wie Christus»
14. «Gönne dich dir selbst!»
15. «Ich hatte keine religiösen Motive»
Literatur
Psalm 121
Ein Wallfahrtslied
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen:
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er lässt deinen Fuß nicht wanken;
er, der dich behütet, schläft nicht.
Nein, der Hüter Israels
schläft und schlummert nicht.
Der Herr ist dein Hüter; der Herr gibt dir Schatten:
Er steht dir zur Seite.
Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden
noch der Mond in der Nacht.
Der Herr behüte dich vor allem Bösen,
er behüte deine Leben.
Der Herr behüte dich,
wenn du fortgehst und wiederkommst,
von nun an bis in Ewigkeit.
1. «Ich bin aus meinem Jahrhundert ausgetreten»
Von dem Mut zum Experiment mit sich selbst
Kann man sich den Glauben erlaufen? Erwandern? Erpilgern? Kann man auf einer Pilgerfahrt Gott ganz unbeabsichtigt begegnen – oder überhaupt nicht?
Damals, mit sechzehn Jahren, als ich meine erste Wallfahrt antrat, hätte ich solche Fragen gar nicht verstanden. Der Glaube war unser Antrieb, unser Ansporn – was sonst hätte uns zu einem frommen Unternehmen beflügeln sollen, bei dem man Wind und Wetter und müden Knochen und Blasen an den Füßen trotzen musste? Und Blasen bekam man; die waren bei dem Schuhwerk, in dem wir uns auf den Weg machten, garantiert. Nein, wir verstanden uns als begeisterte Christen, die aus Kirche und Gemeindesaal ausbrechen und sich singend und betend die Landstraße erobern wollten, als wanderndes Gottesvölkchen gewissermaßen, auf dem Weg zu einem verheißungsvollen Ziel. Wobei wir es nicht wirklich auf eine Kraftprobe ankommen lassen wollten. Bei meiner schmächtigen Statur lag mir Heldentum ohnehin fern, auch frommes Heldentum. Mit dem Auto hätten wir unser Ziel in zwei Stunden erreicht. Aber wir wollten den Glauben mit einem besonderen Erlebnis, mit einer körperlichen Anstrengung und anderen Erfahrungen verbinden, die man im gewohnten Gemeindeleben nicht machen konnte, und all das war auch auf den hundertzwanzig Kilometern von München nach Altötting schon zu haben.
Wir liefen also los, in Doppelreihe, am Rand der Landstraße, etwa hundert junge Leute aus verschiedenen Orten, ein Kaplan vorweg. Es war das Jahr 1957, und es war die erste von drei Wallfahrten, die ich nach Altötting unternommen habe. Ich muss dazusagen: Ich gehörte damals der Legio Mariae an. Der Legion Mariens. Ein etwas kriegerischer Name, der sich der Marienbegeisterung der Iren verdankte. Dort, in Irland, war die Legio Mariae in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts als katholische Laienbewegung gegründet worden, und was mir daran gefiel, war die Kombination aus regelmäßigem Gebet und strategisch geplantem Einsatz für die Schwachen, für Alte und Kranke. Wer der Legio Mariae beitrat, der musste ran und wollte das auch, der investierte ein Gutteil seiner Freizeit in den Dienst am Nächsten, und ein Nebeneffekt unseres Eifers war diese Wallfahrt zum Marienheiligtum Altötting. Wie man jetzt unschwer errät, hatte ich damals eine Vorliebe für die Muttergottes, und die habe ich mir bis heute bewahrt. Ich gebe zu: Diese Vorliebe entsprang zu keiner Zeit einer hohen Theologie. Sie war und ist Ausdruck einer Alltagsfrömmigkeit, die sich nicht vom Verstand maßregeln lassen will, die schlicht und einfach aus dem Herzen kommt: Maria hat sich als Mutter um Jesus gekümmert, jetzt möge sie sich bitte auch um mich kümmern – so habe ich damals gedacht, so denke ich immer noch.
Gut, wir zogen also über Land, in langer Doppelreihe am Rand der asphaltierten Straße, von Autos weitgehend unbelästigt, denn der Verkehr war Ende der fünfziger Jahre spärlich. Da es zur Pfingstzeit war, mussten wir mit Regengüssen rechnen, hatten deshalb alle unsere Regenschirme dabei, und mit einem dieser Regenschirme dirigierte der Mann an der Spitze auch unseren Wechselgesang. Es wurde nämlich, solange wir liefen, fast ohne Unterlass gebetet und gesungen. Abwechselnd ging der Schirm nach rechts oder nach links, je nachdem, welche Reihe dran war. Das Vaterunser wechselte nach der Hälfte die Seite, das ganze Rosenkranzgebet verteilte sich auf rechts und links, und wenn die eine Reihe sich mit «Gegrüßet seist du, Maria» vernehmen ließ, antwortete die andere Seite mit «Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder». Und zwischendurch Marienlieder und Gotteslob, bis wir das halbe Gesangbuch durchhatten. Es kam vor, dass sich der Himmel verdunkelte und tatsächlich ein Schauer niederging; dann funktionierte die saubere Stimmentrennung nicht mehr, und eine gewisse Konfusion trat ein – was wir lustig fanden. Aufhalten aber konnte uns der Regen nicht.
Vorneweg wurde ein Kreuz geschleppt. Ein schweres Holzkreuz. Das wechselte jeweils nach einer Weile von einer Schulter auf eine andere, und wer es nicht mit großem Geschick ausbalancierte, den warf es um. Wir haben uns ordentlich damit herumgequält. Warum? Vielleicht, um schon mal etwas abzubüßen. Es mag sein, dass wir außerdem ein oder zwei Fahnen dabeihatten. Sicher bin ich mir nicht, aber wenn es so war, dann haben wir sie nicht als Triumphzeichen verstanden, sondern als weithin sichtbaren Ausdruck unserer Freude. Denn Freude hat es uns allen gemacht, das Laufen und Beten und Singen und Schleppen; die Pausen nicht zu vergessen, die Verschnaufpausen im kühlen und – was uns bisweilen noch willkommener war – trockenen Innenraum einer Kirche, mitunter auch an einem Wegkreuz oder einem Waldrand, wo man sich wieder sammelte, betete und meditierte oder einfach plauderte, bis die letzten Nachzügler eingetrudelt waren.
Ich erinnere mich gut, und ich erinnere mich gern an diese frühen Wallfahrten, und in besonders angenehmer Erinnerung sind mir die Übernachtungen geblieben. Am Ende des ersten Tages kamen wir in einer Schule unter, die von Schwestern geleitet wurde. Matratzen und Luftmatratzen waren in den Klassenräumen ausgelegt, und vor dem Schlafengehen bewirteten uns die freundlichen Ordensfrauen mit Malventee, wobei es jedes Mal hieß: «Darf ich noch etwas lauwarm nachgießen?» Und da wir in diesem Fall alle beisammen und noch durchaus munter waren, wurden nun zur Abwechslung weltliche Lieder gesungen, harmlose Fahrtenlieder, die sich unser Kaplan gleichwohl tagsüber streng verbeten hatte.
Am nächsten Abend wurden wir auf Privatleute verteilt, die sich – so war das damals – geehrt fühlten, junge Wallfahrer beherbergen zu dürfen. Der Name des Dorfs will mir nicht mehr einfallen, wohl aber erinnere ich mich deutlich an das Glück, das mir und meinem Freund (der heute Abt in Ostafrika ist) in jener zweiten Nacht beschieden war: In einem Krämerladen etwas außerhalb der Ortschaft erwartete uns eine liebe alte Dame mit Franzbranntwein und Heftpflaster und einem guten Essen. Sie ließ es sich nicht nehmen, unsere geschundenen Füße eigenhändig einzureiben und die Blasen vom Laufen in den harten Lederschuhen selbst zu verarzten, so besorgt war sie um uns. Auch die zwei Betten in der Schlafkammer über ihrem Tante-Emma-Laden sehe ich noch vor mir: alte Holzkistenbetten mit dreiteiliger Matratze und Plumeaus, in denen man schier ertrank. Hundemüde, wie wir waren, haben wir vorzüglich darin geschlafen.
Am späten Vormittag des dritten Tages war unser Ziel erreicht: Altötting, das traditionsreiche bayerische Marienheiligtum, auch damals schon der bedeutendste Wallfahrtsort in Deutschland. Und es tat gut, am Ziel zu sein. Allerdings wollten wir uns nicht gleich der Hochstimmung der Ankunft überlassen und drehten mit unserem Kreuz auf der Schulter noch etliche Runden um die Wallfahrtskirche, bevor wir uns auf dem Vorplatz der Basilika mit einer zweiten Pilgerschar aus Regensburg vereinigten. Als wir dann in die Basilika einzogen, waren wir eine ansehnliche Truppe. Die machte schon was her.
Den anschließenden Gottesdienst habe ich als erhebendes Erlebnis im Gedächtnis. Wir feierten die Messe als eine Gemeinschaft von jungen Leuten, die alle das Gleiche durchgemacht hatten, in der jeder die Erinnerungen an die Strapazen – und die Gebete – der letzten Tage mit dem anderen teilte. Und in die Genugtuung, nun am Ziel zu sein, dürfte sich ebenfalls bei jedem ein Quäntchen Stolz gemischt haben. Nach der Messe löste sich alles auf, das heißt, wir verteilten uns auf die umliegenden Wirtschaften, tranken unser erstes Bier, taten uns an Weißwürsten und hausgemachten Brezen gütlich, schrieben um die Wette Ansichtskarten und machten uns schließlich auf den Heimweg, vom Bahnhof aus, mit dem Zug. Mir steht noch das schwere Holzkreuz im Gang vor unserem Abteil vor Augen.
Ich befürchte, die Geschichte meiner ersten Wallfahrten wird ziemlich harmlos und doch irgendwie befremdlich in den Ohren moderner Menschen klingen, antiquiert wahrscheinlich und beinahe rührend. Und ich gebe zu: Der Anblick, den wir seinerzeit geboten haben, und der fromme Überschwang, mit dem wir unsere Lieder und Gebete zum nicht immer blauen bayerischen Himmel gesandt haben, das alles unterscheidet sich beträchtlich von dem Bild, das heutige Pilger mit ihren Hightechschuhen und Spezialrucksäcken bieten, wenn sie still für sich oder in kleinen Gruppen auf einer der mittlerweile so beliebten alten Pilgerrouten unterwegs sind, Hunderte von Kilometern vor sich und dabei so kräftig ausschreitend, dass ich selbst nicht lange mithalten könnte. Doch scheint mir die eine Art des Pilgerns mit der anderen mehr zu tun zu haben, als man auf den ersten Blick vermuten sollte. Sicher, unsere Wallfahrten damals waren Demonstrationen unseres Glaubens, und dass dieser Glaube eine fröhliche Angelegenheit war, durfte jeder mitbekommen. Aber was mir als beglückend daran in Erinnerung geblieben ist, sind Erfahrungen, die ein ungläubiger Mensch genauso schön gefunden hätte.
Allein schon, wie gelassen man mit einem Mal wird, mit wie viel Humor man die ganzen Widrigkeiten des Unternehmens auf die leichte Schulter nimmt, die schmerzenden Füße, die patschnassen Socken nach einem ergiebigen Schauer – als Pilger geht es einem eben doch um etwas anderes, etwas Höheres und Ernsteres, selbst wenn man dabei gar keinen Gedanken an Gott verschwendet. Uns hat jedenfalls keine Unbill etwas ausgemacht, und wenn einem doch mal der Mut zu sinken drohte, wurde er von Leidensgefährten mit stabilerem Gemüt wieder aufgemuntert.
Dann das Erlebnis der Gastfreundschaft. Von wildfremden Menschen bewirtet und umsorgt zu werden, so wie wir die mütterliche Fürsorge der alten Krämersfrau erfahren haben. Als Pilger ist man stets auf Fremde angewiesen, erlebt diese Abhängigkeit aber nicht unwillig als Einschränkung der eigenen Freiheit, sondern erleichtert als vertrauensvolle Hingabe an die Großmut anderer. Wem solche Gastfreundschaft widerfahren ist, der vergisst sie sein Leben lang nicht mehr.
Und schließlich das Gemeinschaftserlebnis. Gewiss, uns hat die Gemeinsamkeit im Gebet besonders tief beeindruckt und die Erfahrung, als Gläubige nicht allein zu sein, mit einer großen Zahl von Gleichgesinnten auf ein gemeinsames Ziel zuzusteuern. Aber ich weiß aus Erzählungen, dass heutige Pilger dieses Gemeinschaftsgefühl ähnlich beglückend empfinden, wenn sie sich unterwegs mit Zufallsbekanntschaften für ein paar Tage zusammentun, miteinander laufen und miteinander Rast machen und abends in einer Runde beisammensitzen. Solidarität ist wohl das Wort, das die Lust am Pilgern am treffendsten erklärt, dieser ursprüngliche, selbstverständliche menschliche Zusammenhalt. Wenn ich an unsere Wallfahrten zurückdenke, spüre ich jedenfalls noch einmal die Freude, die uns damals vom ersten bis zum letzten Augenblick erfüllt hat, und sie speist sich ganz wesentlich aus den Begegnungen mit Menschen, die mir dieses Gefühl von Zusammenhalt vermittelt haben.
Was ist also mit dem Glauben? Kann man sich ihn tatsächlich erlaufen? Oder ist der Glaube womöglich gar keine Voraussetzung dafür, mit Gewinn für sein Leben zu pilgern? Kann einen am Ende der ganze religiöse Kram überhaupt kaltlassen, und man kehrt doch als Veränderter von einer Pilgerreise zurück?
Denn dass man sich von einer Pilgerreise etwas verspricht, etwas, das einen in der Seele berührt, möglichst tief, möglichst nachhaltig, das scheint mir heute nicht anders zu sein als früher, in den Blütezeiten der mittelalterlichen Pilgerei. Ob man dabei einer Verheißung folgt oder bloß einer inneren Unruhe nachgibt, ist für den Erfolg einer solchen Reise wahrscheinlich nicht einmal entscheidend. Immer schon hatten die Menschen die verschiedensten Gründe dafür, aufzubrechen, auch wenn der Glaube in früheren Zeiten stets beteiligt war, bei guten wie bei schlechten Christen. Der größte Unterschied zwischen Früher und Heute scheint mir der zu sein: Heute steht im Vordergrund die Suche – früher die Gewissheit, zu finden.
Und das ist merkwürdig. Denn was läge uns heute ferner, als unsere kostbare Zeit mit Suchen zu verschwenden? Fällt denn die Suche – umständlich und zeitraubend, wie sie ist – dieser Tage nicht dem Ideal der Mühelosigkeit zum Opfer? Suchen – wozu? Es ist praktisch unmöglich geworden, seinen Bestimmungsort zu verfehlen. Da wird einem im Alltag jede Suche erspart, Navigationsgeräte nehmen uns wie Kinder bei der Hand, und fast immer hat man die Gewähr, anzukommen, die Ziele mögen noch so fern liegen. Jede Suche lässt sich abkürzen, und Informationen erhalten wir auf Knopfdruck. Eigentlich leben wir also in einer Welt, in der sich niemand mehr mit Suchen aufhalten will – und dank des technischen Fortschritts auch nicht mehr aufzuhalten braucht.
In der Welt der mittelalterlichen Pilger hingegen… In deren Welt war es nie ausgemacht, ob man je hinfinden würde, nach Rom, Santiago de Compostela oder Jerusalem, ob man jemals sein Ziel erreichen würde – und häufig musste man sich seinen Weg mühsam suchen. Das Gelingen einer Pilgerreise stand in den Sternen. Dennoch sind die Pilgerwege unserer Zeit voller Menschen, die auf der Suche sind, während die Pilgerwege der Vergangenheit von Menschen bevölkert waren, die keinen Zweifel daran hatten, zu finden. Sie wussten, was sie am Ende ihres langen Weges erwartete, nämlich in aller Regel ein Heiliger, der Trost und Vergebung, neue Kraft und vielleicht sogar Erlösung von unheilbaren Gebrechen für sie bereithielt – mithin etwas, das jede Mühe lohnte. Genauso war es uns als jugendlichen Altötting-Pilgern noch vollkommen klar gewesen, am Ende unseres kurzen Weges die Muttergottes zu finden, also die, unter deren besonderen Schutz wir uns gestellt hatten.
Was erhofft sich der moderne Pilger von seiner Reise? Was glaubt er am Ende seines Weges zu finden? Schwer zu sagen. In den meisten Fällen wohl nichts Bestimmtes. Mit dem Verlust der Glaubenszuversicht in unserer Zeit ist auch die Ausstrahlung der Heiligen verblasst – nicht jedoch die Faszination gewisser Pilgerorte, und das ist eine weitere Merkwürdigkeit. Mögen sich viele vom Besuch eines Heiligengrabs, einer Madonna nicht das Geringste mehr versprechen, der Pilgerfreude tut das keinen Abbruch. Wie seit tausend Jahren und mehr geben die Heiligen auch heute noch die Pilgerziele vor, und das, obwohl mitunter ernsthafte Zweifel angebracht sind. Wer möchte zum Beispiel darauf wetten, dass im spanischen Santiago de Compostela tatsächlich der Leichnam des Apostels Jakobus liegt? Schon im späten Mittelalter galt das nicht mehr als ausgemacht.
Sicher, es gibt sie immer noch, die persönlichen Lieblingsheiligen, und ihre Grabstätten haben weiterhin Zulauf. Der heilige Franz von Assisi zieht wie eh und je die Pilger an, auch der besonders in Italien verehrte heilige Antonius von Padua. Unter den zeitgenössischen Heiligen hat Padre Pio wahrscheinlich die größte Schar von Anhängern, ein kerniger, unverblümter Franziskaner, der im bitterarmen Süden Italiens Krankenhäuser gebaut hat und bereits zu Lebzeiten im Ruf der Heiligkeit stand. Und auch die Muttergottes, die Madonna, die Jungfrau, kann nach wie vor auf einen festen Stamm gläubiger Verehrer zählen. Doch gerade unter den zahlreichen Sankt-Jakobs-Pilgern unserer Tage dürften sich nicht viele finden, die diesem Jakobus einen wirklichen Wert für ihr Leben beimessen.
Dennoch – und das ist die nächste Merkwürdigkeit – erfüllen die Heiligen nach wie vor einen Zweck. Denn ohne Heilige gäbe es keine Pilgerziele, und jeder Pilger, ob gläubig oder nicht, bewegt sich auf einen Heiligen zu. Praktische Orientierungshilfe für Suchende zu leisten – dazu sind die Heiligen also immer noch gut. Und diese zielgerichtete Bewegung, dieses Verfolgen eines vorgegebenen, nicht selbst gewählten Ziels, unterscheidet das Pilgern grundsätzlich vom Wandern. Als Pilger steht man sozusagen stets im Bann eines Heiligen, selbst wenn er einem persönlich nichts bedeutet.
Ein Pilgerweg ist eben kein gewöhnlicher Weg. Alles steht hier im Zeichen einer langen, christlichen Vorgeschichte. Auch auf einem Wanderpfad sind vor uns schon Menschen gegangen, aber sie haben uns nichts hinterlassen. Auf einem Pilgerweg jedoch reiht man sich ein in einen unsichtbaren Strom von Menschen, die ein klares Ziel vor Augen hatten, die von einem starken Glauben beflügelt waren, die diesen Weg in vielen Jahrhunderten mit ihrer Hoffnung getränkt haben. Auf einem solchen Weg kommt man gewissermaßen in Berührung mit der grenzenlosen Sehnsucht und der unermesslichen Hoffnung, die Menschen zu allen Zeiten mit dem Heiligen, dem Göttlichen verbunden haben. Auf Pilgerwegen wird man gleichsam Teil einer Menschheitsfamilie, mit der man nicht unbedingt denselben Glauben, aber dieselben Hoffnungen und Lebensträume gemeinsam hat. Als Pilger ist man deshalb nie allein. Und vielleicht geht mit jedem Schritt auf diesem Weg auch etwas von der Zuversicht unserer frühen Vorläufer auf uns über – der Zuversicht, zu finden. Mit anderen Worten: Auch wenn man es als Einzelner betreibt, stiftet Pilgern eine Gemeinsamkeit, über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. So könnte sich auch die Solidarität erklären, die ein Pilger unterwegs immer wieder erlebt, jener Zusammenhalt, der auch mir von den kleinen Wallfahrten meiner Jugend als schönste Erfahrung in Erinnerung geblieben ist.
Kann man sich den Glauben also doch erlaufen? Den Glauben vielleicht nicht, würde ich sagen, aber einen Glauben bestimmt. Ich will zwar nicht ausschließen, dass der eine oder andere, der mit Kirche und Gott gebrochen hat, am Ende seiner Pilgerreise tatsächlich zum einfachen Glauben seiner Kindheit zurückfindet oder zu neuen Einsichten über Wahrheit und Wert des Glaubens gelangt. Die meisten jedoch dürften den Erfolg ihrer Pilgerfahrt nicht als Bekehrung oder Läuterung im christlichen Sinne beschreiben, wohl aber gern bestätigen, dass sie innerlich beruhigt oder gestärkt von ihrer Reise zurückgekehrt sind. Als Verwandelte, mit neu erwachtem Vertrauen zum Leben und zu den Mitmenschen vielleicht, mit wiedergefundenem Selbstvertrauen womöglich. Vertrauen und Selbstvertrauen aber sind Elemente einer gläubigen Grundhaltung – und wenn ein Mensch diese Erfahrung macht, dann hat sich für ihn eine Hoffnung erfüllt, die Menschen zu allen Zeiten mit dem Pilgern verbunden haben. Dann ist etwas mit ihm geschehen, obwohl er einer Zeit angehört, die die Mühe des Suchens scheut und für Heilige kaum noch Verwendung hat. Und das allein ist für mich schon ein kleines Wunder.
Einer, der das erlebt hat, ist Bruno. Ich will seine Geschichte am Ende dieses Kapitels kurz skizzieren, weil sich daran zwei Aspekte des Pilgerns aufzeigen lassen, die bisher noch nicht zur Sprache kamen. Bruno war Abteilungsleiter in einem großen deutschen Unternehmen, bevor er mit neunundfünfzig Jahren in den Ruhestand versetzt wurde. Aber er fand keine Ruhe. Er hielt es daheim nicht aus. Da brach er auf, allein, und lief die zweitausenddreihundert Kilometer von München nach Santiago de Compostela an einem Stück, in sechsundneunzig Tagesetappen. Es sei eine wichtige Erfahrung für ihn gewesen, sagte er. Und ein großer Gewinn. Als zufriedener Mensch sei er zurückgekehrt.
Nun braucht man zunächst einmal keine spirituelle Erklärung für diesen Wandel heranzuziehen – allein das Unterwegssein kann in einer Lebenskrise viel bewirken. Durch das Gehen gerät in Bewegung, was sich über Monate oder Jahre im Kopf zusammengeballt hat. Der starre Zusammenhang der quälenden Gedanken lockert sich, das Denken gerät in Fluss, irgendwann reißen die Gedanken mit einem aus, und im besten Fall entsteht allmählich ein neues Bild vom eigenen Leben im Kopf. Und dann: Die tägliche Schinderei lenkt vom eigenen Unglück ab. Das Ausschreiten in der freien Natur wird ohnehin als befreiend empfunden. Und mit den verschiedenen Lebens- und Leidensgeschichten, die man im Laufe der Zeit zu hören bekommt, locken die Weggefährten einen ebenfalls aus seinem Käfig heraus. Kurz: Man hört auf, um sich selbst zu kreisen. All das stimmt. Und doch gibt es in Brunos Geschichte einen Punkt, der über diese praktischen Vorzüge des Pilgerns hinausweist. Einen Punkt, den er selbst in einer Nebenbemerkung so formuliert hat: «Ich wollte einfach mal in eine andere Welt kommen.»
Und darum eben geht es beim Pilgern, vor allem anderen und auch heute noch: um einen Aufbruch und Ausbruch aus seiner alten Welt, einen – wenn auch nur vorübergehenden – Bruch mit ihren Gewohnheiten, ihren Bequemlichkeiten, ihren Bindungen und Verpflichtungen, einen Ausstieg aus den geordneten oder ungeordneten Verhältnissen seines alltäglichen Lebens, auch ein einstweiliges Ausscheiden aus seiner Zeit mit ihren schnellen Antworten und schnellen Lösungen und schnellen Ortswechseln. Pilgern setzt mithin den Mut voraus, ein Experiment mit sich selbst zu wagen. Und das ist ein durch und durch christlicher Mut.
Die Pilger des Mittelalters mussten Abschied nehmen von allem, was ihnen vertraut war. Monatelang, manchmal jahrelang waren sie unterwegs, wenn sie nach Rom, Santiago de Compostela oder Jerusalem pilgerten, und in dieser Zeit führten sie ein anderes, ein unstetes und unsicheres Leben, stechender Sonne oder strömendem Regen ausgesetzt, Halsabschneidern, Wegelagerern oder einer feindseligen Bevölkerung ausgeliefert. Die Pilgerführer jener Zeit sind gespickt mit Warnungen; bisweilen raten sie sogar, genau benannte Herbergen zu meiden, weil man als Pilger dort ausgeplündert werde. Kurzum: Pilgern war riskant, und die Gefahr, niemals anzukommen, real. Man entschloss sich damals also zu einem radikalen Ausstieg auf Zeit mit ungewissem Ausgang, und ein Hauch dieser Radikalität ist noch in den Geschichten moderner Pilger wie Bruno zu verspüren, der immerhin mehr als drei Monate lang mit dem Ausstieg aus dem gewohnten Leben Ernst gemacht hat.
Wenn wir den Bogen jetzt etwas weiter spannen, kommen wir schnell zu den großen Heiligengestalten Europas. Denn in der Geschichte des Christentums war es oft so: Wer etwas verändern, grundsätzlich verändern wollte, der begann mit sich selbst. Der setzte sein altes Leben nicht fort, der ging auf Distanz zu seiner Zeit, ließ vieles oder alles hinter sich, brach die Brücken zu seinem bisherigen Dasein ab. Er hatte den Mut zum Experiment mit sich selbst.
Ausgestiegen ist der heilige Franz von Assisi, einer der großen Revolutionäre des Christentums, der von sich gesagt hat: «Ich bin aus meinem Jahrhundert ausgetreten.» Da ist es, das Pilgermotiv des Ausbruchs – den heiligen Franz hat es dazu geführt, sich so konsequent der Liebe Gottes auszuliefern wie kaum ein anderer. Mit seiner Zeit gebrochen hat auch der heilige Benedikt von Nursia, der Gründer unseres Ordens. Von Rom, wo er im 5.Jahrhundert als junger Mann studierte, zog er sich in die unwirtliche Einsamkeit der Sabiner Berge zurück und lebte dort drei Jahre lang als Eremit in einer Grotte, bevor er eine Reihe von Klöstern ins Leben rief, jedes davon als Gegenwelt gedacht, als Gegengewicht zu dem, was sich an Verrohung und Lieblosigkeit innerhalb der Zivilisation seiner Epoche ausbreitete. Man könnte die Liste der christlichen Aussteiger beliebig fortsetzen. Und bei allen würde man auf eine Antriebskraft stoßen, die die erstaunliche Radikalität ihres Bruchs mit dem Altbekannten und allseits Üblichen erklärt: Um der Liebe und um der Wahrheit willen machten sie nicht mehr mit. Um der Liebe und der Wahrheit willen lösten sie sich aus den Zwängen der Zeit, der herrschenden Verhältnisse, des herrschenden Denkens.
Schließlich ist auch jeder Mönch ein Aussteiger. Das Leben im Kloster ist ein ständiger Ausstieg, und als Mönch bin ich zeitlebens in der Situation des Pilgers, der seine Familie, seine Freunde, seine Verwandtschaft zurücklässt, vieles aufgibt, was für ihn selbst einmal zum Leben gehört hat, und täglich aufbricht, um etwas Größeres zu finden. Es fällt mir daher nicht schwer, mein ganzes Leben als Pilgerreise zu verstehen – meinen Wechsel in die Welt des Klosters vor langer Zeit, die Stationen und Begegnungen auf meinem Weg als Mönch und Abt und all die anderen Erfahrungen, die man macht, wenn man ein Ziel vor Augen hat.
Von dieser lebenslangen Pilgerreise möchte ich in diesem Buch einiges erzählen. Darüber hinaus werde ich andere Pilger mit ihren Erlebnissen zu Wort kommen lassen, Stimmen aus der Vergangenheit und Stimmen aus der Gegenwart, und irgendwann wird auch Bruno mit seiner ganzen Geschichte an der Reihe sein. All diese Zeugen haben es auf den Pilgerwegen Europas weiter gebracht als ich, denn nach meinem Eintritt ins Kloster blieb mir zum Pilgern kaum noch Zeit – wenn man die zahllosen Reisen, die ich als Erzabt von Sankt Ottilien und später als Abtprimas in alle Welt unternommen habe, nicht als eine weitere Form der Pilgerreise gelten lassen will (Papst Johannes PaulII. hat seine Reisen so verstanden, und BenediktXVI. tut es auch). Nach Santiago de Compostela wäre ich gern gepilgert, hatte es mir für den Herbst des Jahres 1977 auch fest vorgenommen. Da wurde ich im Oktober zum Erzabt gewählt, und mit Plänen dieser Art war es vorbei.
Die abenteuerlichsten Erfahrungsberichte in diesem Buch stammen, wie nicht anders zu erwarten, aus dem späten Mittelalter, nämlich von einem niederrheinischen Ritter und einer Engländerin. Der Ritter ist Arnold von Harff, der 1496 zu einer Pilgerfahrt nach Jerusalem aufbrach und unterwegs ein ungebührlich reges Interesse für die muslimische Welt des Vorderen Orients entwickelte. Die Engländerin ist Margery Kempe, die 1413 eine Reise ins Heilige Land antrat und unter dramatischen Umständen schließlich bis nach Santiago de Compostela gelangte. In ihren jeweiligen Aufzeichnungen treten ihre Motive übrigens deutlich zutage, und es zeigt sich wieder einmal, wie unterschiedlich auch damals schon die Beweggründe für eine solche Pilgerfahrt waren: Neugier und Abenteuerlust dürften für Arnold von Harff den Ausschlag gegeben haben, während Margery Kempe offenkundig Glaubenserfahrungen und fromme Ekstase suchte. Solche Augenzeugenberichte sind für uns nicht zuletzt deshalb wertvoll, weil sie uns verraten, in welche Tradition wir uns als Pilger heute stellen.
Ich will aber nicht allein auf die großen, klassischen Pilgerziele eingehen. Auch unbekanntere Pilgerorte haben ihre bisweilen dramatische Geschichte – das Örtchen Wilsnack an der Elbe ist ein Beispiel dafür. Auch Wallfahrten zu Pilgerstätten außerhalb Europas, in Afrika und Lateinamerika, sollen in dieses Buch einfließen, die Wallfahrten zu den heiligen Stätten des christlichen Äthiopiens etwa und die große Indiowallfahrt zum schwarzen Christus von Tila in Südmexiko. Sie können uns eine Ahnung davon vermitteln, mit welcher Inbrunst das Pilgern einst auch bei uns betrieben wurde, welche Massen ein Heiliger zu mobilisieren vermochte. Und schließlich will ich nicht vergessen, dass Pilgern keine christliche Besonderheit ist. Es muss ein menschliches Grundbedürfnis sein, an heiligen Orten die Präsenz des Göttlichen zu verspüren, denn fast jede Religion kennt Wallfahrten zu solchen Orten – die Hadsch nach Mekka ist nur die bekannteste davon. All diese Beispiele, Berichte und Zeugnisse aus der Welt des Pilgerns werden uns immer wieder Gelegenheit bieten, tiefer in das Geheimnis des Pilgerns einzudringen. Was Sie auf den folgenden Seiten erwartet, sind also, kurz gesagt, Pilgererfahrungen aus mehr als anderthalb Jahrtausenden und Lebenserfahrungen aus neunundsechzig Jahren.
2. «Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte»
Ist der Weg wirklich das Ziel?
Ich erinnere mich, die ersten Pilger meines Lebens schon als Kind gesehen zu haben. Damals, nach Kriegsende, nahmen die Bewohner der abgelegenen Höfe und Ortschaften bei uns im Allgäu nämlich bis zu zwei Stunden Fußmarsch in Kauf, um am Gottesdienst in unserer Kirche teilzunehmen. Auch im Winter, bei tiefem Schnee. Sonntag für Sonntag machten sie alle eine kleine gemeinsame Wallfahrt zur Messe. So kommt es mir jedenfalls heute vor.
Denn Laufen kann durchaus ein Akt der Frömmigkeit sein. Ich glaube nämlich, dass es so etwas wie eine Frömmigkeit des Körpers gibt. Vielleicht fällt mir diese Sichtweise leichter als evangelischen Christen, weil der Glaube für Katholiken nicht allein eine Angelegenheit des Herzens oder des Kopfes ist. Der katholische Ritus bezieht von jeher den ganzen Menschen in die Religionsausübung ein; auch der Körper ist stets beteiligt. Sich bekreuzigen, sich verneigen, das Knie beugen, in die Knie gehen, sich erheben und stehend einer Evangeliumslesung folgen, sich niederwerfen – all dies sind körperliche Ausdrucksformen des Glaubens, wie sie übrigens jede alte Religion kennt. Muslime zum Beispiel werfen sich beim Beten zu Boden und berühren ihn mit der Stirn. In der orthodoxen Kirche Äthiopiens tanzen die Diakone während des Gottesdiensts zum Rhythmus von Trommeln. Und in allen orthodoxen Kirchen wird dem Körper einiges abverlangt, wenn sich ein Gottesdienst stundenlang hinzieht und die Gläubigen unterdessen kaum zum Sitzen kommen. Alte Religionen gehen gewissermaßen in Fleisch und Blut über, das heißt: Man spürt sie auch in den Knochen. Beim Katholizismus ist das nicht anders.
Beobachten Sie nur einmal unsere Mönche in einem beliebigen Kloster dieser Welt beim Chorgebet. Eigentlich ist es eine ruhige Angelegenheit, dieses Chorgebet. Aber schon hier gibt es eine Verbindung von seelischer und körperlicher Bewegung. Leib und Seele wenden sich Gott gleichermaßen zu, wenn wir jeden Psalm mit einem «Ehre sei dem Vater» beenden und dazu aufstehen und uns verbeugen, bevor wir uns wieder setzen. Diese Bewegung wird natürlich individuell vollzogen, von jedem Einzelnen, aber es ist auch eine gemeinschaftliche Bewegung, die unserem Zusammenhalt im Glauben sichtbaren und spürbaren Ausdruck verleiht. Ähnliches geschieht bei jeder Messe: die Kniebeuge vor dem Altar beim Betreten einer Kirche, das Kreuzeszeichen, das Aufstehen und Niederknien im Verlauf eines Gottesdiensts – all dies sind Handlungen, durch die der Mensch auch äußerlich kundtut, dass er Gott Ehre erweist.
Das eindrucksvollste Zeichen der Ehrfurcht und Demut ist zweifellos die Niederwerfung. Wir begegnen ihr in vielen Religionen – der Islam kennt sie, der Buddhismus kennt sie, und auch die katholische Liturgie sieht zu besonderen Gelegenheiten die Niederwerfung vor: Bei Priester- und Bischofsweihen strecken sich die Kandidaten während der Allerheiligenlitanei der Länge nach auf dem Boden aus, und dasselbe geschieht, wenn unsere Mönche ihre ewigen Gelübde ablegen. Auch der Priester legt sich am Beginn der Karfreitagsliturgie zum stillen Gebet nieder, um Gott seine völlige Hingabe zu bezeugen. Allein die Majestät Gottes rechtfertigt für Christen einen derartig spektakulären Akt der Unterwerfung.
Noch ganz andere Kombinationen von Glaube und körperlicher Bewegung ergeben sich, wenn wir den Schritt aus der Kirche hinaus ins Freie tun. Die katholische Christenheit hat diesen Schritt immer wieder gemacht, von frühester Zeit an, zum Beispiel in der Form feierlicher Prozessionen. Damit nähern wir uns dem Pilgern, auch wenn Prozessionen nur eine Sache von Stunden sind, einen streng geregelten Ablauf haben und zumeist nach einem bestimmten Anlass verlangen – so wie die Bittprozession zum Fest des heiligen Markus. Oder die Bußprozessionen am Karfreitag, die bis heute mit großem Aufwand in den Städten Andalusiens begangen werden. Oder die Prozession am Palmsonntag, die an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. Und natürlich die Fronleichnamsprozession, die vielerorts durch die Straßen einer Stadt und weit hinaus über die Felder führt.
Man darf solche Prozessionen nicht als frommes Schaulaufen missverstehen. Sie sind spirituelle Kraftquellen. Es gibt in der Geschichte ein berühmtes Beispiel für die Wirkung einer Prozession, und zwar vom Ende der Antike, als die Römer den Untergang ihrer Stadt vor Augen hatten. Rom wurde damals von den Langobarden bedroht, in allen Straßen kampierten Bettler und Gestrandete – und obendrein hatte ein Tiberhochwasser eine verheerende Seuche ausgelöst. In dieser verzweifelten Lage bestieg Gregor der Große (590–604) den Stuhl Petri. Er muss sich als Erstes gefragt haben, wie dieser sterbenden Stadt neuer Lebensmut einzuflößen wäre, denn kaum gewählt, veranstaltete er eine große Bittprozession durch ganz Rom. Vielleicht hatten die Bürger danach den Eindruck, mit diesem Papst sei etwas in Bewegung gekommen. Jedenfalls trat ein, was sich Gregor der Große von dieser Prozession erhofft haben wird: Die Römer überwanden ihre Niedergeschlagenheit und schöpften wieder Hoffnung. Sie hatten sich – betend und singend – buchstäblich ein neues Selbstvertrauen erlaufen. Dafür sind Prozessionen also allemal gut: Sie heben die Moral und stärken den Gemeinschaftssinn.
Die Prozession ist, wohlgemerkt, keine christliche Erfindung. Religiöse Umzüge gab es bereits im Alten Rom wie in der ganzen Welt der heidnischen Antike, und eine christliche Abwandlung davon dürften auch die Stationsgottesdienste sein. Angeführt vom Papst, ziehen Geistliche und Gläubige dabei in der Fastenzeit von einer der vierzig Stationskirchen Roms zur anderen, nach einer feststehenden Reihenfolge. Ausgangspunkt dieser Wandergottesdienste war früher die Basilika Santa Sabina auf dem Aventin, eine der ältesten Kirchen Roms. JohannesXXIII. hat das geändert: Seither beginnen sie nur wenige hundert Meter von Santa Sabina entfernt in Sant’Anselmo, dem Hauptsitz des Benediktinerordens. Ich erlebe mithin alljährlich, wie der Papst bei uns empfangen und eingekleidet wird, in unserer Klosterkirche den Bußakt der Messe eröffnet und anschließend mit der ganzen Versammlung weiterzieht nach Santa Sabina, die Allerheiligenlitanei auf den Lippen. Dort wird der Gottesdienst dann fortgesetzt.
Halten wir also fest: Seit alter Zeit und nicht allein im Christentum geht die Anbetung Gottes mit Bewegung einher, vollzieht der Körper mit, was in der Seele vor sich geht. In jeder dieser Bewegungen, von der kurzen Verbeugung unserer Mönche am Ende eines Psalms im Chorgebet bis zum Stationsgottesdienst, der durch halb Rom führt, erblicke ich eine Frömmigkeit des Körpers – und damit Vorstufen des Pilgerns. Und so wie diese körperlichen Ausdrucksformen für religiöse Regungen der Seele über die ganze Erde verbreitet sind, kennt auch das Verlangen, heilige Orte aufzusuchen, keine kulturellen Grenzen. Ja, fast sieht es so aus, als sei die Pilgerreise das eigentliche gemeinsame Merkmal aller großen Religionen dieser Welt, so unterschiedlich sie sonst sein mögen.
Schauen wir uns um: Schon die Mayas in vorkolumbianischer Zeit unternahmen lange Pilgerreisen zu heiligen Stätten – zur Pyramide von Izamal etwa oder zum Cenote von Chichén Itzá, einem kreisrunden Kratersee, in dem Spuren von Menschenopfern gefunden wurden. Juden aus dem gesamten Mittelmeerraum pilgerten bis zur Zerstörung des Tempels im Jahr 70n.Chr. anlässlich der drei großen Feste des Jahres nach Jerusalem – von dieser Tradition ist der Besuch der Klagemauer übrig geblieben. Muslime begeben sich wenigstens einmal im Leben nach Mekka, dem Ort der Offenbarung an den Propheten Mohammed, suchen darüber hinaus aber auch zahlreiche andere Stätten auf, an denen die Gräber der Gefährten Mohammeds verehrt werden. Hindus pilgern seit mehr als zweitausend Jahren zu heiligen Orten wie Benares (heute: Varanasi) am Ganges und Allahabad, am Zusammenfluss von Ganges und Yamuna gelegen. Und der früheste buddhistische Pilgerbericht stammt aus dem 3.Jahrhundert vor Christus, eine Felseninschrift, die von einer Wallfahrt nach Bodh Gaya erzählt, dem Ort der Erleuchtung Buddhas. Es lässt sich wohl tatsächlich so sagen: Die Gestalt des Pilgers verbindet die Religionen dieser Erde. Es ist eine wahrhaft universelle Gestalt.
Und eine zeitlose dazu. Wie weit müssen wir zurückgehen, um auf jenen Menschen zu stoßen, der für Juden, Christen und Muslime zum Urbild des Pilgers geworden ist? Bis zu einer Geschichte, die man sich seit mehr als dreitausend Jahren erzählt. Bis zu Abraham, dem Mann aus Ur in Chaldäa.
«Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein… Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte…» So beginnt diese Geschichte, nachzulesen im 12.Kapitel des Buchs Genesis. Und schon dieser Anfang enthält im Kern alles, was einen Menschen zum Pilger macht.
Gott ruft zum Aufbruch, und Abraham trennt sich von allem, was ihm lieb und teuer ist, was seine Identität bis dahin ausgemacht hat. Gott gibt ihm sein Versprechen, und Abraham lässt sich auf das große Experiment ein und bricht tatsächlich auf. Dabei hat er wenig in der Hand. Unklar, welcher Weg nun vor ihm liegt, das Ziel in weiter Ferne und er selbst von nun an ein Fremder, der alle Bindungen aufgegeben hat. Alle, bis auf die zu diesem Gott mit seinem Plan. Aber er setzt darauf, dass das Ziel den Verlust der Heimat und die Mühen des Weges lohnt. Und er vertraut darauf, dass Gott Wort hält. Künftig muss er sich allein von seinem Glauben leiten lassen. Sein ganzes Leben wird dadurch zur Pilgerreise und Abraham zum Vorbild aller, die in viel späteren Zeiten nach Jerusalem, nach Rom oder Santiago aufbrechen.
Abraham ist aber nicht nur der erste Pilger. Er ist gleichzeitig der erste Mensch. Der erste Mensch mit unverwechselbaren Zügen, eigener Lebensgeschichte und individuellem Charakter, der uns in der Bibel entgegentritt. Er ist keine schattenhafte Gestalt wie Adam oder Noah, kein bloßer Name, der einem Menschheitsschicksal angeheftet wird. Er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, der gestaltend, mitgestaltend in die Geschichte eingreift, der Erfahrungen macht und dessen Erfahrungen zählen. Kurz – er ist ein Individuum. Und wenn ich die Botschaft dieser Geschichte richtig verstehe, dann lautet sie: Der Mensch, der auf dem Weg zu Gott ist, findet unterwegs sich selbst. Leben ist Pilgern. Nur wer sich als Pilger begreift, vermag seine Möglichkeiten, sein Entwicklungspotenzial als Mensch voll auszuschöpfen. In dieser alten Geschichte wird also ein sehr modernes Problem behandelt, das der Selbstverwirklichung nämlich. Und die gelingt nur dem, der aus der Sicherheit eines geordneten Lebens ausbricht und bereit ist, im Vertrauen auf Gott ein Experiment mit sich selbst zu wagen.
Das Thema der Selbstverwirklichung wird im Alten Testament später erneut aufgegriffen – und zwar im Zusammenhang mit Mose, ebenfalls ein Prototyp des Pilgers. Doch diesmal geht es nicht allein um die innere Entwicklungsgeschichte eines einzelnen Menschen, diesmal geht es darüber hinaus um die Selbstverwirklichung eines ganzen Volkes. Alles hat in dieser Geschichte eine andere Dimension. Waren die Umstände von Abrahams Aufbruch unspektakulär, sind sie nun dramatisch: Dem Auszug der Israeliten aus dem «Sklavenhaus» Ägypten geht eine Reihe von Plagen voraus, die den Widerstand des Pharaos nur allmählich brechen. Und als sich die Israeliten endlich doch in die Freiheit aufmachen, setzt ihnen die Streitmacht der Ägypter nach – nur die berühmte Teilung der Wasser rettet sie davor, im letzten Moment noch niedergemetzelt zu werden. Ein Ende der Schrecken aber ist nicht in Sicht. Die Wüste erwartet sie, Hunger und Durst quälen sie, und kein Gelobtes Land weit und breit. Und jetzt, im Nachhinein erst, wird dieses Ägypten, dem sie erleichtert den Rücken gekehrt haben, zur schmerzlich vermissten Heimat. Warum noch länger in der Wüste umherirren? Die Freiheit kann warten, solange der Bauch für die «Fleischtöpfe Ägyptens» plädiert. Weiß ihr Führer, dieser Mose, überhaupt, was er will? Wohin die Reise geht? Und ob ein Ende absehbar ist?





























