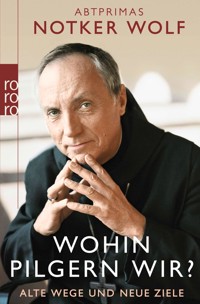8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Ich habe in meinem elektronischen Notizbuch eine eigene Datei für Einfälle aus heiterem Himmel. ‹Gedanken› heißt sie, und sie wird immer länger. Da kommen die zufälligen Beobachtungen und plötzlichen Eingebungen rein, alles, was mir nebenbei auffällt und nichts mit dem zu tun hat, was mich als Abtprimas der Benediktiner normalerweise beschäftigt – nichts mit dem Äbtissinnen-Kongress in New York, nichts mit der Besinnungswoche in einem spanischen Kloster und nichts mit dem Besuch einer irischen Abtei, deren Abt mich zu Hilfe gerufen hat. Diese Einfälle aus heiterem Himmel kommen immer in den Unterbrechungen des Tagesablaufs, den unvorhergesehenen und den vorgesehenen. In den sogenannten leeren Zeiten also, in denen man oft nicht weiß, was man mit sich anfangen soll. In solchen Minuten oder Stunden beobachte ich die Menschen. Und immer fallen dabei kleine Erleuchtungen ab ...»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Abtprimas Notker Wolf
mit Leo G. Linder
Aus heiterem Himmel
Einfälle und Eingebungen für das Leben hier unten
Vorwort
Vielleicht erinnern Sie sich, dem einen oder anderen hier abgedruckten Einfall aus heiterem Himmel bereits begegnet zu sein. Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Sie sind alle als wöchentliche Kolumne in einer großen Frauenzeitschrift erschienen. Dieses Buch nun fasst sie zusammen, und aus verstreuten Einfällen ist eine Art Bekenntnis geworden, mein ganz persönliches Glaubensbekenntnis. Es lautet, in aller Kürze: Der christliche Glaube ist eine Kraft, die sich im Alltag stets aufs Neue bewährt. Das ist meine Erfahrung, das ist meine Überzeugung, das ist das einigende Band aller hier versammelten Beiträge.
Ihren Charakter als Kolumnen aber haben sie bewahrt. Das merken Sie zum einen daran, dass die Beiträge dem Ablauf des Jahres folgen und immer wieder auf die Festtage des Kirchenjahrs eingehen, die ja die großen Ereignisse der Heilsgeschichte widerspiegeln. Das sehen Sie aber auch daran, dass diese Beiträge ihre knappe Kolumnenform behalten haben. Unter Kolumnen versteht man kurze, regelmäßig erscheinende Kommentare, die einer Beobachtung, einer Idee, einer Art Eingabe entspringen. Das heißt, Kolumnen wollen ein Thema nie ganz ausschöpfen, sondern zum Denken anregen. Es wäre deshalb ganz in meinem Sinne, wenn sie auch neue Fragen aufwerfen oder sogar Widerspruch hervorrufen würden.
Jesus hat davor gewarnt, an seine Mitmenschen höhere Ansprüche zu stellen als an sich selbst, von ihnen mehr innere Größe zu erwarten, als man sie selbst besitzt. Ich halte es deshalb für eine urchristliche Haltung, unserer begrenzten Welt mit all ihren Menschlichkeiten wann immer möglich mit einem Schmunzeln zu begegnen. Aufgeregtheit und moralische Empörung hat es bei Jesus nicht gegeben, und ich hoffe, dass Sie auch auf diesen Seiten davon nichts finden. Was uns diese Haltung jedoch erst ermöglicht, ist die Gewissheit, dass es noch einen anderen Blick auf unsere Sorgen, Nöte und Eigenheiten gibt, nämlich den Blick aus einer anderen Welt, und auch diese Perspektive will ich nicht unterschlagen. Denn letztlich geht es immer darum, unsere Grenzen von innen her aufzubrechen und von außen her aufbrechen zu lassen, durch die Kraft der Liebe, die uns mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und mit Gott versöhnt.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesen Einfällen aus heiterem Himmel. Gott segne Sie.
Einfälle aus heiterem Himmel
Ich habe in meinem elektronischen Notizbuch eine eigene Datei für Einfälle aus heiterem Himmel. «Gedanken» heißt sie, und sie wird immer länger. Da kommen die zufälligen Beobachtungen und plötzlichen Eingebungen rein, alles, was mir nebenbei auffällt und nichts mit dem zu tun hat, was mich als Abtprimas der Benediktiner normalerweise beschäftigt – nichts mit der Vorstandssitzung in New York, nichts mit der Besinnungswoche in einem spanischen Kloster und nichts mit dem Besuch einer italienischen Abtei, deren Äbtissin mich um Rat gebeten hat. Diese Einfälle aus heiterem Himmel kommen immer in den Unterbrechungen des Tagesablaufs, den unvorhergesehenen und den vorgesehenen. In den sogenannten leeren Zeiten also, in denen man oft nicht weiß, was man mit sich anfangen soll.
Flughäfen zum Beispiel sind für mich wunderbare Orte der Inspiration. Man steht am Gepäckband – und der eigene Koffer ist wieder mal einer der letzten. Man sitzt längst in der Abflughalle – aber der Aufruf, an Bord zu gehen, lässt auf sich warten. Oder der Start verzögert sich, weil der italienische Flugkapitän sich das Ende der Fußballweltmeisterschaft noch in Ruhe ansehen will. In solchen Minuten oder Stunden beobachte ich die Menschen. Den jungen Amerikaner, der ziemlich finster dreinschaut und sich dann als unglaublich liebenswürdiger Mensch herausstellt. Oder den gestriegelten Geschäftsmann, der sich rücksichtslos durch die Leute wühlt. Oder die jungen Eltern, die sich rührend um ihr schreiendes Kind bemühen. (Du warst auch mal klein, sage ich mir dann, bevor ich selbst ungeduldig werde.) Und immer fallen dabei kleine Erleuchtungen ab, Randbemerkungen, Stoff für meine «Gedanken»-Datei.
Auch auf Zugfahrten öffnet sich mir der heitere Himmel, wenn die Landschaft draußen vorbeizieht. Oder während eines Flugs, wenn ich die Wolkenformationen studiere oder meinen Blick über die weiten Ebenen unten wandern lasse und mir vorzustellen versuche, unter welchen Menschen ich bald sein werde. Besonders ergiebig aber sind die Stundengebete, zu denen wir Mönche uns viermal am Tag in der Kirche versammeln, um die Psalmen zu singen. Diese Stundengebete, das sind die vorgesehenen, die geplanten Unterbrechungen, das sind die Zeiten des Tages, die ganz mir gehören, weil sie ganz Gott gehören. Während ich singe, lösen sich meine Gedanken mitunter von den vertrauten Worten der Psalmen, und mit einem Mal fällt mir ganz neu auf, was ich eigentlich schon lange weiß – dass Gott sich immer auf die Seite der Schutzlosen und Verfolgten schlägt zum Beispiel. Da wird mir plötzlich wieder klar: Wann immer Gott durch den Mund der Psalmsänger und Propheten spricht, setzt er sich für die Pechvögel und die Zukurzgekommenen ein, für die Machtlosen und die Verlierer. Wie oft ermahnt er die Richter, gerecht zu urteilen, und wie oft warnt er die Mächtigen vor Korruption und Machtmissbrauch! «Wer ist wie der Herr, unser Gott?», heißt es in Psalm 113, «der die Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz.» Nein, unser Gott ist nicht der Verbündete der Reichen und Schönen. Unser Gott steht aufseiten derer, die im Leben einen starken Verbündeten brauchen. Auch das ist für mich ein Grund, Gott zu lieben.
Papst BenediktXVI. – Botschafter der Wahrheit und Liebe
Papst BenediktXVI. hatte in der alten römischen Kirche Santa Sabina die Messe gefeiert. Unsere Choralschola hatte während dieser Messe gesungen, die Schola der Abtei Sant’Anselmo, wo ich lebe und arbeite, und als der Papst nun nach der Messe den Altarraum verließ, schaute er zu mir herüber, nickte und lächelte. Vermutlich aus Freude darüber, dass unser Chor so würdevoll gesungen hatte.
Dieses dankbare Lächeln ist mir im Gedächtnis geblieben. Wer BenediktXVI. von früher kennt, hat ihn anders in Erinnerung. Damals war er der scharfsinnige und manchmal scharfzüngige Kardinal Ratzinger, der unnachgiebige Verfechter der reinen kirchlichen Lehre. Und jetzt erleben wir denselben Menschen als einen väterlich-freundlichen Papst, der andere Menschen mit seinem Lächeln sucht und findet. Welche Veränderung!
Und diese Veränderung ist vielen Menschen aufgefallen. Sie lieben ihn dafür. Wer hätte gedacht, dass dieser BenediktXVI. einen solchen Zuspruch erfahren würde? Bei den großen Papst-Audienzen drängen sich heute auf dem Petersplatz noch mehr Menschen als früher, darunter viele junge Leute. Und dabei liegt ihm diese spontane Herzlichkeit gar nicht, mit der sein Vorgänger Johannes PaulII. immer alle Welt umarmen wollte. Was aber fasziniert denn dann an diesem kleinen, schüchtern wirkenden Mann? Oder ist alles nur Massenhysterie, wie manch einer abfällig behauptet?
Wohl kaum. Papst Benedikt ist kein Medienstar, er reißt die Menschen nicht mit, er raubt ihnen nicht den Verstand. Aber er überzeugt uns, weil er Ideale verkörpert, glaubwürdiger als jeder andere. Ideale, die wir in der Politik und in der Wirtschaft, im Sport und im Showbusiness vergeblich suchen. Das erste dieser Ideale ist die Wahrheit. Benedikt hat für sich den Wahlspruch «Mitarbeiter der Wahrheit» gewählt, und in der Tat, er nennt die Dinge beim Namen, er spricht genauso klar und unmissverständlich über Menschenrechtsverletzungen in China oder im Islam wie über den rasanten Verlust aller Glaubensgewissheiten bei uns in Europa. Und das zweite Ideal ist die Liebe. Papst Benedikt weiß heute, dass Wahrheit ohne Liebe hart macht. Deshalb verkündete er in seiner letzten Enzyklika einen Gott, der kein Buchhalter unserer Sünden und kein Strafverfolger ist, sondern ein Gott, der unsere Sehnsucht nach Geborgenheit und Verzeihung und Menschlichkeit stillt.
Genau das also macht Benedikts große Wirkung in meinen Augen aus: Er gibt Orientierung in einer orientierungslosen Zeit, weil seine Botschaft nicht aus unserer Welt der Kriege und Selbstmordattentäter, der Korruption und gnadenlosen Konkurrenz kommt, sondern von einem Gott, der die Menschen zu einer großen Menschheitsfamilie zusammenführen möchte. Und deshalb ist auch niemand hysterisch oder von gestern, der den Papst auf seinem Deutschlandbesuch persönlich erleben möchte. Wahrheitsliebe, Ehrlichkeit und Menschenliebe sind Ideale, die niemals veralten. Die Begeisterung der jungen Menschen für diesen Papst ist der schönste Beweis dafür.
Dürfen wir auf uns stolz sein?
So etwas kann nur in Deutschland passieren. So etwas wie die Geschichte, die ein deutscher Bekannter mir neulich erzählte: Sein Freund sei während der Fußballweltmeisterschaft nach längerem Aufenthalt im Ausland auf einem deutschen Flughafen gelandet – und sei entsetzt gewesen: an allen Taxis Deutschlandfähnchen! Überall Schwarz-Rot-Gold! Empörend. Eins dieser beflaggten Taxis zu besteigen, das wäre für seinen Freund gar nicht in Frage gekommen. Für ihn, den Mann aus der Achtundsechziger-Generation, stand die Fahne für die deutsche Nation und die deutsche Nation für das Böse. Da zählte es auch nicht, dass diese Nation sich gerade als wunderbarer Gastgeber bewährte und das große Fußballfest mit Menschen aus vielen anderen Nationen ausgelassen feierte. Nein, beim Anblick dieser Fähnchen witterte er Nationalstolz – und stolz, das durften die Deutschen doch niemals mehr sein! Jedenfalls nicht auf ihre Nation. Der Freund meines Bekannten wartete erzürnt, bis endlich ein Taxi ohne Fähnchen kam.
Was ist schlecht am Stolz? Stolz, höre ich in Deutschland immer wieder, stolz dürfe man nur auf die eigene Leistung sein. Ich staune. Wie war das damals, als ich mit italienischen Freunden in Rom zusammensaß und alle auf ihre Regierung schimpften? Irgendwann schimpfte ich mit – und erntete betretenes Schweigen. Als Ausländer hätte ich nicht in dieselbe Kerbe hauen dürfen wie sie. Das verletzte ihren Stolz. Da hielten sie plötzlich zusammen.
Und recht hatten sie. Denn Stolz ist nicht Hochmut. Stolz ist Selbstachtung. Wenn wir stolz sind auf das, was uns als Italiener oder Deutsche oder Schweden ausmacht, bedeutet das nur, dass wir die Kultur, die Sprache und die Lebensart unseres Volkes zu unserer eigenen Sache gemacht haben. Zu unserer eigenen Aufgabe. Der Stolz bewahrt uns dann davor, leichtfertig damit umzugehen und das Eigene geringzuschätzen. Nationalstolz ist also das Gefühl, dass jedes Volk viel zu verlieren hat. Denn dies alles gibt es nur einmal auf dieser Welt – die Sprache, die Tradition und die Lebenskunst einer Nation.
Die einmalig entspannte, heitere Atmosphäre der letzten Fußballweltmeisterschaft gehört für uns nun auch dazu. Lassen wir also unsere Fähnchen zu einem solchen Anlass ruhig wehen. Meine italienischen Freunde hätten volles Verständnis dafür. Und als Christ freue ich mich darüber, dass wir Deutschen uns offenbar das zu Herzen genommen haben, was Mose vor langer Zeit schon im Namen Gottes von seinem eigenen Volk verlangt hat: Jeder Fremdling, heißt es in 3.Mose 19, soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer, «und du sollst ihn lieben wie dich selbst».
Oft ist doch noch etwas zu retten
Verstehen wir eigentlich noch, uns zusammenzuraufen? Als Verliebte, meine ich. Als Menschen, die sich eigentlich nichts Schöneres vorstellen können als zusammenzubleiben. Wenn ich mir anschaue, wie viele Paare sich früher oder später trennen, dann denke ich: Offenbar haben wir verlernt, uns zusammenzuraufen.
Als Mönch, meinen Sie vielleicht, wüsste ich doch gar nicht, wovon ich spreche? O doch, das weiß ich. Spätestens seit der Begegnung mit jenem römischen Paar, das eines Nachts vor dem großen Tor von Sant’Anselmo parkte. «Wir fahren gleich weiter», sagte der junge Mann. Sie waren furchtbar verliebt, das sah ich. Wir kamen ins Gespräch. «Kann man hier eigentlich heiraten?», fragte seine Freundin auf einmal. «Das schon», sagte ich. «Aber nicht um diese Uhrzeit.» Und gab ihr unsere Telefonnummer.
Tatsächlich meldeten sie sich zur Trauung an. Doch dann hörte ich ein halbes Jahr lang nichts mehr von den beiden. Und plötzlich tauchten sie wieder bei mir auf – heillos zerstritten. Vier Stunden lang saßen wir beisammen. Da ist nichts mehr zu retten, dachte ich. Zu verschieden. Er war ein Raubein, hatte sich ganz allein durchbeißen müssen und Erfolg gehabt und wollte nun sein Lebensglück genießen. Und sie war das genaue Gegenteil. Bei ihr drehte sich alles um die Familie. Alles, was sie tat, musste vorher im Familienkreis besprochen werden. Echt römisch eben. Aber er fand ihr «Duckmäusertum» unerträglich.
Mein Verstand sagte mir: Du musst ihnen raten, sich zu trennen. Dabei hätte ich ihnen nur zu gern geholfen. Nicht allein, weil ich die beiden ins Herz geschlossen hatte. Auch deshalb, weil ich die Liebe für das Wichtigste im Leben halte, für die größte Gabe es Heiligen Geistes an die Menschen. «Die Liebe ist langmütig. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand» – so sagt es der Apostel Paulus, und so denke ich auch. Und deshalb habe ich es doch noch einmal versucht. Ich nahm die junge Frau beiseite und sagte: «Wenn du deinen Freund wirklich liebst, dann musst du dich jetzt für ihn entscheiden, mit allen Konsequenzen. Und diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen, auch deine Familie nicht.» Sie nickte. Aber viel Hoffnung hatte ich nicht, als sie davonfuhren.
Fünf Monate später habe ich die beiden in der Kirche von Sant’Anselmo getraut. Sie hatten nach unserem Gespräch einen kirchlichen Ehekurs besucht und waren danach wie verwandelt – sie energischer, er liebenswürdiger als früher. Bei ihrer Hochzeitsfeier am Strand von Ostia war ich fast ebenso glücklich wie sie. Sie hatten sich zusammengerauft. Sie hatten verstanden, dass Liebe Nähe ist und Nähe Reibung bedeutet. Diese Reibung kann schmerzhaft sein. Aber sie erzeugt auch Wärme. Eine Wärme, von der man ein ganzes Leben lang zehren kann. Seither jedenfalls sehe ich die beiden alljährlich mindestens zwei Mal in Sant’Anselmo wieder – zur Christmette und in der Osternacht.
Versuchen Sie’s doch mal mit Zusammenraufen. Es lohnt sich.
Das Kreuz, das man trägt, wenn man Madonna heißt
Sie werden davon gehört haben. Die amerikanische Popsängerin Madonna trat in ihrer letzten Show mit einer Dornenkrone auf, wie sie Jesus von den römischen Soldaten zum Hohn aufgesetzt bekam. Und kreuzigen ließ sie sich auch. Ist das nicht Gotteslästerung? Ist das nicht eine neue Verhöhnung Christi – so zum Spaß, zur Unterhaltung eines Publikums mal eben in die Rolle des leidenden Gottessohns zu schlüpfen? Und – soll man jetzt nicht empört sein?
Ich muss zugeben: Empört bin ich nicht. Ich bin bereit, Madonna ernst zu nehmen. Sie sei von Schwestern in einem katholischen Internat erzogen worden, sagt sie, und habe diese Erziehung als beklemmend erlebt. Als traumatische Erfahrung. Daher ja auch ihr Künstlername «Madonna», mit dem sie wohl zum Ausdruck bringen will, dass sie sich in der Schmerzensmutter Maria wiedererkennt. Und daher jetzt auch ihre Show. Madonna versteht sie als Anklage gegen eine Kirche, die die Weiblichkeit gekreuzigt habe. Und gleichzeitig wohl als Versuch, sich von ihrem Trauma zu befreien.
Ich nehme Madonna ab, dass sie die christlichen Symbole des Kreuzes und der Dornenkrone ernst nimmt. Aber ich habe auch den Eindruck, dass sie diese Symbole nur zur Hälfte versteht. Denn Kreuz und Dornenkrone sind paradoxe Symbole – sie haben zwei verschiedene, zwei gegensätzliche Bedeutungen. Sie stehen nämlich nicht nur für das Leiden des unschuldigen Gottessohns, sie stehen auch für den Sieg über den Tod, für Vergebung und Erlösung durch die Liebe Gottes. Sie stehen für die Gewissheit, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Der Tod nicht, und das Schwesterninternat auch nicht. Ich wünsche Madonna deshalb vor allem, dass sie auch die zweite Bedeutung von Kreuz und Dornenkrone erkennt.
Madonnas Auftritt in Rom fiel übrigens genau in die Zeit, in der die Kirche die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel feierte. Und diese Maria war eine starke und selbstbewusste Frau – sie hat einen Sohn zur Welt gebracht, dessen Vater nach christlicher Überzeugung nicht ihr Mann war, und hat sich zu diesem Sohn bekannt, als er hingerichtet wurde. Auch das gehört eben zum Glauben der Kirche: dass einer solchen Frau als erstem Menschen nach Jesus Christus die volle Herrlichkeit Gottes zuteil wurde. Wer sich Madonna nennt, für den sollte die Verherrlichung der Madonna doch ein Grund zur Freude und Genugtuung sein. Finden Sie nicht?
Jubeln gegen dunkle Tage
Ist es nicht so? Spätestens seit August beobachten wir mit Unbehagen, wie die Schatten wieder länger werden. Die schönen, sonnigen Herbsttage hat uns das nicht verderben können – aber jetzt steht die dunkle Jahreszeit bevor, und die kann sich ganz schön aufs Gemüt legen. Vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen, denen das trübe Tageslicht und die frühe Dunkelheit richtig zu schaffen machen, die dann von einer unerklärlichen Schwermut heimgesucht werden. Ich kenne ein wunderbares Mittel dagegen: singen. Mit vielen anderen zusammen singen. Am besten in einem Kirchenchor.
Warum in einem Kirchenchor? Weil die Kirchenmusik uns erlaubt, aus vollem Herzen zu klagen und aus vollem Herzen zu jubeln. Dem tiefsten Leid und der größten Freude begegnen wir nur in den Gesängen, mit denen wir uns an Gott wenden. Denn wenn wir uns an Gott wenden, geht es immer um alles. Da bleibt es nicht bei der alltäglichen Nörgelei oder dem kurzen Aufatmen zwischendurch, da wird aus tiefster Seele geklagt und gefleht oder gelobt und gejubelt. Beim Singen merken wir plötzlich, wie etwas sich in uns öffnet, sodass unsere Seele sich ausdehnen und aufblühen kann. Und das befreit.
Schon für die Psalmendichter war Gottes Größe und Gottes Güte ein Grund zum Jubeln. Sicher, die Bibel kennt auch Not und Verzweiflung, aber nie treffen wir dort auf eine pessimistische Grundstimmung. Immer wieder ließen sich die Psalmdichter von der Schönheit der Welt und dem Wunder des Lebens überwältigen und konnten dann gar nicht anders, als Gott zu loben. An wen hätten sie sich sonst auch wenden sollen, um ihrer Freude und Dankbarkeit Luft zu machen? Ein ansteckender Jubel durchzieht deshalb die Psalmen. «Jauchzet dem Herrn, alle Welt!», so beginnt der 100.Psalm, und der Dichter des 96.Psalms fordert sogar die ganze Schöpfung zum Mitsingen auf: «Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich… Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald.»
Gott zu loben macht unendliche Freude – diese Erfahrung habe ich selbst vor vielen Jahren schon gemacht. Damals war ich ein junger Philosophielehrer in Sant’Anselmo, und nebenher leitete ich unseren Chor. Hin und wieder gaben wir Konzerte an herrlichen Orten wie der gotischen Kirche von Fossanova – unvergessliche Momente. Und je mehr ich bei diesen wunderbaren Gesängen auf Gott blickte, umso deutlicher wurde mir seine Größe, seine Herrlichkeit und seine Liebe. Als ich dann Abt meines Heimatklosters St.Ottilien wurde, brauchte ich einen Wahlspruch, wie ihn jeder Abt hat. Da entschied ich mich für «Jubilate Deo» – «Lobet Gott». Denn der Jubel über Gottes Güte war zu meinem Lebensinhalt geworden, und die Freude über seine Führung trägt mich beim Beten und Singen in meiner Mönchsgemeinschaft bis heute. Deshalb mein Rat an Sie: Singen Sie. Am besten in einem Kirchenchor. Denn es gibt kein besseres Mittel gegen dunkle Tage und schwere Zeiten.
Kinder brauchen Zuversicht, um das Leben meistern zu können
Sind Mütter dafür da, ihren Kindern alle Wünsche zu erfüllen? Die Frau, mit der ich neulich sprach, scheint das zu glauben. «Mein dreijähriger Sohn ist so süß», sagte sie, «dass ich ihm nichts abschlagen kann. Ich bin froh, dass wenigstens seine Erzieherinnen im Kindergarten ‹nein› sagen können.» Sie bringt es also nicht über sich, ihr Kind zu erziehen, habe ich gedacht. Sie will die gute Fee für ihren Sohn spielen. Feen brauchen niemals nein zu sagen. Feen sind einzig und allein fürs Wünsche-Erfüllen zuständig.