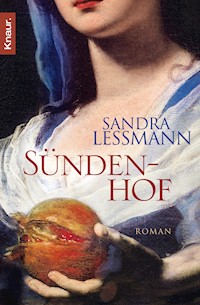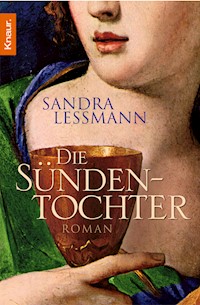5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau, die alles verloren hat, aber niemals aufgibt … England im 18. Jahrhundert. Nach dem Tod ihrer Eltern bricht die junge Kitty ins düstere London auf, um dort nach ihrem verschollenen Bruder zu suchen. Doch sie wird von der grausamen Nachricht empfangen, dass er als Dieb gehängt wurde und sie nun auf sich allein gestellt ist. Hoffnung schöpft Kitty erst wieder, als sie dem charmanten Daniel begegnet … aber dann lässt er sie in ihrer dunkelsten Stunde im Stich – und ebenso ihr ungeborenes Kind. Für ihr Überleben muss Kitty nun den höchsten Preis zahlen: Sie wird zur Kurtisane. Immer wieder vernimmt sie dabei Gerüchte über einen Mann, der als König der Londoner Unterwelt gilt … und der ihren Bruder damals verraten haben soll. Wird Kitty ihn rächen können? Für Fans von Philippa Gregory und Astrid Fritz: »Spannend und einfühlsam zugleich geschrieben. Historische Lektüre vom Feinsten.« www.ruhrnachrichten.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
England im 18. Jahrhundert. Nach dem Tod ihrer Eltern bricht die junge Kitty ins düstere London auf, um dort nach ihrem verschollenen Bruder zu suchen. Doch sie wird von der grausamen Nachricht empfangen, dass er als Dieb gehängt wurde und sie nun auf sich allein gestellt ist. Hoffnung schöpft Kitty erst wieder, als sie dem charmanten Daniel begegnet … aber dann lässt er sie in ihrer dunkelsten Stunde im Stich – und ebenso ihr ungeborenes Kind. Für ihr Überleben muss Kitty nun den höchsten Preis zahlen: Sie wird zur Kurtisane. Immer wieder vernimmt sie dabei Gerüchte über einen Mann, der als König der Londoner Unterwelt gilt … und der ihren Bruder damals verraten haben soll. Wird Kitty ihn rächen können?
Über die Autorin:
Sandra Lessmann, geboren 1969, lebte nach ihrem Schulabschluss fünf Jahre in London. Zurück in Deutschland studierte sie in Düsseldorf Geschichte, Anglistik, Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaften. Anschließend arbeitete sie am Institut für Geschichte der Medizin; ein Thema, dass sie ebenso wie ihre Englandliebe in ihre historischen Romane einfließen ließ.
Sandra Lessmann veröffentlichte bei dotbooks auch ihren historischen Roman »Die Spionin der Krone« sowie ihre historische Krimireihe um »Pater Jeremy«.
Die Website der Autorin: www.sandra-lessmann.de
***
eBook-Neuausgabe September 2024
Copyright © der Originalausgabe 2013 Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/StockNick, Try_my_best
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-217-6
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sandra Lessmann
Die Kurtisane des Teufels
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Mai 1719
Ganz London war in Feiertagsstimmung. Menschen jeden Alters und jeden Standes strömten über Holborn und St. Giles zur Oxford Street, einem tiefen Hohlweg voller Sumpflöcher, der zu den westlichen Grafschaften führte. An der Ecke des von einer Ziegelmauer umsäumten Hyde Parks verteilte sich die fröhliche Menge auf den umliegenden Wiesen, die sich in der Ferne in der hügeligen Landschaft verloren. Obwohl es erst Anfang Mai war, wirbelten die unzähligen Kutschen, Pferde und Fußgänger eine gelbe Staubwolke auf, die wie eine Dunstglocke über dem Hohlweg lag. Noch kamen die Karossen der Adeligen und Reichen zügig voran und konnten ungehindert die mächtigen hölzernen Tribünen erreichen.
Als der Morgen vorrückte, füllten sich die Kuhweiden nördlich der Straße mehr und mehr mit Menschen. Einige Schaulustige, die gelenkig genug waren, kletterten auf die Parkmauer und richteten sich dort so bequem wie möglich ein.
Geschmeidig wie eine Katze schlängelte sich der junge Daniel Gascoyne durch die Menge. Wie die Bürger, die Handwerker, die Adeligen, die Bettler und die Gevatterinnen, die Mütter mit ihren Kindern und die Lehrknaben, denen ihre Meister an diesem Tag traditionell freigaben, war auch Daniel schon früh am Morgen die zwei Meilen von London bis Tyburn gelaufen, um das Schauspiel zu sehen, das sich etwa um die Mittagszeit vor den Augen unzähliger Gaffer zutragen würde. Da er nur ein frugales Frühstück, bestehend aus Brot und Käse, zu sich genommen hatte, erstand der junge Mann eine Pastete bei einem fahrenden Händler. Die heruntergebrannten Kerzen an dessen Handwagen verrieten, dass der Pastetenbäcker bereits seit dem Morgengrauen vor Ort sein musste. Daniel biss in das inzwischen kalte, trockene Gebäck und betrachtete die Menschen, die ausgelassen schwatzten, scherzten, sangen und einander Anzüglichkeiten zuriefen. Eine Frau, der ein Bursche in den Hintern gekniffen hatte, verabreichte dem Frechdachs eine schallende Ohrfeige. Eine andere trug ein schreiendes Kind auf ihrer Hüfte. Fasziniert von dem fröhlichen Treiben, bemerkte sie die Tränen nicht, die dem Kleinen unablässig über die roten Bäckchen rollten. Zwei Handwerksburschen stibitzten Orangen vom Karren einer Hausiererin und bewarfen kichernd einen Prediger mit den Schalen der frisch geschälten Früchte. Das Einzige, was nicht so recht zu der ausgelassenen Jahrmarktsstimmung passen mochte, war der riesige dreibeinige Galgen auf dem Tyburn-Hügel.
Im Gegensatz zu den meisten Anwesenden betrachtete Daniel die Richtstätte mit einem leisen Schaudern. Er hatte schon des Öfteren einer »Tyburn-Messe«, wie man die Hinrichtungen auch nannte, beigewohnt und den armen Teufeln in die Augen geschaut, bevor der Henker sie aufknüpfte. Er hatte die Angst darin gesehen, die Panik vor dem Tod und der Hölle, die auf so manchen wartete, oder auch verzweifelten Trotz und das Bedürfnis, in den letzten Stunden des Lebens eine gute Figur zu machen. Zuweilen hatte Daniel das Gefühl gehabt, in einen Spiegel zu blicken. In diesen Zeiten konnte jeder vom rechten Weg abkommen und auf dem Schafott enden.
In dem Menschengewühl fiel Daniel eine flüchtige, kaum sichtbare Bewegung ins Auge. Der glänzende Stahl einer Uhrkette blitzte kurz auf, dann war nichts mehr zu sehen außer der leichten Drehung einer Hand, bevor der Taschendieb mit der Menge verschmolz. Ein weiterer Kandidat für den Galgenstrick!
Mit einem Mal schlug die ungeduldige Erwartung in gespannte Stille um, die kurz darauf einem lauten Jubel wich. Die Menschen drängten sich enger zusammen, in dem Verlangen, einen günstigeren Platz zu ergattern. Einige der Rücksichtsloseren traten und schlugen um sich oder rammten einem Unbedarften, der ihnen im Weg stand, den Ellbogen ins Gesicht. Bald gab es die ersten blutigen Nasen und ausgeschlagenen Zähne. Als ein Kriegsveteran in geflickter Uniform und auf Krücken gehend die Frau mit dem plärrenden Kind anstieß, fiel ihr der Kleine aus den Armen. Rasch griff Daniel zu, zog den Knaben unter den trampelnden Füßen hervor, ehe er Schaden nehmen konnte, und reichte ihn der erschrockenen Mutter zurück.
Aus aller Munde ertönte nun der Ruf: »Hüte runter!« – nicht aus Respekt vor den Verurteilten, sondern damit die hinten Stehenden besser sehen konnten.
Zu Pferde führten der Stadtmarschall und der Untersheriff die Prozession an, gefolgt von einem Trupp Berittener und dahinter einer Schar Konstabler, die ihre Amtsstäbe vor sich hertrugen. Dann kam ein einzelner Reiter, der in der Haltung eines Fürsten dem Karren mit den Verurteilten vorausritt. Bei seinem Anblick presste Daniel Gascoyne unwillkürlich die Lippen zusammen. Es war der Diebesfänger Jonathan Wild, der die drei Galgenvögel eigenhändig verhaftet und vor Gericht gegen sie ausgesagt hatte. Die Prozession nach Tyburn war für ihn ein Triumphzug. Als gelte das Interesse der Menge allein ihm, winkte er den Menschen mit strahlender Miene zu und rief: »Seht, in dem Wagen sitzen meine Kinder. Jubelt, ihr Leute, auf dass sie einen leichten Tod am Galgen finden!«
In dem besagten Leiterwagen hockten die Verurteilten mit gesenkten Köpfen auf ihren Särgen. Sie fuhren rückwärts, damit sie beim Anblick des Dreibeins nicht in Panik gerieten, doch ein jeder von ihnen wusste, was ihn erwartete. Reverend Paul Lorraine, der Ordinarius des Newgate-Gefängnisses, in schwarze Soutane und kurze Lockenperücke gekleidet, versuchte vergeblich, die Verbrecher zum Psalmensingen zu ermuntern. Eine Eskorte mit Piken Bewaffneter bildete die Nachhut.
Die Aufmerksamkeit der Menge war nun uneingeschränkt auf die Parade gerichtet. Daniels geübtes Auge registrierte so manche Geldkatze am Gürtel eines Schaulustigen, die er mit einer geschickten Bewegung unbemerkt hätte abschneiden können. Unwillkürlich begann es ihm in den Fingern zu jucken, doch er beherrschte sich. Unter Jonathan Wilds Augen einen Diebstahl zu begehen war gefährlicher Leichtsinn, der einen das Leben kosten konnte.
Als der Leiterwagen unter dem Dreibein hielt, wurde eine Brieftaube freigelassen, die dem Kerkermeister des Newgate Nachricht bringen sollte, dass die Verurteilten sicher an ihrem Bestimmungsort angekommen waren.
Nun trat der Zeremonienmeister von Tyburn vor: Richard Arnet, der Henker, gekleidet in seinen besten Rock und einen federbesetzten Hut. Sein Vorgänger William Marvell war zwei Jahre zuvor auf dem Weg zu einer Hinrichtung wegen nicht bezahlter Schulden verhaftet worden, was den Galgenvögeln das Leben rettete. Da sich auf die Schnelle kein Ersatz fand, brachte man sie ins Gefängnis zurück und deportierte sie schließlich in die amerikanischen Kolonien.
Die Verurteilten trugen bereits die Schlinge um den Hals. Der Scharfrichter musste nur noch die Stricke lösen, die man ihnen vor dem Aufbruch vom Newgate um den Leib gewunden hatte, und deren Enden mit Hilfe einer Leiter an einem der Querbalken des Dreibeins befestigen. Die Menge wurde ruhiger, man stieß einander an, um den Nachbarn zum Schweigen zu bringen, denn es war den Todgeweihten traditionell gestattet, vor ihrer Hinrichtung eine Rede zu halten. Dabei spielte es keine Rolle, worüber sie sprachen. Sie konnten sich mit ihren Untaten brüsten oder ihre Unschuld beteuern, sie durften ihre Ankläger verfluchen oder die Obrigkeit beschimpfen.
Der Erste der drei, ein Taschendieb, rechtfertigte sein kurzes Leben als Langfinger mit ständiger Geldnot und einer mangelnden Kraft, der Versuchung einer leichten Beute zu widerstehen. Seine Rede war jedoch kaum zu verstehen, da er völlig betrunken war. Die Prozession hatte unterwegs immer wieder an einer Schenke haltgemacht, wo man den Todgeweihten Gin oder Brandy ausgegeben hatte. Der Zweite, ein fünfzehnjähriger Knabe, der einer Bande bei mehreren Einbrüchen geholfen hatte, indem er durch ein kleines Fenster eingestiegen war und seinen Komplizen dann die Tür geöffnet hatte, brachte vor Angst kein Wort heraus. Der Dritte, ein junger Mann aus der Provinz, der in London sein Glück hatte machen wollen, erklärte mit schlichter Würde, dass er des Straßenraubs, dessen er angeklagt war, unschuldig sei. Man habe ihn fälschlicherweise beschuldigt, damit die wahren Täter unbehelligt blieben.
Der Rest seiner Rede ging im Lärm der Menge unter, die lieber grausige Einzelheiten eines Verbrechens als Unschuldsbeteuerungen hören wollte. Viele der Schaulustigen waren seit dem Morgen auf den Beinen, um die Hinrichtung zu sehen. Müdigkeit und Hunger verwandelte die Menschen in blutgierige Bestien, die ungeduldig nach dem Schauspiel verlangten, das sie hergeführt hatte. Erneut ermunterte der Ordinarius die Verurteilten zum Psalmensingen, doch die Menge begann zu schreien und zu fluchen, so dass kein Wort zu verstehen war und Lorraine seine Bemühungen aufgab. Als der Kleriker von dem Leiterwagen hinabgestiegen war, trat der Henker zu den Verurteilten und zog ihnen mit einer brüsken Bewegung, die etwas Endgültiges hatte, die weiße Mütze über das Gesicht, die man ihnen im Kerker aufgesetzt hatte. Blind und zitternd standen die drei noch einen Moment auf der Ladefläche des Karrens. Dann schwang der Scharfrichter die Peitsche, und die Pferde zogen an.
Die Menge wurde still. Aller Augen richteten sich auf die im Todeskampf zuckenden Körper, als sich die Schlingen um die Hälse der Männer zuzogen und das Blut sich in ihren Köpfen zu sammeln begann. Ein kräftiger Bursche stürzte vor und hängte sich an die Beine des Knaben, um das qualvolle Sterben zu beschleunigen.
Daniel nutzte die Ablenkung der Leute, um sich zum Galgen durchzudrängen. Ein starker Geruch nach Urin stieg ihm in die Nase, der von den Beinkleidern der Gehängten ausging. Einem Impuls folgend, hängte er sich mit seinem ganzen Gewicht an die Beine des Mannes, der seine Unschuld beteuert hatte, bis sich seine Glieder nicht mehr bewegten.
Mit dem Tod der Verurteilten löste sich die Anspannung der Menge, und die Massen gerieten in Bewegung. Einige machten sich auf den Heimweg, andere hielten Ausschau nach einem fahrenden Händler, um noch schnell einen kleinen Imbiss einzunehmen. Ein Großteil jedoch blieb an seinem Platz und wartete auf den Moment, da die Hingerichteten vom Galgen abgeschnitten wurden. Dies geschah frühestens nach einer Stunde. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass die Gehängten auch wirklich tot waren. Dennoch kam es immer wieder vor, dass ein Verurteilter den Deckel seines Sarges öffnete und herauskletterte oder auf dem Seziertisch der Chirurgen wieder zu sich kam.
Der Wagen, den die Gilde der Barbiere und Wundärzte regelmäßig nach Tyburn schickte, stand schon in einiger Entfernung bereit. Dem Gesetz nach stand den Chirurgen eine festgelegte Anzahl von Gehängten für ihre Vorlesungen zu.
Eine zweite Brieftaube wurde freigelassen und machte sich auf den Weg zum Newgate-Gefängnis. Bald würde auch der Kerkermeister wissen, dass die Hinrichtung ohne Zwischenfälle verlaufen war.
Daniel hatte die Beine des Gehängten losgelassen, blieb aber an seiner Seite stehen, ohne recht zu wissen, warum. Er hatte den jungen Mann aus der Provinz nicht näher gekannt, hatte ihn nur einige Male in einer Schenke in Covent Garden gesehen. Allerdings war Daniel einer der wenigen, die wussten, dass der Bursche bei seiner Rede die Wahrheit gesagt hatte. Man hatte ihn zu Unrecht verurteilt. Aber das war nun nicht mehr wichtig.
Eine Balladenverkäuferin drängte sich durch die gaffende Menge und pries ihre Flugschriften an, auf denen die Geständnisse der Hingerichteten und der Bericht ihres verpfuschten Lebens für sechs Pence das Stück nachzulesen waren. Diese Geschichten wurden vom Ordinarius des Newgate verfasst, womit dieser sich ein stattliches Zubrot verdiente, denn besonders an den Hinrichtungstagen verkauften sich die Flugblätter wie warme Semmeln.
Doch Lorraine war nicht der Einzige, dem sein Amt die Gelegenheit bot, nebenher ein gutes Geschäft zu machen. Nach jeder Hinrichtung versteigerte der Scharfrichter in einer nahegelegenen Schenke die Galgenstricke in Stücken von einem Fuß Länge. Die schaurigen Andenken brachten viel Geld ein, denn die Leute glaubten, dass der Strick, mit dem ein Mensch gehängt worden war, Heilkräfte besaß. Man setzte ihn gegen Kopfschmerzen und Anfälle ein.
Als die Toten vom Galgen geschnitten wurden, drängten Kranke und Entstellte zum Schafott und legten einige Münzen in die Hand des Henkers, damit dieser ihnen erlaubte, die Leichen zu berühren. Eine junge Frau entblößte ihre Brüste und strich mit den Fingern eines der Gehängten darüber, um ein Geschwür oder ein anderes Leiden zu heilen. Eine andere Frau brachte ihr Kind, dessen Gesicht von einem Ausschlag bedeckt war, zum Galgen und legte ihm die Hand des gehängten Knaben auf. Ein Mann behandelte auf dieselbe Weise seinen Kropf. Nach einer Weile war Arnets Geldbeutel wohlgefüllt. Als Letztes standen ihm noch die Kleider der Gehängten zu. Nachdem er die drei Leichen ausgezogen hatte, fuhr der Wagen der Chirurgengilde vor, und die Diener der Wundärzte luden eilig den Taschendieb und den Knaben auf, bevor die Menge ihnen die Beute streitig machte, denn nichts erschreckte die Menschen so sehr wie der Gedanke, nach dem Tod zerstückelt zu werden. Schließlich konnte nur ein unversehrter Körper beim Jüngsten Gericht auferstehen. Der Mann aus der Provinz wurde dagegen auf den Henkerskarren geladen. Er ging zurück ins Newgate-Gefängnis, wo seine Leiche mit Teer bestrichen wurde. Später sollte sie im Hyde Park in Ketten aufgehängt werden, wie es einem Straßenräuber zukam.
Als der Leichnam weggebracht wurde, erhaschte Daniel noch einen letzten Blick auf sein blau angelaufenes, aufgedunsenes Gesicht. Der Bursche hatte einfach Pech gehabt. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Daniel empfand tiefes Mitleid für ihn und für seine Angehörigen.
Kapitel 2
Gedankenverloren betrachtete Catherine Marshall, genannt Kitty, ihr Spiegelbild. Die Sprünge, die sich durch das Glas zogen, verzerrten die rechte Seite ihres blassen Gesichts und verschleierten so die Pockennarben, die sich über Schläfe und Wange zogen. Sie waren kaum zu sehen und entstellten sie nicht. Aber sie würden sie stets daran erinnern, dass sie ihrer Familie den Tod gebracht hatte. Vor vier Wochen war Kitty an den Blattern erkrankt und hatte ihre Eltern, die sie pflegten, angesteckt. Sie hatte die Krankheit überlebt, Vater und Mutter nicht. Nun hatte sie nur noch ihren Bruder Thomas, der vor Jahren nach London gegangen war. Denn nach Beendigung seiner Lehre als Kunstmöbeltischler in ihrem Heimatort Stamford, einer kleinen Stadt in Lincolnshire, hatte er keine Arbeit gefunden. Ihr Vater, der Schulmeister war, hatte gehofft, dass aus seinem Sohn einmal etwas Besseres als ein Handwerker werden würde. Doch Thomas’ Stärke hatte von jeher weniger in seinem Verstand als in seinen Händen gelegen. Er war künstlerisch begabt und verstand es, ein paar unscheinbare Holzbretter in ein edles Möbelstück zu verwandeln. Als der Vater schließlich feststellte, dass Kitty die rasche Auffassungsgabe und das gute Gedächtnis ihres alten Herrn geerbt hatte, die dieser sich eigentlich bei seinem Sohn gewünscht hätte, unterrichtete Marshall stattdessen seine Tochter in Lesen und Schreiben, Rechnen und Französisch. Er wusste zwar nicht so recht, was sie als Frau im späteren Leben mit diesen Fähigkeiten anfangen sollte. Doch immerhin konnte es für eine zukünftige Ehefrau und Mutter hilfreich sein, wenn sie etwas von Buchführung verstand. Ihre Französischkenntnisse würde sie dagegen kaum anwenden können.
Bei dem Gedanken an ihren Vater, der ihre Klugheit stets mit so viel Stolz gelobt hatte, musste Kitty lächeln. Gleichzeitig traten ihr Tränen in die Augen. Ihre Zähne pressten sich in ihre Lippen, bis der Schmerz den Tränenfluss versiegen ließ. Wie durch einen Schleier betrachtete Kitty die kahlen Wände der Schlafkammer, in der sie stand. Bis auf den zerbrochenen Spiegel, den niemand haben wollte, einer Waschschüssel und einer Kanne aus Zinn war der Raum leer. Um die hohen Forderungen des Arztes zu bezahlen, hatten sie die Möbel und alles, was einen Wert besaß, verkaufen müssen. Von dem wenigen Geld, das nach der Bestattung der Eltern übrigblieb, würde Kitty zumindest einige Wochen ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
Auf der Treppe waren Schritte zu hören. Seufzend wandte sich Kitty ab und begegnete dem mitfühlenden Blick von Mistress Scroggs, der Nachbarin, die der Familie Marshall in den schweren Stunden beigestanden hatte.
»Bist du sicher, dass du nach London fahren willst, Kitty?«, fragte die mütterliche Frau zweifelnd und strich mit den Händen abwesend über ihre Schürze. »Das Leben in einer so großen Stadt ist gefährlich für ein unerfahrenes Mädchen. Du bist doch erst siebzehn.«
Mit einem gezwungenen Lächeln trat Kitty zu ihr und nahm mit einer dankbaren Geste ihre vor Sorge feuchten Hände. Die junge Frau konnte nicht leugnen, dass es ihr schwerfiel, ihre Heimat zu verlassen, und dass der Gedanke an die unsichere Zukunft sie mit Furcht erfüllte. Doch sie versuchte, ihre Gefühle zu überspielen, um es Mistress Scroggs nicht noch schwerer zu machen.
»Ich bin ja nicht allein«, sagte sie beschwichtigend. »Thomas wird mir helfen, eine Anstellung als Dienstmädchen zu finden.«
Die Nachbarin unterdrückte ein Schluchzen. »Dein Vater hatte sich so sehr gewünscht, dich gut zu verheiraten«, presste sie hervor. »Wie schmerzlich wäre es für ihn, zu wissen, dass du ein Leben als Dienstbote führen musst.«
»Ein Mädchen ohne Mitgift ist nun einmal keine gute Partie«, konstatierte Kitty mit einem Sarkasmus, der ihr selbst fremd war.
Ein wenig schockiert über die Offenheit des jungen Mädchens, sah Mistress Scroggs sie an. Bevor sie etwas sagen konnte, fügte Kitty mit einem Lächeln hinzu: »Vielleicht gelingt es mir, ein wenig Geld zu sparen, wenn ich eine gute Stelle finde. Dann kann ich in ein paar Jahren doch noch heiraten.«
Mistress Scroggs nickte erleichtert. »Ja, ganz bestimmt.« Unten in der Stube, die ebenso leer und kahl war wie die Schlafkammer, stand Kittys Reisetruhe, in dem sich ein paar Kleider, Schuhe und andere Kleinigkeiten befanden.
»Mein Sohn bringt dich mit dem Karren zur Herberge. Es ist noch genug Zeit. Der Rollwagen nach London fährt erst in einer Stunde. Gott segne dich, mein Kind.«
Herzlich umarmte Mistress Scroggs das junge Mädchen, bevor sie ihren Sohn, der vor der Tür mit dem Karren wartete, hereinrief. Der junge Jack lächelte Kitty schüchtern an, während er sich den breitkrempigen Hut vom Kopf zog. Wie die meisten Burschen in der Nachbarschaft hatte er schon seit Jahren eine Schwäche für das hübsche Mädchen, das immer fröhlich war, dabei aber stets ein wenig unnahbar blieb. Die Träume der Jungen heizte dies nur noch mehr an. Dass Kitty gebildet war und Französisch sprach wie die feinen Leute, flößte ihnen zudem großen Respekt vor ihr ein.
»Jack, nimm Kittys Koffer und lade ihn auf den Wagen«, wies Mistress Scroggs ihren Sohn an, der, den Hut in der Hand, das junge Mädchen bewundernd anstarrte.
»Ja, Mutter«, antwortete der Bursche, der sich nur mit Mühe auf seine Pflichten besann.
Erneut tief in Gedanken versunken, folgte Kitty ihm ins Freie. Sie hatte seine begehrlichen Blicke kaum bemerkt.
Mit einer letzten Umarmung verabschiedete sich die junge Frau von Mistress Scroggs und stieg neben Jack auf den Bock des zweirädrigen Karrens. Ein kurzes Zungenschnalzen seines Herrn, und das Zugpferd setzte sich gemächlich in Bewegung. Gierig atmete Kitty den Duft der Frühlingsblumen auf den Wiesen ein. Sie war noch nie zuvor in London gewesen, doch diejenigen, die es schon einmal in die Hauptstadt verschlagen hatte, beschrieben sie als stinkenden, schmutzigen Moloch, dessen Einwohner von den ungesunden Lebensverhältnissen in jungen Jahren dahingerafft wurden. Eine bedrückende Aussicht, die Kitty mit Missbehagen erfüllte.
Vielleicht gelingt es mir, genug Geld zu sparen, damit ich eines Tages nach Stamford zurückkehren kann, dachte sie hoffnungsvoll.
»Was wirst du tun, wenn du in London ankommst?«, fragte Jack neugierig.
»Ich werde Thomas aufsuchen«, antwortete das Mädchen abwesend. »Er kann mir sicher eine Anstellung besorgen.« »Wie geht es Thomas? Ich hätte erwartet, dass er zur Beerdigung eurer Eltern kommt, aber offensichtlich war er zu beschäftigt.«
»Ja, das wird es wohl sein«, murmelte Kitty.
»Hat er dir geschrieben, weshalb er nicht kommen konnte?«, hakte Jack nach, der nicht bemerkte, dass seiner Begleiterin das Thema unangenehm war.
»Nein«, erwiderte sie einsilbig.
»Was? Er hat dir nicht einmal eine Erklärung gegeben, weshalb er die Bestattung eurer Eltern versäumt?«, rief Jack empört.
Kitty senkte betreten den Blick. »Er hat überhaupt nicht geschrieben«, gab sie zu.
»Das ist nun wirklich ungeheuerlich!«
»Vielleicht hat mein Brief ihn nicht erreicht«, versuche Kitty die Nachlässigkeit ihres Bruders zu erklären.
»Möglich«, stimmte der Bursche zu. »Dann wird dein Bruder aber sehr überrascht sein, wenn er jetzt erst vom Tod eurer Eltern erfährt!«
»Ja, das wird er.«
Kitty verschwieg ihm, dass schon seit zwei Monaten kein Brief mehr von Thomas gekommen war. Da ihr Bruder seit seiner Ankunft in London bis dahin stets regelmäßig an seine Familie geschrieben hatte, beunruhigte Kitty dieses plötzliche Schweigen. Thomas war kein leichtfertiger Mensch, doch die verderblichen Einflüsse der großen Stadt waren legendär. Und so fürchtete das Mädchen, dass ihr naiver Bruder in schlechte Gesellschaft geraten sein könnte.
Vor einer Herberge am Rande von Stamford zügelte Jack das Pferd und half Kitty beim Absteigen. Der Rollwagen nach London stand schon bereit. Einige Warenbündel wurden noch auf den vierrädrigen Wagen verladen und unter der Plane, die sich über die Ladefläche wölbte, verstaut. Der Fuhrmann spannte mit Hilfe eines Stallknechts die Zugpferde an. Sechs Tiere gingen hintereinander, während der Fuhrknecht auf einem Pony nebenherritt und die Pferde mit Zurufen lenkte.
Kitty schenkte Jack noch ein Abschiedslächeln, das diesen erröten ließ, bevor sie neben den anderen Passagieren auf der Sitzbank Platz nahm. Der Rollwagen legte zwar nur zwei Meilen pro Stunde zurück und brauchte vier Tage bis nach London, aber mit acht Schillingen war er um die Hälfte billiger als die Postkutsche, die die Strecke in zwei Tagen bewältigte.
Als der Fuhrmann sein Pony bestieg und die Peitsche schwang, setzten sich die sechs Pferde gehorsam in Bewegung. Kurze Zeit später entzog eine Biegung Kitty den Blick auf die kleine Provinzstadt, in der sie aufgewachsen war. Eine dumpfe Ahnung, dass sie Stamford nie wiedersehen würde, überkam sie und ließ erneut Tränen in ihre Augen steigen.
Vier Tage später fuhr der Rollwagen um die Mittagszeit in den Hof des »Bell Inn« auf der Wood Street nahe Cheapside. Die Herberge war drei Stockwerke hoch, so dass kaum ein Sonnenstrahl auf das Pflaster des Innenhofs fiel. Mit prächtig geschnitzten Geländern versehene Galerien ermöglichten den Zugang zu den Gastzimmern.
Als Kitty vom Wagen hinabstieg, schwirrte ihr der Kopf vom Lärm der Großstadt und dem Trubel ihrer Einwohner. Noch nie hatte sie so viele Menschen auf einmal gesehen. Im Hof des »Bell Inn« herrschte reges Treiben. Stallknechte striegelten Pferde oder spannten sie vor Kutschen und Fuhrwerke, Lastenträger be- und entluden Frachtwagen, schleppten Bündel und Kisten oder rollten Fässer über das Kopfsteinpflaster. Auf den Galerien standen müßige Herbergsgäste und schauten dem Gewimmel zu.
Schon bei der Durchquerung der nördlichen Vororte hatte Kitty über die Zahl an Fuhrwerken, Kutschen und Reiter gestaunt. Es roch nach Kohlenrauch, Abwässern und Pferdemist. Der Gestank war schlimmer, als Kitty es sich je vorgestellt hätte. Über den Straßen lag eine schwere Dunstwolke, die von dem Rauch der unzähligen Herdfeuer verursacht wurde und die Fassaden der Häuser dunkel färbte. Unwillkürlich fragte sich das Mädchen, wie die Wäscherinnen das Linnen sauber bekamen, mit dem sich die Menschen so überschwänglich schmückten. Überall sah sie weiße Hauben, Manschetten und Schürzen. Viele der vornehmen Herren trugen schneeige Spitzenjabots zur Schau, und die Rüschen ihrer feinen Leinenhemden quollen üppig unter den Ärmeln ihrer farbenprächtigen Röcke und den nur nachlässig zugeknöpften Westen hervor. Aber Kitty sah auch Bettler in schmutzigen, fadenscheinigen Kleidern, von denen sich viele aufgrund eines körperlichen Gebrechens nur mühsam fortbewegten, und Kinder mit dreckverschmierten Gesichtern und nackten Füßen. Der Anblick des Elends erschreckte das Mädchen und verstärkte die Sehnsucht nach der Gesellschaft ihres Bruders. Während Kitty wartete, dass ihre Reisetruhe abgeladen wurde, sah sie sich neugierig im Hof der Herberge um. Stallburschen und Lastenträger eilten an ihr vorüber, ohne von ihr oder einem der anderen Passagiere Notiz zu nehmen. Da bemerkte Kitty auf einmal eine Gevatterin, die wie die Herbergsgäste auf den Galerien unbeteiligt inmitten des geschäftigen Treibens stand und aufmerksam die Reisenden betrachtete, die mit dem Rollwagen aus der Provinz gekommen waren. Als ihr Elsternblick an Kitty hängenblieb, teilte ein zufriedenes Lächeln die Lippen der Frau, und sie näherte sich dem Mädchen mit herzlicher Miene.
»Ich hoffe, Ihr hattet eine angenehme Reise, gutes Kind«, sagte sie freundlich.
Erstaunt über die Vertraulichkeit, musterte Kitty die Alte von Kopf bis Fuß. Sie mochte um die fünfzig sein. Ihre Züge wirkten verlebt, und unter der feinen Haube stahlen sich einige Strähnen grauen Haares hervor. Die Gevatterin trug ein Kleid aus schimmernder Seide, das ein Vermögen gekostet haben musste. Kitty hatte noch nie einen so edlen Stoff gesehen. Bänder und Schleifen schmückten das Mieder, dessen Ausschnitt einen faltigen Busen sehen ließ. Das Gesicht der Frau war stark geschminkt, und auf Schläfe, Wange und Stirn fanden sich schwarze Flecken aus Seide, die Sonnen, Herzen und andere Dinge darstellten. Kitty kannte diese Schönheitspflästerchen nur aus den Erzählungen ihrer Mutter. Diese hatte ihrer Tochter nach einem Aufenthalt in London einmal das modische Beiwerk beschrieben, mit dem sich die reichen Leute so gerne herausputzten. Offensichtlich hatte Kitty eine vornehme Dame vor sich.
»Woher kommt Ihr, meine Liebe?«, fragte die Gevatterin mit unverhohlener Neugierde.
Kitty, die zu gut erzogen war, um sich ihr Unbehagen angesichts der Unverblümtheit der Fremden anmerken zu lassen, antwortete höflich: »Aus Stamford, Madam.«
»Da habt Ihr eine lange Reise hinter Euch«, erwiderte die Alte. »Und wie ich sehe, bringt die Provinz nach wie vor die hübschesten Blumen hervor.«
Ihr Blick wanderte über Kittys Gesicht und nahm den gesunden rosigen Farbton ihrer Haut, ihre ebenmäßigen Züge, die kornblumenblauen Augen, die schmale gerade Nase und die vollen Lippen in sich auf, aber auch die verblassten Pockennarben, die auf der rechten Schläfe und Wange zu sehen waren und der Gevatterin ein zufriedenes Brummen entlockten. Das Mädchen war etwa eine Handbreit größer als sie, ihr Körperbau schlank und von natürlicher Grazie, was die Augen der Alten während der eingehenden Begutachtung noch befriedigter leuchten ließ. Kittys Kleid war aus einfachem Leinen. Dazu trug sie eine Schürze und ein Halstuch, das züchtig den Ausschnitt bedeckte. Ihr honigblondes Haar war streng zu einem Knoten gebunden und wurde fast vollständig von einer schlichten Leinenhaube und einem daraufsitzenden Strohhut bedeckt.
»Viele junge Mädchen kommen vom Land nach London, um hier eine Anstellung als Dienstmagd oder Stubenmädchen zu suchen«, bemerkte die Alte mit wissender Miene.
Kitty errötete leicht, weil sie das unheimliche Gefühl beschlich, die Gevatterin habe ihre Gedanken gelesen.
»Ich vermiete saubere möblierte Kammern für wenig Geld an anständige junge Mädchen und helfe ihnen, eine gute Stelle bei einer angesehenen Familie zu finden«, fuhr die Alte fort. »Wenn ich Euch zu Diensten sein kann, meine Liebe, so braucht Ihr es nur zu sagen. Zurzeit habe ich eine geräumige Kammer frei.«
Kitty konnte ihr Glück kaum fassen, dass sie so kurz nach ihrer Ankunft jemandem begegnete, der ihr genau das verschaffen konnte, was sie suchte. Dabei hatte sie sich die Arbeitssuche viel schwieriger vorgestellt.
»Ihr habt recht, Madam«, erwiderte sie. »Ich bin tatsächlich auf der Suche nach einer Anstellung. Aber ich brauche keine Kammer, denn ich habe einen Bruder hier in London. Falls ich jedoch nicht bei ihm wohnen kann, komme ich gerne auf Euer Angebot zurück.«
»Das freut mich«, meinte die Gevatterin befriedigt. »Wenn Ihr mit mir kommt, zeige ich Euch mein Haus, damit Ihr wisst, wo Ihr mich findet. Auch würde ich Euch gerne eine Erfrischung anbieten. Die lange Reise hat Euch sicher erschöpft.«
Bevor Kitty antworten konnte, trat eine der Reisenden an ihre Seite, mit der sie sich unterwegs angefreundet hatte. Mistress Webster war die Frau eines Uhrmachers, die in Stamford Verwandte besucht hatte.
»Mistress Marshall, ein Geselle meines Gatten holt mich ab.
Wenn Ihr möchtet, können wir Euch mitnehmen«, erbot sich Mistress Webster. Dabei warf sie dem Mädchen einen warnenden Blick zu. Verwirrt blickte Kitty sie an. Daraufhin nahm die Uhrmacherfrau energisch ihren Arm und zog sie in den Schankraum der Herberge.
»Er wird gleich da sein. Wir setzen Euch dann bei Eurem Bruder ab«, sagte sie in einem Ton, der keinen Widerspruch zuließ. Auf Kittys fragenden Blick seufzte Mistress Webster tief und erklärte: »Das war Mutter Jolley. Sie führt ein verrufenes Haus in der Drury Lane und ist immer auf der Suche nach hübschen jungen Mädchen vom Land. Haltet Euch fern von ihrer Sorte!«
Obwohl Kitty nur eine dunkle Vorstellung davon hatte, was in einem »verrufenen Haus« vor sich ging, begriff sie, dass Mistress Websters Eingreifen sie vor einer großen Dummheit bewahrt hatte.
»Ich kann nur hoffen, dass Euer Bruder ein strenges Auge auf Euch haben wird«, sagte die Uhrmacherfrau inbrünstig und faltete die Hände.
Nach einer Weile schaute der Geselle ihres Gatten in den verrauchten Schankraum, und die beiden Frauen folgten ihm erleichtert in den Hof. Mutter Jolley war verschwunden. Doch bei der Ankunft des nächsten Wagens aus der Provinz würde sie vermutlich wieder zur Stelle sein. Nachdem der Geselle Kittys Reisetruhe aufgeladen hatte, nahmen sie und Mistress Webster neben ihm auf dem Kutschbock Platz, und das Fuhrwerk setzte sich in Bewegung.
»Wo wohnt Euer Bruder?«, fragte die Uhrmacherfrau.
»Im Haus ›Zum Vogelkäfig‹ auf der Cock Lane nahe Smithfield«, antwortete Kitty. »Ist das weit von hier?«
»Nein, nur ein paar Straßen gen Westen«, erklärte Mistress Webster.
Aufgrund des dichten Verkehrs, der Kitty noch immer in Erstaunen versetzte, brauchte der Wagen eine halbe Stunde bis zur Cock Lane. Als der Geselle die Truhe vor dem Haus »Zum Vogelkäfig« abgeladen hatte, verabschiedete sich Mistress Webster von dem Mädchen.
»Alles Gute, Mistress Marshall. Möge der Herr Euch schützen.«
Kitty dankte ihr herzlich. Nachdem die Uhrmacherfrau sie bereits in der ersten Stunde ihres Aufenthalts in London davor bewahren musste, sich in die Nesseln zu setzen, sah das Mädchen ein, dass sie den göttlichen Beistand bitter nötig hatte. Während sie dem davonfahrenden Fuhrwerk nachsah, fühlte sie sich verlassener denn je.
Kapitel 3
Das Haus, an dessen Fassade sich das Schild mit dem aufgemalten Vogelkäfig quietschend an einem gusseisernen Arm im Wind bewegte, bestand aus einem Gerüst silbergrau gebleichter Eichenbalken und mit Lehm beworfenem Flechtwerk. Es musste an die zweihundert Jahre alt sein und stand ein wenig windschief zwischen seinen ebenso altersschwachen Nachbarn. Die oberen Stockwerke kragten über die Straße hervor, so dass die Räume im ersten und zweiten Stock mehr Platz boten als die unteren. Als sie von der Giltspur Street in die Cock Lane eingebogen waren, war Kitty der abrupte Übergang von den neu erbauten Ziegelhäusern zu dem alten Fach werk aufgefallen. Mistress Webster hatte ihr erklärt, dass der verheerende Brand des Unglücksjahres 1666, das den gesamten Stadtkern von London zerstört hatte, bis zu genau dieser Stelle vorgedrungen war, bevor man das Feuer hatte eindämmen können. Die alten Häuser stammten noch aus der Zeit der Königin Elizabeth und würden vielleicht noch weitere hundert Jahre überdauern.
Auf Kittys Klopfen hin öffnete ihr eine alte Frau, deren knochiges schmales Gesicht von einer mit Rüschen besetzten Haube umrahmt wurde. Freundliche graue Augen sahen sie fragend an.
»Mein Name ist Catherine Marshall«, stellte Kitty sich vor. »Ich möchte meinen Bruder Thomas besuchen.«
Über das faltige Gesicht der Frau wanderte ein Ausdruck des Erstaunens, der kurz darauf deutlichem Bedauern Platz machte. »Es tut mir leid, mein Kind. Aber Mr. Marshall wohnt nicht mehr hier.«
Die Erklärung überraschte Kitty so sehr, dass sie kein Wort herausbrachte. Ein Gefühl der Hilflosigkeit überkam sie. Die alte Frau, die von ihrem Gesicht ablas, was in ihr vorging, trat von der geöffneten Tür zurück und breitete einladend den Arm aus.
»Kommt doch erst einmal herein, Mistress Marshall. Seid Ihr gerade erst in London angekommen?«
Kitty schluckte schwer und nickte. Während sie der Alten in die Küche folgte, überschlugen sich ihre Gedanken. Wie sollte sie Thomas in dieser riesigen Stadt finden? Und was sollte aus ihr werden, wenn es ihr nicht gelang, ihn aufzuspüren?
In der kleinen Küche, die nach hinten auf einen winzigen Hof hinausging, saß ein Mann vor der Feuerstelle und wärmte sich die Hände, obwohl es ein warmer Frühlingstag war. Überall standen Töpfe und Kessel. Von der Decke hingen getrocknete Kräuter, in einem Korb stapelten sich Lauch, Zwiebeln und Kohl. Offenbar kochte die Hauswirtin regelmäßig für ihre Mieter.
»Ich bin Mistress Speering«, stellte sich die Frau mit dem knochigen Gesicht vor. »Mir gehört das Haus.«
Der hagere Mann am Feuer nickte den beiden Frauen kurz zu, bevor er wieder andächtig in den Anblick der Flammen versank.
»Mr. Pinfold, einer meiner Mieter«, erklärte Mistress Speering. »Er ist recht wortkarg, aber das macht ihn zu einem angenehm ruhigen Hausgast.«
Noch immer verwirrt, ließ sich Kitty auf den angebotenen Stuhl sinken.
»Mein Bruder hat in seinen Briefen nicht erwähnt, dass er umziehen wollte«, sagte sie. »Wann hat er Euer Haus verlassen, Madam?«
»Das war so vor zwei Monaten«, erwiderte Mistress Speering nach kurzer Überlegung.
Von diesem Zeitpunkt an waren auch seine Briefe ausgeblieben, dachte das Mädchen bedrückt.
»Unsere Eltern sind gestorben«, platzte sie heraus. »Daher ist es ungemein wichtig, dass ich ihn finde. Wisst Ihr, wohin er gegangen ist, als er Euer Haus verließ?«
»Er sagte, er habe eine preiswertere Bleibe in Covent Garden gefunden«, antwortete Mistress Speering. »Aber er machte leider keine näheren Angaben.«
Kitty senkte den Blick, um die aufsteigenden Tränen zu verbergen, die sich in ihren Augen sammelten.
»Ist dieses Covent Garden groß?«, fragte sie unsicher. »Würde es schwierig sein, dort jemanden zu finden?«
»Nun, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht«, gestand Mistress Speering. »Ich war noch niemals dort. Es ist ein Platz, der vor fast hundert Jahren nach ausländischer Manier angelegt wurde, mit Schenken, Buden und Theatern. Die Gegend genießt keinen guten Ruf. Es ist ein Vergnügungsviertel, kein Ort, an den sich eine anständige Frau verirren würde.« Allmählich überkam Kitty Verzweiflung. »Aber was soll ich denn nur tun? Ich muss meinen Bruder finden! Er weiß noch
nichts vom Tod unserer Eltern.«
»Das tut mir sehr leid, armes Kind«, sagte Mistress Speering mitfühlend.
Als ihr Blick die Reisetruhe streifte, erkundigte sie sich: »Habt Ihr schon eine Unterkunft?«
Bekümmert schüttelte Kitty den Kopf.
»Das Zimmer Eures Bruders ist bereits wieder vermietet, aber zufällig habe ich eine Kammer frei. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr sie haben. Sie kostet vier Schillinge und sechs Pence.«
Der Preis war hoch, doch Kitty hatte keine Kraft mehr, um anderswo eine billigere Unterkunft zu suchen, und so stimmte sie zu.
Mistress Speering führte sie in den ersten Stock und schloss eine Tür auf, die sich knarrend zu einer geräumigen Kammer mit einem hellen Erkerfenster öffnete. Die Wände waren mit dunkler Eiche getäfelt, und der Kamin war aufwendig mit geschnitzten Figuren und Blumenranken verziert. Der Raum hatte sicher einst als gute Stube gedient, in dem der Hausherr wichtige Besucher empfangen hatte. Dies erklärte auch den stolzen Preis. Länger als eine Woche konnte sie hier nicht bleiben.
»Soll ich Feuer machen?«, erbot sich Mistress Speering.
»Nein danke. Ich gehe gleich wieder aus«, erwiderte Kitty und zahlte die Miete für eine Woche.
Die Alte blickte sie besorgt an. »Wenn Ihr nach Covent Garden geht, seid vorsichtig. Dort wimmelt es von Gaunern und Diebesgesindel.«
»Danke für die Warnung. Ich werde schon aufpassen.«
Als sich die Hauswirtin zurückgezogen hatte, ließ sich Kitty seufzend auf der Kante des vierpfostigen Bettes nieder, dessen Vorhänge aus verblichenem rotem Kamelott zurückgeschlagen waren.
Wie hatte es nur so weit kommen können? Natürlich hatte sie sich Sorgen gemacht, als die Briefe ihres Bruders ausblieben, aber sie hatte dies auf Nachlässigkeit oder Zeitmangel zurückgeführt. Sie hätte nicht erwartet, dass Thomas umziehen könnte, ohne seiner Familie seine neue Adresse mitzuteilen. Was war nur in ihn gefahren? Dachte er denn überhaupt nicht mehr an seine Schwester und an Vater und Mutter?
Kitty wusste, dass sie allen Mut verlieren würde, wenn sie noch länger grübelte. Es war besser, unverzüglich mit der Suche nach Thomas zu beginnen. Und wenn sie ihn gefunden hatte, würde sie ihm tüchtig die Leviten lesen.
Auf einem Waschstand befanden sich eine Zinnschüssel und eine Kanne mit frischem, aber kaltem Wasser. Da Kitty nicht warten wollte, bis die Hauswirtin ihr heißes brachte, wusch sie sich kalt, ordnete ihr blondes Haar vor dem Spiegel an der Wand und setzte sich Haube und Strohhut auf. Bevor sie die Kammer verließ, versteckte sie eingedenk von Mistress Speerings Warnung einen Großteil ihres Geldes unter der Bettmatratze und behielt nur ein paar Münzen in ihrer Geldbörse, die sie in einem Beutel über dem Arm trug.
Als sie die Treppe hinunterstieg, begegnete sie der Hauswirtin auf dem Absatz.
»Wäret Ihr wohl so freundlich, mir den Weg nach Covent Garden zu beschreiben, Madam?«, bat sie.
Mistress Speering sah den entschlossenen Ausdruck in ihren Augen und unterließ den Versuch, ihr den Ausflug auszureden.
»Wollt Ihr nicht lieber eine Mietkutsche oder eine Sänfte nehmen, mein Kind?«, schlug sie stattdessen vor. »Zu Fuß ist es sehr weit. Ihr müsstet den ganzen Holborn entlanggehen, hinter Lincoln’s Inn Fields in die Drury Lane einbiegen und dieser hinunter bis zur Russell Street folgen. Die führt dann gerade auf die Piazza. So heißt der Platz, auf dem der Covent- Garden-Markt abgehalten wird.«
»Wo finde ich denn eine Mietkutsche?«
»Auf dem Smithfield-Markt. Wenn Ihr aus der Tür geht, haltet Euch links, dann am Pie Corner noch einmal links«, erklärte Mistress Speering hilfsbereit.
Kitty dankte ihr und trat auf die Straße hinaus. Da die Sonne von einem makellos blauen Himmel schien und es angenehm warm war, entschied sich das Mädchen spontan, doch lieber das Geld für die Mietkutsche zu sparen und zu Fuß zu gehen. Es gab so viel zu sehen!
Trotz der Sorge um ihren Bruder füllte sie Augen und Ohren mit dem Trubel der großen Stadt. Die schmale Cock Lane ging bald in den gewundenen Snow Hill über, der an der Holborn-Brücke endete. Die gepflasterten Straßen hallten vom Hufschlag unzähliger Pferde wider, die Reiter trugen oder Fuhrwerke und Kutschen zogen. Viele Londoner gingen auch zu Fuß. Die besser Gekleideten zogen allerdings die Karosse oder Sänfte vor. Als Kitty dem ersten Tragsessel begegnete, blieb sie staunend stehen und beobachtete bewundernd, wie die Träger trotz des Gewichts der Sänfte im flotten Laufschritt die Straße entlangtrippelten. All die Pferde und Fußgänger wirbelten Staub vom Pflaster auf, der sich bald am Saum von Kittys Kleid absetzte. In der Mitte der Straße verlief eine recht tiefe Rinne, die mit allem erdenklichen Unrat, wie Asche aus den Herdstellen, Scherben und Küchenabfällen, verstopft war. Kitty entdeckte sogar Austernschalen und einen toten Vogel. Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie selbst der stärkste Regenschauer diese Mengen Kehricht fortschwemmen sollte. Besonders in den engen Gassen hing der Gestank nach verrotteten Abfällen und Pferdemist in der Luft und mischte sich mit dem Rauch der Kohlenfeuer. Bei jedem Schritt bereute Kitty ihren Entschluss, zu Fuß zu gehen, ein wenig mehr und sehnte sich schmerzlich nach den blühenden und duftenden Wiesen Stamfords zurück.
Da sie nun aber schon so weit gekommen war, riss sie sich zusammen und marschierte weiter den Holborn entlang, bog schließlich in die Drury Lane und dann in die Russell Street ein, wie Mistress Speering es ihr beschrieben hatte. Wenig später gelangte sie auf einen offenen Platz.
Auf der Westseite fiel Kitty zuerst der klassische Portikus einer Kirche ins Auge. Auf den drei verbliebenen Seiten umschlossen hohe Reihenhäuser, deren Türen von eleganten Arkaden beschattet wurden, die Piazza, in deren Mitte sich teils leere Marktstände befanden. Das innere Quadrat mit einer Säule im Zentrum war zum Schutz der Passanten durch hüfthohe Pfosten von der vielbefahrenen Straße getrennt. Spaziergänger flanierten gemächlich unter den Arkaden, Kutschen und Sänften eilten vorüber.
Kitty fühlte sich wie in eine andere Welt versetzt, in eine Stadt auf dem Kontinent, nach Rom oder Mailand, die sie selbst zwar nie gesehen hatte, aber aus den Erzählungen ihres Vaters kannte. Was sie sah, gefiel ihr. Nun konnte sie verstehen, weshalb ihr Bruder nach Covent Garden gezogen war. Aber wie sollte sie ihn finden?
Die Marktstände, an denen vormittags frisches Obst und Gemüse feilgeboten wurde, waren zu dieser Tageszeit verlassen, aber in manchen der Buden arbeiteten Handwerker, die der Markt angezogen hatte. Allerorts hörten sie den meisten Klatsch und wussten daher am besten über das Kommen und Gehen der Leute in einem Viertel Bescheid. So fasste sich Kitty ein Herz, sprach einen Korbweber an und erkundigte sich nach ihrem Bruder. Unermüdlich ging sie von Töpfer zu Böttcher, von Messerschleifer zu Blechschmied und wiederholte immer wieder ihre Frage nach Thomas Marshall. Doch niemand schien ihn zu kennen. Sie ging von Schenke zu Weinstube, von Bierhaus zu Garküche, die es auf der Piazza und in den Nebenstraßen zuhauf gab, doch auch dort hatte sie keinen Erfolg.
Kapitel 4
Erschöpft und hungrig und mit schmerzenden Füßen kehrte Kitty schließlich auf den Platz zurück. Nahe der Marktstände auf der Südseite der Piazza standen drei lange Holzhütten, die die Namen »White Horse«, »Green Man« und »Blackamoor« trugen. Im Vorbeigehen hatte Kitty gesehen, dass es sich bei der mittleren Baracke, dem »Green Man«, um ein Kaffeehaus handelte, das aber nicht besonders gut besucht schien. Aufgrund seines heruntergekommenen Aussehens hatte Kitty es bisher nicht gewagt, einzutreten. Doch inzwischen war sie bereit, nach jedem Strohhalm zu greifen. Zögernd stand sie vor dem Eingang, bevor sie sich überwand und über die Schwelle trat. Der Schankraum war verraucht. Im Gegensatz zu den Bierstuben, die sie an diesem Nachmittag bereits besucht hatte, saßen nur wenige Gäste auf den Bänken an groben langen Tischen, rauchten Pfeife und tranken aus flachen kleinen Schälchen Kaffee oder Kakao. Aber Kitty sah auch Trinkkrüge, in denen sich offenbar Gin oder Brandy befand. In einer Ecke hinter der Theke stand eine beleibte Frau von Mitte zwanzig mit einem breiten Gesicht unter einer groben Leinenhaube, deren Bänder unter dem fleischigen Kinn zusammengebunden waren. Ein Schankmädchen trat an die Theke, um eine jener Steingutschalen entgegenzunehmen, aus denen das türkische Gebräu getrunken wurde. Dann holte sie zwei Tonpfeifen aus einer Kiste, die unter der Theke bereitstand, und verteilte sie an die Gäste, die rauchen wollten. Vor dem Kamin, in dem ein prasselndes Feuer brannte, standen eiserne Kaffeekannen mit konischen Deckeln, während in einem Kessel, der über den Flammen hing, der Kaffee köchelte und sein exotisches Aroma sich mit dem des Tabaks und dem Geruch nach ungewaschenen Leibern mischte. An den Wänden hingen Gemälde, die der Rauch so dunkel gefärbt hatte, dass Kitty aus der Entfernung nicht erkennen konnte, was sie darstellten. Zwischen den Bildern klebten bedruckte Plakate, und auf den Tischen lagen hier und da Zeitungen und Pamphlete, die sich die Gäste von dem Ständer an der Wand nehmen konnten. Der Holzboden war mit Sägespänen bedeckt.
Beim Nähertreten bemerkte Kitty einen jungen Mann, der auf einer Bank flegelte, die Beine von sich gestreckt, mit dem Rücken an die Wand gelehnt, den Hut über die Stirn tief ins Gesicht gezogen, als würde er schlafen. Doch sie sah deutlich seine Augen auf sich gerichtet und errötete leicht, denn sie fühlte, dass dies kein Ort für ein anständiges Mädchen war. Auf einer anderen Bank lag zusammengesunken eine in Lumpen gekleidete Frau in tiefem Schlummer. Ihr schmutziges Halstuch war verrutscht und ließ ihre prallen Brüste sehen, die aus dem locker geschnürten Mieder quollen und die Aufmerksamkeit zweier Gäste erregten, die sie mit trunkenem Blick anglotzten.
Die Augen von der anzüglichen Szene abwendend, trat Kitty tapfer zur Theke. Die beleibte Frau in der ausladenden Haube sah sie erstaunt und dann neugierig an.
»Was kann ich für dich tun, Kindchen?«, fragte sie.
»Ich suche meinen Bruder«, begann Kitty und versuchte, ihrer Stimme Festigkeit zu verleihen. »Er heißt Thomas Marshall und ist gelernter Kunsttischler. Man sagte mir, dass er in Covent Garden wohnt. Kennt Ihr ihn vielleicht, Madam?« Der freundliche Ausdruck auf dem breiten Gesicht der Frau wich deutlicher Betroffenheit. Aus einer Ecke hinter ihr war die unsichere Stimme eines angetrunkenen Mannes zu hören: »Wenn du wissen willst, was aus Tom Marshall geworden ist, Süße, dann frag Jonathan Wild.«
Die Frau warf ihm einen strafenden Blick zu. »Halt den Mund, Tom King. Du bist wieder einmal voll bis an die Kiemen und weißt nicht, was du redest.«
Schwankend wie ein Schiff im Sturm versuchte der Mann, sich von seinem Stuhl aufzurichten.
»Du bist ungerecht, Moll. Ich habe nur ein Glas Gin gezwitschert.«
»Ach, das höre ich jeden Tag. Setz dich wieder hin, Gatte, bevor du aus den Schuhen kippst.«
Moll King gab ihrem Gemahl einen Stoß vor die Brust, der diesen auf seine ächzende Sitzgelegenheit zurückbeförderte. Inzwischen schien Tom vergessen zu haben, worum sich das Gespräch gedreht hatte, denn er ging nicht weiter darauf ein.
»Es tut mir leid, Herzchen«, sagte Moll entschuldigend zu Kitty. »Mein Mann ist leider dem Genever nur allzu verfallen. Hört nicht auf ihn. Wenn Euer Bruder jemals Gast hier gewesen wäre, wüsste ich es.«
»Seid Ihr sicher, Madam?«, hakte das Mädchen nach. »Könnte dieser Jonathan Wild, den Euer Gatte erwähnte, vielleicht etwas über Thomas wissen?«
»Glaubt mir, Kindchen, Mr. Wild hat bedeutende Geschäfte, um die er sich kümmern muss. Es wäre besser, wenn Ihr ihn nicht mit Euren Fragen belästigt. Möchtet Ihr etwas trinken? Ein Schälchen Kaffee kostet einen Penny.«
Entmutigt nickte Kitty und zog ihre Börse hervor. Ein Silberpenny wechselte den Besitzer und ließ die Augen der Schankfrau aufleuchten.
»Wie schön, dass Ihr es passend habt, Herzchen«, sagte sie strahlend. »Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie rar Kleingeld in London ist. Schenken und Kaffeehäuser geben hier ihre eigenen Münzmarken heraus.«
Sie füllte Kitty eine Schale mit dem duftenden schwarzen Gebräu und reichte sie ihr. »Wenn Euch der Kaffee zu bitter ist, könnt Ihr etwas Zucker dazu haben, aber das kostet einen Farthing zusätzlich. In anderen Kaffeehäusern mischt man Senf, Ale oder Zimt, Nelken und Minze hinein, aber solch ausgefallene Zutaten habe ich nicht da.«
»Nein danke«, erwiderte Kitty abwehrend. »Ich trinke ihn so.«
Vorsichtig ergriff sie die Schale mit dem heißen Getränk und setzte sich an einen leeren Tisch. Doch bereits nach dem ersten winzigen Schluck bereute sie es, zumindest den angebotenen Zucker ausgeschlagen zu haben, denn das Gebräu war so bitter, wie es aussah, und entlockte ihr eine angewiderte Grimasse.
Der Schmerz in ihren Füßen ließ ein wenig nach, und auf einmal begann Kitty ihre Erschöpfung zu spüren. Da es inzwischen auf den Abend zuging, blieb ihr nichts anderes übrig, als in ihre Unterkunft zurückzukehren und eine Fortsetzung der Suche auf morgen zu verschieben. Bedrückt starrte sie auf die schwarze Brühe hinab, nahm noch einen Schluck, und da dieser nicht schmackhafter war als der erste, ließ sie den Rest stehen, nickte Moll King noch einmal kurz zu und trat dann auf die belebte Straße hinaus. Sie bemerkte nicht, dass einer der Gäste, der sie bereits eine Weile beobachtet hatte, geschmeidig von der Bank rutschte und ihr nach draußen folgte. Als sie ein paar Schritte über die Piazza gegangen war, spürte sie, wie sich jemand an ihr vorbeidrängte, dachte sich aber nichts dabei. Im nächsten Moment sprang ein Mann wie aus dem Nichts auf einen jungen Burschen zu und packte ihn am Schlawittchen.
»Ich dachte mir schon, dass du es auf die Geldbörse abgesehen hattest«, stieß er zynisch hervor.
Da vermisste Kitty, die überrascht stehen geblieben war, auf einmal ihren Beutel. Der Bursche musste die Bänder von ihrem Arm abgeschnitten haben, als er sie beim Überholen gestreift hatte. Und nun erkannte sie in dem Mann, der den Beutelschneider am Kragen festhielt, den jungen Kaffeehausgast, der sich so nachlässig auf der Bank gerekelt hatte. Er nahm dem Taschendieb den Beutel ab, gab ihm noch einen groben Klaps auf den Hinterkopf und ließ ihn dann laufen. »Hoffentlich ist dir das eine Lehre«, rief er ihm nach.
Mit einer galanten Bewegung zog er den Hut, verbeugte sich tief vor Kitty und reichte ihr den Beutel zurück.
»Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Daniel Gascoyne. Zu Euren Diensten, Madam.«
»Ich danke Euch, Sir«, erwiderte Kitty herzlich. »Ich hatte gar nicht bemerkt, dass er meine Börse gestohlen hat.« »Ihr seid noch nicht lange in London, nicht wahr?«, meinte der junge Mann mit einem Lächeln, das die Beschämung über ihre Dummheit noch verstärkte. Er musste sie für reichlich naiv halten.
»Ach, woran erkennt Ihr das?«, erwiderte sie ironisch, wütend auf sich selbst, weil sie bereits an ihrem ersten Tag in London von einer Falle in die nächste getappt war, und noch mehr auf ihn, weil er sie mit der Nase hineinstieß.
»Ihr hättet in ›Tom Kings Kaffeehaus‹ den glänzenden Silberpenny nicht so offen herumzeigen sollen«, erklärte er, noch immer mitleidig lächelnd. »Wie Moll schon sagte, ist Kleingeld in London so selten, dass man an einer wohlgefüllten Börse sofort den Provinzler oder den Ausländer erkennt.« »Aber wie kann das sein?«, entfuhr es Kitty verständnislos. »London ist doch eine so reiche Stadt!«
Daniel Gascoyne zuckte die Schultern. »Es heißt, der Wert des Silbers sei in den letzten Jahren so angestiegen, dass es sich für die königliche Münze nicht lohnt, Silbermünzen zu prägen. Und das Geld, das es noch aus den Regierungszeiten früherer Monarchen gibt, ist so abgenutzt, dass es nur noch die Hälfte seines Wertes besitzt. Offensichtlich gehen die Leute in der Provinz sorgsamer mit ihrem Münzgeld um. Euer Silberpenny stammt sicher noch aus der Zeit Williams und Marys.«
Beeindruckt hatte Kitty seinen Ausführungen gelauscht. »Ihr wisst sehr viel über diese Dinge, wie es scheint«, sagte sie anerkennend und entlockte ihm damit erneut ein breites Lächeln, das sie nicht so recht zu deuten wusste.
»In London lernt man zwangsläufig, mit dem Problem des fehlenden Münzgeldes umzugehen.«
»Aber wie bezahlen die Leute, wenn sie einkaufen?«, fragte Kitty verwundert.
»Einige kaufen monatelang auf Kredit und bezahlen, wenn sie ihren Lohn in Münzen von höherem Wert erhalten. Zusätzlich ist sehr viel ausländisches Geld im Umlauf, aus Frankreich, Venedig, Spanien oder Portugal.«
»Ich muss wohl noch viel über das Leben in London lernen«, gestand Kitty.
»Wenn Ihr mögt, gebe ich Euch gerne einige Ratschläge«, erbot sich der junge Mann. »Habt Ihr schon zu Abend gegessen, Madam? Ich würde Euch gerne einladen.«
Einen Moment zögerte Kitty, denn das Angebot war verlockend. Daniel Gascoyne war ein gutaussehender Junger Mann mit einer ausdrucksvollen Mimik und einer vorwitzigen Nase. In seinen braunen Augen tanzten fröhliche Lichter, und um seinen sinnlichen Mund schien stets ein Lächeln zu spielen. Auf seinen Wangen lag ein dunkler Schatten, der verriet, dass er sich an diesem Morgen nicht rasiert hatte. Sein schulterlanges dunkelbraunes Haar war gepflegt, und seine Kleider waren von gutem Schnitt, auch wenn man ihnen ansah, dass sie aus zweiter Hand stammten und so manche Stickerei an Manschetten und Taschen bereits abgewetzt war. Er war schlank und überragte Kitty, die für ein Mädchen ihres Alters recht hochgewachsen war, um mehr als Haupteslänge. Doch so gern sie seine Gesellschaft genossen hätte, wusste sie doch, dass es für eine anständige Frau undenkbar war, sich allein mit einem fremden Mann in der Öffentlichkeit zu zeigen. Mit tiefem Bedauern, das sich deutlich auf ihrem Gesicht spiegelte, schüttelte Kitty daher den Kopf.
»Es tut mir sehr leid, Sir, aber das ist nicht möglich«, sagte sie. »Es wird Zeit, dass ich mich auf den Heimweg mache.« Daniel übertrieb seine Enttäuschung. »Wie schade«, murmelte er und sah sie mit einer Freundlichkeit an, dass sich ihr der Magen zusammenkrampfte. Aber er verstand ihre Bedenken und drängte sie nicht weiter.
»Falls Ihr Rat oder Hilfe braucht, findet Ihr mich gewöhnlich in ›Tom Kings Kaffeehaus‹«, fügte er noch hinzu.
»Vielleicht könnt Ihr mir noch mit einer Auskunft weiterhelfen, Sir«, sagte Kitty hastig, da sie keine Lust verspürte, sich von ihm zu verabschieden. »Kennt Ihr diesen Jonathan Wild, den Mr. King erwähnte?«
Daniels Züge verloren schlagartig ihre Fröhlichkeit und wurden ernst. »Diesen Namen solltet Ihr lieber vergessen.« »Aber warum? Wer ist er, dass sich alle vor ihm fürchten?« »Wild ist der selbsternannte ›General-Diebesfänger‹, vor dem die Londoner Unterwelt zittert. Er hat schon unzählige Gauner an den Galgen gebracht.«
Daniels gereizter Ton, in dem er dies sagte, erschreckte Kitty. Verständnislos starrte sie ihn an.
»Aber was kann ein solcher Mann mit meinem Bruder zu tun haben?«, rief sie aus. »Thomas ist kein Verbrecher!«
Einen Moment lang schien Daniel Gascoyne unschlüssig, was er sagen sollte. Kitty hatte das Gefühl, dass er mit sich rang. Dann wechselte er plötzlich das Thema.
»Ihr solltet Euch nicht länger in dieser Nachbarschaft aufhalten. Der Abend rückt näher. Bald wimmelt es hier in Covent Garden von Vergnügungssüchtigen, Betrunkenen und Huren.«
»Das sagt Ihr nur, um abzulenken«, empörte sich Kitty, die sein Ausweichmanöver durchschaute. »In ›Tom Kings Kaffeehaus‹ ging es doch ganz friedlich zu.«
Der junge Mann verdrehte ironisch die Augen. »Das scheint nur so. Die Kundschaft anständiger Kaffeehäuser besteht aus Männern, die dort, unbelästigt von ihren Ehefrauen, die Zeitung lesen und Pfeife rauchen wollen. Dass man Euch im ›Tom Kings‹ nicht gleich die Tür gewiesen hat, hätte Euch eigentlich zu denken geben sollen. Dort verkehren in erster Linie Gauner und Huren, die auf Freier warten.«
Kittys Gesicht lief rot an. Mistress Speering hatte sie vor einem Besuch in Covent Garden gewarnt. Nun wurde ihr klar, wie naiv sie gewesen war. Sie hätte nie herkommen dürfen!
»Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als Euren Rat zu befolgen und mich auf den Weg zu meiner Unterkunft zu machen«, sagte sie spitz und wandte sich ab.
Einen Moment zögerte der junge Mann, dann folgte er ihr mit großen Schritten und holte sie ohne Mühe ein.
»Nehmt eine Sänfte oder eine Mietkutsche, Madam. Das ist sicherer«, beschwor er sie.
Unschlüssig blieb Kitty stehen. Seine Sorge war echt, das las sie von seinem Gesicht ab.
»Also gut, wenn Ihr meint«, gab sie nach.
Daniel gestattete sich ein Lächeln. »Kommt mit, ich zeige Euch, wo Ihr eine Sänfte findet.«
Während sie die Piazza überquerten, wurde sich die junge Frau seiner prüfenden Blicke bewusst. Die Schamesröte kehrte in ihre Wangen zurück. Zweifellos hielt er sie für ein dummes Landei, das sich in der großen Stadt nicht zurechtfand. Auf der Nordseite der Piazza reihten sich einige Sänften aneinander, deren Träger auf den Straßenpfosten lümmelten und miteinander schwatzten. Daniel sprach zwei von ihnen an, die er offensichtlich kannte, und wandte sich dann an Kitty. »Wo wohnt Ihr, Madam?«, fragte er.
»Im Haus ›Zum Vogelkäfig‹ auf der Cock Lane«, erwiderte Kitty. »Das ist in der Nähe von Smithfield«, fügte sie erklärend hinzu, was den Sänftenträgern ein amüsiertes Lächeln entlockte.
»Wissen wir, M’am«, riefen sie wie aus einem Munde. »Wir kennen hier jeden Pflasterstein«, ergänzte der ältere der beiden. Ihr Akzent wies sie als Iren aus.
Kitty errötete leicht. Sie war ein weiteres Mal an diesem Tag ins Fettnäpfchen getreten.
Galant nahm Daniel Gascoyne ihre Hand und küsste sie mit einer Anmut, als sei er es gewohnt, bei Hof zu verkehren. »Ich bin untröstlich, dass Ihr mich schon so bald wieder verlasst, Madam«, sagte er. Dabei übertrieb er den Ton des Bedauerns in seiner Stimme so sehr, dass Kitty nicht wusste, ob er es ehrlich meinte oder sich über sie lustig machte. Zu ihrem Ärger verspürte sie einen schmerzhaften Stich ins Herz und ertappte sich bei dem Wunsch, er möge die Einladung zum Essen wiederholen.
Mit undurchdringlicher Miene half er ihr beim Einsteigen in die Sänfte, während der ältere Träger die Tür öffnete und der andere das Dach anhob, damit sie sich nicht den Kopf stieß.
Nachdem die Tür geschlossen war, legten sich die Männer die breiten Riemen über die Schultern, die an den Stangen der Sänfte befestigt waren, umfassten die Enden der Stangen mit den Händen und hoben den Tragsessel behutsam an.
Zum Abschied suchte Kitty den Blick des jungen Mannes, der sie warnend ansah. Ein zweites Mal an diesem Tag hatte sie das unheimliche Gefühl, dass ein anderer ihre Gedanken las, und wandte hastig die Augen ab.
Leichtfüßig trippelten die Iren die Russell Street, dann die Drury Lane und den High Holborn entlang. Als sie die Sänfte schließlich vor Mistress Speerings Haus absetzten und Kitty sie bezahlen wollte, winkten sie jedoch dankend ab und versicherten, dass sie ihnen nichts schuldig sei.
Verwundert steckte Kitty ihre Börse in den Beutel zurück.
»Ich brauche noch eine Auskunft«, bat sie. »Da Ihr Euch so gut in London auskennt, könnt Ihr mir doch sicher sagen, wo ich einen gewissen Jonathan Wild finde.«
Die Sänftenträger warfen einander erstaunte Blicke zu.
»Hat man Euch etwas gestohlen, Madam?«, fragte der Altere. »Jeder hier in der Stadt kennt Mr. Wilds Fundbüro auf der Little Old Bailey gleich neben der Schenke ›Cooper’s Arms‹. Ihr müsst nur zum Snow Hill zurückgehen und der Straße nach Osten folgen, an St. Sepulchre vorbei, dann trefft Ihr auf der rechten Seite unmittelbar auf die Little Old Bailey. Ein Katzensprung von hier aus, Madam!«
Kapitel 5
Während der Nacht fand Kitty kaum Schlaf. Ihre Gedanken kreisten unablässig um das mysteriöse Verschwinden ihres Bruders. Hatte er Mistress Speering die Unwahrheit gesagt, als er ihr Haus verlassen hatte, oder hatte er sich spontan entschlossen, doch in ein anderes Stadtviertel zu ziehen? Dagegen sprach, dass Tom King offensichtlich etwas über Thomas’ Schicksal wusste, und seine Frau musste ihn ebenfalls kennen, auch wenn sie es nicht zugegeben hatte. Und Daniel Gascoyne? Was wusste er? Weshalb hatte er ihr davon abgeraten, diesen Diebesfänger aufzusuchen? Nun, sie hatte jedenfalls nicht vor, seinen zweifellos gutgemeinten Rat zu befolgen. Wenn es keinen anderen Weg gab, etwas über den Verbleib ihres Bruders in Erfahrung zu bringen, würde sie Jonathan Wild aufsuchen und ihn höflich um Auskunft bitten. Auch ein vielbeschäftigter Mann würde sicherlich die Zeit finden, eine kurze Frage zu beantworten. Was konnte er schon Schlimmeres tun, als ihr die Tür zu weisen?
Nach kurzem Schlummer riss der Lärm der erwachenden Stadt Kitty bei Anbruch der Dämmerung aus dem Schlaf. Läden wurden geöffnet, Pferde wieherten, Menschen grüßten oder beschimpften einander. Kitty trat ans Fenster und öffnete den Flügel, der in den Angeln quietschte. Für einen Augenblick meinte sie, wieder zu Hause in Stamford zu sein, denn aus der Ferne war das Muhen von Rindern und das Blöken von Schafen zu hören. Und dann zogen Herden von Vieh über die Cock Lane und wirbelten Wolken von Staub auf, die die frühe Morgensonne hinter einem Dunstschleier verschwinden ließen. Die Bauern der Umgebung trieben ihre Tiere zum Markt von Smithfield, um sie dort zu schlachten und das Fleisch zu verkaufen.
Kitty erschauerte bei dem Gedanken und schloss das Fenster. Kurz darauf klopfte Mistress Speering an die Tür und brachte heißes Wasser in einer Zinnkanne.
»Ich hoffe, Ihr habt gut geschlafen, Madam«, sagte sie freundlich. »Hattet Ihr Erfolg in Covent Garden? Habt Ihr Euren Bruder gefunden?«
»Leider nicht«, antwortete Kitty. »Aber ich werde weitere Nachforschungen anstellen.«
»In der Küche stehen Käse, Ale, Muffins und Brot frisch vom Bäcker bereit. Tee habe ich leider keinen da, falls Ihr den vorzieht. Meine Hausgäste legen gewöhnlich keinen Wert auf etwas derart Ausgefallenes.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: